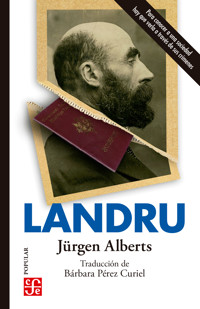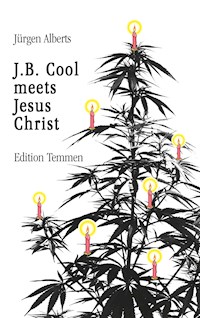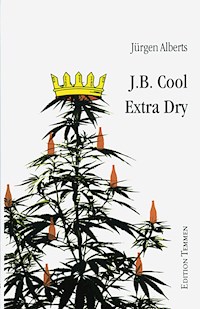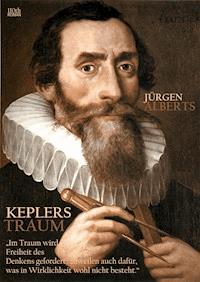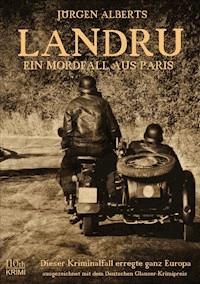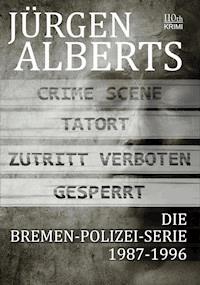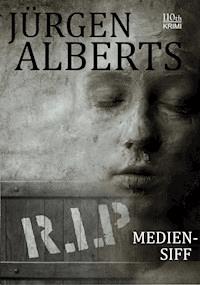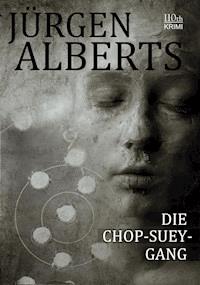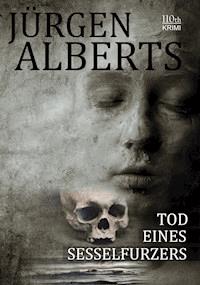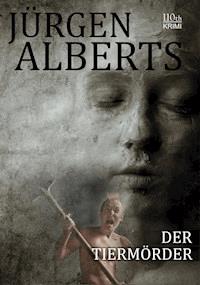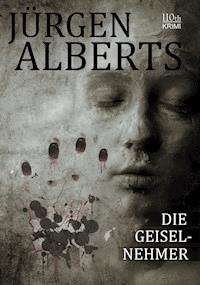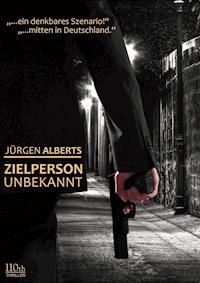
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vier Topagenten eines deutschen Geheimdienstes fühlen sich unwohl. Man hat sie aufs Abstellgleis geschoben. Aber statt sinnlose Aktenvermerke anzulegen, planen die Geheimdienstler eine spektakuläre Aktion, platziert im Fadenkreuz von Terrorismus und Atomkraft. Plötzlich jedoch gerät die brisante Inszenierung aus den Fugen — und die Nation an den Rand einer Katastrophe. Drei Jahre hat Jürgen Alberts recherchiert. Er ist Affären nachgegangen, hat in Archiven geforscht und sich mit Agenten mehrerer Geheimdienste unterhalten. Er war der einzige westdeutsche Journalist, der mit Hansjoachim Tiedge ausführlich sprechen konnte. Aus der Fülle des gesammelten Materials wurde ein Roman. Ein Realitätsthriller. Es ist der Stoff, aus dem die politischen Skandale sind. Als Buch knisternd, spannend, phantastisch; in Wirklichkeit ein Alptraum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÜRGEN ALBERTS
Zielperson unbekannt
Roman aus dem Verfassungsschutz
Impressum:
Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency
Foto: fotolia
© 110th / Chichili Agency 2015
EPUB ISBN 978-3-95865-686-4
MOBI ISBN 978-3-95865-687-1
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
„Es riecht nicht angenehm in dieser Welt, aber es ist die Welt, in der wir leben, und gewisse Schriftsteller, die über genügend Distanz und kühlen Kopf verfügen, können sehr interessante und sogar amüsante Geschichten daraus machen.“
(Raymond Chandler)
Kurzinhalt
Vier Topagenten eines deutschen Geheimdienstes fühlen sich unwohl. Man hat sie aufs Abstellgleis geschoben. Aber statt sinnlose Aktenvermerke anzulegen, planen die Geheimdienstler eine spektakuläre Aktion, platziert im Fadenkreuz von Terrorismus und Atomkraft. Plötzlich jedoch gerät die brisante Inszenierung aus den Fugen — und die Nation an den Rand einer Katastrophe.
Drei Jahre hat Jürgen Alberts recherchiert. Er ist Affären nachgegangen, hat in Archiven geforscht und sich mit Agenten mehrerer Geheimdienste unterhalten. Er war der einzige westdeutsche Journalist, der mit Hansjoachim Tiedge ausführlich sprechen konnte. Aus der Fülle des gesammelten Materials wurde ein Roman. Ein Realitätsthriller. Es ist der Stoff, aus dem die politischen Skandale sind. Als Buch knisternd, spannend, phantastisch; in Wirklichkeit ein Alptraum.
Der Autor
Jürgen Alberts, geb. 1946, Studium in Tübingen und Bremen, Promotion über die BILD-Zeitung, lebt als Schriftsteller und Journalist in Bremen. Seine zahlreichen Romane, darunter auch Krimis, sind mehrfach ausgezeichnet worden.
1
»Hohlkopf drei Strich siebzehn«, die dunkle Stimme legte eine Pause ein, »keinen blassen Schimmer.«
»Soweit bin ich noch nicht«, antwortete Helmut Tappert, der an diesem Morgen Kaiser werden wollte. »Was ist mit Zehennagel vier halb zwölf?«
»Das ist doch ganz einfach, denk an Sonnenschein im Winter«, kam es prompt zurück.
»Ach ja, klar«, Tappert schrieb das Wort hin.
»Ich komme wieder. Roger.«
Immer die alten Töne vom alten Bach. Er saß vier Büros weiter, war zwei Gehaltsstufen über ihm und stand kurz vor der Pensionierung. Helmut Tappert konzentrierte sich wieder auf den laufenden Wettbewerb. Wie immer hatten sie den Konspi abgestellt, um sich ganz dieser Aufgabe widmen zu können. Das machte zwar keinen guten Eindruck, wenn dauernd die Leitung besetzt war, aber wer würde sie schon anrufen. Vielleicht würde man sie sogar loben, dass sie so früh am Morgen eine Aktivität entfalteten. Da gab es ganz andere Gestalten, die um die Zeit im Büro nichts als die Morgenlektüre erledigten. Hatte doch ein früherer Präsident gesagt: »Jeder meiner Männer muss mindestens fünf Tageszeitungen lesen.« Er hatte diesem öffentlich geäußerten Begehren jedoch keine Dienstanweisung folgen lassen. Der Hörer lag neben dem Konspi. Durch das Wählen einer Nummer war er zum Schweigen gebracht.
Das Telefon klingelte. Die hausinterne Amtsleitung. »Schulterstück ganz oben?«, fragte eine krächzende Stimme.
»Ja, hab ich, sag ich aber nicht«, gab Tappert zurück, »nur so viel: ein Maikäfer im April.«
»Das zählt nicht als Hinweis, Helmut, Hinweise müssen konkret sein, sonst zahlst du in die Kasse, ist das klar?« Gönnerwein konnte einen widerlichen, militärischen Tonfall anschlagen, so dass Tappert den Hörer ein wenig vom Ohr nahm.
»Gut, gut, ich sag mal weißer Schimmel«, er wusste, dass damit alles verraten war.
»Danke, Kamerad. Und immer daran denken, die Parole muss stimmen. Ist das klar?«
Tappert legte den Hörer sacht auf die Gabel, ohne zu antworten. Er mochte diesen Gönnerwein nicht, sein ganzes Gehabe, sein Auftrumpfen, wenn er von der Aktion sprach. DER Aktion, wie er sie nannte.
Kurt Gönnerwein lebte nicht wie die anderen. Familie, Eigenheim, bescheidenes Auto. Er war und blieb Einzelkämpfer. Befriedigte gelegentliche Bedürfnisse in luxuriösen Bordellen oder, was auch vorgekommen war, nach Dienstschluss im Amt. Das hatte bei einigen zu seiner Reputation hinzugetan. Tappert griff zum Hörer und wählte die Nummer von Nutzke. Der war noch nie Kaiser geworden, weil er einfach den Kopf nicht dazu hatte.
Erst nach mehrmaligem Ruf nahm Nutzke ab. »Nutbohm«, sagte er.
»Quatsch, Fritz! Ich bin's, Helmut. Was macht denn Brust-bein Mitte hoch zwei?«
»Wart mal«, Nutzke zögerte. Tappert wusste, dass sein jüngerer Kollege erst mal in die Verschlüsselung schauen musste, um zu wissen, was er gefragt worden war.
»Brillenschlange«, kicherte Nutzke.
»Oh, danke, Fritz, sehr liebenswürdig.« Tappert füllte die Buchstaben ein. Hatte ihm der Rollschuhfahrer tatsächlich das Lösungswort verraten, anstatt, wie es üblich war, einen Hinweis zu geben. Jetzt fehlten ihm nur noch drei Worte.
Fritz Nutzke hatte eine steile Karriere hinter sich, obwohl er erst siebenundzwanzig Jahre war. Er hätte es zu etwas bringen können. Nicht nur, weil er der einzige war, der morgens mit Rollschuhen ins Amt kam. Er ließ sich von seiner Frau am Hauptbahnhof absetzen, schnallte die teuren Skates unter und sauste dann in Höchstgeschwindigkeit bis zur Inneren Kanalstraße. Autofahrer, die ihm zu folgen versuchten, hatten stets das Nachsehen. Außerdem besaß Fritz Nutzke einen schwarzen Neufundländer, dessen rosa Zunge zur Seite hing und triefte. Man hatte ihn trotz dieser Panne in Frankfurt zum Regierungsoberinspektor befördert, A 10. Aber diese Gehaltsstufe konnte auch schon die letzte sein. Nur ungern dachte Fritz Nutzke an seine Niederlage zurück. Als sie ihn in dieser Wohnung eingesperrt hatten. Als sie ihn stundenlang verhörten. Als er auf diese Frau hereingefallen war. Als er alles zugab. Als sie ihm dann geraten hatten, sofort aus Frankfurt zu verschwinden. »Beim nächsten Mal, wenn wir dich erwischen, gibt's einen dauerhaften Knochenbruch.« Dieser Satz klang ihm im Ohr. Das Ende eines V-Mannes, der behauptete, aus Süddeutschland zu kommen, aber dessen Ruhrgebiets-Dialekt schon beim Husten zu erkennen war. Der V-Mann, der ein Auto mit Kölner Kennzeichen fuhr, obwohl er vorgab, aus Freiburg zu stammen. Der V-Mann Fritz Nutzke, der sich zum Wochenende bei seinen Genossen abmeldete, um zu den Eltern zu fahren, dann aber seinen zu teuren Wagen nach Köln steuerte, weil dort Frau und Fußballklub auf ihn warteten. Es waren einfach zu viele Fehler. Trotz der Pannen blieb er zwei weitere Jahre in der Abteilung III, Linksextremismus. Er sollte Quellen in alternativen Stadtzeitungen anwerben. Bis man ihn dann endlich abschieben konnte. Das Telefon klingelte. Tappert nahm den Hörer ab.
»Sag mal, Helmut, hab ich dir vorhin die Auflösung mitgeteilt? Das wäre ja fürchterlich...«
Auch dieser Verstoß führte dazu, dass einer der vier Mitspieler Geld in die gemeinsame Kasse abführen musste.
»Nein, nein, Fritz«, beruhigte ihr ihn Tappert, »ich sag's niemand weiter.«
»Danke, Helmut. Du bist ein echter Kumpel.«
Sie verabschiedeten sich.
Dem Regierungsamtmann fehlten nur noch zwei Worte. Aber er konnte sich die Lösung nicht vorstellen. War wie blockiert. Jede Sekunde würde das Telefon läuten und einer der Konkurrenten sagen: »Bingo!« Seit es die vertrackten Rätsel in dem Wochenmagazin gab, hatten sie die lächerlichen Riesen-rätsel aus den Heftchen aufgegeben.
Sein ärgster Konkurrent war Armin Bach. Der hatte viele Abteilungen hinter sich. Regierungsoberamtsrat, das klang nach etwas, aber für einen 63jährigen war der gehobene Dienst nicht gerade ein Ruhmesblatt. Nur die hundertprozentige Pension konnte die Aussicht auf den Ruhestand verschönen. Armin Bach war »Differenzler«, so nannte man die schon pensionierten Offiziere im Amt, denen es erlaubt war, sich die restlichen fünfundzwanzig Prozent zur Pension hinzuzuverdienen. Sie alle waren zwischen 1910 und 1920 geboren, hatten den gleichen Fasson-Haarschnitt, waren schlank, manche hager, andere mit kantigem Gesicht. Da machte Armin Bach eine Ausnahme. Zu bestimmten Zeiten leuchtete sein Kopf wie ein roter Vollmond. Man nannte diesen Haufen im Amt auch »Rentnerband« oder »Kalkgeschwader«. Die letzte Stelle vor seiner letzten Umsetzung hatte Armin Bach in der Abteilung V absolviert: Sicherheitsüberprüfungen. Nicht erst seit dem Radikalenerlass 1972 prüfte das Amt die Gesinnung von Beamten und Angestellten in sicherheitsempfindlichen Bereichen. So führte das Engagement für linke Ideen dazu, dass Entlassungen aufgrund getarnter Sicherheitsüberprüfungen ausgesprochen wurden. Wenn es an die abschließende Stellungnahme ging, schrieb er in das Formular: »Obwohl Angehöriger der SPD, dürfte der Überprüfte auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.« Oder: »Trotz seiner gewerkschaftlichen Orientierung dürfte er den gestellten Anforderungen gerecht werden.« Oder er formulierte: »Nahkampfspange - Gewähr für Staatstreue.« Oder auch schon mal: »Ritterkreuzträger haben ein abgewogenes Urteil.« Die eigentlichen Höhepunkte seiner Arbeit feierte Armin Bach immer dann, wenn er jemand ablehnen konnte. Aus politischen Gründen. Aber auch, weil der Überprüfte trank, schwatzhaft oder sexuell hörig war. Der Abteilungsleiter V hatte die Arbeit so umschrieben: »Die Sicherheitsüberprüfungen arbeiten nach dem Prinzip der chemischen Reinigung. Wir garantieren nicht den Erfolg der Fleckenbeseitigung. Wir garantieren nur die Gleichbehandlung aller Fälle.«
»Bingo«, kam es durch das Telefon. Gönnerwein war an diesem Donnerstag Kaiser geworden. Tappert war deprimiert. So kurz vor dem Ziel. Und dann auch noch Gönnerwein. Wie immer legte er den Hörer des Konspi auf, erhob sich langsam von seinem Bürostuhl, schraubte den Füller zu. Nächste Woche gab es Revanche. Irgendwie schaffte es dieser Gönnerwein immer wieder, als erster das Rätsel zu lösen. Aber jetzt würden sie genau überprüfen, ob er auch nicht geschummelt hatte. Schon häufiger musste jemand den Sieg zurückgeben, weil er Buchstaben doppelt verwandte oder einfach abgeschrieben hatte.
Kurt Gönnerwein war der einzige von ihnen, der schon immer in der Abteilung IV, Spionageabwehr, gearbeitet hatte. Auch schon, als es das Amt noch gar nicht gab. Damals hieß seine Dienststelle Abwehr fremder Dienste, Abwehrstelle Niederlande. Ein Außenposten des Reichssicherungshauptamtes. Und was für ein Posten war das gewesen. Tappert brauchte nur ein geringes Stichwort zu sagen, und schon sprudelte Gönnerwein hervor, wie damals DIE Aktion abgelaufen war. Von Mal zu Mal hatte er seinen Auftritt größer gemacht, als habe er selbst das »Unternehmen Nordpol« geplant. Damals hatten sie die Tommies hereingelegt. Es gab keine größere Aktion als diese. Gönnerwein wurde nicht müde zu erzählen. Wie sie die Funkstationen der Engländer angepeilt und ausgehoben haben. Wie sie diese illegalen Sender zurückspielten und damit Zeichen nach London gaben, auf dass die Briten erst Material, später dann Hunderte von Spionen per Fallschirm abwarfen. Wie sie Tote und Verwundete nach London meldeten, die friedlich im Gefängnis saßen. Wie sie in holländischen Zeitungen Falschmeldungen lancierten. Wie sie einen Sender sprengten, damit die Tommies dachten, diese Aktion hätten ihre eigenen Leute vollbracht. »Es war DIE Aktion meines Lebens«, betonte Gönnerwein, »es gab nie eine größere.« Helmut Tappert hatte mal nachgerechnet: Gönnerwein konnte höchstens Anfang zwanzig gewesen sein, als das »Unternehmen Nordpol« 1943/44 in Holland durchgeführt wurde. Wahrscheinlich war er einer von den kleinen Mitläufern, die nachts eine Lichterkette am Boden bilden mussten, damit die englischen Flieger dachten, dies sei die vereinbarte Landestelle für ihre Spione. Denn von diesen Nächten erzählte Gönnerwein immer besonders ausführlich. Überhaupt nicht vertragen konnte er, wenn jemand sagte, bei diesen Aktionen seien auf beiden Seiten Menschenleben geopfert worden. Das war zwar nicht Tapperts Meinung, aber anders konnte er ihn oft nicht stoppen. Dann wurde Gönnerwein richtig fuchtig.
Die Stimmung war gut in Gönnerweins Büro, das genauso aussah wie die anderen: billiger Holzschreibtisch, Gummibaum, zwei Stühle, Aktenböcke, Stahlschrank SG 2, zwei Telefone auf dem Tisch, Schreibtischlampe in Schwarz, Garderobenschrank.
»Dem Kaiser, was des Kaisers gebührt«, schnarrte Gönnerwein, der schon die Gläser auf dem Tisch füllte.
»Ist zwar nicht richtig zitiert, Kurt, aber lass erst mal die Lösung sehen.« Bach nahm ihm die Fotokopie aus der Hand. Dann verglichen sie ihre Eintragungen. Es stimmte. Gönnerwein hatte alles richtig gelöst. Er schenkte eine Runde Genever aus. Tradition muss sein.
Sie hoben das Glas.
Tranken ex.
»Wenn ich daran denke, wie wir damals in Holland gesoffen haben, nur vom feinsten, Champagner aus Frankreich, Grand cru, Aquavit aus Dänemark, russischen Wodka. Mein Gott, das hätte ewig so weitergehen können.« Gönnerweins Vollmond leuchtete. Es war nicht der erste Genever, den er an diesem Donnerstagmorgen zu sich nahm. Das Telefon schrillte. Es war der Konspi. Gönnerwein ließ ihn lange läuten. Obwohl alle Gespräche verstummt waren, sah er auf den Apparat.
»Ich bin heute Kaiser geworden, da kann mich niemand stören. Schon gar nicht vor neun, meine Herren. Trinken wir noch einen.«
Die zweite Lage schmeckte auch nicht schlechter. Gönnerwein hatte einige Freunde im niederländischen Geheim-dienst, die ihn regelmäßig mit Genever versorgten. Und was er im Dienst trank, das brauchte er am Abend nicht in die Kneipe zu tragen.
Helmut Tappert verabschiedete sich als erster, um in die Kantine zu gehen. »Mal sehen, was wir noch aus diesem Tag machen können«, er versuchte einen flotten Spruch, weil er dem siegesbewussten Gönnerwein nicht mehr zuschauen wollte. Er legte in seinem Büro die Fotokopie des Rätsels unter die Schreibplatte, schloss seinen SG 2 mit dem fünfzehn Zentimeter langen Schlüssel ab, damit das VS-Material nicht offen zugänglich war. Das konnte einen Eintrag in die Personalakte bedeuten. Dann goss er den Gummibaum, dessen kleine rote Spitze noch unentschieden war, ob sie weiterwachsen sollte. Was war dieser Gönnerwein doch für ein Angeber! Hätte nicht heute Nutzke das Rätsel gewinnen können oder sogar Bach, aber nicht dieser verhinderte Canaris-Ersatz.
Zum wiederholten Male nahm sich Tappert vor, einen Anlauf zu nehmen, um aus dem Sachgebiet 105, »Fälle ohne nachrichtendienstlichen Hintergrund«, versetzt zu werden. Wenn nicht diese andere Aufgabe gewesen wäre, er hätte es geschafft. Aber diese Aufgabe hielt ihn zurück. Er ging in den fünften Stock, wo die Kantine im Altbau lag. Ein nüchterner Raum, mit großen Fenstern auf der Straßenseite, vierzig Meter lang und knapp zehn Meter breit. An der Längsseite war die Essenausgabe. Der vormalige Pächter Zweipfennig hatte die Kantine als »Essensabfertigungshalle« bezeichnet. Helmut Tappert ging zur Theke und erstand eine Marke für das billigere Gericht. Schmecken würden sie beide nicht. Dann kaufte er zwei Flaschen Bier für den Vormittag. Von ferne winkte sein Gruppenleiter. Dem wollte er lieber nicht begegnen, auch wenn er einen neuen Stasi-Witz gehört hatte.
Der schwergewichtige Gruppenleiter erhob sich und brüllte durch den ganzen Saal: »Tappert, Alkohol vor zehn, kann nicht gut gehn!«
Tappert rief zurück: »Und selbst, noch ganz gesund?« Der Gruppenleiter drohte ihm. Die Hand erhoben, den Zeigefinger ausgestreckt.
Die mit ekelhaft riechendem Putzmittel gesäuberten Resopaltische, meistens für vier, aber auch für sechs und acht Personen, füllten sich erst kurz nach elf. Jetzt saßen nur einige Beamte aus dem höheren Dienst an einzelnen Tischen. Tranken Kaffee und lasen Zeitung.
Der Gruppenleiter kam auf Tappert zu.
»Wollen Sie einen ausgeben?«
»Nein, nein«, Tappert schüttelte den Kopf, »ich muss die Akten bewässern, die sind sooo trocken.«
»Und was macht die Kunst des Witzes?«, fragte der Gruppenleiter und fasste eine der beiden Bierflaschen an.
Na gut, dachte Tappert, dann erzähl ich ihn eben jetzt.
»Also, da kriegt Onkel Otto eine Postkarte aus Erfurt, da steht drauf: 'Wenn ich die rote Fahne raushänge, kannst du die Bombe liefern, Gruß Erich.' Eine Woche später schickt Erich eine zweite Karte an Onkel Otto: 'Kannst jetzt die Blumenzwiebeln liefern, der Stasi hat meinen Garten umgegraben.'« Der Gruppenleiter fiel beinahe auseinander vor Lachen.
»Der ist gut, der ist gut«, keuchte er, »den muss ich gleich weitererzählen. Aus Ihnen wird nochmal was, Tappert, muss ich schon sagen. Für Beschaffung eines guten Witzes... Aber jetzt wieder an die Arbeit, los.«
Noch im Flur hörte Tappert, wie sein Gruppenleiter lachte. Wahrscheinlich würde der Witz schon mittags die Präsidentensuite erreicht haben.
Helmut Tappert beeilte sich nicht besonders. Was sollte schon in den Akten zu finden sein.
Wie anders waren damals die schönen Observationen verlaufen. Als sie bei der Aktion »Orkan« am Flughafen in Köln-Wahn standen und die Stasi-Mitarbeiter aufklärten. Immer zu sechs Observanten, die dann einem »Kundschafter«, wie die sich nannten, bis zu seiner Wohnung folgten. Am nächsten Morgen mussten sie zur Bestätigung nochmal nachsehen, ob der Mann aus der gleichen Wohnung kam und in welches Auto er stieg. Oder die Observation einer Agentin in der Sauna. Sie hatte keine Ahnung, dass sie unter Bewachung stand. Was für ein prickelndes Gefühl! Er saß genau hinter ihr, auf der nächsten Stufe. Sie schwitzte ganz ordentlich. Eine tolle Frau. Sie hatte ihm gefallen. Auch wenn sie vom gegnerischen Dienst war. Oder damals die Verfolgung der drei sowjetischen Residenten, die auf dem Bonner Petersberg endete. Sie waren ihnen in das Restaurant nachgeeilt. Setzten sich ein paar Tische weiter. Bis dann der Ober kam und ihnen randvolle Gläser mit Wodka hinstellte, mit der Bemerkung: »Von den Herren dort drüben.« Sie hatten sich zugeprostet.
Und dann war dieser Unfall gekommen. Betrunken im Dienst. Das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Es war ein Dienstfahrzeug, das er mit hohem Tempo in die Schaufensterscheibe eines Bettengeschäftes gesetzt hatte. Anstatt abzuhauen, war er stehengeblieben. Die Betten sahen so einladend aus. Als die Polizei kam, hatte er sofort seinen Dienstausweis gezückt, wollte es kollegial regeln. Aber die beiden Streifenpolizisten waren von der falschen Fakultät, meinten, es sei besonders verwerflich, wenn ein Beamter, und dann auch noch einer, der in diesem Amt, die könnten sich wohl alles, er werde schon sehen. Helmut Tapperts Pech war, dass er schon etwas auf seinem Konto hatte: eine kleine Spesenschieberei, wie sie im Außendienst häufiger vorkam.
Als er sein Büro betrat, den Tresor aufschloss und das dicke Paket mit Akten auf den Tisch wuchtete, wusste er nur eins, dieser Tag war schon gelaufen, obwohl der Dienst gerade erst begann.
2
Ein großes »M« und ein kleines »alk« standen in akkurater Schrift mit grüner Präsidententinte auf einem weißen Blatt. Das »M« tauchte in den letzten Monaten häufiger auf. Seit jenem Gespräch mit dem Innenminister, der in einer lauen Abendstunde davon gesprochen hatte, wie sehr doch die her-ausgehobenen Persönlichkeiten des Staates auf einem Seil tanzten. Wie schnell sie stürzen konnten. »Absturz inklusive.«
Der Präsident hatte seinem Innenminister gelauscht, ohne etwas zu sagen. Aber er wusste, so ein Gespräch beginnt niemand, der nicht etwas damit ausdrücken will. Der Innenminister hatte sich zu einer Theorie verstiegen über das Hoch und das Tief, über das Kletternde und das Fallende, über die Geschwindigkeit des Aufstiegs und das Tempo des Niederstürzens. Sie tranken nur Mineralwasser, weil der Innenminister am Abend zuvor mit einem Botschafter versackt war. Der Präsident trank, was sein Vorgesetzter offerierte.
Seit jenem Abend machte er sich Gedanken, was er wohl in seine Memoiren schreiben konnte. Auf keinen Fall wollte er sich verbreiten über jenen peinlichen Augenblick der Amtsübergabe vor vier Jahren. Ein Montag. Der Präsident hatte ihn den Stachel-Montag genannt. Nicht, weil der Innenminister beinahe über ein Fernsehkabel gestürzt wäre. Und das vor den Augen von mehr als hundert dunkel gekleideten Würdenträgern, der erlesensten Schar der obersten Verfassungsschützer. Die Feier zum 25. Jubiläum des Amtes stand an. Es wurde hinter vorgehaltener Hand sogar von einer »BfV-Fete« gesprochen. Alle sicherheitsrelevanten Männer der Republik waren geladen und beäugten sich misstrauisch: BKA überwachte BND, BND überwachte MAD, MAD überwachte BfV, BfV war Gastgeber und gewährte keine Einblicke.
Der Präsident hatte sich seinen Auftritt als ein Feuerwerk vorgestellt, als eine Abrechnung mit Fehlern seines Vorgängers. Aber dann sprach sein Vorgänger zuerst und teilte aus wie ein angeschlagener Boxer. Er schlug so fest zu, dass die kampfgewohnten Männer zusammenzuckten. Der Vorgänger hatte allen Grund dazu: Er war geopfert worden in jener Affäre, die auch den Kanzler stürzen ließ. »Absturz inklusive«, hatte der Innenminister gesagt. Der Präsident wollte dem Stachel-Montag in seinen Memoiren kaum ein paar Zeilen widmen. Am besten war es, ihn ganz zu unterschlagen. Wer würde sich daran erinnern?
Über die Chefanlage hatte er dem Vorzimmer bestellen lassen, dass er in den nächsten zwei Stunden nicht gestört werden wolle. Ganz gleich, wer nach ihm verlange.
»Zwei Stunden?« hatte die Sekretärin nachgefragt. Der Präsident bestätigte die Zeitangabe. Dann zog er das maschinengeschriebene Manuskript hervor, in das er sich zu vertiefen gedachte.
Der Autor war ebenfalls ein Präsident gewesen. Allerdings eines eher verfeindeten Dienstes. Im eigenen Land. Der Autor hatte immerhin eine bewegte Vergangenheit, war über den kleinen Umweg des Andienens bei den amerikanischen Freunden wieder in Amt und Würden gelangt, hatte sogar als Leiter eine Organisation befehligt, die seinen Namen trug, bis sie dann offiziell umbenannt wurde. Nur die Richtung der Arbeit war über all die Jahrzehnte die gleiche geblieben. Immer stur gegen Osten.
Der Präsident dachte darüber nach, was er wohl über seine langweilige Vergangenheit in seinen Memoiren schreiben konnte. Ein paar bisher geheim gehaltene Aktenstücke über die leidige Abhöraffäre würde er schon bieten müssen. Aber die war ja kein Erfolg gewesen. Er brauchte ein paar Erfolge. Wenigstens lief die Aktion »Ummeldung« auf vollen Touren; immer wieder konnten sie beim Durchsieben der Karteien der Einwohnermeldeämter auf verdächtige Personen stoßen. Allein in Bonn zogen sie siebzigtausend Namen aus der Kartei. Die Beamten fielen Freitagnachts in die Meldebehörde ein und arbeiteten durch bis Montag früh. Nur die Amtsleiter wussten Bescheid. Ein Bürgermeister aus dem Bergischen Land hatte seine Genehmigung, trotz wiederholter Aufforderung aus Düsseldorf, versagt. Aber das blieb der einzige Miesepeter. Man hatte sich seinen Namen gemerkt.
In den letzten Jahren habe ich oft erleben müssen, dass die Unsicherheit unter den Bediensteten im Sicherheitsbereich, auch bei Beamten und Soldaten in hohen Dienststellungen, zur Resignation, ja an den Rand der Verzweiflung geführt hat. Dies war vor allem dann der Fall, wenn im Verlaufe der Diffamierungskampagnen infame Vergleiche mit Methoden gezogen wurden, die unsere Sicherheitsorgane in die Nähe der hitlerischen Gestapo rückten. Indessen ließen sich Verunglimpfungen und Verleumdungen dieser niedersten Qualität noch am leichtesten als Produkte staatsfeindlicher Giftküchen anprangern. Für ungleich gefährlicher halte ich jene 'Offenlegungen' neuesten Datums, die moderne Methoden unserer Abwehrorgane einschließen. Die öffentliche 'Bekanntmachung' technischer Hilfsmittel der Polizei bedeutet zugleich die Herabsetzung oder gar die Ausschaltung ihrer Wirksamkeit. Wer jedoch Fahndungsmaßnahmen gegen Spione und Terroristen gleichfalls öffentlicher 'Behandlung' preisgibt, kann von mir aus nur als staatsfeindlicher Saboteur angesehen werden.
Starke Worte, dachte der Präsident und machte sich eine kleine Notiz: Die Memoiren müssen radikal sein. Radikal enthüllen, radikal beschimpfen, radikal anprangern. Darin hat der frühere Präsident des BND Recht. Sonst würde niemand Interesse an den Memoiren haben.
Die Präsidentensuite im vierten Stock des Amtes glich einem Wohnzimmer. Hinter der doppelten Holztür, die für Ruhe und Abgeschiedenheit sorgte, stand eine schwarzlederne Sitzgarnitur, zwei Sessel und ein Sofa, davor ein edler Couchtisch aus einem der vornehmsten Möbelhäuser Kölns. Und ein roter Kamelpuff für den überzähligen Mitarbeiter, wenn die Runde, die sich hier traf, zu groß war. Auf dem mausgrauen Teppichboden lag eine wertvolle Brücke.
Dem Präsidenten machte es besonderes Vergnügen, seine Beamten, aber auch seine Besucher mit moderner Kunst zu schockieren, die er an den Wänden platzieren ließ. Er war zwar kein Kunstsammler, aber so hinterließ etwas in seinem Büro einen bleibenden Eindruck. Von Zeit zu Zeit tauschte er die Bilder aus, um sie dann ins benachbarte Besprechungszimmer hängen zu lassen.
Der Blick aus dem Präsidentenfenster auf die Eingangspforte, im Amtsjargon auch »Tankstelle« genannt, war hässlich. Dieses Pförtnerhäuschen blieb ein Jahr eine Bauruine, weil man vergessen hatte, die Mittel im Haushalt zu veranschlagen. Aber auch seit der Fertigstellung war die Tankstelle kein Schmuckstück. Der Präsident dachte über eine Begrünung nach. Wollte dies aber mit dem Sicherheitsreferat absprechen.
Sein Schreibtisch war ohne besonderen Ausdruck. Nur die vier Telefone zeigten präsidiale Würde. Neben der Chefanlage der unvermeidliche Konspi, daneben das Telefon mit den Sonderleitungen zu den Abteilungsleitern und dann die ELCRO¬VOX-Anlage, mit der die Stimme wie in Micky-Maus-Filmen verzerrt werden konnte. Als später noch einige Telefone hinzukamen, gab der Nachfolger dieses Präsidenten zu, dass er mindestens einmal den falschen Hörer abnahm, wenn es klingelte.
Besondere Freude bereitete dem Präsidenten, was der BND-Präsident über Nollau, seinen Vorgänger im BfV schrieb. Diesen Bergsteiger, der mit Stilfibel und Kleiderordnung sein Amt regierte. Mit Genugtuung beobachtete der Präsident, wie sich diese beiden Heroen des Geheimdienstes in ihren Memoiren mit Schmutz bewarfen. Keiner dem anderen traute. Jeder etwas Gift aus den geheimen Köchern holte, um den anderen zu meucheln. Glücklicherweise befand sich jetzt niemand gleich Starkes auf dem Präsidentensessel des BND. Mit jenem ehemaligen Hitler-Gefolgsmann hätte er es nicht gern aufgenommen
»Entschuldigen Sie die Störung, ich weiß, Herr Präsident, Sie wollen Ihre Ruhe, aber, ich muss, ich meine, es ist...« Modick, der Abteilungsleiter VII war einfach hereingeplatzt. So schnell konnte der Präsident gar nicht das Manuskript verschwinden lassen. Noch weniger kam er dazu, seinen Untergebenen hinauszukomplimentieren.
»Was gibt's so Dringendes? Jetzt keine Kinkerlitzchen, mein Lieber, sonst werde ich barsch.« Der sportliche Präsident, der bei seinem Aussehen einem Golf- oder Tennisclub hätte vorstehen können, kniff die Lippen zusammen.
»Ich sage nur: Aktion 'Feuerzauber'. Darüber müssen wir sprechen.«
»Erfolge?« fragte der Präsident. Es gelang ihm nicht, das Manuskript mit einer Akte abzudecken. Jetzt war es Modick bestimmt schon aufgefallen.
»Nein, Schwierigkeiten.«
»Hat das nicht Zeit bis Montag zur Sitzung. Ich meine, für Schwierigkeiten bin ich doch gar nicht zuständig.« Der Abteilungsleiter VII kam näher an den Schreibtisch heran. Er starrte auf die Hände des Präsidenten, der immer noch die zwei Aktenstücke hin- und herschob.
»Also, was für Schwierigkeiten? Werden Sie deutlicher!«
»Wir hatten in Celle den Gefängnisdirektor eingeweiht, er wusste von der Aktion...«
»Hält er nicht dicht?«, unterbrach ihn der Präsident heftig.
»Das wissen wir nicht, er könnte alles versauen...«
»Ich habe immer gesagt: need-to-know-Prinzip, das sollten Ihre Leute doch wirklich kennen, nur so viel rausgeben, wie wirklich erforderlich ist. War es erforderlich, diesen Gefängnisdirektor von 'Feuerzauber' zu unterrichten?« Der Präsident machte eine Pause. Der Abteilungsleiter VII hielt den Atem an, denn er wusste, dass der Präsident seine Fragen gerne selbst beantwortete. »Nein, sage ich, nein, nein. Man hätte ihn genauso wie alle Wärter und Polizisten und das BKA, und wer jetzt noch alles versucht, herauszufinden, wer dieses Loch tatsächlich gesprengt hat, im Dunkeln tappen lassen sollen. Wenn dieser Gefängnisdirektor quatscht, dann Gnade uns Monitor...«
»Ich hätte da einen Vorschlag«, warf Modick kleinlaut ein. Sein dunkelblauer Anzug mit der weinroten Fliege schien noch aus den Tagen der Konfirmation zu stammen. Außerhalb jeder Mode. Der helle Haarschopf war akkurat beschnitten.
»Und welchen? Für Vorschläge bin ich immer zu haben, wenn sie zum Erfolg führen.« Der Präsident lehnte sich auf dem hohen Stuhl zurück. Verschränkte die Arme vor der Brust.
»Weil Gefahr im Verzuge ist, den Gefängnisdirektor versetzen lassen und unter VS stellen...«
»Sind Sie denn komplett verrückt geworden?« fauchte der Präsident, »das macht den völlig kirre, da fragt sich sofort jeder, warum ist der versetzt worden und so weiter und so weiter... Das ist kein Vorschlag, sondern eine Dummheit. Vergessen Sie's...«
»Deswegen war ich gekommen, ich dachte, Herr Präsident, ich dachte, wenn wir schnell handeln, dann ist noch was zu retten.« Der Präsident fing an zu brüten. Immer dann, wenn er nach einem Bonmot suchte oder nach einem Einfall für seine Memoiren, den er sogleich notierte und in das Eisfach seines SG 3 legte, schloss er die Augen ein wenig.
»Wie sagte schon ein englischer Kollege: Die Leute von der Terroristenbekämpfung vermeiden immer einen Unfall, wenn sie eine Katastrophe anrichten können. Und jetzt raus hier. Ich habe zu lesen.« Der Abteilungsleiter VII blieb stehen.
»Sie lesen nicht etwa das letzte Werk von Gehlen, oder?«
»Woher wissen Sie?« fragte der Präsident zurück.
»So was weiß ich. Und ich weiß auch, dass Gehlen verfügt hat, dass sein Buch 'Verschlusssache' erst veröffentlicht werden soll, wenn er unter der Erde ist...«
Nun machte Modick eine Pause, sah den Präsidenten forsch an.
»Und noch lebt der gute Mann. Oder soll ich sagen, der böse Mann?«
»Man hat es mir zur Prüfung vorgelegt«, erwiderte der Präsident schnell, »wir müssen überlegen, ob wir das zulassen können...«
»Und wer hat das Buch beschafft, Herr Präsident, ich meine, das Manuskript?«
»Das geht Sie gar nichts an. Das Gespräch ist beendet.« Der Präsident stand auf, reichte seinem Untergebenen die Hand und zeigte auf die Tür.
»Gut, dann Montag mehr«, sagte der Abteilungsleiter VII. Er humpelte ein wenig.
Nachdem er die Doppeltür leise geschlossen hatte, ließ sich der Präsident in den Lehnsessel fallen. Dieser Siebener wurde ihm zu frech, der brauchte einen Dämpfer. Wahrscheinlich ist er auf meinen Posten aus. Dem war es glatt zuzutrauen, dass er die Schwierigkeiten in Celle erfand, um ihm das Leben schwerzumachen. Wie genial war dieser Plan, mit einem kleinen Loch in der Gefängnismauer einen oder zwei V-Leute in die Terrorszene einzuschleusen. Zwar gab es noch keine nennenswerten Erfolge, aber die würden kommen. Die Aktion »Feuerzauber« lag ja nicht einmal ein halbes Jahr zurück. Das könnte ein Glanzstück seiner Memoiren werden.
Der Präsident vertiefte sich wieder in das Manuskript von Reinhard Gehlen, dem ersten Chef des BND. Dann sah er aus dem Fenster. Der Blick über Köln hatte etwas Beruhigendes. Der Dom, dessen beide Türme wie Kölsch-Flaschen in den Himmel ragten, hatte alles im Griff. Zum wiederholten Male kam dem Präsidenten der Gedanke, dass Terroristen auf dem gegenüberliegenden Schulparkplatz einen Raketenwerfer zum Abschuss bringen könnten. Sie hatten leichtes Spiel, denn sie brauchten nur auf die einzigen Räume im Amt zu zielen, die mit einer Klimaanlage ausgestattet waren. Auf seinen Merkzettel schrieb er ein großes »T« und umrahmte es. Ein Vermerk für das Referat »Sicherheit des Amtes«.
An jenem Stachel-Montag war vielen Besuchern, die das erste Mal im Amt waren, die Festung als uneinnehmbar vorgekommen Wie ein mittelalterliches Wehrschloss. Alles auf Verteidigung ausgerichtet. Der Präsident legte das Manuskript zur Seite. Er musste sich um den nächsten Punkt kümmern. Karneval war in diesem Jahr sehr früh. Und es floss einfach zu viel »Alk« im Amt. Ein andauerndes Problem.
Schon der erste Präsident war darüber entsetzt. Wollte Karneval ganz verbieten, aber es gelang ihm nicht. Also beschloss er, Weiberfastnacht und Rosenmontag freizugeben. An diesen Tagen musste die Verfassung ungeschützt bleiben. Es tat ihr ganz gut. Am Karnevalsdienstag wurde der Dienstbeginn auf zehn Uhr festgesetzt. Hauptsache, es blieb still im Amt. Keine auffälligen Exzesse.
Als dann Nollau Präsident wurde, bekam die Sache eine scharfe Wendung. Denn eines Tages wurde er durch Radau gestört, der aus der Etage unter ihm kam. Er zögerte einzugreifen. Packte seine Sachen und wollte das Amt heimlich verlassen. Doch dann begegnete er vier Schnapsleichen aus der Abteilung II, Rechtsextremismus, die unter Absingen des Horst-Wessel-Liedes durch die Gänge zogen. Das veranlasste den Präsidenten, einen sogenannten Zwickel-Erlass herauszugeben: »Trinken von Alkohol im Dienst ist untersagt.« Als ein paar Tage nach diesem unmissverständlichen Begehren eine Gruppe von Beamten Pittermännchen mit Kölsch die Treppe hochtrugen, erbleichte Nollau, griff aber nicht ein. Der Präsident malte Kringel aufs Papier. Was sollte er auf den Dienstweg bringen?
»Alk« stand da. Aber ihm fiel keine Lösung ein. Wenn dieser Siebener ihn nicht gestört hätte, dann wäre er zumindest mit dem großen »M« etwas weiter gekommen.
Ein nutzloser Morgen. Nichts für die Memoiren.
Eine halbe Stunde später formulierte der Präsident folgenden Erlass:
»Bei jährlich wiederkehrenden Festen darf kein Alkohol konsumiert werden. Besondere Ereignisse sollen gesammelt und dann in kleinen Gruppen abgefeiert zu werden. Dies hat außerhalb der Dienstgebäude zu geschehen.« Eine besondere Bestimmung zu Karneval verkniff sich der Präsident. Immerhin fielen im Amt täglich acht bis zehn Geburtstagsfeiern an. Auch dieser Erlass zeitigte keinen großen Erfolg.
3
An diesem Donnerstagmorgen hatte sich Max Esser auf die Lauer gelegt. Sein Wagen fiel unter den anderen Kölner Autos auf dem Lehrerparkplatz nicht auf. Durch das Fernglas schaute er hinüber. Was für ein schönes Gefühl, beobachten zu können, ohne dass es jemand bemerkte. Max Esser hatte zwar schon viele Aspekte seines Berufes ausgekostet, aber noch nie war er als Observant tätig geworden. Einfach ganz ruhig im Auto sitzen, eine Zigarette rauchen und zuschauen. Ganz gleich, was passiert. Nicht eingreifen. Zuschauen.
Die ergiebigste Observationszeit war jedoch schon vorbei. Er hätte früher aufstehen müssen. Aber er hatte es nicht geschafft. Er hasste das Frühaufstehen so sehr, dass es ihm sogar gelang, den lauten Küchenwecker zu überhören. Er wollte es am nächsten Morgen wieder probieren.
Esser saß ohne Emotion da und war doch bis aufs äußerste gespannt. Hatte die kleine Macht über andere. Das kleine Vergnügen. Die kleine Anspannung. Eine erotische Situation. Natürlich durfte er nicht entdeckt werden. Es gab immer wieder Dilettanten. So gefährlich sie auch waren. Max Esser hatte mit großem Vergnügen die Geschichte gelesen, wie in Bremen eine Wohngemeinschaft die Observanten vom Landesamt für Verfassungsschutz ihrerseits observierten und eine konspirative Wohnung gekapert hatten. Die Kameras und Tonbandgeräte flogen aus dem dritten Stock. Die Notizbücher wurden von der Wohngemeinschaft beschlagnahmt und im alternativen BREMERBLATT veröffentlicht. Um die Geräte hatte es Max Esser leidgetan. Sie kosteten mehrere zehntausend Mark. Er hatte ein Faible für professionelles Werkzeug.
Sein Miniatur-Tonband wog kaum mehr als ein Pfund, Nagra SN. Er konnte es in der Jackentasche tragen, ohne dass sie ausbeulte. Das Mikro, Reichweite bis zu vier Metern, hatte er in einen Knopf eingebaut. Es war nicht zu erkennen. Dieses Luxusgerät kam jedoch selten zum Einsatz. Nur an jenem Abend hatte es plötzlich an Bedeutung gewonnen.
Seitdem er diesem schwäbisch-fröhlichen Typ in der Kneipe begegnet war, hatte er auf alle erdenkliche Weise versucht herauszubekommen, wer dieser Mann war.
Der Wirt kannte ihn, aber seinen Namen nicht. »Und außerdem bei der trüben Funzel, die in meinem Laden hängt«, hatte der Wirt gesagt und sich sofort ahnungslos gestellt, als Esser ein paar Infos über den Gast erfahren wollte. Das einzige, was ihm aufgefallen war: der starke Schuppenbefall auf der dunklen Jacke. Das Gesicht des Gastes war in seiner Erinnerung verblasst, nur Schemen, nichts Genaues, so sehr hatte Max Esser sich auf das Gespräch konzentriert. Und darauf, dass sein Minitonband in der Windjacke nicht entdeckt wurde. Als der Gast ins Detail ging, hatte Max Esser eingeschaltet. Er nahm das Fernglas hoch und spähte zu der Eingangspforte hinüber. Dort war wenig Bewegung.
Ein paar Autos, die hineinfuhren.
Anhalten.
Ausweis zeigen.
Weiterfahren.
Ein paar Autos, die hinausfuhren.
Anhalten.
Ausweis zeigen.
Weiterfahren.
Ein Mann, der zu Fuß an den Pförtnern vorbei wollte, wurde in die gläserne Kabine gebeten. Die anderen Stammgäste der Kneipe kannten diesen Schwaben nicht. »Ja, ein paar Mal wor dä hier, awwer wer dat is? Nä, kenn ich nit.« Damit hätte Esser seine Nachforschungen einstellen können, wenn nicht dieses Tonband existierte. Dieses kurze Stück Tonband, das nicht einmal sendefähig war.
Er ließ das Fernglas sinken.
Nur durch Zufall war Esser in die Kneipe »Zum Pitter« geraten, weil er auf eine alte Bekannte wartete, die aber nicht erschien. Er hatte ein paar Kölsch getrunken, wollte schon abhauen, als er zwei Tische weiter einen Mann sitzen sah, der ihm irgendwie bekannt vorkam. Ein Schulfreund? Kein Klassenkamerad.
Er rutschte von seinem Hocker und ging auf den Tisch zu.
Wie schon häufiger hatte er sich getäuscht, diesen Mann kannte er nicht. Besonders peinlich wurde es, wenn Esser jemanden mit falschem Namen ansprach, weil er fest davon überzeugt war, dass es sich um einen bestimmten Menschen handelte. Noch schlimmer war es, wenn ihm erst mitten im Gespräch auffiel, dass er mal wieder jemand verwechselt hatte. Er musste sich zusammennehmen. In seinem Beruf konnte dies leicht zu einer Katastrophe führen.
Der Mann diskutierte mit dem Schwaben.
Über Daten, über Computer, über riesige Mengen von Datensammlungen, über Kompatibilität der Systeme, er sprach von der Möglichkeit, eines Tages all diese Dateien zusammenzuführen, und dann, was er schon lange befürchtete, wäre der gläserne Mensch erreicht. Denn mehr als zehntausend Daten brauche man nicht, um einen Bürger ausreichend zu beschreiben.
Der Schwabe hörte zu. Ganz gemütlich. Nickte gelegentlich.
Esser fragte, ob er sich dazusetzen dürfe, das Thema interessiere ihn.
Der Mann und der Schwabe hatten nichts dagegen.
»Das wird noch so weit kommen, dass es eine Schaltzentrale gibt, in der alle mit allem gespeichert sind, wo man dann auf Knopfdruck jeden herausfischen kann, alles überwachen und kontrollieren, ein goldenes 1984 schon heute.«
Der Schwabe meinte, das sei leicht übertrieben.
Aber Esser setzte sogar noch eins drauf: »Dieser ganze Datenschutz ist doch nichts anderes als Augenwischerei. Die Datenschutzbeauftragten in den einzelnen Ländern könnten genauso gut versuchen, Kühen das Singen beizubringen. Der Erfolg wäre der gleiche.«
Sie tranken ein paar Runden Kölsch zusammen.
Der Mann verstieg sich in die Phantasie einer Gehirnstation, die, geheim angelegt, unter der Hauptstadt modernes Politikmanagement betreiben würde.
Esser sah dem Schwaben an, dass ihm nicht wohl war. Anfangs führte er das auf den Bierkonsum zurück. Der Schwabe war ein Schnelltrinker, der das Glas Kölsch in einem Zug leerte. Dann aber merkte er, dass der Schwabe eine Menge vertragen konnte.
Eine viertel Stunde später schaltete Max Esser sein Miniaturtonband ein.
Ich höre immer Datenschutz, Daten löschen, ist doch alles Quatsch. Sie können Daten gar nicht löschen. Wenn jemand in der Kartei ist, dann ist der drin. Da bleibt der auch drin. Wie soll das denn gehen, löschen, wie denn bitte? Einmal ist der in seiner Akte, also da kommt der Datenkontrolleur und sagt, der will gelöscht werden. Das kann geschehen. Aber dann ist der noch in anderen Akten drin. Kann man auch versuchen, ihn da herauszufiltern. Dann gibt es diese Akten aber auch auf Papier. Soll jetzt überall da, wo sein Name auftaucht, der herausgeschnitten werden? Schöne Akten werden das. Und dann sind viele Akten verfilmt, da müssen Löcher reingebrannt werden, nur weil jemand aus den Akten will. Dass ich nicht lache. Und dann gibt es noch das Protokollband, auf dem steht, wann der Datenbestand aufgenommen wurde und wann er gegebenenfalls wieder gelöscht worden ist. Da müsste der Name auch raus, und von diesem Protokollband gibt es eine Kopie. Nachher wird es mehr Löcher von Daten geben als Einwohner in Köln.
Wie oft hatte sich Max Esser dieses Stück Tonband angehört, hatte es untersucht auf Tonfall, den spärlichen schwäbischen Akzent, auf Eigentümlichkeiten im Sprachgebrauch, auf Satzlängen. Die etwas lallende Stimme machte ihm die Arbeit nicht gerade leichter. Als er am Ende des Abends seinen Mitzecher fragte, wo er beschäftigt sei, hatte der nur noch trunken gesagt: »Bundesverwaltungsamt am Rudolfsplatz.«
Dort hatte Max Esser tagelang den Eingang observiert. Vergeblich.
Dann konzentrierte er seine Suche auf den Mann, der mit dem Schwaben gezecht hatte.
Er bekam einen Hinweis. Es war ein Schriftsteller in Nippes, der sich seit Jahren an einem Science-Fiction-Roman über Datenverbrechen versuchte, aber über die ersten fünfzig Seiten nie hinauskam. Dann verhedderten sich die Wege seiner Personen.
»Sie haben mit dem so vertraut geredet, da müssen Sie ihn schon gekannt haben?« fragte Esser verzweifelt, weil er fürchtete, dass auch diese Recherche bei null enden konnte.
»Ich rede mit allen vertraulich«, sagte der Schriftsteller müde, »das ist mein Fehler. So haben manche Kollegen mir die besten Romane vor der Nase weggeschrieben.«
Max Esser konnte kein Mitleid empfinden.
»Also, Sie kennen den nicht?«
»Doch, ich kenne ihn.«
Der Schriftsteller sah auf die mechanische Schreibmaschine, auf der eine dünne Staubschicht lag.
»Was denn nun?« Max Esser wurde ärgerlich.
»Ich kenne ihn seit diesem Abend.«
»Und haben Sie ihn wiedergesehen?«
»Warum fragen Sie?« Der Schriftsteller zog die Augenbrauen hoch.
»Weil ich den Mann seit einigen Tagen suche.«
»Nein.«
Max Esser drehte sich um. Machte die paar Schritte zur Tür. »Noch gutes Schaffen, Herr Kollege.«
Dann schlug er die Tür heftig zu. Er mochte solche Schriftsteller, die, anstatt etwas zu Papier zu bringen, darüber sprachen, dass sie etwas zu Papier bringen wollten. So waren sie ziemlich ungefährlich. Papiertiger.
Jetzt saß er in seinem Auto und beobachtete die Eingangspforte des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Vielleicht war das die Adresse, die ihm der Schwabe verschwiegen hatte.
In seinem Autoradio steckte die Kassette des überspielten Bandes. Dieser Mann sollte doch zu finden sein. Und wenn er jeden Abend alle Kneipen im Umkreis von fünf Kilometern abklappern musste. Seine Beharrlichkeit war es, die ihm manchen Erfolg, allerdings auch manchen Ärger einbrachte. In einem Bewerbungsschreiben hatte Max Esser von sich behauptet, er lasse schon deswegen nicht locker, weil Aufgeben nicht zu seinen starken Seiten gehöre. Die Stelle bekam er nicht.
Immer wieder blickte er hinüber zu den Pförtnern. Das Fernglas lag auf seinem Schoß.
Was würdest du machen, wenn der Schwabe jetzt herauskommt, dachte Max Esser. Es wäre sicher nicht gut, ihm gleich zu folgen. Das würde auffallen. Vielleicht kam er mit dem Wagen heraus. Dann war die Sache einfach. Kennzeichen checken. Er hatte einen guten Bekannten bei der Polizei, der erledigte das in drei Minuten. Wenn er mit dem Fahrrad herauskam, könnte er ihm folgen. Wenn auch nur eine kurze Strecke. Hoffentlich war er kein Fußgänger.
Max Esser verspürte Hunger. Wegen des ungewohnt frühen Aufstehens hatte er gut gefrühstückt. Das wirkte sich jetzt aus. Der Magen verlangte Nachschub. Er gab zehn Minuten zu. Dann wollte er abfahren. Die Mittagszeit hatte auch nichts gebracht. Du musst Morgen um sieben hier stehen, dachte Esser, sonst kannst du die Sache vergessen.
Er stellte sich ein Leben als Observant vor. Trotz der kleinen Anspannung war es gleichzeitig auch langweilig. Immer nur warten müssen. Dennoch, der Reiz überwog. Dieses Heimliche, Versteckte, Unkontrollierbare. Der Schwabe konnte jeden Moment heraustreten. jede Sekunde. Er konnte auftauchen, und dann ging die Verfolgung los.
Max Esser dachte über einen Plan nach, wie er ihn ansprechen sollte. Autoritär, vielleicht als Oberkommissar, der in einer bestimmten, ganz geheimen Sache eine Nachfrage hat. Kumpelhaft, wir haben doch schon zusammen gesoffen. Offen, wie viele Bürger unserer Republik sind denn im Amt gespeichert. Zehn Prozent, zwanzig Prozent? Was ist legal, oder schert sich das Amt nicht darum? Versteckt, als Versicherungsvertreter, der ein ganz besonders günstiges Krankenhaustagegeld anbietet, mit dem Hinweis, dass es geradezu Spaß machen würde, sich im Erste-Klasse-Bett zu räkeln, wenn Tag für Tag ein schönes Sümmchen aufs Konto kommt.
Dann sah er im Rückspiegel den Mann, der den Parkplatz der Schule betrat.
Mit schnellen Schritten.
Direkt auf den Wagen zu.
Max Esser startete den Motor.
Aber der Blondschopf stellte sich ihm in den Weg. Esser drehte die Scheibe herunter.
»Was wollen Sie von mir?«, rief er aus dem Auto.