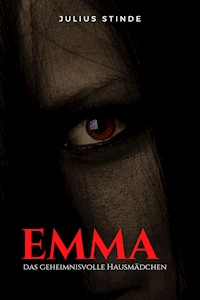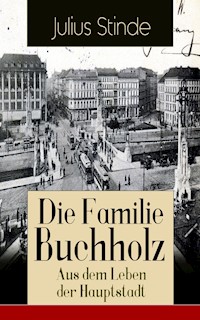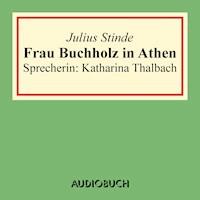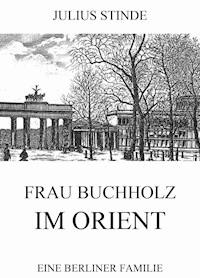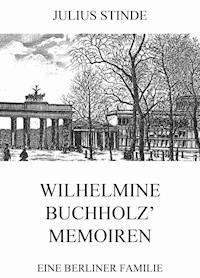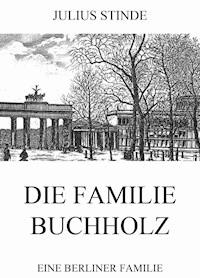
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stindes realistisch-satirische Erzählungen über die Berliner Familie Buchholz waren ein großer Erfolg Ende des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book Die Familie Buchholz wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Familie Buchholz
Julius Stinde
Inhalt:
Von außen
Ein Geburtstag
Musikalischer Bräutigamsfang
Auf der Ausstellung
Herr Buchholz hat Zahnschmerzen
Spukgeschichten
Bei der Silvesterbowle
Ein magnetischer Tee
Im Kremser
Ein Polterabend in der dritten Etage
Warum wir ins Bad müssen
Badeleben
Wieder ein Jahresanfang
Herrn Bergfeldts Unglück
Der Erstgeborene
Taufe
Eine Pfingsttour
Sommerfrische
Erntefest
Geheimnisse
Der letzte Kaffee
Auf dem Bock
»Beschwören kann und mag ich's nicht.«Hochzeit
Nach der Hochzeit
Die erste Gesellschaft
Onkel Fritzens Weihnachten
Erziehungspläne
Das Pressefest
Häusliche Kunst
Regatta
Im grünen Grunewald
Das Porträt
Neue Verwandtschaft
Der Weihnachtsmarkt
Feiner Verkehr
Auf dem Kriegspfad
Betti
Der erste April
Wie es so ganz anders kam
Der verhängnisvolle Donnerstag
Die Schule des Lebens
Prüfungen
Mein Schwiegersohn
Onkel Fritz
Wie es allen geht
Die Familie Buchholz, J. Stinde
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636852
www.jazzybee-verlag.de
Julius Stinde– Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 28. Aug. 1841 zu Kirch-Nüchel in Holstein, gest. 5. Aug. 1905 in Olsberg bei Kassel, studierte Chemie und Naturwissenschaften, war, nachdem er 1863 promoviert, in Hamburg mehrere Jahre als Fabrikchemiker tätig, übernahm aber schließlich die Redaktion des »Hamburger Gewerbeblatts« und widmete sich ganz der Schriftstellerei, insbes. dem naturwissenschaftlichen Feuilleton. Außer zahlreichen Aufsätzen in Fachzeitschriften veröffentlichte er: »Blicke durch das Mikroskop« (Hamb. 1869); »Alltagsmärchen«, Novelletten (2. Aufl., das. 1873, 2 Bde.); »Naturwissenschaftliche Plaudereien« (das. 1873); »Die Opfer der Wissenschaft« (unter dem Pseudonym Alfred de Valmy, 3 Aufl., Leipz. 1898); »Aus der Werkstatt der Natur« (das. 1880, 3 Bde.) u. a. Für die Bühne schrieb S. eine Anzahl mit großem Erfolg ausgeführter plattdeutscher Komödien, wie: »Hamburger Leiden«, »Tante Lotte«, »Die Familie Karstens«, »Eine Hamburger Köchin«, »Die Blumenhändlerin« u. a.; ferner das Lustspiel »Das letzte Kapitel«, die beiden Weihnachtsmärchen: »Prinzeß Tausendschön« und »Prinz Unart« sowie gemeinschaftlich mit G. Engels das Volksstück »Ihre Familie«. Seit 1876 in Berlin lebend, schrieb er noch: »Waldnovellen« (Berl. 1881, 2. Aufl. 1885); »Die Wandertruppe oder das Dekamerone der Verkannten« (das. 1881, 3. Aufl. 1887); »Berliner Kunstkritik, mit Randglossen von Quidam« (das. 1883) und seine ergötzlichen Bücher über die Familie Buchholz: »Buchholzens in Italien« (das. 1883), »Die Familie Buchholz« (1884, 87. Aufl. 1905), »Der Familie Buchholz zweiter Teil« (1885), »Der Familie Buchholz dritter Teil: Frau Wilhelmine« (1886), »Frau Buchholz im Orient« (1888), »Wilhelmine Buchholz' Memoiren« (1895), die seinen Namen am bekanntesten machten und seitdem ebenfalls in zahlreichen Auflagen erschienen sind. Es folgten: »Hotel Buchholz. Ausstellungserlebnisse« (1896), »Die Perlenschnur und Anderes« (1887), »Pienchens Brautfahrt« (1891), »Humoresken« (1892), »Ut'n Knick. Plattdeutsches« (1893), »Der Liedermacher«, Roman (1893), »Martinhagen« (1900), »Emma, das geheimnisvolle Hausmädchen« (1904) und aus seinem Nachlaß »Heinz Treulieb und allerlei Anderes«, mit Einleitung von Marx Möller (1906).
Die Familie Buchholz
Von außen
In der Landsberger Straße, welche vom Alexanderplatz nach dem Friedrichshain führt und zum Postbezirk Nordost der Reichshauptstadt gehört, steht ein Haus, das sich von seinen Nachbarn rechts und links, gerade und schräg gegenüber dadurch unterscheidet, daß es keine Ladenfenster hat und an seiner Fassade ein Paar Pilaster aufweist, die ein Architekt ersonnen hat, der einmal griechisch bauen wollte und aus Versehen falsche Vorlageblätter in die Hand bekam, als er den Aufriß zu Papier brachte.
Aber diese beiden Wandpfeiler, welche von der ersten Etage bis fast an das Dach reichen und den zweiten Stock durchschneiden, geben dem Hause trotzdem ein gewisses feierliches Aussehen, so daß es sich vorteilhaft von den modernen Mietskasernen abhebt, denen die kleinen Gebäude Alt-Berlins allmählich zum Opfer fielen, die dort im Nordost noch hin und wieder anzutreffen sind und nur auf das Weggerissenwerden zu warten scheinen.
Das Haus mit den mißverstandenen griechischen Pilastern wird sich aber noch eine Weile halten; denn als es entstand, schüttelten die Leute die Köpfe über den gewaltigen und prunkvollen Bau, der viel zu sehr gegen seine Umgebung abstach. Sollte vielleicht ein Prinz darin wohnen oder ein Graf? Die Vornehmen zögen nicht nach der Landsberger Straße, die blieben Unter den Linden oder in der Wilhelmstraße, wo die anderen Paläste stehen und die Kinder nicht in Pantinen herumlaufen. So sagten die Leute damals, und jetzt nach kaum einem Menschenalter paßt jenes Haus nur noch eben in das moderne Berlin hinein, weil es seinerzeit auf den Nachwuchs gebaut wurde, wie der Sonntagsrock für den Dreizehnjährigen, dem die Arme und Beine quartalsweise länger werden. Aus dem vermeintlichen Palaste ist mittlerweile ein gut bürgerliches Haus geworden, und wer jetzt vom Alexanderplatz kommt, den Bahnhof der Stadtbahn, das schloßartige Hotel, die Markthalle und die anderen himmelanstrebenden Neubauten bewundert, der wird, wenn er die Landsberger Straße durchschreitet, nichts merkwürdig finden als das für die Nachwelt in Stuck erhalten gebliebene Gelüste des Architekten, einmal das Antlitz eines modernen Wohnhauses mit griechischen Motiven zu tätowieren.
Der eine Flügel des Haustores, dem der übliche Rundbogen nicht fehlt, ist am Tage meistens geöffnet, so daß man auf den Flur sehen kann und auf die Glastüre, die zum Hofe führt. Durch die mattgemusterten Glasscheiben schimmert es im Sommer grün, denn hinter dem Hause liegt ein kleiner Garten, in dem ein Apfelbaum und einige Fliederbüsche nach Luft und Licht ringen. Wenn der Steinkohlenrauch von der benachbarten Fabrik von feuchten Winden in den Hof hinabgedrückt wird, färbt er die spärlichen Apfelblüten schwarz und dringt in die zarten Kelchröhren des Flieders, dem deshalb stets ein Beigeruch nach dem Schornstein anhaftet. Es wird auch jedes Jahr versucht, ein wenig Rasen anzusäen, aber die langen Keime, die im Schatten unter dem Baume aufsprießen, bringen es nicht weit, denn was die Spatzen übriglassen, scharren die Hühner aus der Erde. Wenn aber ein linder Mairegen gefallen ist und die Jungens in den überfluteten Rinnsteinen der Straße Papierkähne schwimmen lassen oder in Ermangelung dieser ihre Mützen, dann sieht der Garten hinter dem Hause aus, als wäre der Frühling drin zu Gast. Und das ist schon sehr viel in dem großen, weiten Berlin.
Groß und weit ist die Stadt geworden, so groß, daß der einzelne Mensch darin verschwindet. Wie ganz anders ist es dagegen in einer kleinen Stadt. Da kennt einer den andern, wenn auch nicht näher, so doch vom Ansehen, und wenn einmal ein Fremder durch die Straßen geht, so weiß jeder, der ihn sieht, daß es wirklich ein Fremder ist. Es kann jemand durch ganz Berlin wandern, Straße für Straße, ohne daß man ihn beachtet; er muß es für einen glücklichen Zufall halten, wenn ihm ein Bekannter oder Freund begegnet. Tausende hasten an ihm vorbei, sie sind ihm fremd, er ist ihnen fremd; fremd sind ihm die Mitfahrenden in dem Omnibus, im Pferdebahnwagen, im Waggon der Stadtbahn. Es überkommt ihn das Gefühl der Einsamkeit mitten in dem lauten Treiben des Tages und in dem Gedränge der Menschen. Die Einsamkeit ist nicht allein draußen im Wald daheim, auf dem Meere und in der Öde, sie hat ihre Stätte auch in der Millionenstadt.
Und doch ist jedes Haus dieser großen Stadt eine Heimat für die, welche darin wohnen, und die Straße, in der das Haus liegt, ist ein Bezirk, in dem es Nachbarn gibt wie in einer kleinen Stadt, in der man sich persönlich nahesteht oder doch wenigstens vom Ansehen kennt. Die Familien in den Häusern haben Verwandte und Bekannte, ganz so wie in einer kleinen Stadt, man hat seine Kreise ganz so wie dort und redet von den Angehörigen dieser Kreise ebensoviel Gutes und ebensoviel Böses wie anderwärts. Der Unterschied besteht nur darin, daß es in der großen Stadt mehr Kreise gibt als in der kleinen und daß sie schärfer voneinander getrennt sind, weil sich die Einsamkeit der Großstadt dazwischendrängt. Sie gleichen jenem Garten, den die hohen Mauern der Nachbarhäuser einschließen, dessen grünen Schimmer der Vorübergehende nur gewahrt, wenn das Haustor offensteht. Der Fliederbaum blüht nicht für jedermann, wie in den Anlagen des Lustgartens, wo die weißschäumenden Strahlen der Springbrunnen sich hoch in die Luft erheben und das blühende Gebüsch netzen, das sie umhegt, wenn der Wind mit den glitzernden Tropfen spielt.
Über das öffentliche Leben der Großstadt wird täglich von den Zeitungen Protokoll geführt. Wir erfahren gewissenhaft, wann die ersten Knospen im Tiergarten sich entfalten, aber über die ersten Blüten jenes Apfelbaumes wird keine Zeile gedruckt, denn er ist ein privater Apfelbaum und hat als solcher kein Anrecht an der Druckerschwärze, es sei denn, daß er irgend etwas Außerordentliches leiste, im Herbst noch einmal wieder anfängt jung zu werden, oder vor Altersschwäche stürzt und dabei Unheil anrichtet. Und so ist es auch mit dem Privatleben in den Häusern und mit dem Tun und Treiben in den vielen Kreisen. Nur außergewöhnliche Vorkommnisse gelangen an die Öffentlichkeit: ein Einbruch, eine Feuersbrunst, ein besonderes Unglück oder ein fröhliches Ereignis seltener Art. Von Tausenden und aber Tausenden erfährt die Welt nichts; die wandeln ihren Weg von der Geburt bis zum Tode mitten in der großen Stadt wie in stiller Verborgenheit, und doch schlägt ihnen ein Herz in der Brust, das liebt und haßt, Freude empfindet und Leid, weil es ein Menschenherz ist.
Auch die Familie Buchholz in der Landsberger Straße würde zu jenen Tausenden gehören, wenn nicht ein Erlebnis ärgerlicher Natur der Frau Wilhelmine Buchholz die Veranlassung gegeben hätte, ihre Entrüstung der Öffentlichkeit zu unterbreiten und aus der Verborgenheit hervorzutreten. Mit dem ersten Briefe, den sie an die Redaktion einer Berliner Wochenschrift sandte, war sie der Presse verfallen, denn ein Brief folgte dem anderen und jeder gewährte einen Einblick in das Privatleben der Familie und in den Kreis ihres Verkehrs. Frau Wilhelmine öffnete nicht allein das Gartentor, sondern sie schnitt auch, wenn es an der Zeit war, eine Handvoll von dem Flieder für solche Leute ab, die der Schornsteingeruch nicht störte. Sie meinte: »Orchideen wüchsen nicht in der Landsberger Straße; einfache Bürgersleute hätten kein Treibhaus.«
Sie hat recht. Wem die Schilderung des kleinbürgerlichen Lebens der Reichshauptstadt nicht gefällt, dem bleibt es unbenommen, sich einen Roman zu kaufen, in dem Grafen und Komtessen gebildete Konversation führen. Wen es aber interessiert, zu erfahren, wie sich intimes Familienleben in der Einsamkeit der großen Stadt gestaltet, der wird an den Sorgen und den Freuden der Frau Wilhelmine Anteil nehmen und ihre Briefe als Skizzen aus dem Leben der Hauptstadt betrachten, die nicht bloß aus Asphaltstraßen und langen Häuserreihen besteht, sondern aus vielen, vielen Heimstätten, deren Türen dem Fremden verschlossen bleiben. Eine von diesen Heimstätten ist das Haus Buchholz in der Landsberger Straße, und was Frau Buchholz dazu trieb, die Tür zu öffnen, war der Ärger. Wie das kam, lassen wir sie selbst erzählen.
Ein Geburtstag
Ich bin nur eine einfache Frau, Herr Redakteur, und das Schreiben ist meine Sache durchaus nicht, aber da in Ihrem Blatte, welches ich so gerne lese, doch auch manchmal Gegenstände zur Sprache kommen, die nur von Frauen richtig erfaßt und behandelt werden können, so wage ich es, als vorsorgliche Mutter, Ihnen mein Herz auszuschütten, und bitte Sie, den Stil, wo er reparaturbedürftig ist, gütigst ausbessern zu wollen. Es wäre mir nämlich peinlich, wenn meine Töchter Fehler in meinem Schreiben entdecken sollten; so etwas würde meine bisherige Autorität schädigen. Sie glauben gar nicht, wie die Kinder heutzutage es weit in der Schule bringen.
Nun aber zur Sache.
Vor zwei Weihnachten schenkte Onkel Fritz den Kindern ein Puppentheater, womit wir auch ganz einverstanden waren, weil sie ruhig sind, wenn sie sich damit beschäftigen. Selbst wenn der kleine Krause zu Besuch kommt und Heimreichs Dreie aus der Müllerstraße, geht es ohne Lärm her, sobald sie das Puppentheater vorhaben. Sonst spielten sie immer: »Wie gefällt dir dein Nachbar«, oder »Räuber und Soldat«, wobei es nie ohne Spektakel abging und einmal sogar die Scheibe von der Servante eingestoßen wurde, worin das gute Porzellan steht, das Gott sei Dank unversehrt blieb. Mein Mann schenkte den Mädchen daher auch hin und wieder einige Groschen, damit sie sich Bilderbogen kaufen und neue Figuren für das Theater zurechtpappen können; es ist das immer noch vorteilhafter, als wenn etwas entzweigebrochen wird. Die Scheibe vom Spinde kostete bare acht Mark! Neulich war nun Emmis Geburtstag, und weil es doch ein Aufwaschen war, so bat ich die Alten auch, während Emmi, wie wir das so gewohnt sind, ihre Kindergesellschaft hatte.
Den Kindern war das Eßzimmer überlassen, und nachdem sie ihre Schokolade bekommen hatten (notabene mit der nötigen Portion Kuchen), bauten sie das Puppentheater auf und stellten Stühle davor, ordentlich wie im Theater. Dann kam der kleine Krause und lud uns Großen ein, die Vorstellung zu besuchen, und wir gingen denn auch alle hin, um den Kindern den Gefallen zu tun. Wir Damen saßen gleich vorne an, die Herren mußten aber an der Wand stehen, denn das Geschleppe mit den Plüschstühlen aus der guten Stube dulde ich nicht.
Als wir nun so sitzen und der Dinge harren, die da kommen sollen, sagte Frau Heimreich zu mir, daß sie im ganzen nicht sehr dafür wäre, daß die Kinder sich mit Komödie beschäftigten, es machte sie so phantasiereich. Ich erwiderte ihr darauf: »Im Gegenteil, es bildet Herz und Gemüt und ist eine bessere Beschäftigung als das Skandalmachen, wobei leicht Spiegelscheiben von Schränken eingerannt werden.« – Den Stich hatte sie weg, denn ihre Agnes war damals schuld an dem Malheur gewesen, und so schwieg sie denn auch still.
Endlich ging der Vorhang auf. Onkel Fritz fing an zu applaudieren, obgleich noch kein Wort gesprochen war; er mußte wohl meinen, im Viktoriatheater zu sein, wo die Dekorationen immer den meisten Beifall bekommen. Hier war jedoch gar nichts zu beklatschen, denn die Szenerie stellte ein einfaches Zimmer dar, an dem unsereins nichts Bemerkenswertes finden konnte. Aber Onkel Fritz will einmal als Kenner gelten.
Nun fingen die Kinder an zu sprechen. Meine Emmi schob eine der auf dem Theater befindlichen weiblichen Figuren noch vorne und sagte ganz laut und vernehmlich:
»Guten Morgen, meine Damen. Nee, ich kann nicht anders, als Ihnen mein Herz ausschütten. Denken Sie sich, die Rosalie, das leichtsinnige Geschöpf, kokettiert nun auch schon mit meinem Wachtmeister.«
»Das fängt ja nett an!« flüsterte Frau Heimreich mir zu. – »Wer wird denn gleich alles auf die Goldwaage legen!« sagte ich. Ein bißchen sonderbar war mir aber doch zumute geworden, allein der Heimreichen gegenüber wollte ich mir keine Schwäche anmerken lassen.
Die Kinder spielten weiter und Emmi fuhr fort: »Na, es ist auch kein gutes Haar an dem Frauenzimmer. Hat sie Ihnen nicht auch Ihre Liebhaber abspenstig zu machen gesucht, das fatale Ding?«
»Ja freilich! Ja freilich!« antworteten die anderen Kinder im Chor und bewegten die Puppen an ihren Drähten, als wenn die gesprochen hätten. Sogar der kleine Krause stimmte mit ein, weshalb er vom Theater weggewiesen wurde und weinerlich hinter dem Bettschirm hervorkam, mit dem die Kinder das Puppentheater auf der Seite verstellt hatten, damit man sie nicht sehen konnte.
»Mir scheint, die Sache wird immer heiterer!« sagte Frau Heimreich ziemlich laut. Ich tat, als wenn ich nicht merkte, was sie meinte, und sagte deshalb zum kleinen Krause: »Komm nur zu mir, Eduard, von hier siehst du's am allerbesten!« – »Ich denke, das Kind täte gut, wenn es von solcher Art Komödie gar nichts sähe,« bemerkte Frau Heimreich spitz. Ich schwieg. Nun erschienen auf der Bühne zwei Puppen, die davon redeten, daß sie heimlich verheiratet seien, einen Sohn hätten, von dem die Eltern nichts wüßten, und dergleichen Anzüglichkeiten mehr. Hierauf kam ein alter Sünder, welcher der Rosalie die Cour machen wollte und zwei Flaschen Champagner mitbrachte, auf die er zwei Zehntalerscheine geklebt hatte. Frau Heimreich machte in einem fort spöttische Bemerkungen. »Das bildet wohl Herz und Gemüt?« gab sie mir zurück. »Besser ist denn doch, die Glasscheiben nehmen Schaden als die jungen Kinderseelen!« – Konnte ich ihr recht geben? Ich hätte es wohl eigentlich müssen, allein sie war zu impertinent, so daß ich nur sagte: »So etwas wie auf der Bühne kommt im Leben oft genug vor!« – »Derlei Erfahrungen habe ich nicht gemacht!« höhnte sie. – Ich hätte ihr dies und das antun können, aber recht sollte sie doch nicht haben. »Wenn man sich blind und taub stellt, sieht und hört man natürlich nichts von der Welt!« erwiderte ich. Zum Glück fiel der Vorhang, und der erste Akt war vorbei. Onkel Fritz und der kleine Krause waren die einzigen, die applaudierten, ich klatschte natürlich auch mit, bloß um Frau Heimreich zu zeigen, daß ich mich an ihr Geschwätz durchaus nicht kehrte.
Nun kam der zweite Akt. Es wurde ein Kind ausgesetzt, die Rosalie findet es, ein Mann sagt ihr auf den Kopf, es wäre das ihre. – »Ich bin Stickmamsell, wie käme ich denn zu so was!« ruft meine Emmi, welche die Rolle der Rosalie zu sprechen hatte.
Mir war es schon zu verschiedenen Malen heiß und kalt übergelaufen, und jetzt konnte ich nicht länger an mir halten. – »Nun ist's aus mit der Komödie!« rief ich, »das geht mir denn doch über allen Spaß!« und sprang auf. –»In Ihrem Hause lernen die Kinder allerliebste Dinge!« rief die Heimreich. »Ha, ha! Herz und Gemüt! Ja, die finden ihre Rechnung. Das muß man sagen!« Hierauf rief sie: »Agnes, Paula, Martha, ihr kommt zu mir, von solchem Unfug will ich nichts wissen. Wir sind eine respektable Familie, euer Großpapa, mein seliger Vater, hatte sogar den Roten-Adler-Orden.«
»Aber man bloß vierter,« warf ich ein, denn wenn sie nur irgend kann, bringt sie den alten Mann mit seinem Orden aufs Tapet. – Die Kinder kamen hinter dem Bettschirm mit trübseligen Gesichtern hervor. Meine weinten laut, und der kleine Krause fing mit an zu heulen. Es war das reine unterbrochene Opferfest. – »Was haben wir denn getan, daß du so böse bist, Mama?« flennte Emmi. – »Ach was!« sagte ich, »wie könnt ihr so dummes Zeug aufführen!« – »Bloß dumm?« fragte die Heimreich. – »Wo habt ihr das Stück her?« inquirierte ich. – »Vom Buchbinder!« antwortete Emmi und brachte mir ein Büchlein, dessen Titel lautete: »Eine leichte Person. Posse in drei Akten von Büttner und Pohl. Für Kindertheater bearbeitet von Dr. Sperzius. Neuruppin, Verlag von Öhmigke und Riemschneider.« – »Das mag ein schöner Doktor sein, der Spuzius oder Sperenzius,« sagte die Heimreich. »Schämen sollte er sich.« – Nun mischte Onkel Fritz sich dazwischen. »Eine sehr gute Posse,« sagte er, »sie ist unzählige Male auf großen Bühnen gegeben.« – »Jawohl!« rief ich, »eine Posse für einzelne Herren. Aber was dir als ledigem Junggesellen gefällt, braucht deshalb noch immer nicht gut zu sein. Ich hoffe nicht, daß du sie gesehen hast, Karl?« fragte ich meinen Mann. Er erinnerte sich nicht genau.
Nun bohrte Frau Heimreich wieder nach. Ich, als Mutter, hätte nicht dulden müssen, daß solche Bücher in mein Haus kämen, worauf ich sagte, daß ich mehr zu tun hätte, als darauf zu achten; in meinem Hause könnten die Leute, die zu Besuch kämen, ihren Namen nicht anstatt der Visitenkarte in den Staub schreiben, der fingerdick auf den Möbeln läge. Ein Wort gab das andere, und sie verließ uns, indem sie sagte, sie würde nie wiederkommen, ebensowenig wie sie ihren Kindern ferner gestattete, ein solches Gomorrha wieder zu betreten, wie unser Haus sei. Das war mir ganz recht, denn meine beiden sind eigentlich schon zu groß für Heimreichs drei Jüngsten, und wenn die Heimreichen sich auch mit ihrer Moral brüstet, so bin ich doch der festen Meinung, daß sie nur so lange fromm ist, als sie sonntags in der Kirche sitzt.
Die Kinder weinten schrecklich, als die Heimreichs davongingen. Ich gab ihnen Schokolade und Kuchen, obgleich sie erst vor kurzem genug gehabt hatten, aber Kinder haben immer noch Platz, und das war in diesem Fall sehr gut, denn so wurden die wenigstens ruhig. Wir hatten zwar ziemlich lange Umgang mit Heimreichs gehabt, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Sie wollte es einmal nicht anders. Außerdem wohnen sie ganz hinten in der Müllerstraße, und das ist von uns ein entsetzliches Ende. Krauses blieben noch, und als wir wieder in der guten Stube saßen, kam die Rede natürlich auf das infame Buch, das so viel Unheil angerichtet hatte. Herr Krause meinte, es sei unverantwortlich, solches Zeug den Kindern in die Hände zu geben. Onkel Fritz entgegnete, die seien viel zu dumm, als daß sie wüßten, worum es sich eigentlich handelte. »Aus kleinen Kindern werden große!« sagte mein Mann. »Jugendeindrücke haften fürs ganze Leben!« sagte Frau Krause. »Die Kinder hätten ja nur ›Schneewittchen‹ oder ›Rübezahl‹ oder derartiges aufführen können,« rief ich, »daß ihnen auch gerade solche Dummheit in die Hände geraten mußte wie die ›Leichte Person‹.«
Onkel Fritz meinte, wir hätten die Komödie ruhig zu Ende spielen lassen sollen, das wäre besser gewesen, als unnützes Aufsehen zu machen. – Ich wusch ihm aber nicht schlecht den Kopf, denn Onkel Fritz ist mein jüngster Bruder. Sein albernes Theater sei an allem schuld, behauptete ich. Er wälzte es jedoch auf den Buchbinder ab und den Dr. Sperenzius oder wie er heißt. Es gab eine allgemeine Verstimmung.
Nun frage ich Sie, Herr Redakteur: Ist es zu verantworten, daß Fabrikanten und Händler unter der harmlosen Bezeichnung »für Kindertheater bearbeitet« Schriften zum Verkauf bringen, die für die Kinderwelt passen wie die Faust aufs Auge? Wo ist ein Gesundheitsamt für die Verfälschung der geistigen Nahrungsmittel?
Das Geburtstagsfest war allerdings gründlich gestört – schuld hatte die Heimreich auch... aber das habe ich als Lehre daraus genommen: die Lektüre meiner beiden wird von heute ab von mir und meinem Manne überwacht; in das Paradies ihrer Kindheit kommt mir ein solches Giftgetier nicht wieder. Krausens sind ganz meiner Meinung und vielleicht sind es andere Familien auch, wenn sie erfahren, wie es mir ergangen ist. Sie sind nicht Mutter wie ich, aber ich hoffe, Sie werden mir in dieser Angelegenheit beistehen, Herr Redakteur.
Ihre ergebene Wilhelmine Buchholz, geb. Fabian.
P.S. Das Buch füge ich bei. Sie sehen, daß ich die schlimmsten Stellen noch gar nicht angeführt habe.
Musikalischer Bräutigamsfang
Sie waren damals so nett und druckten die fatale Geschichte ab, welche auf meiner Emmi Geburtstag passiert war, als die Kinder das alte gräßliche Komödienstück auf dem Puppentheater spielten und ich mich mit der Heimreich erzürnte. Sie ist noch nicht wieder bei uns gewesen, und die Krausen von nebenan, die eine sehr verständige Frau ist, meint auch, ich würde mir etwas vergeben, wenn ich den ersten Schritt täte.
Nun muß ich Ihnen aber erzählen, wie ich neulich überrascht wurde. Ich sitze also und denke an rein gar nichts, als es klingelt und der Postbote kommt und das dazu mit einer Geldanweisung für mich. Erst wollte ich es gar nicht glauben, aber ich mußte ja quittieren, und er legte die Goldstücke auf den Tisch. Es war das Honorar für das, was ich für Sie geschrieben hatte; nein, ich hatte es wirklich nicht erwartet und dann so viel, ich war ganz außer mir und fing an zu weinen und die Kinder auch. Das Geld lag auf dem Tisch, ich dachte, es würde vor meinen sichtlichen Augen verschwinden, wenn ich es anrührte, und hätte geglaubt, der Postbote wäre ein Gespenst aus einem Zaubermärchen gewesen, wenn er die Stube nicht so vollgetreten hätte.
Mein Mann sagte: »Ich kann ordentlich stolz auf dich sein, Wilhelmine, das hast du nun so mit dem Schriftstellern verdient.« – »Karl,« sagte ich zu ihm, »ich bin mitunter wohl etwas heftig gegen dich gewesen, es soll nicht wieder vorkommen, nein, ganz gewiß nicht.« Er umarmte mich und gab mir einen Kuß, und ich mußte wieder anfangen zu weinen. Emmi und Betti klammerten sich an mich, als sie sahen, daß ich mich noch immer nicht beruhigen konnte, und wischten sich auch die Augen. »Laßt gut sein, Kinder,« beschwichtigte ich sie, »es ist ja nur die Freude. Wenn bloß die Heimreich das sehen könnte, wie würde die sich ärgern!«
»Was willst du nun mit dem Gelde anfangen?« fragte mein Mann. – »Das bewahre ich zum ewigen Andenken auf,« antwortete ich, »oder wenn es nicht anders ist, kaufe ich mir einen neuen Hut dafür, der alte ist durchaus nicht mehr modern. Die Krausen hat sich kürzlich auch erst einen neuen angeschafft.« – Die Kinder meinten auch, es wäre das beste, wenn ich den Hut kaufte. So gab ich denn ihrem Drängen nach, und wir gingen alle drei ins Modemagazin. Weil aber noch ein kleiner netter Rest von dem Gelde übrigblieb, das der Postbote gebracht hatte, sagte ich: »Dafür wollen wir uns einen vergnügten Tag machen. Wir gehen heute abend ins Konzerthaus bei Bilse; ich setze den neuen Hut auf, und Papa holt uns nachher ab.«
Der Jubel der Kinder war unermeßlich, und weil wir doch einmal unterwegs waren, gingen wir in eine Konditorei und ließen uns Schokolade geben mit Schlagsahne darauf und etwas Angenehmes zum Knabbern dazu. Es war allerliebst. –
Am Abend machten wir uns rechtzeitig auf den Weg, um einen guten Platz bei Bilse zu bekommen. Als wir nun in den Saal treten, sehe ich da bereits eine Freundin von mir an einem Tisch sitzen. Wir gingen heran und begrüßten uns. »Guten Abend, Frau Bergfeldt,« sagte ich, »sieht man Sie auch mal wieder? Nein, und wie Ihre Auguste herangewachsen ist, seit ich sie nicht gesehen habe!« – Die Bergfeldten meinte auch, daß ihre Tochter sich sehr herausgemacht hätte. – Na, ich sah gleich, daß es nur das Kleid war, welches das Mädchen so groß machte, ganz modern mit Schleppe und Küraßtaille und die Haare vorne ins Gesicht heruntergekämmt wie eine Ponymähne. Bei meinen würde ich so etwas nicht leiden, obgleich der Betti bereits ebensogut solches Kleid passen würde wie Bergfeldtens Auguste, die freilich schon vor zwei Jahren konfirmiert wurde, aber noch sperrig und ungelenk ist, daß es eine Sünde und Schande ist, sie wie eine Erwachsene zu kleiden. Nun, wer so spitze Ellbogen hat, tut freilich am besten, lange Ärmel zu tragen.
Wir nahmen Platz, aber als Emmi sich neben Auguste setzen wollte, sagte die Bergfeldten, der Stuhl wäre vergeben, ihr Emil käme noch nach. Ich sagte: »Es sind ja zwei Stühle frei, an einem wird Ihr Emil wohl genug haben.« – Da gab sie mir zur Antwort, ihr Emil würde noch einen Freund mitbringen, und wurde ganz verlegen. – »Aha,« dachte ich, »hier spinnt sich etwas an. Aufgepaßt, Wilhelmine!«
Es dauerte denn auch nicht lange und Emil kam richtig mit seinem Freunde an, der, wie sich nachher herausstellte, ebenso wie Emil auf den Assessor studiert, wozu er jedoch noch ein paar Jährchen Zeit hat. Wie ich nicht anders erwartete, setzte sich der Freund neben die Auguste, die rot bis hinter die Ohren wurde und sich von nun ab noch linkischer benahm als zuvor. Emil kam bei meiner Betti zu sitzen, und so war unser Tisch denn komplett.
Das Konzert begann, und kaum fingen die Musiker an zu spielen, als die Bergfeldten einen Strickstrumpf aus der Tasche holte und darauf losstrickte, als wollte sie das Entree wieder verdienen. Solange die Musik langsam und feierlich war, strickte sie ganz ruhig; aber als nachher ein Walzer gespielt wurde, fuhr ihr der Takt in die Finger, und sie ließ so viele Maschen fallen, daß ihre Auguste alles wieder auftrennen mußte, was sie fertiggebracht hatte. Nun konnte ich mir auch erklären, warum der Strumpf auch so grau aussah.
Ich bin ja sehr für den häuslichen Fleiß und hasse das Müßiggehen, aber wenn man seinen Geist im Konzert bilden will, kann man doch die Aufmerksamkeit nicht zwischen einer Sinfonie und dem Strumpf teilen. Auch glaube ich nicht, daß Beethoven seine himmlischen Eingebungen komponierte, damit dazu gestrickt werden sollte. Und wie großartig ist solche Sinfonie, wenn sie alle vier Kellertreppen tief in Gedanken dasitzen und man meinen muß, sie könnten höchstens durch einen Eimer kaltes Wasser wieder zu sich gebracht werden. Das ist die Macht der Musik!
In den Zwischenpausen unterhielten wir uns recht gut. Emil ließ sich mit meiner Betti in ein umfassendes Gespräch über die deutsche Literatur ein, und da Betti erst kürzlich etwas von der Marlitt gelesen hatte, so wußte sie recht gut Bescheid. Sie fand auch, daß die Marlitt ihre Charaktere außerordentlich schildert, und hielt es für durchaus richtig, daß der Baron erschossen wurde und der brave charaktervolle Ingenieur die Gräfin kriegte. Wenn die Kinder etwas lernen, können sie nachher auch ein Wort mitsprechen.
Bergfeldtens Auguste und der Student redeten fast gar keine Silbe miteinander, aber von Zeit zu Zeit warfen sie sich schief von der Seite verliebte Blicke zu, die gerade genug sagten. Die Bergfeldten tat aber, als wenn sie gar nichts bemerkte, im Gegenteil nannte sie den Studenten immer »lieber Herr Weigelt« und fragte, wie es ihm ginge, was seine Eltern machten und warum er die Pulswärmer nicht trüge, die Auguste ihm gehäkelt habe? – »Sie wollen den jungen Mann wohl warm halten, weil Sie ihm Pulswärmer schenken?« flüsterte ich ihr leise zu, ohne etwas Übles bei dem Scherz zu denken. Sie aber warf einen höhnischen Blick auf meinen neuen Hut und sagte: »Wir sind für das Nützliche und nicht für Flitterstaat und Tand!« – Ich war sprachlos. Meinen neuen Hut Tand zu nennen! Ja, wenn ich ihn geborgt oder meinem Karl das Geld dafür abgezwackt hätte, das wäre etwas anderes gewesen. Als ich mich gefaßt hatte, erwiderte ich: »Natürlich, wenn der Mann alles allein verdienen muß, ist es unrecht von der Frau, die Mode mitzumachen.« Das hatte sie weg.
Während der zweiten Abteilung aßen wir den Kuchen, den ich mitgebracht hatte; die beiden jungen Herren steckten sich eine Zigarre an, und je schöner die Musik wurde, um so näher rückten sich der Student und Bergfeldtens Auguste. Ich sagte gar nichts. weiter und bemerkte nur, als die Kapelle in einem sehr zu Gemüte sprechenden Potpourri die Melodie: »Ach, wenn du wärst mein eigen« spielte, daß die zwei Hand in Hand dasaßen und sich anschmachteten.
Endlich war das Konzert aus; mein Karl und Herr Bergfeldt erwarteten uns auf dem Flur, und wir gingen in ein Restaurant, wo wir ein Separatzimmer nahmen, um gemütlich beisammen zu sein. Mein Karl hatte Herrn Bergfeldt erzählt, woher ich meinen neuen Hut hätte, und er gratulierte mir und sagte, nun gehöre ich auch zu den deutschen Schriftstellerinnen, worauf seine Frau sagte – es war ja nur der Neid über den Hut, der sie reden hieß –, Damen, welche am Schreibtisch säßen, kümmerten sich nicht viel um den Hausstand und die Familie. – »So?« erwiderte ich. »Jedenfalls kümmere ich mich mehr um meine Töchter als Sie sich um die Ihrige, ich würde nie leiden, daß meine Älteste eine Liebschaft mit einem Studenten anfinge wie Ihre Auguste.«
– Na, das Wort fuhr denn dazwischen wie eine Bombe. – »Was ist das?« rief Herr Bergfeldt, »Herr Weigelt, ich will nicht hoffen – – –« »O Gott, Papa!« rief Auguste. – »Franz meint es aufrichtig,« sagte die Bergfeldt. – »Welcher Franz?« fragte Herr Bergfeldt heftig. – »Nun, Herr Weigelt,« erwiderte sie, »er liebt Auguste treu und innig...«
»Ich bitte Sie um ein Wort,« wandte sich Herr Bergfeldt an den jungen Studenten, der aufstand, und dessen Aussehen wurde wie konfiszierte Milch. Du mein Gott, wie er zitterte! Wie so eine neumodische elektrische Klingel. Er konnte einen wirklich dauern.
»Was sind Sie?« fragte Herr Bergfeldt.
»Student der Rechte.« – »Wo haben Sie meine Tochter kennengelernt?« – »Bei Bilse.« – »Und sie lieben sich so sehr!« rief die Mutter. – »Ach ja, Papa!« weinte Auguste. – »Aber sie sind doch noch zu jung zum Heiraten, und auf weite Aussichten hin gibt ein Vater seine Tochter nicht.« – »O Papa, du brichst mir das Herz,« schluchzte Auguste, »Franz ist so gut.« – »Willst du unser Kind unglücklich machen?« fragte die Mutter. – Der Student stand vor Herrn Bergfeldt wie ein armer Sünder im Verhör und konnte kein Wort hervorbringen. – »Werden Sie für das Glück meines Kindes sorgen?« wandte sich Herr Bergfeldt an ihn. »Wollen Sie mir versprechen, fleißig zu sein, Ihre Examina zu machen, solide zu leben und mein Kind – meine Älteste – meine Erstgeborene – –.« Hier konnte er nicht weiter. Auguste war ganz aufgelöst in Tränen. Und als die Mutter nun rasch die Hände der beiden jungen Leute ineinanderlegte und sagte: »Ich segne euch, meine Kinder,« da fingen meine beiden ebenfalls an. Es war auch zu rührend, denn ich selbst hatte Tränen in den Augen; aber im stillen mußte ich mir doch sagen, daß die Partie mindestens übereilt war. Er hat sein Brot nicht...und sie mit den spitzen Ellbogen! Er wird sich wundern, wenn er die zu sehen bekommt.
Obgleich die Bergfeldten nicht artig gegen mich gewesen war, so gratulierte ich ihr doch und sagte, ich hoffte, daß sie nie bereuen möge, ihr Kind so früh mit einem so sehr jungen Mann verlobt zu haben. Daß er jung war, sah man ja auf den ersten Blick an den Finnen im Gesicht und den paar Bartstoppeln; ich hätte ihn nicht zum Schwiegersohn haben mögen, denn etwas geb ich stets auf das Äußere.
So feierten wir denn die Verlobung in aller Stille und versprachen auch, keinen Ton darüber zu reden, bis der Bräutigam sein Assessorexamen gemacht haben würde. Als wenn eine Verlobung verschwiegen bleiben könnte! Am nächsten Tag weiß es die Waschfrau, und in einer Woche wissen es alle Bekannten, das kenne ich aus Erfahrung, weil es mir selbst so ging, als ich mit meinem Karl verlobt war und Vater die Sache noch geheim halten wollte. Mutter konnte nicht reinen Mund halten. Herr Bergfeldt war schweigsamer als gewöhnlich und drehte in einem fort Brotkügelchen zwischen den Fingern, während sie, die Bergfeldten, sich ein möglichst wonnestrahlendes Aussehen zu geben versuchte. Nun, ich will ja auch nicht leugnen, daß eine frisch verlobte Tochter das Mutterherz mit Stolz und Genugtuung erfüllen darf, aber doch nur dann, wenn man mit dem Bräutigam einigen Staat machen kann und er statt an den Haaren mit den sanften Banden der Liebe herbeigezogen ist.
Herrn Bergfeldts Einsilbigkeit war schuld daran, daß wir die Sitzung nicht zu lange ausdehnten. Er berappte alles, auch was wir gehabt hatten, er war also gewissermaßen nobel, und das machte einen guten Eindruck. Auf dem Heimwege fragte ich meinen Karl, ob er nicht auch bemerkt hätte, daß der Bräutigam, so wie man bei uns in der Landsberger Straße zu sagen pflegt, ein dämliches Gesicht gemacht hätte, als wenn ihm die ganze Verlobung ein bißchen überrascht gekommen wäre? Karl meinte, der junge Mann wäre eine Padde (er drückt sich mitunter etwas familiär aus, mein guter Karl), sonst hätte er sich nicht so überrumpeln lassen, denn, genau besehen, wäre die Mutter doch nur die Anstifterin von der Verlobung gewesen, die ginge nicht wegen der Musik zu Bilse, sondern nur, um ihre Tochter sehen zu lassen. Er fügte noch hinzu, daß es ihm unangenehm sein würde, wenn ich ohne ihn mit den Kindern ausginge.
Hierauf erwiderte ich, daß er sich auf mich verlassen könne, und ich schon dafür sorgen würde, daß unsere Kinder solche Partien nicht machten, und ich schon verstände, junge Leute ohne Aussichten zu verscheuchen. So gab denn ein Wort das andere, und es wurde auch nicht eher Friede, als bis Karl schwieg. Das tut er immer, wenn wir nicht egaler Meinung sind, und ich ärgere mich um so mehr, weil ich dann nie weiß, was er im stillen denkt. Es ist eben schwer, mit den Männern umzugehen.
Als wir zu Hause waren, fragte Betti, wann wir wieder nach dem Konzerthaus gehen wollten, worauf Papa sagte, das hätte noch lange Zeit. Betti machte einen schiefen Mund und stotterte, sie hätte Bergfeldtens Emil aber versprochen, am nächsten Donnerstag wieder bei Bilse zu sein.
Der Schreck, den ich bekam, ich danke! Nun aber ging ich ins Geschirr, und sowohl mein Mann als die Kinder kriegten ihr Teil. Mein Karl, weil er nicht gleich mitgekommen war, Betti, weil sie mit dem Emil sich verabredet hatte, und Emmi, weil sie doch hätte sehen müssen, daß Emil und Betti miteinander redeten. Es war ungemütlich, und der Tag, der so schön anfing, endete mit Kummer und Verdruß.
Als ich mit meinem Karl allein war, sagte ich: »Wir wollen auf die Mädchen achtgeben, solche Verlobungen, wie die heute bei Bergfeldtens, können doch uns nicht passen!« – Karl meinte, wenn die Mütter nur vernünftig wären, könnten keine Dummheiten passieren, selbst wenn die jungen Leute noch so liebenswürdig und die Musik noch so sentimental sei. Ich möchte nur wissen, was Männer von solchen Sachen verstehen?
In zwei Jahren kann Bergfeldtens Emil vielleicht bereits Assessor sein, und Betti ist denn doch zehnmal hübscher als die spitzknochige Auguste, die nun schon Braut ist. Und was die Musik anbelangt, so spielen sie bei Bilse wirklich ausgezeichnet, nur der Paukenschläger haut auf sein Instrument, als sollte es entzwei werden und wollte nicht. Warum soll man nicht öfter ins Konzerthaus gehen? Auch läßt sich nicht leugnen, daß Emil ein schmucker Mensch ist und namentlich einen blendenden Vizefeldwebel abgeben würde. Vielleicht sogar Leutnant.
Es trat eine lange Pause ein. Mittlerweile war der Sommer des Jahres 1879 herbeigekommen, an den der Berliner mit Freude zurückdenken wird, denn die Berliner Industrie hatte ein Festtagsgewand angezogen und hielt täglich großen Empfang auf der Gewerbeausstellung ab, für die in der Nähe des Lehrter Bahnhofes ein großes Gebäude errichtet worden war, das ein hübscher Park mit Anlagen, Wasserkünsten und freundlichen Pavillons aller Art umgab.
Vor der Ausstellung war dieser Platz eine kleine Privatsandwüste, ein unangenehmes Terrain, auf dem sich selbst das Gras zu wachsen weigerte. Und nun hatte man einen Garten daraus gemacht, aber ohne Zauberei, nur durch Arbeit und das erforderliche Kleingeld. Schade, daß wir nicht auch in fremden Weltteilen den nötigen Grund und Boden haben, um deutscher Kultur und Industrie Heimstätten zu bereiten... es sollten schon prächtige Plätze werden.
In dem Ausstellungspark standen damals bereits die Bogen der Stadtbahn, über welche die Züge noch nicht hinwegsausten in die weite Welt hinein, aber die großen Gewölbe wurden als Ausstellungsräume benutzt, und eins derselben war sogar in eine altdeutsche Weinstube verwandelt worden, denn das Antike fing gerade an, Mode zu werden. Mit einigen Fenstern von grünem Glase und einem Topf voll brauner Farbe kann man jedes Lokal ins Altdeutsche übersetzen.
Industrie und Gewerbe gaben ein Fest, das ganz Berlin mitfeierte, und gar bald konnte der millionste Besucher der Ausstellung begrüßt und vor den Apparat des Photographen gesetzt werden, damit sein Bild der dankbaren Nachwelt erhalten bleibe. Die Berühmtheit ist eben ein sonderbares Ding. Einige machen ihr ganzes Leben lang vergebens Jagd darauf, anderen wird sie zuteil, ohne daß sie eine Ahnung davon haben. Unvermutetes Glück soll, wie man sagt, das reinste sein.
Unter den neunhundertneunundneunzigtausend Besuchern der Ausstellung, die vor dem millionsten den Drehzähler passierten, befand sich auch die Familie Buchholz, wie wir aus einem Schreiben der Frau Wilhelmine erfahren, das gleichzeitig über den Grund ihres langen Schweigens Aufschluß gibt. Sie ist vielleicht die einzige, deren Erinnerung an die Ausstellung keine ungetrübte genannt werden kann. Es gibt Leute, die dem Verdruß auf halbem Wege entgegengehen, anstatt ihm auszuweichen; dafür, daß unsere Freundin ihn auch auf der Ausstellung finden sollte, ist bei genauer Prüfung der Verhältnisse das Ausstellungskomitee nicht verantwortlich zu machen.
Auf der Ausstellung
Sie haben gewiß schon oft gedacht, wie mag es wohl zugehen, daß die Buchholzen nichts von sich hören läßt, sie greift doch sonst hin und wieder zur Feder. Aber können Sie schreiben, wenn Sie ein solches Gallenfieber bekommen, daß Sie einen Doktor gebrauchen müssen und sich dann später beim Gardinenaufstecken eine Nadel in den Finger rennen, als hätte man kein Gefühl und keine Nerven? – Nein, dann schreiben Sie auch nicht.
Nun fragen Sie sicher, wie ein Wesen von meiner Sanftmut und Geduld mit einem Gallenfieber behaftet werden kann? Ich möchte jedoch jemand sehen, der ruhig bliebe, wenn ihm passiert, was mir geschehen ist.
Und was hatte ich getan? Nichts, reinweg gar nichts. Ich hatte nur geäußert, daß die Bergfeldten dem jungen Studenten ihre Auguste aufgehängt hätte, und diese harmlose Äußerung war ihr hinterbracht worden. Ich dachte mir weiter gar nichts Böses dabei, denn es war die unverfälschte Wahrheit. Dies hat die Bergfeldten jedoch schrecklich übelgenommen, und so schrieb sie mir denn einen empörenden Brief, in dem sie sagte, daß, wenn sie wollte, sie von meinem Karl Geschichten erzählen könnte, worüber die Leute sich sehr amüsieren würden. Ich zeigte meinem Manne den Brief und sagte: »Karl, lies, was diese Person geschrieben hat, und dann geh gleich zum Staatsanwalt und verklage sie.«
Mein Karl las den Brief und antwortete zögernd, daß er keinen Grund zum Einschreiten darin finden könnte. – Mir war, als rührte mich der Schlag. Ich sank wie vernichtet auf das gute Sofa und rief: »Also du fühlst dich schuldig, deine Vergangenheit ist eine verschleierte, dies elende Weib hat recht. Oh, Karl!« – Er suchte sich zu verteidigen, indem er behauptete, die Bergfeldten habe nur aus Rache eine sinnlose Bemerkung hinausgeschleudert, allein dies beruhigte mich nur halb; denn wenn sie doch etwas wüßte? Und wäre Karl ganz rein in seinem Gewissen, so hätte er ihr das Gericht auf den Hals geschickt. Ich merkte ihm deutlich an, daß er verlegen war. In demselben Augenblick kamen die Kinder herein und brachten den großen Schmortopf und die Waschleine, die ich der Bergfeldten geliehen hatte und die sie nun mit spöttischen Bemerkungen retour schickte. Außerdem ließ sie sagen, der Henkel an dem Topf wäre schon entzwei gewesen, als sie ihn von mir bekommen hätte. Das war aber eine grobe Unwahrheit, und diese Malice warf mich nun ganz danieder.
So kam ich zu meinem Gallenfieber. Kann die Bergfeldten es vor ihrem Schöpfer verantworten, daß sie so an mir handelte, so ist es gut, ich hoffe jedoch nicht, daß ich einmal unter vier Augen mit ihr zusammentreffe. Dann sage ich ihr, wie ich es meine, denn in meinem Hausstande ist alles ganz und proper!
Als ich mich allmählich wieder erholte und mein Teint nicht mehr so abscheulich gelb war, wie ich ihn mir herangeärgert hatte, sagte Karl: »Wilhelmine, wie wäre es, wenn du dich etwas zerstreutest? Ich denke, wir gehen alle zusammen auf die Ausstellung, du und ich und die Kinder; es soll mir auf ein paar Groschen nicht ankommen, deine Genesung zu feiern.« –Im ersten Augenblick empfand ich große Freude über diesen Vorschlag, dann aber mußte ich denken, ob Karls liebevolles Benehmen gegen mich nicht etwa aus einem geheimen Schuldbewußtsein hervorgegangen sein könnte, das durch den Brief der Bergfeldten neu aufgefrischt worden war? Ich sagte jedoch keine Sterbenssilbe von dem, was ich fühlte, sondern ging bereitwillig auf seine Wünsche ein. Die Kinder hatten gerade ihre neuen Sommerkostüme bekommen, und da Karl mir sowieso einen modernen japanesischen Schal versprochen hatte, war der Ausführung seines Planes ja nichts im Wege. Hätte ich aber gewußt, was mir bevorstand, so wäre ich sicher zu Hause geblieben.
Ich will Sie nicht mit der Beschreibung der Ausstellung aufhalten, denn dazu gehört am Ende doch wohl eine Fachfeder, nur das muß ich bemerken, daß der Eindruck des Ganzen sowohl auf mich als auf die Kinder ein überwältigender war. Karl, der schon öfter draußen gewesen, kam mir bereits etwas abgehärtet gegen die Schönheiten im allgemeinen und im einzelnen vor.
Weil es an diesem Tage sehr heiß war, schlug Karl erst eine kleine Herzstärkung im Moabiter Bierausschank vor, und wir sagten denn auch nicht nein. Karl ging gleich nach dem dicken Bayern hin, der aus dem großen Riesenfaß zapfte, um das Bier selbst zu holen. Ich dachte, er ist doch galant und nett, mein Karl, ein wirklich ausgezeichneter Gatte, als mein Blick auf die Münchner Kellnerin in ihrem bunten Maskeradenanzug fiel, die ihm Kleingeld herausgab und ihn dabei sehr freundlich anlächelte. Dies Lächeln gab mir einen Stich durch das Herz, aber ich blieb ruhig. Im stillen nahm ich mir jedoch vor, Karl nie wieder allein auf die Ausstellung gehen zu lassen. Dies gelobte ich fest und heilig.
Daß das Bier mir unter solchen Umständen wie Wermut schmeckte, ist natürlich kein Wunder. Ich konnte es nicht austrinken und gab es daher den Kindern, damit es nicht umkommen sollte.
Karl fragte: »Schmeckt dir das Bier nicht, Wilhelmine? Wollen wir lieber einen leichteren Stoff versuchen?« – »Es ist mir hier zu viel Sonne,« entgegnete ich mit einem Blick auf die Münchnerin, aber Karl verstand mich nicht oder wollte mich nicht verstehen. »Gut,« sagte er, »dann gehen wir zum Böhmischen Brauhaus.« – Ich war froh fortzukommen, und wir siedelten ins nasse Dreieck nach dem Böhmischen Ausschank über. Hier trafen wir zu unserer großen Freude nicht nur Onkel Fritz, sondern auch den Doktor Wrenzchen, der mich behandelte, als der Brief von der Bergfeldten mich auf das Siechbett geworfen hatte. Das Wiedersehen war ein sehr vergnügtes, denn ein Doktor ist für einen Patienten immer so eine Art von übernatürlichem Wesen und ein wahrer Engel des Trostes, namentlich wenn er milde und gut mit einem umgeht und den leidenden Mitmenschen ab und zu durch einen niedlichen kleinen Scherz aufzuheitern versteht. Nun, wir kamen denn auch bald in ein sehr angenehmes Gespräch. Nur mein Karl und Onkel Fritz fingen einen Streit darüber an, welches das beste Bier sei, weil mein Mann darauf hinwies, daß mir das Böhmische besser zu munden schien als das Moabiter. Aber kannte er die innerlichen Gründe?
Der eine hatte diese Meinung und der andere jene, und da sie sich nicht einigen konnten, war Onkel Fritz so gottlos, eine Bierwette zu proponieren, auf die mein Karl trotz meines stark betonten Hustens einging und wobei der Doktor durchschlug. Als ich jedoch bemerkte, es sei nachgerade Zeit, etwas von der Ausstellung zu sehen, erklärte Karl, daß er mit Fritz Bier probieren müsse, um die Wette zum Austrag zu bringen, und ich daher besser mit den Kindern allein ginge. Um fünf Uhr wollte er und Onkel Fritz uns in der altdeutschen Weinstube treffen. Der Doktor bot uns seine Begleitung an, da er wegen seiner Völligkeit gerade eine Marienbader Hauskur durchmachte und deshalb, wie er sich scherzhaft ausdrückte, auf die Bierreise Verzicht leisten müßte. Mein Mann machte ein so unschuldiges Gesicht, als wäre er erst gestern konfirmiert worden.
Ich durchschaute meinen Karl jedoch, aber ich faßte mich, denn ich wollte nicht, daß der Doktor sehen sollte, wie unser eheliches Glück Risse bekam und sich dem Einsturz näherte, da Betti sich für ihn interessiert und Bergfeldts Emil ein für allemal keine Partie für sie ist. Der Brief und der zerbrochene Schmortopf trennen uns für ewig von dieser Familie. Überdies ist ein Doktor in der Verwandtschaft stets sehr zweckmäßig, da er doch seinen Angehörigen nicht gleich jede Kleinigkeit auf die Rechnung setzen kann. Ich bat meinen Mann nur noch: »Karl, bleibe bei einer Sorte, du weißt, vieles durcheinander bekommt dir nicht!«
Der Doktor führte uns nun durch die Ausstellung. Es war wirklich prachtvoll, wie er alles zu erklären wußte und uns belehrte. Betti kam aus dem Erstaunen gar nicht heraus, so daß ich ihr mehr als einmal zuflüstern mußte: »Sperr' doch den Mund nicht so auf, es sieht zu einfältig aus.« – Bei den Zimmereinrichtungen bemerkte ich, daß der Mittelstand sich so etwas Kostbares wohl nicht leisten könne, worauf er sagte: »Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar.« – »Hörst du, Betti,« rief ich, »wie treffliche Anschauungen der Doktor vom Leben hat?« Aber, anstatt daß sie nun eine geistreiche Gegenbemerkung gemacht hätte, da sie doch auf die Gartenlaube abonniert ist, klappte sie plötzlich mit einem hörbaren Ruck den Mund zu, den sie wieder aufstehen gehabt hatte, weil sie erschrak und glaubte, ich wollte ihr abermals eine mütterliche Ermahnung zuteil werden lassen. »Betti ist ganz hingerissen von diesen Ergebnissen des menschlichen Geistes auf dem Gebiete der Industrie und des Gewerbes,« sagte ich gewandt, »sie überhörte deshalb Ihren wohlmeinenden Ausspruch, lieber Doktor!«
»O bitte, das macht nichts,« sagte dieser liebenswürdig wie immer, »das ist ja nur äußerlich.« – Ich tippte ihm leicht mit dem Fächer, der gleichzeitig als Sonnenschirm zu gebrauchen ist, auf den Arm und erwiderte: »Ganz recht, die Hauptsache beruht in der gleichen Stimmung der Seelen.« – Hierauf sah er mich ein bißchen schief an und plinkerte mit dem einen Auge, und schon wollte ich ihm sagen, was Betti mitbekommt und daß wir noch eine Erbtante in Bützow wohnen haben, als Emmi mit einem Male laut dazwischen rief: »O seh mal, Mama, wie blank die Badewanne ist, und dabei läuft das Wasser ordentlich!«
Obgleich mein eigen Fleisch und Blut, hätte ich dem Kinde doch in diesem Moment etwas antun können, da sie mit ihrem dummen Ausruf plötzlich ein Gespräch unterbrach, von dem das Glück ihrer Schwester abhing. Wie schön wäre es gewesen, wenn der Doktor und Betti als heimlich Verlobte die Ausstellung verlassen hätten, und wie würde die Bergfeldten sich geärgert haben! Denn wenn man in die eine Waagschale einen Doktor mit Praxis und in die andere einen hungrigen Studenten legt, so wird der letztere doch entschieden zu leicht befunden. Jetzt war das Gespräch aber einmal abgerissen und nicht gut wieder anzuknüpfen, denn angesichts einer Badewanne lassen sich Herzensangelegenheiten nicht erörtern, wenigstens widerstrebt das meinem Zartgefühl. Die schöne Konjunktur war richtig verpaßt; ich kann doch nicht wieder krank werden, bloß um den Doktor bei uns zu sehen, und von alleine kommt er nicht. Nun, ich rechnete noch auf den Nachhauseweg.
Der Doktor sah auf die Uhr und sagte, es sei gerade Zeit, die Weinstube aufzusuchen, wo wir mit meinem Mann und Onkel Fritz zusammentreffen wollten, und so gingen wir denn. Der Badewanne warf ich aber noch einen Abschiedsblick zu, von dem sie eine Beule bekommen mußte, wenn sie einigermaßen unsolide gearbeitet war. Diese Wanne ist gewissermaßen das Grab von dem Glück meiner Ältesten.
Wir mußten nun die Abteilung der Spirituosen passieren, wo die Aussteller uns auf das dringendste zum Gratisprobieren einluden, und wirklich verleitete uns der Doktor, einen kleinen Damenlikör zu nehmen. Grad als ich mich lobend über diese Annehmlichkeit aussprechen wollte, sehe ich meinen Karl, wie er sich einschenken läßt und verschiedene Arten von Branntwein probiert. Ich gehe auf ihn zu. »Karl,« sagte ich, »heißt das auf uns warten?« – »Na ob,« sagte er und lachte, »das Moabiter ist doch das Beste.« – »Du warst wieder dort?« – »Gewiß, mein Engel!« sagte er und kniff mich in die Backe! – »Karl,« rief ich strenge, »du hast zu viel durcheinander getrunken!« – »Noch immer nicht genug!« antwortete er vergnügt. – »Wo ist Onkel Fritz?« – »Der ist ein Schwachmatikus, der wollte nicht mal an den Likör heran; der kann sich meinetwegen abmalen lassen.«
»Doktor,« sagte ich, »nehmen Sie meinen Mann unter den Arm, damit die Kinder nichts merken, er hat nun einmal einen schwachen Magen.« – »Das ist ja nur äußerlich,« sagte der Doktor und faßte meinen Karl unter und zog ihn fort.
Es war durchaus liebenswürdig vom Doktor, daß er sich soviel Mühe mit meinem Karl gab und seine Aufmerksamkeit auf die Ausstellungsgegenstände lenkte, obgleich Karl immer wieder nach dem Likör wollte, weil er noch nicht alle Sorten gekostet hätte. Der Doktor hielt ihn aber fest, und da wir gerade in der chirurgischen Abteilung waren, die unmittelbar beim Likör lag, so erklärte er ihm, wozu alle die Messer und Sägen gebraucht würden, die Kehlkopfpinsel und Sonden und zeigte ihm die künstlichen Beine und Arme. »Wieviel Elend gibt es doch in der Welt,« sagte mein Karl, »die unglücklichen Menschen! Oh, Kinder, dankt eurem Schöpfer, daß ihr gesunde Gliedmaßen habt. Oh, die arme leidende Menschheit und so viel Elend!« Weiter konnte er nicht reden, denn in diesem Augenblicke spielte jemand nebenan auf der Orgel »Das ist der Tag des Herrn!« Nun war es alle. Die Rührung überkam meinen Karl so stark, daß er laut zu schluchzen anfing und immer wieder dazwischen rief: »Kinder, dankt eurem Schöpfer; ja, das müssen wir alle.« Und so knickte er auf einen Stuhl und weinte bitterlich.
Als die Kinder dies hörten und sahen, ward ihnen angst und bange. »O Gott, was fehlt Papa?« schrie Emmi... »O Papa, mein guter Papa,« rief Betti. Die Leute liefen bereits zusammen und bildeten einen Kreis, und unter diesen Leuten – ich denke, der Himmel soll einbrechen – waren die Bergfeldten und Auguste mit ihrem mageren Lulatsch von Studenten. – »Kinder,« rief ich, »stellt euch vor Vatern, dies ist kein Anblick für Menschen ohne Gemüt und Bildung!«
»Ich bitte Sie, meine Herrschaften, zerstreuen Sie sich,« sagte der Doktor, »der Herr ist von der großen Hitze ein wenig unwohl geworden; er wird sich bald wieder erholen.« Die Leute gingen nun auch, nur die Bergfeldten blieb noch stehen. »Hitze?« rief sie ungläubig, »wird wohl nichts Ordentliches zu essen bekommen haben, denn wenn die Frau schriftstellert, muß der Mann natürlich darben. Kommt, Auguste und Franz, wir haben heute abend junges Huhn und Stangenspargel.« – Ich war sprachlos. Bergfeldtens und Spargel! Lieber Gott, am ersten Pfingsttag vielleicht ein paar grünköpfige in der Suppe, aber sonst doch nicht! Spargel?! Den großen Klumpen Zyankali, den wir vorher bewundert hatten, weil man so viele Menschen damit vergiften kann, als im Berliner und Charlottenburger Adreßbuch zusammen stehen, Rixdorf eingerechnet, hätte ich ihr in den Hals stopfen mögen, bis sie daran erstickte. Dabei spielte die Orgel immerzu, und mein Karl jammerte über das Elend der leidenden Menschheit. – –
Als er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, fuhr ich mit ihm nach Hause; die Kinder blieben noch mit dem Doktor zum Konzert. Erst wollte ich sein Anerbieten, Ritterdienste bei meinen beiden zu tun, nicht annehmen, aber ich gab zuletzt nach, zumal es mir vorkam, als wenn der Doktor mir mit dem Auge vielsagend zuplinkerte.
Zu Hause nahm ich meinen Karl heftig ins Gebet, und er wurde auch ganz zerknirscht. »Geliebte Wilhelmine, ich rühre nie wieder einen Likör an. « – »Und läßt dich von Fritz nicht wieder zum vielen Biertrinken verführen?« – »Nein.« – »Und kokettierst nicht wieder mit der bayrischen Kellnerin?« – »Aber Minchen.« – »Überhaupt mit keiner Kellnerin?« – »Ich bitte dich!« – »Und gehst auf die Polizei und verklagst die Bergfeldten wegen gröblicher Injurien?« – »Alles, Minchen, aber nur das nicht!« – »Du läßt also deine dir angetraute Gattin von dieser Klapperschlange beleidigen?« – »Ich kann und darf sie nicht verklagen!« – »Hier liegt etwas vor. Karl, gestehe, oder du setzest mein Glück und das deiner Kinder aufs Spiel. Was weiß die Bergfeldten von dir?«
Als ich ihn mürbe genug hatte, beichtete er. In ganz früheren Jahren hatte er einmal mit Bergfeldt, als sie noch ledig und jugendlich überwallend waren, Geburtstag gefeiert und dann nachts mit einem Nachtwächter krakeelt, der sie alle beide auf die Wache brachte, wo sie leider, weil es am Sonnabend spät gewesen war, bis zum Montag verweilen mußten. Dies wußte die Bergfeldten, und hiermit glaubte sie Unfrieden stiften zu können. »Das hat nichts auf sich, Karl,« sagte ich, »denn es gehört doch gewissermaßen Mut dazu, mit einem Nachtwächter anzufangen, und Mut hast du immer gehabt. Nur das viele Durcheinander kannst du nicht vertragen!« Er versprach, von nun an vorsichtig zu sein, und so wie ich ihn kenne, wird er auch Wort halten.
Ich machte ihm nun eine gute Tasse Kaffee und nahm mir vor, nicht nur alles zu vergessen, sondern recht liebevoll gegen ihn zu sein, denn er war doch nur der unschuldig Verleitete. Er lobte den Kaffee auch sehr und meinte, daß er ihm guttun werde, denn er sei wirklich etwas leidend. Als ich hierauf mitleidsvoll zu ihm trat und sein Dulderhaupt sanft streicheln wollte, duckte er sich rasch, als wenn er sich vor mir fürchtete. »Karl,« rief ich, »traust du mir so etwas zu? Glaubst du, ich könnte meine Hand gegen dich erheben?« –»Es sah beinahe so aus,« antwortete er. »Nimm's nicht übel, Minchen, meine Nerven haben etwas gelitten.« – »Von dem Bier und dem Likör,« rief ich. – »Schon möglich!« entgegnete er, »aber tu mir den Gefallen und sprich nicht so viel mehr, es greift mich wirklich an.« –
Die Kinder kamen erst zurück, als mein Karl schon im Bette lag, das er diesmal früher aufsuchte als sonst gewöhnlich.
»Nun?« fragte ich, »habt ihr euch noch gut amüsiert?« – »Ja,« sagte Emmi, »und der Doktor plinkerte immer so mit dem einen Auge.«
»Tat er das wirklich, Betti, mein Herzenskind?«
»Ja, Mama, den ganzen Abend.«
»Und was sagte er?« fragte ich gespannt.
»Er sagte, er würde wohl ein Gerstenkorn bekommen,« rief Emmi, »er hätte es schon am Nachmittage gespürt.«
»Nun ja,« sagte ich, »das muß er als Doktor am besten wissen.« – Hinterher erfuhr ich noch, daß es natürlich Onkel Fritz gewesen ist, der die Orgel spielte. Ich habe ihn darüber aber nicht schlecht zur Rede gestellt.
Herr Buchholz hat Zahnschmerzen
Vor acht Tagen feierten wir unsern Hochzeitstag – es war der schauderhafteste, den ich je erlebt habe. Mir ist dieser Tag sonst das schönste Fest im Jahre, mehr noch als Ostern und Pfingsten zusammen, denn es ist mein Tag, und mein Karl ist der Kalenderheilige dazu. Man könnte fragen, ob der Tag nicht auch meinem Karl gehört? Gewiß auch das, aber weiß ich, ob ich ihn ebenso glücklich gemacht habe als er mich? Ich will es hoffen, aber ich kann mir nicht denken, daß je eine Menschenseele so glücklich sein könnte als ich an dem Tage, als er mir seinen Namen gab und vor dem lieben Gott und den vielen Menschen laut und offen bekannte, daß er mich liebte. Ich konnte das Ja kaum über die Lippen bringen, weil ich mich vor den vielen Leuten genierte, und doch hätte ich laut aufjubeln mögen in all dem Glück.
«Wenn nun unser Hochzeitstag herankommt, dann wird jener erste Tag wieder lebendig in meiner Erinnerung, als wäre es gestern, und wenn mein Karl mich stillschweigend umarmt und mir einen innigen Kuß gibt, dann ist mir, als sei er noch mein Bräutigam, mit dem Myrtenstrauße im Knopfloch, der weißen Binde und den fein frisierten Haaren, obgleich er jetzt nur den Schlafrock anhat und auf dem Kopfe frühmorgens ein bißchen wuschig aussieht.
Am Abend haben wir stets eine kleine Gesellschaft, gute Bekannte und Freunde, und auf den Tisch kommt auch etwas Ordentliches. Mein Karl ist kein Kostverächter, und mich freut es, wenn es ihm schmeckt. Diesmal aber rührte er fast nichts an, und das machte mich besorgt.
»Fehlt dir was, mein Karl?« fragte ich.
»O nein,« antwortete er, aber ich merkte doch, daß das »O« so lang herauskam wie die halbe Friedrichstraße. Ich drang weiter in ihn, allein er verwies mir jede Frage und wurde sozusagen etwas unangenehm gegen mich.
Gegen halb zwei Uhr entfernten sich die Gäste. Als wir nun unter uns waren, konnte ich doch nicht umhin, meinem Karl einige Vorwürfe über sein Betragen zu machen, worauf er sagte, daß er ein wenig Zahnschmerzen habe und nicht zum Vergnügtsein aufgelegt sei. Ich schlug ihm vor, ein Zahntuch umzubinden, aber er lachte mich aus und meinte, die Schmerzen seien nicht von Belang und würden sich schon wieder geben.
Als ich darauf in die Küche ging, um unserer Aufwaschfrau, die immer bei festlichen Gelegenheiten hilft, ihren Tagelohn zu geben, ließ ich auch ein Wort darüber fallen, daß mein Mann leidend sei, worauf die alte Grunert – so heißt die Aufwaschfrau nämlich – sagte, daß sie ein ausgezeichnetes Sympathiemittel wüßte, das schon sehr vielen Leuten geholfen habe.
Warum sollte man nicht einmal einen Versuch machen, da Sympathie so unendlich billig ist?
Mein Karl höhnte anfangs, als ich ihm von der Grunerten sagte, jedoch ich redete ihm zu, da Sympathie keinen Schaden tun könnte, und so gestattete er denn, daß die Alte ihr Mittel anwendete.
Die Grunerten wußte, daß im Garten ein Holunderbusch wuchs, der zu ihrem Vorhaben notwendig war. Stillschweigend ging sie hinunter, schnitt einen Span aus dem Baum und bohrte meinem Karl damit so lange an dem kranken Zahn herum, bis er blutete. – Alles stillschweigend. – Dann ging sie wieder zu dem Baum, band den Span auf derselben Stelle mit einem leinenen Faden fest und fragte, ob die Schmerzen weg seien.
»Was sollten sie wohl?« rief mein Karl ärgerlich. »Sie sind nach dem Bohren nur noch schlimmer geworden!« – Die Grunerten sagte, er solle nur warten, bis der Span angewachsen sei, dann würde der Schmerz wie weggeblasen sein, wünschte gute Besserung und ging nach Hause.
Mein Karl schalt sehr über den Unsinn, zumal die Pein nach der Sympathie immer heftiger ward.
Ich riet ihm, warmes Wasser in den Mund zu nehmen, was ja auch sehr gut ist, und ging nach der Küche, um Wasser zu kochen.
»Gott, Madame,« sagte die Köchin zu mir. »Wenn ich Zahnschmerzen habe, nehme ich Senfspiritus und reibe die Backe damit ein. Es beißt wohl ein bißchen, aber es hilft!« Zum Glück hatte sie noch einen Rest, den ich dankend annahm und bei meinem Karl in Anwendung brachte.