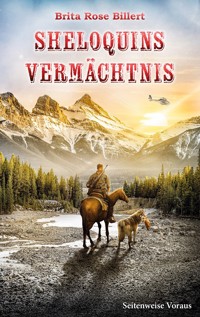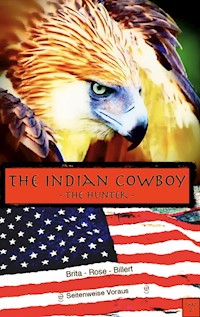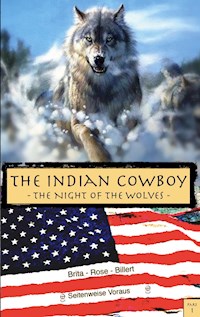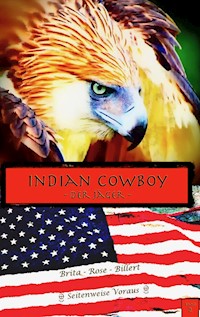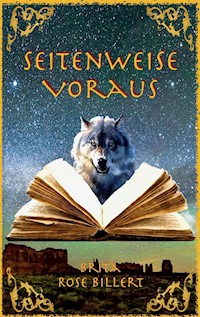Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Blue McKanzie, ein zwölfjähriger Großstadtjunge, schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein durch die Straßen Chicagos. Sein Vater, der die Familie verlassen hatte, als sein Sohn fünf war, lässt den Jungen auf Anweisung des Jugendamtes von der Polizei einfangen und tritt das Sorgerecht an Wayton Stone Horse ab, den Großvater des Jungen. Doch Blue hat ganz andere Lebensvorstellungen und ist nicht begeistert, als er feststellt, dass er zur Hälfte Indianer ist und nun auf der Pine Ridge Indianerreservation leben soll. Nur seiner Schwester Bonnie zuliebe erträgt er die anfänglichen Schikanen und unterdrückt den Impuls, einfach wieder abzuhauen. Und dann sind da noch die Pferde … und Großvater Wayton, der einen eigentümlichen Zauber auf ihn ausübt. Als plötzlich die Pferdeherde der Familie verschwunden ist, muss auch Blue sich bewähren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brita Rose-Billert
Die Farben der Sonne
Die Rückkehr der Steinpferde
Die Farben der Sonne
Die Rückkehr der Steinpferde
Roman
von
Brita Rose-Billert
Impressum
Die Farben der Sonne, Brita Rose-Billert
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2015
e-book ISBN 978-3-941485-43-3
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: readbox, Dortmund
Titelbild: Astrid Gavini
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,
Hohenthann
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbH
Inhalt
Kapitel 1
Blue Light Shadow
Kapitel 2
Oben und unten
Kapitel 3
Die Farben der Sonne
Kapitel 4
Halbblut
Kapitel 5
Steinpferd
Kapitel 6
Einen Schritt weiter
Kapitel 7
Mustangs
Kapitel 8
Der Weg zurück
Kapitel 9
Heimkehrer
Kapitel 10
Großvater erzählt
Kapitel 11
Eine Familie
Kapitel 12
Freunde
Kapitel 13
Neuschnee
www.traumfaenger-verlag.de
Die Handlung ist frei erfunden und jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen und Personen wäre rein zufällig.
In Erinnerung, Liebe und Dankbarkeit an meine Großeltern sowie an alle Großeltern, die sich liebevoll um ihre Enkelkinder kümmern und ihnen ihre Geschichten erzählen.
Kapitel 1
Blue Light Shadow
Die Dämmerung beherrschte die engen Straßenschluchten. Es war weder Tag noch Nacht. Schwarze Wolken hatten sich bedrohlich über den Häuserblöcken der großen Stadt ausgebreitet. Der Donner krachte wie ein Kanonenschuss. Dann prasselte der Regen mit aller Macht auf den Asphalt nieder. Zwei Jungen flüchteten zwischen Mülltonnen, Dreck und Zigarettenkippen in das Kellerloch eines verlassenen Hauses. Der Regen verwandelte die Gasse innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Bach.
„Der Missouri kommt zu uns. Siehst du?”
Sie lachten.
Zusammengekauert, mit angezogenen Knien, saßen sie im Kellerloch und beobachteten die Regentropfen, die mit voller Wucht wieder vom Asphalt prallten. Der eine der beiden Jungen war größer als sein Freund. Sein ebenmäßig braunes Gesicht war etwas kantig und ließ ihn älter erscheinen als seine zwölf Jahre. Das halblange, schwarze Haar glich einem Mopp, der allerdings aus dem Wasser gezogen und ausgeschüttelt worden war. Einige Haarsträhnen klebten über dem Gesicht. Sie reichten über die Nasenspitze bis fast zum Kinn. Das Regenwasser tropfte langsam herab auf die verwaschene Jeans. Der Junge wischte es mit dem Arm zur Seite. Schwarze Augen funkelten sein Gegenüber an. „Du siehst aus wie eine gebadete Maus“, lachte der Junge, den Regen übertönend.
Der andere, etwas kleinere Junge amüsierte sich. „Und du siehst aus wie der Wischmopp meiner Großmutter“, schrie er zurück. Im Gegensatz zu seinem Freund war er blass und zitterte vor Kälte. Auch von seinem Haar tropfte das Wasser. Es war dunkelblond. Beide waren schlank und in etwa gleich alt. Die beiden Freunde trugen jedenfalls die gleichen wasserfesten Turnschuhe mit Gleitverschnürung, wie sie in dieser Altersgruppe eben modern waren. Der Regen prasselte schier unaufhörlich und ließ das Wasser auf der Straße bereits gegen die Kellerfenster drücken.
Es schwemmte Zigarettenkippen und anderen kleinen Unrat am Kellerloch vorbei.
Wenige Minuten später tauchte eine dunkle Gestalt auf und nahm ihnen die Sicht. Der Fremde beugte sich zu den Jungen herab.
„Hallo”, sagte er freundlich.
„Verschwinde!”, fauchte ihn einer der beiden Jungen an.
„Ich suche Schutz vor dem Gewitter”, sagte der alte Mann, der seine Hände auf den Knien abstützte und lächelte.
„Hast du Schiss, alter Mann?”, fragte der erste Junge höhnisch.
„Nein”, antwortete der Alte noch immer freundlich. „Aber habt ihr zwei Angst vor einem alten Mann?”
„Komm schon, Blue. Ist doch Platz genug”, mischte sich nun der andere Junge ein.
Der, der zuerst gesprochen hatte, verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die sagte: Bleib mir bloß vom Leibe. Dann nickte er.
„Okay. Komm rein.”
Der alte Mann bückte sich, kam zu ihnen und setzte sich den beiden Jungen gegenüber auf den Boden. Er lehnte sich an die Wand, während Blue ihn auffällig und misstrauisch musterte. Immerhin war es in der Dämmerung des Kellers noch hell genug, um sein Gegenüber zu erkennen. Der Alte trug eine verwaschene Jeans, die sich an den Nähten aufzulösen drohte und einen grauen Parka, der offen stand. Aus seiner Kleidung lief das Regenwasser und bildete eine Pfütze am Boden. Es gelang Blue nicht, dem Mann in die Augen zu sehen. Als der Mann die Kapuze nach hinten abstreifte und sein graues Haar, welches sorgfältig in zwei Zöpfe geflochten war, zum Vorschein kam, drehte Blue seinen Kopf demonstrativ zum Ausgang und starrte auf die Gasse. Das Gewitter tobte. Ohrenbetäubend krachte der Donner, gefolgt von Blitzen, die sogar kurzzeitig das Kellerloch erhellten. Der Regen prasselte mit unverminderter Wucht. Auf der Straße bildeten sich fortwährend unzählige Blasen, sodass sie nun endgültig wie der Missouri aussah.
Der alte Mann hatte zunächst geschwiegen und die Jungen in seiner eher unauffälligen Weise beobachtet. Dann griff er in das Innere seiner Jackentasche und zauberte zwei Äpfel hervor. In jeder Hand einen, hielt er sie den Jungen hin.
„Vielen Dank, dass ich bleiben darf.”
Zögernd griff der eine Junge nach dem Apfel, nahm ihn und bedankte sich mit einem Kopfnicken. Blue rührte sich nicht aus seiner Starre, als sein Freund genussvoll in den Apfel biss, dass es knackte. Der Alte legte den anderen Apfel vor Blue auf den Boden.
„Vielleicht sollten wir uns die Zeit ein wenig mit einer Geschichte vertreiben”, sagte der Alte schließlich. Der kleinere Junge sah ihn erwartungsvoll an. Blue stöhnte genervt, lehnte sich mit der ganzen Breite seines Rückens an die feuchte, modrige Wand und verschränkte die Arme.
Der Alte begann zu erzählen: „Ich erinnere mich noch genau. Es ist schon lange her, sehr lange. Dunkelheit und Stille lag über dem Wald und um mich herum. Durch die kahlen Kronen der Bäume schimmerte der klare Sternenhimmel. Unter meinen Füßen knirschte bei jedem Schritt der Schnee. Klirrende Kälte ließ jeden meiner Atemzüge zu Rauch werden. Doch ich fror nicht. Zwischen den Bäumen, vor den Schneestürmen geschützt, tauchten sie auf, die Zelte mit ihrem schwachen Lichtschein. Der Neuschnee des letzten Abends hatte sie eingehüllt und verbarg alle Spuren ringsum, so als hätte nie ein Lebewesen den Boden mit den Füßen berührt. Ich ging durch das Dorf und niemand bemerkte mich. Nicht einmal der Junge, der auf seinem Rappen lag und die Pferde bewachte, bemerkte mich. Er hatte sich in eine Büffelfelldecke gehüllt und sah auf. Aber er sah durch mich hindurch, wie es schien. Vor dem letzten Zelt blieb ich stehen und lauschte. Schließlich entschied ich mich, hineinzugehen. Eine alte Frau, die gegenüber des Einganges saß, sah mich an, nickte und winkte mich heran. Neben ihr lag eine junge Frau, die gerade ihr Kind geboren hatte. Die alte Frau durchtrennte die Nabelschnur und schnitt ein Stück davon ab, um es gut für das Kind aufzubewahren. Ich sah die Angst in den Augen der jungen Frau, als sie mich betrachtete und sie schmiegte ihr Kind sanft an sich.
Wo ist dein Mann, fragte ich sie.
Tot, antwortete sie kaum verständlich.
Ich setzte mich zu ihr und betrachtete das Neugeborene. Dein Kind wird leben, sagte ich zu ihr.”
„So ein Blödsinn! Wer glaubt schon solchen Scheiß?”, unterbrach Blue ihn wütend und leise fügte er hinzu: „Alter Spinner.”
„Ein Märchen, mit dem du Kinder beeindrucken kannst”, bemerkte der andere Junge, der inzwischen den Apfel aufgegessen hatte und den Rest des Kerngehäuses mit einer schwungvollen Bewegung hinaus in den Regen feuerte.
„Ihr seid keine Kinder”, stellte der Alte fest.
„Nein. Wir sind Männer und das hier ist die Realität. Wer braucht schon Geschichten!”, antwortete Blue nicht gerade freundlich.
„Gut. Wer lehrt euch?”
„Pff!”, pfiff Blue mehr als genervt durch die Zähne.
„Wo ist euer Zuhause? Wo wohnt ihr?”
Blue drehte den Kopf zu dem alten Mann und kniff die Augen zusammen.
„Die Straße gehört uns. Die Stadt gehört uns.”
„Wo sind eure Eltern?”
„Was geht dich das an?!”, herrschte Blue ihn an und sah dann wieder hinaus.
Der andere Junge zuckte mit den Schultern und bequemte sich zu einer Antwort: „Zwei Querstraßen weiter wohne ich. Vater ist auf Montage. Er baut Brücken über den Missouri. Riesengroße Brücken. Mutter liegt im Wochenbett. Ich habe fünf kleine Geschwister. Sie warten auf mich. Vielleicht bringe ich ihnen etwas zu essen mit.”
„Wie ist dein Name?”
„Gabriel. Wie der Erzengel.” Der Junge grinste.
Der Alte lächelte. „Du glaubst an Gott?”
„Nein. Er liebt mich nicht und deshalb ist er mir scheißegal.”
Der alte Mann schüttelte den Kopf.
„Und was ist mit dir, Blue?”
Blue lächelte spöttisch, als er antwortete: „Gott liebt mich. Er hat mir die ganze Stadt geschenkt. Chicago gehört mir. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche.”
„So? Und wie ist dein richtiger Name?”
„Hab‘s vergessen.”
Der Alte legte den Kopf etwas schräg, hob die Augenbrauen und schien ihn mit seinem Blick durchbohren zu wollen. Er wartete.
„George Washington.”
„Wer hat dich eigentlich Respekt gelehrt?”
„Das Leben.”
„Deinem Vater und deiner Mutter würde das Herz weh tun.”
„Keine Sorge, alter Mann. Mutter ist tot und einen Vater gibt es nicht.”
„Du redest nicht wie ein zwölfjähriger Junge.”
„Stimmt. Ich bin als Mann zur Welt gekommen. Ich war nie zwölf.”
„Moment mal. Woher willst du wissen, dass Blue zwölf ist?”, mischte sich Gabriel ein.
„Ich habe geraten.”
Gabriel grinste, als er sagte: „Der weiß es ja selbst nicht so genau.”
„Weshalb seid ihr nicht in der Schule?”, fragte der Alte unbeirrt weiter.
„Das ist unsere Schule. Hier lernst du alles, was du zum Leben brauchst”, klärte ihn Blue auf.
„Was brauchst du denn zum Leben, Blue George Washington?”
„Was zu essen, einen trockenen Schlafplatz und eine Wasserleitung.” Blue wies mit dem Kopf in Richtung Keller, wo einige alte Rohre zu sehen waren. „Da kommt wirklich gutes, kühles Wasser raus, auch wenn‘s nicht so aussieht.”
Der Alte bemerkte wohl, dass der Junge bei diesen Worten verstohlen auf den Apfel schielte.
„Er gehört dir. Hast du Hunger?”
Blue antwortete nicht, drehte den Kopf zur Seite und starrte wieder in den nicht abreißenden, heftigen Regen.
„Du besitzt nicht viel, Junge, aber eine ordentliche Portion Stolz hat dir dein Großvater mitgegeben.”
„Woher willst du das wissen?”, fragte Blue, ohne den Kopf zu bewegen.
„Vielleicht kenne ich ihn.”
„Hm!”, bekam der Alte von ihm nur zur Antwort.
„Bist du vielleicht sein Großvater?”, fragte Gabriel.
Der Alte lächelte geheimnisvoll, nickte und sagte: „Sein Großvater, dein Großvater und der aller meiner Enkel.”
Der Junge schien verwirrt über diese Antwort. Gabriel starrte den alten Mann mit großen Augen an. „Aber … du bist ein … ein Indianer.”
Wieder nickte der Alte und lächelte nachsichtig. Blue verließ ohne ein Wort zu sagen seinen Platz und floh in den strömenden Regen hinaus. Binnen weniger Sekunden war er bis auf die Haut durchnässt. Er presste die Hände auf seine Ohren, um nichts mehr hören zu müssen. Der alte Mann erhob sich und kroch ebenfalls hinaus. Der Regen ließ nach und hörte schließlich ganz auf. Der alte Indianer trat zu Blue und sagte leise: „Großmutter wartet auf dich. Geh nach Hause.”
Blue schrie so laut er konnte: „Ich bin kein Indianer! Verdammt noch mal! Lasst mich in Ruhe!”
Als er sich umdrehte, stand sein Freund vor ihm.
„Ist ja schon gut”, sprach Gabriel besänftigend auf ihn ein.
„Haut ab!“, rief Blue wütend. „Lasst mir einfach meine Ruhe!“
„Ich sag doch gar nichts!“, verteidigte sich Gabriel. „Und der Alte ist längst verschwunden! Wo ist der überhaupt so schnell hin?“
Sie sahen sich beide suchend um, doch der alte Mann war wie vom Erdboden verschluckt.
Kapitel 2
Oben und unten
Die Absätze der jungen Dame, die einen engen Rock und eine weiße Bluse trug, knallten auf dem Laminatboden, als sie mit schnellen Schritten von ihrem Schreibtisch zur Zimmertür eilte. Ihre rotblonden Locken wippten im Takt dazu. Sie hielt ein Schreiben in der Hand und atmete tief durch, bevor sie an die Bürotür ihres Bosses, Frank McKanzie, klopfte.
„Was gibt es Mrs Hanson”, fragte der junge Mann im blau gestreiften Hemd und sah vom Computerbildschirm auf. Die Gläser seiner randlosen Brille funkelten. Er hatte sein Jackett über die Lehne des Bürostuhls gehängt und die Krawatte gelockert. McKanzies Zimmer in der Anwaltskanzlei, die in der Michigan Avenue in Downtown Chicago lag, war wesentlich großzügiger ausgestattet, als das Büro seiner Sekretärin. Es beherbergte unzählige Aktenordner, die wie Zinnsoldaten in Regalen standen, die vom Boden bis zur Zimmerdecke reichten. Eine große Fensterfront, hinter dem Schreibtisch des Vierunddreißigjährigen, ließ das Tageslicht herein. Der Lärm des Loops, des Geschäftszentrums der Stadt und das Rattern des alten El Trains wurden von den dicken, isolierten Glasscheiben abgewehrt. Zwei große Grünpflanzen, rechts und links neben dieser Glasfront, lockerten die triste Ausstattung etwas auf. Dank der Klimaanlage des Bürogebäudes war die Luft hier drin erträglich und duftete dezent nach „Meeresbrise”.
Mrs Hanson schloss die Tür hinter sich und trat näher.
„Das Schreiben an Ihre Versicherung ist fertig, Sie müssen es nur noch unterschreiben. Und hier ist ein Schreiben vom Gericht angekommen, Mr McKanzie. Ich denke, es ist sehr wichtig.”
Sie legte beides auf seinem Schreibtisch ab. Ohne es zu lesen unterschrieb er das Versicherungsschreiben.
„Das Jugendamt hat seit gestern mehrmals versucht, Sie zu erreichen. Was soll ich der Dame ausrichten? Sie möchte mit Ihnen persönlich sprechen.”
McKanzie schielte über den Brillenrand, mit einem bittenden Blick, den Mrs Hanson schon zur Genüge kannte.
„Das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen und sie lässt sich nicht mehr vertrösten.”
„Gut. Dann geben Sie ihr einen Termin – in sechs Monaten.” McKanzie grinste seine Sekretärin spitzbübisch an.
Mrs Hanson lächelte, als sie mitfühlend antwortete: „Sie sollten sich umgehend darum kümmern und die Sache schleunigst erledigen. Es ist besser so.”
„Sie hören sich schon an wie meine Mutter. Ich bin Anwalt für Verkehrs- und Arbeitsrecht, nicht für Familienrecht. Was wollen die eigentlich von mir?”
„Tja ich denke es gibt, … also es hat sich so angehört, als ob man Sie dringend sucht. Sie möchten sich bitte umgehend Ihres Kindes annehmen.”
McKanzie ließ den Kugelschreiber auf die Schreibtischplatte fallen und nahm seine Brille mit einer Hand ab.
„Ich soll was?” Er fuhr von dem Stuhl auf.
Mrs Hanson wäre lieber schnell aus der Schusslinie verschwunden, aber er gab ihr keine Chance.
„Es gibt da einen Sohn und Sie sind wohl der einzige Vater … ehm … Verwandte … oder so.” Sie verdrehte hilfesuchend die Augen.
„Alimente”, schnaufte McKanzie, während er die Brille mit Schwung wieder auf den Nasenrücken setzte und zum Telefon griff. „Das ist doch bloß ein Trick!“ Er hielt inne und starrte seine Sekretärin an.
„Gibt es Beweise, dass ich wirklich der Vater bin?”
„Keine Ahnung. Sie sollten sich erst einmal mit der Dame vom Jugendamt in Verbindung setzen. Mrs Cooper wird Ihnen alles erklären können.”
McKanzie nahm den Hörer an sein Ohr. „Verflixt! Die Nummer?”
„Moment. Ich kann Sie verbinden.”
„Dann tun Sie das, bevor ich es mir anders überlege!”
„Ja, Sir.”
Mrs Hanson verschwand fluchtartig im Vorzimmer. Hier glaubte sie sich im Moment besser aufgehoben.
Kaum fünf Minuten später kam Frank McKanzie aus seinem Büro. Er redete fortwährend mit sich selbst, während die Tür hinter ihm ins Schloss knallte. Mehrmals zählte er die Finger an seinen Händen ab.
„Ich fahre dorthin. Bin in den nächsten zwölf Stunden nicht erreichbar. Quatsch! Zwei. Also: zwölf… vierunddreißig, vierundzwanzig, zweiundzwanzig. Oh, verflucht nochmal”, murmelte er weiter.
Die Sekretärin schüttelte den Kopf und grinste. „So schlimm?”
„Schlimmer. Viel schlimmer!”
„Na, dann viel Glück, Mr McKanzie.”
„Danke”, antwortete er abwesend.
Er schoss zur Tür hinaus, ging mit ausgreifenden Schritten zu einem der Aufzüge und verschwand wenig später in einem der Hochgeschwindigkeitsaufzüge, Speeds genannt. Wie ferngesteuert stieg er schließlich in sein Sportcabriolet. Im rasanten Tempo stürzte er sich in den Großstadtverkehr Chicagos. Der Loop selbst war eine lärmende Geduldsprüfung. Die Michigan Ave, obwohl sechsspurig, wie immer verstopft. Ungeduldig hupte Frank ein paarmal. Doch es nutzte, wie immer, nichts. „Ich liebe Chicago”, murmelte er zu sich selbst und trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad herum. Als er endlich den Chicago River in Richtung Norden überquert hatte, kam er mit seinem Cabriolet annähernd auf zulässige Stadtgeschwindigkeit. Am Old Water Tower bog er links in die Chicago Avenue. Zwei Querstraßen weiter in die La Salle Street, immer in nördlicher Richtung. Eine geschlagene Stunde brauchte er dennoch bis zum Ziel, was in ihm wieder einmal die Frage aufkommen ließ, weshalb man ein schnelles Auto besaß, um dann im Schneckentempo durch die Straßen von Ampel zu Ampel zu kriechen. Er grinste, denn er wusste, weshalb er sich ein solches Auto gekauft hatte, obwohl es nicht zwingend notwendig gewesen wäre, denn die halbe Damenwelt Chicagos konnte ihm auch so nicht widerstehen.
Eine Stunde und dreizehn Minuten später rückte Frank McKanzie seine Krawatte zurecht, fuhr mit der Hand über seine kurzen Haarstoppeln und schob die Brille mit dem Zeigefinger den Nasenrücken hinauf. Er schwitzte nicht der Temperaturen wegen. Dann klopfte er an die Zimmertür, neben der ein Schild mit der Aufschrift Sorgerechtswesen - Margret Cooper - hing. Frank wurde bereits erwartet.
„Guten Tag, Mr McKanzie”, grüßte eine ältere Dame mit auffällig gefärbtem Haar und mühte sich, über den Brillenrand zu ihm aufzusehen. „Setzen Sie sich doch.”
„Guten Tag”, erwiderte Frank McKanzie einsilbig und ließ sich auf den Stuhl, jenseits ihres Schreibtisches, gleiten. Er glaubte die Luft um ihn herum knistern zu hören, in Anbetracht der angespannten Situation, der er sich nun ausgeliefert fühlte.
„Also es handelt sich um Ihren zwölfjährigen Sohn, Walter McKanzie. Seine Mutter ist verstorben. Seitdem streift er allein durch die Stadt. Er besucht keine Schule und ist schon mehrmals wegen Diebstahls geschnappt worden.”
„Diebstahl?”
Die Frau auf der Seite ihm gegenüber holte tief Luft. „Leider. Er ist einfach nicht in den Griff zu kriegen. Aber hier handelt es sich um Ihren Sohn!”
„Und deshalb kommen Sie ausgerechnet jetzt auf mich zu? Ist seine Mutter gestern erst gestorben?”
„Nein. Letztes Jahr. Sein Großvater hat sich an uns gewandt. Aber er hat kein Sorgerecht.”
„Wo liegt das Problem?”
„Das Sorgerecht haben Sie. Sie sind der Vater.”
Sie nickte bedächtig und schüttete ein paar Papiere aus einem großen Briefumschlag auf ihren Schreibtisch.
Langsam griff McKanzie nach ihnen und las. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde und ein paar Fotos.
„Er war fast noch ein Baby. Er kennt mich überhaupt nicht.”
„Walter war fünf als Sie gingen und ihn, samt seiner Mutter Winona McKanzie, allein ließen. Sie haben weder Unterhalt für sie, noch für Ihr Kind bezahlt. Finden Sie das nicht ein wenig verantwortungslos?”
„Was wissen Sie schon”, murmelte Frank.
Mrs Cooper ging auf diese Äußerung nicht ein. „Vielleicht können Sie ihm helfen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät.”
Frank legte die Fotos und die Papiere zurück, atmete hörbar tief durch und sagte schließlich: „Okay! Wo muss ich unterschreiben?”
„Was unterschreiben?”
„Die Abtretung des Sorgerechts an seinen Großvater. Wenn er ihn haben will, dann soll er sich um ihn kümmern.”
„Gut”, sagte Mrs Cooper ein wenig fassungslos und bereitete das Schreiben vor.
„Hören Sie! Ich kann in meiner Position kein Kind gebrauchen. Ich habe gar keine Zeit für so was”, versuchte er halbherzig zu erklären.
„Sie brauchen sich vor mir nicht zu rechtfertigen. Vielleicht sollten Sie das eines Tages vor ihrem Sohn tun.”
„Falls wir uns jemals begegnen”, fügte Frank zynisch hinzu.
Mrs Cooper hob den Kopf und lächelte ihn an.
„Das lässt sich wohl kaum vermeiden, Mr McKanzie. Mit der Abtretung des Sorgerechts verpflichten Sie sich gleichzeitig, Walter McKanzie zu seinem Großvater zu bringen und ihn dort persönlich und wohlbehalten abzuliefern.”
„Sie sind verrückt!”
„Ich darf ja wohl bitten!”
„Entschuldigen Sie. Aber warum kann ihn der Großvater nicht einfach selber abholen? Er war doch hier, denke ich.”
„Er ist ein Reservatsindianer.”
„Und?”
„Er kann ihn nicht holen.” Mrs Cooper schnappte nach Luft.
„Jetzt fragen Sie mich bloß nicht, warum!”, fegte sie ihn an, sodass selbst Frank McKanzie es nicht wagte, ihr zu widersprechen. „Also gut. Wo finde ich Walter?”
Margret Cooper druckte das Schreiben aus und lächelte nun wieder, als sie antwortete: „In Chicago.”
„Warum sagen Sie nicht gleich im Amazonas.”
„Lassen Sie ihn sich bringen. Sie haben doch die nötigen Mittel dazu, Mr McKanzie. Die Polizei hat ihn schon ein paar Dutzend Mal eingefangen, aber nie ist er auf einem Polizeirevier angekommen. Er war so clever, ihnen immer wieder zu entwischen. Einigen Polizisten hat er einfach in die Finger gebissen, sodass sie ihn losließen. Ein paar hat er getreten und, weiß Gott, er wusste genau wohin.”
„Das sind ja tolle Aussichten.” Frank schüttelte den Kopf. „Von mir hat er das nicht!”
„Wissen Sie, wie sie ihn nennen? Blue Light Shadow.”
„Blaulichtschatten?”
Seit zwei Stunden saß Walter McKanzie, genannt Blue, im Polizeirevier im 23. District und wartete. Worauf? Man hatte ihn zur Sicherheit mit Handschellen an einem der Heizungsrohre gefesselt. Vergeblich hatte er versucht, seine Hand hindurch zu zwängen. Irgendwann hatte sich der Junge damit abgefunden. Das Handgelenk schmerzte. Seine Jeans war auf der Flucht an mehreren Stellen zerrissen. Sein Shirt stand vor Schmutz und Schweiß. Die nackten Füße steckten in offenen Turnschuhen. Die Wut ließ seine schwarzen Augen funkeln und seine zusammengepressten Lippen waren nach unten gezogen.
Blue war wütend auf die Polizisten, die ihn aufgegriffen hatten und es gewagt hatten, ihm sein Messer wegzunehmen. Und er war wütend auf sich selbst, weil er es dieses Mal nicht geschafft hatte, ihnen zu entkommen. Sie sagten ihm nicht einmal warum sie ihn festhielten. Die Turnschuhe hatte er schon vor vier Wochen gestohlen. Das konnte es also nun wirklich nicht sein. Blue streckte den Hals, um einen Blick nach draußen zu erhaschen. Das türkisfarbene Sonnenschutzsegel vor dem Fenster ließ nur einen Blick an der Ampel vorbei auf die Straßenkreuzung und die gegenüberliegende Tankstelle zu. Er beobachtete die vorbeifahrenden Autos eine Weile.
Die Zeit schien endlos. Der quälende Durst ließ Blues Zunge schließlich am Gaumen kleben. Zweimal hatte er einen der Männer ansprechen wollen, aber sein Stolz ließ seine Zunge da, wo sie klebte. Schließlich hockte er sich wieder neben die Heizung. Der Officer, der ihm gegenüber am Schreibtisch saß, hob hin und wieder den Kopf und nickte ihm lächelnd zu. Blue ignorierte das. Mit geneigtem Kopf beobachtete er stattdessen alles und jeden aufmerksam durch die langen Strähnen seines zerzausten Haares, das ihm über die Augen fiel. Seine Hoffnungen schienen zu schwinden. Was habt ihr mit mir vor verflucht, dachte er wütend Ich habe nichts verbrochen!
Irgendwann kam eine ältere Lady durch die Tür, gefolgt von einem jüngeren Mann im Anzug. Beide steuerten geradewegs auf den Jungen zu. Blues ganze Aufmerksamkeit richtete sich auf die Ankömmlinge. Doch er bemühte sich um Gleichgültigkeit.
„Ist er das?”, fragte der Mann.
Walter blickte dem Fremden auf die Schuhe. Es waren keine Turnschuhe. Er mochte weder den Tonfall, in dem er seine Frage gestellt hatte, noch seine schwarzen Slipper.
„Ja. Darf ich vorstellen: Das ist Walter McKanzie. Walter, das ist Frank McKanzie, dein Vater.”
Blue zuckte innerlich zusammen. Als er aufspringen wollte, hinderte ihn die Heizung daran und das Handgelenk, um das er die Handschellen trug, schmerzte erneut unter dem Ruck, sodass er hätte aufjaulen können. Aber er biss die Zähne hart aufeinander. „Hi, Walter”, grüßte Frank, nur um überhaupt etwas zu sagen. Blue schwieg. Er sah ihn nicht einmal an.
„Ich bin Margret Cooper vom Jugendamt. Dein Großvater, Mr Stone Horse, hat sich an mich gewandt. Willst du deinem Vater nicht Guten Tag sagen, Walter?”, fragte die ältere Dame freundlich.
„Es gibt keinen Vater.”
„Jeder Mensch hat einen Vater, Walter, und das hier ist deiner.” Der Junge begann den Kopf zu heben und blickte an dem fremden Mann hinauf. Er musterte den Anzug, das weiße Hemd, sein skeptisches Gesicht, mit dem kaum sichtbaren Brillengestell. Die kurzen, dunklen Haare glichen einer Frisur aus einem Modemagazin und glänzten übertrieben. Dann spürte Walter plötzlich den scharfen Blick des Fremden unangenehm auf seiner Haut, in der er sich nun nicht mehr wohl fühlte.
„Und?”, fragte er schließlich.
„Walter. Dein Vater und auch dein Großvater haben beschlossen, dass es besser für dich ist, wenn du zu Hause wohnst, die Schule besuchen und ein geregeltes Leben führst.”
„Mein Leben ist geregelt!”
„Das sehe ich”, meinte Frank McKanzie. „Ich bringe dich nach Hause.”
„Woher willst du wissen, wo mein Zuhause ist?”, schnaufte Blue.
Mrs Cooper hatte die Hände ineinander gefaltet, atmete tief durch und hüllte sich in Schweigen.
„Hör zu, Walter. Dein Großvater will dir helfen. Er hat lange nach dir gesucht. Ich werde dich zu ihm bringen. Ich glaube, bei ihm bist du in den besten Händen.”
Blue schluckte seine Wut schweigend hinunter. Bis gestern war sein Leben noch völlig in Ordnung gewesen und heute tauchten plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Vater auf, der von einem Großvater faselte, den er nicht einmal kannte. Verflucht nochmal! Wer zum Teufel hatte ihn gefragt, ob er einen Großvater wollte, der es gut mit ihm meint und einen Vater, der sich nie um ihn gekümmert hatte.
„Komm, Walter! Es ist besser so.”
Und wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen und diese verdammten Handschellen loszuwerden, dachte Walter und stimmte schließlich zu. Erstmal raus hier, dann konnte man weitersehen.
„Okay. Gehen wir”, sagte Frank.
Mrs Cooper schien ehrlich überrascht von Walters rascher Vernunftsanwandlung und nickte. Der Officer, der die ganze Zeit über am Schreibtisch gesessen hatte, stand auf und gab Walter McKanzie frei.
„Passen Sie gut auf Ihren Sprössling auf!”, mahnte er und grinste Frank McKanzie hintergründig an.
Blue ging mit seinem Vater aus dem Polizeirevier. Er blieb skeptisch, als sie das zweistöckige Backsteingebäude verließen und sich von Mrs Cooper verabschiedeten. Dann schob Frank seinen Sohn am Arm voran um die Ecke in die North Halsted Street, in der sein Wagen unter dem Schatten eines Baumes parkte. Vor dem Sportcabriolet blieb er stehen und Walter betrachtete es genau. Sein Erstaunen war Frank nicht verborgen geblieben. Er lächelte, als er Blue die Tür öffnete.
„Steig ein”, sagte er, als er das Zögern des Jungen bemerkte. Blue zögerte, doch dann folgte er der Anweisung. Es konnte nicht schaden, einmal mit so einem Nobelschlitten durch die Straßen kutschiert zu werden. Zum Flüchten würde sich noch eine passende Gelegenheit finden. Walter ließ sich auf den Beifahrersitz gleiten und schlug die Tür zu.
„Anschnallen!”
Walter folgte dem Befehl seines Vaters ohne Widerworte. Dann spürte er den Fahrtwind um seine Ohren pfeifen, der mit seinem Haar sein Spielchen trieb. Walter genoss den Augenblick. Er lächelte sogar, ohne dass er es wollte. Schnell verschwanden das Polizeirevier, die Tankstelle, das Haus an der Kreuzung, aus seinem Blick.
Blue sah nach vorn. Entlang der Straße parkten an beiden Seiten Autos. Er sah die alten Häuser und las die Wegweiser. Frank blinkte und bog nach rechts, in den Lake Short Drive ab. Links führte dieser zum Lincoln Park. In südlicher Richtung allerdings baute sich in der Ferne die Skyline der Downtown vor Blues Augen auf. Blue kannte diesen Anblick. Wenn er sich manchmal am Lincoln Park herumtrieb, konnte er von dort sein altes Revier sehen. Der Lake Short Drive führte direkt am Ufer des Michigan Lake nach Süden. Eine beliebte Touristenroute. Das gegenüberliegende Ufer des Sees war nicht zu sehen.
Heute war es fast windstill, sodass er friedlich wirkte. Aber Blue wusste nur zu gut, wozu der Wind fähig war. Dann peitschten die Wellen ziemlich hoch und man konnte fast vergessen, dass hier kein Meer, sondern nur ein See vor einem lag. Blue schielte zur Landseite, als sie am Big John, dem zweithöchsten Wolkenkratzer der Stadt, vorbeifuhren.
„Schlappe vierundneunzig Stockwerke”, sagte Frank, wie zu sich selbst. „Von da oben hat man einen phantastischen Ausblick auf die Stadt und den Michigan.”
Blue antwortete nicht und hoffte inständig, niemals hinauf zu müssen. Er hob die Hand als Sonnenschutz vor die Augen und sah, eine Handbreit daneben, den Old Water Tower in weiterer Entfernung auftauchen. Er grinste. Das Gebäude hatte wirklich Ähnlichkeit mit einer überdimensionalen Pfeffermühle. Dabei war es einst das Wasserlager der Feuerwehr gewesen und war heute eine zentrale Pumpstation der städtischen Wasserwerke. Mehrere Geschäfte und Restaurants mit Seeblick reihten sich entlang der Promenade aneinander. Wenig später bog Frank McKanzie zum Lake Point Tower am Navy Pear ein und steuerte direkt auf eines der Hochhäuser zu.
Oh mein Gott! Das ist nicht dein Ernst, dachte Blue noch, als das Sportcabriolet viel zu früh stoppte, um schließlich mit ihm in einer Tiefgarage zu verschwinden. Als er die Tür öffnen wollte, um auszusteigen, packte ihn eine starke Hand am Arm. Blitzschnell wandte er sich um und blickte in Frank McKanzies Augen.
„Denk nicht mal dran”, zischte sein Vater drohend.
Blue schwieg und wich Franks Blick aus. Wie ferngesteuert folgte er dem Mann, der sich sein Vater nannte, zum Aufzug. Er hasste diese Dinger, aber noch mehr hasste er es, zuzugeben, dass er Angst hatte dort einzusteigen. Er versteckte sich hinter einer Maske des Schweigens und wandte Frank den Rücken zu, damit dieser seine Angst nicht bemerkte. Himmel, muss er ausgerechnet eine Wohnung unter dem Dach dieses Wolkenkratzers haben, dachte Blue, während er sich im Hochgeschwindigkeitsaufzug fast schwerelos fühlte. Der Lift stoppte abrupt, noch ehe er zu Ende gedacht hatte.
Frank schob den Jungen voran in den Flur und öffnete seine Wohnungstür.
„Bitte”, sagte er mit einer Geste.
Blue trat hinein, blieb stehen und sah sich um.
So sieht also die obere Etage Chicagos aus, dachte er.
„Hey! Willst du Wurzeln schlagen? Fühl dich wie zu Hause!”
„Wohnst du allein hier?”
„Ja.”
„Und das gefällt dir?”
„So ist es.”
„Erwarte nicht von mir, dass ich Dad oder so was zu dir sage.”
„Okay.” Frank lachte. „Für dich also Frank.”
„Wer hat mir eigentlich den beschissenen Namen verpasst?”
„Walter?”
Blue nickte.
„Ich finde ihn gut.”
„Ich hasse ihn.”
Frank zuckte mit den Schultern. „Du hast eine ordentliche Dusche bitter nötig, Junge. Hier liegen neue Sachen für dich. Ich hoffe sie passen dir. Mrs Cooper hat sie eingekauft. Die Tür rechts neben dir geht zum Badezimmer.”
„Sag nicht Junge zu mir, verstanden!” Blue hasste diese Bezeichnungen. Er war erwachsen!
„Okay. Was dann?”
„Blue.”
„Du spinnst!”
„Sie nennen mich Blue Light Shadow.”
„Also doch.”
„Weißt du, dass du da unten umgebracht werden kannst, nur weil du Walter heißt?”
„Verstehe.” Frank lachte leise.
„Nichts verstehst du!”
Blue ließ die Badezimmertür hinter sich ins Schloss fallen. Er genoss das Wasser im Überfluss, welches prickelnd über seine nackte Haut perlte. Dann griff er nach dem Duschgel, auf dem ‚for man‘ stand. Mit dem Duschtuch um die Hüften schüttete er den Plastikbeutel aus, in dem sich die neue Kleidung befand.
„Wow!”, entfuhr es ihm. „Die Alte ist cooler, als ich dachte”, murmelte er vor sich hin, als er die nagelneue Jeans, das Shirt und die Unterwäsche untersuchte.
Blue zog alles an und er konnte nicht leugnen, dass er sich so wohl fühlte, wie schon lange nicht mehr. Für die nächste Zeit würde das reichen. Jetzt wurde es Zeit, abzuhauen. Frank war weder zu sehen noch zu hören und Blue drehte den Türknauf der Wohnungstür auf.
„Scheiße”, zischte er leise, als er bemerkte, dass die Tür abgeschlossen war.
Dann begann er die Fenster näher zu untersuchen. Nirgendwo fand er etwas, um sie zu öffnen. Die Nase an die Scheibe gedrückt, sah er hinaus und schlug schließlich wütend mit der flachen Hand gegen das dicke Fensterglas. Das erste Mal in seinem Leben sah er die Straßenschluchten der großen Stadt von oben. Die Strahlen der sich neigenden Abendsonne brachen sich auf den kleinen Wellen des Chicago River und schaukelten sanft auf dem türkisblauen Wasser des Michigansees, als wollten sie ihn necken. So verharrte Walter McKanzie, bis er irgendwann zusammenzuckte, als ihn Franks Stimme aus seinen Gedanken riss.
„Na. Keine Erfahrungen im Fassadenklettern?”
„Noch nicht. Aber ich bin lernfähig”, meinte Blue zynisch.
„Das freut mich. Ich meine, dass du dich als lernfähig einschätzt.”
„Bist du auch einer von denen, die Menschen für dumm halten, nur weil sie nicht in so feinen Anzügen rumlaufen wie du?”
Frank schien zu überlegen. Dann sagte er: „Darüber habe ich noch nie nachgedacht.”
„Hm”, machte Blue und wandte sich vom Fenster ab.
Frank stand in Jeans und schlabberigem Shirt vor ihm.
„Ich mach uns was zum Essen. Hast du Hunger?”
Blue schob die Daumen in die Gesäßtaschen der neuen Jeans und nickte.
„Du solltest vielleicht die Preisschilder von den Sachen abmachen”, lächelte Frank und wies mit einer Geste zu ihm. Blue sah suchend an sich herab und riss einen Zettel ab. Frank trat einen Schritt auf ihn zu und griff zum Halsausschnitt des Shirts. Blue verstand das als Angriff und ging reflexartig in Abwehrposition. „Schon gut, Blue Light Shadow.” Frank hielt inne. „Da hängt noch eins. Hinten.”
Blue angelte selbst danach und zog es ab, während Frank seine Hand wieder sinken ließ.
„Du lässt dir nicht gerne helfen”, stellte er fest.
„Da unten hilft dir niemand. Ich musste lernen, mir selbst zu helfen und das kann ich ganz gut.”
Frank nickte, sagte aber nichts darauf und wandte sich um. In der Küchenecke im großen Wohnraum kramte er scheppernd eine große Pfanne hervor und schob sie auf das Kochfeld.
„Ich habe uns Steaks gekauft und Backkartoffeln. Ich hoffe, du magst das. Ich bin kein großartiger Koch”, meinte er, während er die Kartoffeln aus der Tüte auf ein Blech schüttete.
Blue hatte Hunger. Weiß Gott, er hatte großen Hunger. Ihm war völlig egal, was der Mann namens Frank McKanzie da zusammenrührte. Hauptsache es gab etwas zu essen und es duftete so gut, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Blue beschloss, zum Essen zu bleiben. Zum Flüchten war später noch Zeit. Sein Hunger war größer als sein Stolz es jemals sein konnte. Doch dann wollte er gehen. Er hatte nicht vor, sich von Frank oder irgendjemandem zu irgendwelchen Großeltern bringen zu lassen. Und schon gar nicht in ein Indianerreservat! Blue setzte sich in den großen Ledersessel und lehnte sich an. Er konnte nicht leugnen, dass es sich gut anfühlte, darin zu sitzen.
„Willst du fernsehen?”, rief Frank aus der Küchenecke, während die Steaks in der Pfanne brutzelten.
„Die Fernbedienung liegt auf dem Couchtisch.”
Blue probierte alles aus, schaltete von Sender zu Sender und sog alles in sich hinein, wie es schien. Das letzte Mal hatte er ferngesehen, als er acht war, glaubte er. Dann war die alte Kiste kaputtgegangen. Geld für eine neue gab es nicht. Es reichte gerade für Miete, Strom, Wasser und manchmal auch für etwas zu essen. Als seine Mutter dann im letzten Jahr gestorben war, brachte man ihn, zusammen mit seiner kleinen Schwester Bonnie, in ein Heim. Sie war erst sechs. Als Blue von ihr Abschied nahm, hatte sie sich fest an ihn geklammert und geschluchzt. Er hatte die Freiheit der Straßen Chicagos gewählt und war aus dem Heim geflüchtet.
„Komm Blue! Das Essen ist fertig.”
Blue hörte Frank mit Tellern und Besteck klappern und stand auf. Er brachte es tatsächlich fertig, ein wenig zu lächeln, als er sich zu ihm an den Tisch setzte. Frank hatte es bemerkt und lächelte ebenfalls. Walter haute rein was das Zeug hielt, als befürchte er, jemand könne es ihm wegnehmen. Frank beobachtete ihn und grinste schließlich. Als der Junge sich den Teller ein zweites Mal voll packte, fragte er ihn: „Schmeckt‘s?”
„Hm. Dafür, dass du kein großartiger Koch bist, schmeckt es ganz gut.”
Frank lachte. „Danke.”
Walter sah ihn einen Augenblick verwundert an, zuckte mit den Schultern und aß weiter. Als er schließlich fertiggekaut hatte, trank er das große Glas Cola in einem Zug aus und rülpste laut, während er es abstellte. Dann wischte er sich mit dem Handrücken über den Mund. Frank kaute noch.
„Warum bist du abgehauen?”, fragte Blue unvermittelt.
Frank würgte den Brocken hinunter. Vor solch einer Frage hatte er sich immer gefürchtet.
„Verdammt”, sagte er so leise, dass er es selbst kaum verstand. „Ich bin nicht abgehauen. Sie hat mich vor die Tür gesetzt!” Frank bemühte sich um Selbstbeherrschung.
Blue sah seinem Vater fragend in die Augen und schwieg. Der konnte seinen Blick kaum ertragen. Er wich ihm aus und schüttelte energisch den Kopf.
„Das ist eine lange Geschichte”, sagte Frank schließlich und trank sein Bier aus. Frank McKanzie wollte offensichtlich nicht darüber sprechen. Er hatte diesen Teil seines Lebens lange hinter sich gelassen und abgehakt. Der Blick seines Sohnes auf ihm behagte ihm nicht und er spürte den Anflug eines schlechten Gewissens. Er wusste nichts von ihm und er hatte nie an ihn gedacht, nicht mal zu Weihnachten.
„Sieben Jahre”, sagte Blue. „Ich wette, du hättest jeden mitgenommen, den dir die Bullen eingefangen hätten und du hättest nicht mal gewusst, ob ich es bin oder ein anderer. Vielleicht wäre es dir sogar egal gewesen.”
Frank versuchte sich mit der Situation anzufreunden.
„Du siehst genauso aus wie sie. Sie war wunderschön. Du hast ihre schwarzen Augen und ihr widerspenstiges, schwarzes Haar.”
„Ha! Jetzt werd‘ bloß nicht sentimental, Frank. Dafür ist es zu spät.”
Frank schlug leicht mit den Handflächen auf die Tischplatte und stand auf.
„Okay. Ich zeige dir das Gästezimmer. Morgen früh bringe ich dich nach Pine Ridge zu deinen Großeltern. Ich habe das Sorgerecht an sie abgetreten. War schön dich kennengelernt zu haben.” Blue kniff die Augen zu kleinen Schlitzen und presste die Lippen aufeinander. Das werden wir ja noch sehen, dachte er.
Gegen Morgen wälzte sich der Junge im Bett hin und her und zerwühlte seine Decken. Zwischen Wachen und Schlafen lag er auf dem Bauch und hielt die Zipfel des Kissens krampfhaft fest, das er sich über seinen Kopf gezogen hatte. Er war schweißgebadet und wehrte sich gegen das Aufwachen. Noch nicht! In seinem Traum rannte er. Er wollte es nicht, aber er lief und lief. Er rannte und wusste nicht wohin. Hauptsache weg! Es wurde dunkel und kalt, als er ein paar Zelte vor sich auftauchen sah. Was soll denn das, dachte er noch.
Zwischen den Bäumen standen sie: große, spitze Zelte mit Büffelhäuten bespannt und verschieden bemalt. Die dicke Schneedecke schien unberührt, als hätte sie nie ein menschliches Wesen berührt und glitzerte im Licht des Vollmondes. Walters Atemluft verwandelte sich zu Rauch und verflüchtigte sich.
Schnee mitten im Juni, fragte er sich in Gedanken und zog eine Büffelfelldecke enger um sich herum. Aber er spürte die Kälte nicht.
„Ist hier jemand?”, rief Blue laut.
Niemand antwortete. Gedämpftes Licht drang durch die Zelte nach außen und umgeben von völliger Stille ging er langsam, fast zögernd weiter. Nicht einmal die dösenden Pferde beachteten ihn. Er fand sich vor dem Eingang eines Zeltes und sah sich um. Dann fasste er seinen ganzen Mut zusammen und ging hinein. Was er dort sah, brachte sein Herz zum Trommeln. Eine junge Frau schürte das Feuer und legte zwei Holzscheite hinein.
„Mutter?”
Blue war verwirrt. Er kämpfte jetzt nicht mehr mit Decke und Kopfkissen. Die junge Frau sah auf und lächelte. Blue spürte eine starke, schwere Hand auf seiner Schulter und blickte erschrocken zu dem Mann, der wie aus dem Nichts neben ihm aufgetaucht war. Der Alte lächelte ihn freundlich an. Blue erschrak noch mehr. Er konnte sich an diesen Mann genau erinnern, der vor zwei Wochen zu ihm ins Kellerloch gekrochen war. Doch heute trug er Ledersachen mit Fransen, wie er es einmal in einem Western im Fernsehen gesehen hatte. Nur diese waren viel schöner und sie waren kunstvoll bestickt. Der Alte lachte leise, als er die sprachlose Verwunderung im Gesicht des Jungen sah. Dann sprach er Worte zu der jungen Frau, die Walter Blue Light Shadow nicht verstand. Sie nickte daraufhin. Blue erinnerte sich an die Geschichte, die der alte Mann im Kellerloch, während des Gewitters, erzählt hatte und ein kribbelnder Schauer kroch an seinem Nacken hoch. „Dein Kind soll leben”, hatte er zu der jungen Frau gesagt. Er hörte es noch genau in seinen Ohren.
Es dauerte eine Weile, bevor er realisierte, dass er aufgewacht war. Es roch nach frisch gewaschener Wäsche und es war warm und trocken. Ein schwacher Lichtschein fiel zum Fenster herein. Blue tastete nach seinen Sachen, die er am Leibe trug. Ein kurzer Baumwollpyjama. Keine Büffelfelldecke. Dann griff er in seine Haare und zerzauste sie, mehr als sie ohnehin schon waren. Nein. Er hatte keine Zöpfe. Einen Augenblick lang hatte er an sich gezweifelt. Er schüttelte den Kopf.
„Hm. Verrückt.”
Wenn Frank McKanzie gedacht hätte, sein Sohn wäre zur Vernunft gekommen und würde freiwillig zu ihm in das Sportcabriolet steigen, so hatte er sich geirrt. Blues Gedanken waren auf Flucht programmiert. Er wollte hier weg und zwar so schnell wie möglich. Sobald sie in der Tiefgarage angekommen waren, ließ er sich hinter Frank zurückfallen. Der steuerte geradewegs auf seinen Wagen zu, spielte mit dem Schlüssel in der Hand und sagte nebenbei: „Interessierst du dich für Autos? In deinem Alter habe ich bereits von so einem geträumt. Ich konnte es kaum erwarten, endlich alt genug zu sein, um selbst fahren zu dürfen.” Frank lachte. Es antwortete ihm niemand, aber so ungewöhnlich schien das bei Walter nicht zu sein. Dennoch sah er sich nach ihm um, als er aufschloss.
„Walter!”, rief er.
Der Bengel war nirgendwo zu sehen.
„Walter!”, rief er noch einmal.
„Blue Light Shadow!”, versuchte er es, in der Hoffnung, der Junge würde auf diesen Namen reagieren.
„Scheiße!”, fluchte Frank schließlich wutentbrannt und knallte die Fahrertür wieder zu, als er schließlich erkennen musste, dass der Junge entwischt war.
Blue hörte die Stimme seines Vaters und rannte so schnell er konnte aus der Tiefgarage hinaus, ein Stück die Straße entlang und um die nächste Ecke. Keuchend schnappte er nach Luft, blieb kurz stehen und lehnte sich gegen die Hauswand. Als sich sein Atem etwas gemäßigt hatte, lief er weiter. Er kannte Straßen, Wege und Gassen, durch die Frank noch nie in seinem Leben gekommen war. Schmale Schluchten, durch die nicht einmal ein amerikanischer Kleinwagen passte. Hier, in seinem Revier, fühlte er sich sicher und so schlenderte er, die Hände in den Hosentaschen, über eine der zweiundfünfzig Hebebrücken des Chicago River, bis zu seinem Kellerloch. Eine leere Coladose, die mitten auf dem Weg lag, schoss er im hohen Bogen fort, dann lachte er fröhlich. Niemand brachte ihn irgendwohin!
Frank hatte indessen über sein Handy die Polizei gerufen. Er wurde noch wütender, als der Officer am anderen Ende schallend in den Hörer lachte.
„Sie hätten ihn an sich ketten sollen, McKanzie. Ich hatte schon öfter das Vergnügen mit ihm, glauben Sie mir. Ich kenne den Burschen. Hat mich gewundert, dass er überhaupt mit zu Ihnen in die Wohnung gegangen ist. Wie haben Sie das fertiggebracht?”
Wieder lachte er amüsiert durch den Hörer, während Frank schnaufte.