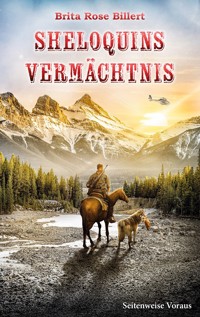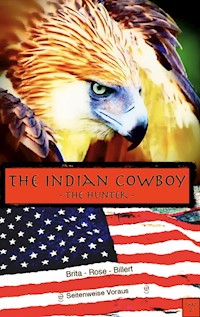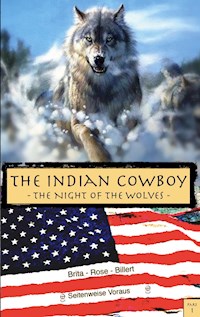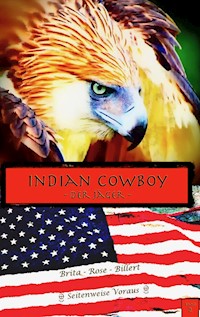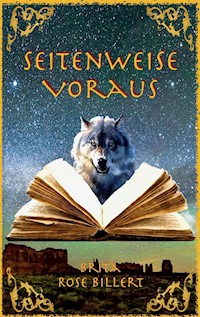Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Pferd für Stella
- Sprache: Deutsch
Als Stella durch einen Unfall im Rollstuhl landet ist sie gerade 24. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung sucht sie einen Weg in ein neues Leben, in dem alles anders bleibt. Sie ist wütend auf den Kerl der ihr das angetan hat und will ihn verklagen. Stella sinnt auf Rache. Eines Tages taucht Freddy mit seinem Pferd vor ihr auf. Stella besiegt ihre Angst und lernt Reiten. Sie gewinnt durch den feinfühligen Umgang mit den Pferden nicht nur neue Freunde, sondern auch neuen Lebensmut und Selbstvertrauen. Doch der Tag, an dem sie dem Unfallverursacher gegenüber sitzt, wirft sie erneut aus der Bahn...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Autorin:
Brita Rose Billert wurde 1966 in Erfurt geboren und ist Fachschwester für Intensivmedizin und Beatmung, ein Umstand, der auch in ihren Romanen fachkundig zur Geltung kommt. Ihre knappe Freizeit verbringt sie mit ihrem Pferd beim Westernreiten durch das Kyffhäuserland in Thüringen. Während ihrer Reisen in die USA und Kanada schloss sie einige Freundschaften mit Native Indians in Utah, South Dakota und British Columbia. Diese Tatsache, ihre Liebe zu den Pferden und zu ihrem Job inspirieren die Autorin zum Schreiben. 13 Romane sind bereits publiziert.
Autorenhomepage: www.brita-rose-billert.de
Wenn das Leben dich aus dem Sattel wirft, dann nimm die Zügel selbst in die Hand.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Stella erwacht
Kapitel 2 – Stella boxt sich durch
Kapitel 3 – Stella zieht um
Kapitel 4 – Stella trifft Freddy
Kapitel 5 – Stella auf Abwegen.
Kapitel 6 – Stella lernt reiten
Kapitel 7 – Stella macht Dummheiten
Kapitel 8 – Stellas neues Leben
Kapitel 1
Stella erwacht
Ich war noch so unsagbar müde. Einfach liegen bleiben. Ich hütete mich davor, meine Augen zu öffnen. Meine geschundenen Glieder schmerzten und fühlten sich so unsagbar schwer an. Nur noch ein paar Minuten. Es war still um mich herum. Ich genoss den Augenblick. Ich wusste nicht einmal wie spät es war. Zeit und Raum waren mir sowas von egal. Ich hörte meine eigenen, gleichmäßigen Atemzüge. Das wirkte beruhigend.
Irgendetwas klackte leise in die Stille. Keine Ahnung was das war. Plötzlich piepte mein Wecker unnachgiebig und erbarmungslos. Verdammt! Das nervt! Normalerweise drückte ich das Ding sofort aus. Doch ich war nicht fähig, mich zu rühren. Was war bloß los? Der Piepton und das Klacken bohrten sich schmerzhaft in meinen Kopf. Ich wurde wütend. Noch einmal nahm ich all meine Willenskraft zusammen, um das nervige Ding endlich zum Schweigen zu bringen. Doch meine Arme und Hände schienen mir absolut nicht gehorchen zu wollen. Meine Wut darüber ließ mich heftiger atmen. Shit!, durchschoss es wie ein heißer Blitz meine Gedanken und meinen Körper. Ich wollte doch einkaufen! Was liege ich so faul hier herum, als hätte ich nichts zu tun. Auf jetzt, Stella Fröbel!, schalt ich mich selbst. Verdammt! Heute klappt aber auch gar nichts. Mein Körper war noch immer schwer wie Blei und schien andere Pläne zu haben. Irgendjemand hatte zumindest den nervigen Wecker ausgestellt. Wie spät ist es überhaupt?, fragte ich mich. Ich versuchte wenigstens die Augen zu öffnen, um zu sehen, wer in mein Schlafzimmer eingedrungen war.
»Alles gut«, hörte ich eine fremde Stimme aus weiter Ferne. Nichts ist gut!, warf ich ein. Ich muss aufstehen und zwar sofort. Ich muss los! Denkst du vielleicht, ich hätte nichts zu tun? Und wer bist du überhaupt?, redete ich in meinen Gedanken, sodass niemand meine Worte hören konnte. Ich wollte aufspringen, doch die Erdanziehungskraft war stärker als ich. Viel stärker. Ich kam nicht hoch. Nicht einen Zentimeter! Nicht mal die Augen konnte ich öffnen. Was verdammt ist nur los mit mir? Ein Alptraum, beruhigte ich mich. Dann muss ich wohl wieder eingeschlafen sein. Okay, ich hatte in den letzten Tagen viel zu wenig geschlafen. Vielleicht holte mein Körper sich jetzt einfach, was er so dringend gebrauchte.
Jemand berührte mich, strich mir zärtlich über den Kopf. Das war wie im Traum. Keine Stimme. Keine Worte. Aber ich spürte genau, dass dieser Jemand da war. Ich spürte eine warme Hand, die die meine nahm und festhielt. Lange Zeit. Ich fragte mich, wer das war. Und ich ärgerte mich darüber, dass ich immer und immer wieder einschlief.
»Stella?«, fragte eine fremde Stimme irgendwann.
Ich konnte nicht antworten, so sehr ich auch wollte. Jemand hielt vorsichtig meine Hand, so vorsichtig, als befürchtete er, sie könne zerbrechen. Ich versuchte mit aller Macht, meine Hand wegzuziehen.
»Sie hat sich bewegt. Ich glaube sie wacht auf«, vernahm ich eine leise, fremde Stimme. Sie war direkt neben mir, ganz deutlich und klar. Nein, ich kannte diese Stimme nicht. Noch nie gehört. Sie gehörte zu einem Mann, glaubte ich. Oh mein Gott! Jetzt hört sich aber alles auf! Was hatte ich nur angestellt?, überlegte ich krampfhaft. Ein fremder Mann neben mir im Bett! In meinem Bett?!
Mein Herz pochte schneller. Die nächsten Versuche, aufzustehen, schlugen ebenso fehl, wie der erste. Okay, du musst erst einmal richtig aufwachen, Stella, sagte ich in Gedanken zu mir selbst.
Mühsam blinzelte ich. Es schien schon spät zu sein. Grelles Tageslicht blendete mich. Ich glaubte inzwischen nicht mehr daran, zu träumen. Mein Wecker hatte doch Weckwiederholung. Weshalb hatte er noch nicht wieder gepiept? Bisher hatte ich mich immer auf ihn verlassen können. Hatte der Fremde, der eben gesprochen hatte, das Ding einfach ausgestellt? Wenn ich nur wüsste, wie der Kerl in mein Bett gekommen ...
Ich konnte mich an nichts erinnern, sosehr ich mich auch anstrengte. Irgendwann musste ich schließlich doch wieder eingeschlafen sein. Das war mir inzwischen egal. Eine eigenartige Gleichgültigkeit hatte Besitz von mir ergriffen. Das änderte sich schlagartig, als furchtbare Schmerzen mich quälten, die mich in meinen Dämmerzustand zurückholten. Ich glaubte fast, mir die Rippen gebrochen zu haben. Jeder Atemzug fiel mir unsagbar schwer. In meinem Kopf hämmerte es furchtbar und ich wurde das Gefühl nicht los, dass er jeden Augenblick zerplatzen konnte. Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Nichts war richtig. Das machte mir Angst. Mein Herz schlug schneller. Ich rang nach Luft. Der Piepton setzte wieder ein. Laut, deutlich und unnachgiebig. Gnadenlos quälte er meine Ohren und bohrte sich schmerzhaft in meinen Kopf. Hör auf!, schrien meine Gedanken. Nun hörte ich, wie Leute zu mir hereinkamen. Ich hörte mehrere Stimmen, die ich nicht kannte. Wieder griff die Angst eiskalt nach mir. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass dieser böse Traum endlich aufhören und ich endlich aufwachen würde. Meine Arme mussten eingeschlafen sein. Sie kribbelten furchtbar bis in die Fingerspitzen. Ich versuchte, meine Finger zu bewegen. Und... ich konnte sie bewegen! Ich rieb sie gegeneinander. Das hatte schon manchmal geholfen. Dann versuchte ich, zum wer weiß wievielten Mal, die Augen zu öffnen. Es war extrem hell. Das grelle Licht blendete und stach schmerzhaft in meinen Augen, deshalb schloss ich sie wieder. Die fremden Stimmen redeten durcheinander. Ich verstand nur Wortfetzen.
»Sie ist wach«, verstand ich.
Wach?, fragte ich mich. Ich zweifelte daran. Ich wurde berührt. Jemand schob mein Augenlid hoch, während er mit einem brutalen Licht davor herumfunzelte.
Ich murrte. Ich wehrte mich und kniff die Augen fest zu. Wer war das? Ich kam mir wie ein Versuchskaninchen vor. Ich konnte nicht fliehen. Deshalb wünschte ich mir meinen Tiefschlaf herbei, um einen zweiten Versuch zum Erwachen zu haben. Ja, dachte ich, beim zweiten Mal Aufwachen klappt es bestimmt besser. Die Leute gingen weit weg und es wurde still um mich herum. Mann! Ich musste mächtig durcheinander sein und zweifelte einen Augenblick an meinem Verstand. Verrückt! Doch ich wurde das Gefühl nicht los, verschlafen zu haben. Ich hatte mit Sicherheit verschlafen.
Warum hatte niemand mich richtig wachgerüttelt? Warum hatte niemand angerufen? Wie sollte ich heute bloß alles schaffen? Noch schneller laufen? Schneller arbeiten?
Das hatte ich in letzter Zeit nur noch getan. Ich hatte immer gedacht, dass das eines Tages weniger wird. Aber das war ein Trugschluss. Eine ebensolche Fatamorgana, wie schneller zu arbeiten, um schneller fertig zu werden.
Ha! Blödsinn! Ich hatte das Gefühl, nie mehr fertig zu werden. Dabei war ich gerade erst vierundzwanzig geworden und stand mit beiden Beinen im Leben.
Ich hatte seit vier Jahren eine kleine Wohnung in der Donaustraße, am Stadtrand Erfurts, auf die ich sehr stolz war.
Ich hatte in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, Labordiagnostik studiert und mich einem Forschungsarbeitskreis angeschlossen. Der Job machte mir wirklich Spaß, denn er war eine Herausforderung. Ich war besessen davon, die Welt zu retten. Ich war schlichtweg glücklich, hatte einen Freund und meine Eltern wohnten nicht weit entfernt. Anfangs hatte ich sie noch jedes Wochenende besucht. Später alle paar Wochen. Wir hatten oft miteinander telefoniert, um uns davon zu überzeugen, dass es uns gut ging. Eines Tages ging am anderen Ende niemand mehr ans Telefon. Wenig später bekam ich einen Anruf, der meine heile Welt zerstörte. Meine Eltern waren bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Wenige Wochen danach hatte mein Freund mich betrogen. Ich war tief verletzt und wütend, deshalb setzte ich ihn kurzerhand vor die Tür. Plötzlich war ich völlig allein. So allein wie in diesem Augenblick hatte ich mich noch nie gefühlt. Es gab wirklich niemanden mehr, nicht mal Geschwister. Ich hatte noch eine Tante, die Schwester meines Vaters, die allerdings einen amerikanischen Soldaten geheiratet hatte, mit dem sie vor zig Jahren nach Texas gezogen war. Mein Leben war aus der Bahn geraten, ob ich es wollte oder nicht. Ich stürzte mich also in meine Arbeit. Wen würde es interessieren, wenn ich heute den ganzen Tag im Bett bliebe, um mich mal richtig auszuschlafen. Ich lächelte triumphierend in mich hinein. Und plötzlich war mir alles egal. Sollte doch alles warten. Trotzig ließ ich mich tiefer in meine Kissen sinken, die unter mir nachzugeben schienen.
Wenn nur diese Kopfschmerzen aufhören würden, wünschte ich mir. Vielleicht ist das Migräne? Das soll vorkommen, wenn man dauernd Stress hat. Schlaf ist in solchen Fällen schließlich die beste Medizin, dachte ich noch. Dann musste ich wieder eingenickt sein.
Irgendwann bemerkte ich, dass wieder jemand in meinem Zimmer war. Ich hatte komischerweise das Gefühl, tagelang geschlafen zu haben. Dennoch fühlte ich mich niedergeschlagen und noch immer müde. Dieser Jemand massierte unermüdlich meine Hand und meinen Arm. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Ich hörte keine Stimme.
Wer hier so alles ein- und ausgeht, ohne mich zu fragen! Mir würde doch auch nicht einfallen, einfach in fremde Schlafzimmer einzudringen.
Wieder musste ich in mich hinein lachen. Die Massage tat tatsächlich gut. Meine Hände und Arme kribbelten nicht mehr. Ich seufzte zufrieden. Sollte ich jetzt vielleicht aufstehen? Nein! Ich genoss weiter die Massage. Die tat so gut. Die Berührungen der fremden Hände tat gut. Ich wollte nicht, dass das aufhörte. Wie lange hatte mir niemand die Hände gestreichelt? Gerade in diesem Augenblick wurde mir bewusst, wie sehr ich liebevolle Berührungen vermisste.
Meine Wut war längst verflogen. Es war sechs Monate her, seit mich mein Verlobter verlassen hatte und von Männern hatte ich die Nase gestrichen voll. Das Wort Verantwortungsbewusstsein schien im männlichen Sprachgebrauch und Leben gänzlich zu fehlen. Wer würde das schon verstehen?! Männer jedenfalls nicht. Männer und Frauen waren zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, die nur äußerlich zusammen passten. Manchmal. Bei diesem Gedanken musste ich schmunzeln.
»Kitzelt es?«, fragte eine männliche Stimme belustigt.
Ich erschrak innerlich. Hoffentlich würde ich nicht rot anlaufen! Ich öffnete die Augen und blinzelte, um zu sehen, wer das gefragt hatte. Doch das Bild verschwamm herzlos vor meinen Augen, ohne dass ich den, der mich gerade verwöhnte, sehen konnte. Das bedauerte ich sehr.
*****
Die Stimmen, die in mein Zimmer kamen und mit mir redeten, waren nah, real und wurden deutlicher. Manche kamen mir inzwischen bekannt vor, obwohl ich die dazugehörigen Menschen nicht aus meinem früheren Leben kannte. Allmählich wurde mir auch bewusst, dass es nicht mein Bett war, in dem ich lag. Die Bilder vor meinen Augen wurden langsam klarer. Das waren Schwestern, Pfleger und manchmal Ärzte. Sie schienen sich ehrlich darüber zu freuen, dass ich langsam erwachte. Aus dem Koma!? Mein Herz raste und ich riss die Augen weit auf. Ich war auch jetzt nicht allein.
»Sie ist wach! Rufen Sie Professor Winter«, rief eine weibliche Stimme, die fast ebenso aufgeregt war wie ich. Ich war wach!
Ich sah mich im Zimmer um. Mein Nacken schmerzte. Aber das war mir egal. Meine Augen funktionierten. Wow! Das Licht blendete mich, doch ich weigerte mich strikt, die Lider deshalb wieder zu schließen. Ich hatte Angst, wieder einzuschlafen. Ein Fenster mit Jalousie, ein weißer Schrank, undefinierbare Kästen, Apparate und Kabel konnte ich erkennen. Um Himmels willen! Was war passiert? Mühsam versuchte ich mich zu erinnern. Ich wollte nur noch schnell einkaufen… Ja, genau...nach der Arbeit. Es war spät und bereits dämmrig. Ich hatte Angst, dass die Geschäfte schlossen, denn ich hatte nichts mehr zu essen. Oh ja, ich hatte Hunger.
Ein Mann mittleren Alters betrat den Raum. Er hätte mein Vater sein können. Durch sein volles schwarzes Haar zogen sich deutlich einige Silberstreifen. Er trug einen weißen Kittel, der offenstand. Darunter sah ich ein blau-gestreiftes Hemd. Er lächelte mir freundlich entgegen und musterte mich aufmerksam. Dann setzte er sich zu mir auf den Bettrand, als wäre er ein Besucher oder ein alter Freund. So hätte es mein Vater getan, wäre er noch am Leben.
»Na, wie geht es Ihnen?«
Ich wollte antworten, doch das schien nicht so einfach zu sein, wie ich mir das vorstellte. Mühsam formte ich meinen Mund. Doch meine Zunge machte, was sie wollte. Sie störte. Also versuchte ich, zu nicken. Es gelang mir tatsächlich. Der Arzt stellte sich vor. Doktor Winter, der ein Professor war. Er beugte sich weit über mich, als wolle er sich auf mich legen und quälte mich mit dem Licht seiner Taschenlampe. In meinen Augen zuckten Blitze. Für einen Augenblick sah ich gar nichts mehr. Ich wollte protestieren und hörte mich murren. Na immerhin. Doktor Winter beruhigte mich.
»Alles in Ordnung, Frau Fröbel. Von nun an machen wir Fortschritte. Jeden Tag einen kleinen.«
Witzbold!, dachte ich. Nichts ist in Ordnung! Kann mir vielleicht einer sagen, was ich hier mache? Weshalb habe ich geschlafen? Und wie lange? Warum habe ich einen steifen Nacken und Kopfschmerzen? Wann kann ich endlich wieder aufstehen? Und überhaupt!
Der freundliche Doktor ging. Typisch! Nie hatten die Zeit für ihre Patienten. Nie sagten sie einem, was los war. Aus irgendeinem Winkel meines Bewusstseins stieg wieder die tief in mir vergrabene Wut herauf.
Ich schnaufte. Laut und deutlich.
Der Professor drehte sich zu mir um. Noch immer lächelte er. Auch das machte mich wütend. Mir war ganz und gar nicht nach Lächeln zumute. Ich musste sicher furchtbar aussehen. Nur gut, dass es hier keinen Spiegel gab. Doktor Winter kam zurück, setzte sich zu mir auf das Bett und wies mit der Hand auf meine Stirn. »Was für hässliche Sorgenfalten! Ich kann Sie verstehen. Sie wollen wissen, weshalb Sie bei uns sind, nicht wahr?« Ich nickte.
»Also«, begann er und sein Lächeln schlich sich aus seinen Gesichtszügen.
»Sie hatten einen Unfall, Frau Fröbel. Jemand hat Sie mit einem Auto angefahren und vom Fahrrad geschubst. Sie sind auf den Asphalt geflogen. Nur gut, dass Sie einen Helm getragen hatten, sonst...« Winter wiegte den Kopf.
»Der hat Ihnen womöglich das Leben gerettet.«
Ich bemerkte deutlich, dass ich den Mann anstarrte. Ich wartete, was nun kommen würde. Mein Blick klebte förmlich an seinen Lippen. Seine Gesichtszüge blieben ernst und wenn mich nicht alles täuschte, meinte ich sogar Besorgnis darin zu erkennen.
Oh mein Gott! Warum hatte es ausgerechnet mich erwischt?
In der Stadt gab es tausende Fahrradfahrer.
»Und?«, vernahm ich überrascht meine eigene Stimme fragen, als wäre es eine fremde. Ich war erschrocken.
»Ihr Schädel war hart genug, das Schädel-Hirn-Trauma und das Schleudertrauma wegzustecken. Ihr Kopf ist wieder in Ordnung, auch wenn Sie noch hin und wieder Schmerzen haben. Durch die erlittenen Prellungen können Schmerzen ebenso im Nacken, den Schultern und den Rippen auftreten. Das wird nach einiger Zeit abklingen, sodass sie bald wieder ohne Schmerzmedikamente auskommen werden.«
Ich nickte, zum Zeichen, dass ich verstanden hatte, was er mir gesagt hatte.
»Allerdings sind zwei ihrer Lendenwirbel angebrochen. Das heißt…« Er machte eine Pause und schien nach den passenden Worten zu suchen.
Mich durchflutete ein Hitzeschauer, der meine Haut frösteln ließ.
Querschnittsgelähmt? Rollstuhl? Ich rang nach Luft.
Professor Winter legte die Hand beruhigend auf meine Schulter.
»Sie müssen geduldig sein. Zum Glück wurden Sie umgehend zu uns verlegt.«
»Wo bin ich?«, wisperte ich.
»Im Querschnittzentrum, Paraplegiologie und Neurologie Bad Berka. Vielleicht …«
Ich spürte, wie meine Kinnlade nach unten klappte. Entsetzt starrte ich Winter an. Mir war plötzlich schwindlig und übel. Ich musste kreidebleich sein. So fühlte sich das jedenfalls an.
»Vielleicht…«, nahm der Professor seine Ausführungen wieder auf, »kann ich Ihnen helfen, wieder auf Ihre eigenen Beine zu kommen.«
Ungläubig schüttelte ich mit meinem Kopf.
Nein!, schrien meine Gedanken. Nein! Das ist nicht wahr!
»Wir schaffen das, Stella! Ich habe mich auf solche Fälle…«, Winter räusperte sich, »…spezialisiert. Ich kann zwar nicht zaubern, aber ich bin davon überzeugt, dass ich Ihnen helfen kann. Ihre Chancen stehen gut, doch Sie müssen geduldig sein «, vernahm ich seine Worte.
Das Gesicht des Arztes verschwamm vor meinen Augen.
Ich spürte die ersten Tränen in meinen Augen. Selbst die Nase hatte ich voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schniefte. Professor Winter zog von irgendwoher ein Taschentuch und tupfte vorsichtig an mir herum, als wäre ich zerbrechlich. Wahrscheinlich war ich das gerade auch. Zerbrochen. Alles in mir war gerade zerbrochen. Ich war vierundzwanzig und wollte doch lieber tot sein.
Verdammt! Welcher Idiot hatte mir das angetan!
Anstatt mich weiter meinem Selbstmitleid hinzugeben, ergriff eine unbeschreibliche Wut Besitz von mir.
Möglicherweise gab gerade diese Wut mir die Kraft, die ich im Moment brauchte, um nicht aufzugeben. Der Professor nickte mir aufmunternd zu. Mit dem Anflug
seines Lächelns verabschiedete er sich von mir. Ich atmete hörbar tief durch.
»Ach, noch etwas«, wandte er sich noch einmal zu mir um, als er den Türdrücker bereits in der Hand hatte. »Die Polizei war bereits einige Male hier, um sich nach Ihnen zu erkundigen. Die haben einige Fragen an Sie. Aber ich werde sie erst zu Ihnen lassen, wenn Sie dazu bereit sind.«
Winter legte den Kopf schräg und schien auf eine Antwort zu warten. Unfähig, zu reagieren, starrte ihn an.
»Das ist sehr wichtig«, betonte er.
Er wusste genau, dass ich ihn verstanden hatte.
Ich nickte schließlich. Winter ging und schloss hinter sich die Tür. Ich war nun allein mit meinen Gedanken, die sich in meinem Kopf überschlugen und sich hoffnungslos verknoteten. Es würde sicher Jahre dauern, bis ich wieder klar denken konnte.
Ich sah mich im Zimmer um. Nichts hatte sich verändert.
Die Einrichtung war karg. Ich war wach und mir war langweilig. Durch die halb herabgelassene Jalousie knallte mir grelles Sonnenlicht entgegen. Wie gern hätte ich jetzt zum Fenster hinausgesehen. Plötzlich spürte ich das unnachgiebige Verlangen, einfach aufzustehen und zum Fenster zu gehen. Ich verzog das Gesicht zu einem bitteren Lächeln. Noch immer hing ich an diesen undefinierbaren Apparaten, die mich wie gnadenlose Wächter überwachten und die jede Bewegung, jeden Atemzug, ja vielleicht sogar meine Gedanken registrierten. Ich fühlte mich beobachtet.
Misstrauisch schielte ich zu den Kabeln und den Monitoren. Vorsichtig schob ich die Bettdecke weg. Ich wollte meine Beine sehen. Ich wollte wissen, ob sie noch da waren. Sie waren da und sahen aus, wie ich sie kannte, nur etwas blasser vielleicht. Mit Verachtung starrte ich auf den Blasenkatheter, während die Decke in Richtung Boden rutschte. Reflexartig wollte ich danach greifen und konnte meinen Absturz nur um Haaresbreite verhindern. Zitternd hing ich am Bettrand und schnappte nach Luft. Die Geräte, meine Wächter, schrien sofort Alarm. Mein Herz schalt mich mit hastigen Schlägen. Mein Kopf ebenfalls. Mühsam bugsierte ich mich in meine Ausgangsposition. Geschafft! Bevor ich auch nur einen Gedanken über mein Missgeschick verschwenden konnte, flog die Zimmertür auf. Eine Schwester erschien.
Sie wirkte offensichtlich erschrocken. Dennoch fragte sie freundlich: »Alles okay?«
Ich nickte.
»Die Decke«, murmelte ich.
Sie lächelte.
»Kein Problem. Ich bin Jenny«, erwiderte sie und hob die Bettdecke vom Boden auf. »War dir zu warm?«
Jenny duzte mich. Eigentlich war ich froh darüber. Sie schien etwa in meinem Alter zu sein. Ihre Stupsnase war von Sommersprossen umrandet und ihre grünen Augen blickten mich fröhlich an. Ihr rötlich schimmerndes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, der hinter ihrem Kopf tanzte , während sie mich wieder zudeckte.
»Danke«, sagte ich leise und räusperte mich.
»Ich bin Stella.«
Jenny grinste mich überaus belustigt an.
»Ich weiß. Schön dich kennenzulernen.«
Jenny tat mir gut.
»Kann ich irgendetwas für dich tun?«, fragte sie. »Hier ist übrigens eine Klingel, falls du mich brauchst.«
Ich rang mir ein Lächeln ab. Es funktionierte.
»Ich habe ein großes Problem«, begann ich zu sprechen.
Die Worte kamen mir nur mühsam über die Lippen, aber mit jedem Wort funktionierte auch das besser. Der erste Fortschritt, dachte ich und war stolz darauf.
»Ich will duschen, Zähne putzen, Haare waschen, etwas Schickes anziehen und vor allem will ich diese Bodyguards loswerden.«
Jenny nickte verständnisvoll.
»Geht klar«, versprach sie mir. »Ich organisiere alles und komme dann wieder.«
Ich war erleichtert. Ich freute mich ehrlich und ich spürte ein strahlendes Lächeln in meinem Gesicht.
Jenny grinste.
»Schön, dich Lächeln zu sehen, Stella! Wir machen gleich eine Prinzessin aus dir«, sagte Jenny und war postwendend verschwunden, bevor ich protestieren konnte.
Wieso wir?!
Von dieser Sekunde an erwischte ich mich, wie ich inständig darum bettelte, dass ich schneller sein würde, als die Polizei.
*****
Es klopfte kurz und laut an der Tür. Ich erschrak.
Die Polizei?!
Nein, es war Jenny die zur Tür hereinkam. Sie grinste hintergründig. Hinter ihr tauchte ein Mann auf. Ein sehr junger Mann, wie ich fand.
Will der etwa…?!
Ich schnappte nach Luft, wagte aber nicht zu protestieren. Die Tür fiel ins Schloss. Weiter kam niemand herein. Erleichtert ließ ich die Luft durch den schmalen Spalt meiner Lippen heraus.
»Keine Angst. Das hier ist Peter, unser Physiotherapeut.
Er wird uns beiden helfen«, beruhigte Jenny mich.
Sie konnte ja nicht ahnen, wie sehr mich das beunruhigte. Der Mann namens Peter grinste. Okay, er wirkte auf den ersten Blick harmlos. Aber musste das wirklich sein?
»Guten Tag«, begrüßte er mich.
Der Physiotherapeut trug hellblaue Baumwollhosen und ein lässiges Shirt, auf dass ein weißes Stück Stoff genäht war. Ich bemühte mich, die kleinen Buchstaben darauf zu entziffern.
»Ich bin Peter. Schön dich kennenzulernen«, sagte er, während er mir lächelnd die Hand reichte . Er war der Erste der das tat, seit ich hier war. Ich starrte ihn an. Er war nur wenig größer als Jenny, hatte eine Durchschnittsfigur und strahlte mich aus seinen rehbraunen Augen ehrlich an. Das braune, lockige Haar auf seinem Kopf erinnerte mich an den Wischmopp meiner Großmutter. Dieser Gedanke veranlasste mich dann doch zu einem Lächeln.
»Hallo«, erwiderte ich schüchtern.
»Peter Lustig«, kicherte Jenny, während sie mit dem Finger auf den Physiotherapeuten zeigte.
»Nein, Peter Fröhlich«, stellte er richtig. »Ernsthaft. Das ist mein Name«, fügte er hinzu.
Er musste meinen zweifelnden Blick wohl gesehen haben. Doch Zweifel waren mir egal. Verzweiflung hätte es wohl eher getroffen. Ich hatte Zeitdruck. Ich wollte frisch geduscht und frisiert sein, wenn die Polizisten kamen. Womöglich konnten das nur Frauen verstehen.
Deshalb beschloss ich, das dem Physiotherapeuten unmissverständlich klar zu machen.
»Herr Fröhlich, Schwester Jenny möchte mich gern duschen und mir die Haare waschen. Ich erwarte nämlich Besucher, die gleich kommen werden, und ich möchte gern vorher salonfähig sein. Wenn Sie also bitte später … wiederkommen würden…?«
Peter, der meiner Schätzung nach sicher nur wenig älter war als ich selbst, schüttelte entschieden den Kopf.
»Ohne mich wirst du dich nicht aus diesem Bett bewegen, Stella Fröbel. Anordnung vom Professor.«
Niedergeschlagen akzeptierte ich das Unvermeidliche.
»Okay«, gab ich mein kleinlautes Einverständnis.
Peter baute sich seitlich vor meinem Bett auf, Jenny hinter meinem Rücken. Nun erklärte er mir unsere erste gemeinsame Übung: Aufrichten und auf dem Bettrand sitzenbleiben. Ich war beruhigt. Wenn es weiter nichts war. Das war doch eines der einfachsten Dinge der Welt.
Dachte ich! Als Peter und Jenny mir beim Aufrichten halfen, wurde mir nicht nur schwindelig, sondern auch übel. Ich kämpfte tapfer dagegen an und gab nichts dergleichen zu. Ich spürte mich in Peters Arme sinken und blinzelte in sein Gesicht.
»Wirklich alles okay?«, zweifelte er.
»Ja!«, entgegnete ich entschieden.
Sein Lächeln machte mir Mut. Ich schaffte es tatsächlich, auf dem Bettrand sitzenzubleiben. Meine Beine baumelten. Bis zum Boden reichten sie nicht. Peter und Jenny wagten beide nicht, mich loszulassen. Die Frage, weshalb sie nicht losließen, erübrigte sich bereits in dieser Sekunde. Mein Bett schwankte plötzlich wie ein Boot auf hoher See und schlagartig wurde mir speiübel.
Als ich glaubte, mich gegen meinen Willen um meine eigene Achse zu drehen, wurde es dunkel. Ich riss die Augen auf, doch es blieb tiefschwarz.
»Stella?«, vernahm ich Peters besorgte Stimme.
Allmählich wich das Schwarz einem gleißenden Nebelschleier. Es wurde wieder hell. Aus dem Nebel tauchten vor meinen Augen zwei Gesichter auf. Ich fand mich im Bett liegend wieder. Peter und Jenny lächelten.
Ich nicht! Ich war enttäuscht. Mein Traum von einer erfrischenden Dusche zerplatzte. Mir war zum Heulen zumute. Ich wollte niemanden mehr sehen.
»Hey, wer wird denn gleich das Korn in die Flinte stopfen?«, fragte Peter herausfordernd.
»Das kriegen wir schon hin, Stella«, versuchte auch Jenny mich zu ermutigen.
»Wann!«, schrie ich verzweifelt.
»Dein Körper hat sechs Wochen gelegen und sich ausgeruht. Nun muss er sich erst langsam wieder daran gewöhnen, dass er etwas tun muss.«
»Sechs Wochen…?«, wisperte ich.
»Ich verstehe, dass du sofort duschen möchtest. Das würde mir genauso gehen. Fühlt sich einfach eklig an«, sagte ausgerechnet Peter.
Ich sah ihn bittend an. Ich wusste nicht wie, aber in mir flackerte ein Hoffnungsschimmer auf.
»Bitte«, flüsterte ich.
Peter nickte Jenny zu. »Hol uns den Lifter.«
Jenny verschwand postwendend und Peter setzte sich zu mir aufs Bett.
»Wir fahren dich in unser Pflegebad. Danach fühlst du dich wie neu geboren«, sagte er.
»Ich habe ja nichts zum Anziehen«, wagte ich, ihm mein nächstes Problem zu beichten.
»Stimmt«, bestätigte er und grinste hintergründig. »Die Sachen, in denen du eingeliefert wurdest, waren kaputt, zerschnitten und sind entsorgt worden. Du wirst deinen Besuch nackt empfangen müssen.«
Ich spürte sehr deutlich, dass ich schamrot anlief. Plötzlich fühlte ich mich ausgeliefert. Jenny kam mit dem Lifter herein und rückte ihn direkt an mein Bett. In ein Duschtuch durfte ich aufgrund meiner Diagnose nicht.
Jetzt ging alles ziemlich rasch. Noch bevor ich etwas sagen konnte, lag ich auf dem kalten Ding und wurde mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt. Ich biss die Zähne zusammen. Nicht ein Wort wollte ich sagen. Wenn das der einzige Weg zu meinem Ziel war, musste ich da durch. Auf dem Flur zog ich die Bettdecke über mein Gesicht, soweit der Gurt das zuließ. Es war nur ein Zipfel.
Zur Sicherheit schloss ich die Augen. Erst als die beiden mich durch die Tür in einen Raum geschoben hatten, lugte ich vorsichtig wieder hervor. Ich hörte das Wasser laufen. Es strömte in eine große Wanne, die mitten im Raum stand. Angenehmer Duft durchströmte den Raum und benebelte meine verwirrten Sinne. Jenny stahl mir meine schützende Bettdecke, doch es blieb angenehm warm. Peter machte tatsächlich keine Anstalten, den Raum zu verlassen, doch ich wagte nicht, zu protestieren. Jenny zog mir das Nachthemd vorsichtig vom Körper, das ohnehin nur ein Stück Baumwollstoff aus dem Klinikfundus war. Und schon ließ Peter vorsichtig den Lifter hinab in das Wasser.
»Sage bitte, wenn es dir zu heiß oder zu kalt ist, Stella.«
»Alles in Ordnung«, antwortete ich.
Das fühlte sich gut an. Verdammt gut! Ich schloss die Augen und genoss den Augenblick. Alles andere um mich herum rückte weit, weit weg. Ich vergaß sogar, dass meine Beine gelähmt waren. Sie bewegten sich sanft im Wasser. Ich gab mich dem Traum hin, dass ich tiefenentspannt zu Hause, in meiner eigenen Badewanne saß.
Tiefe Ruhe und Selbstzufriedenheit beherrschten mich.
Ich musste wohl gerade lächeln, als Peter leise bemerkte: »Wenn Sie lächelt, sieht sie sogar hübsch aus.«
Ich hörte Jenny leise kichern.
Ach die beiden, dachte ich, und war glücklich darüber, dass sie da waren. Als ich hörte, dass die Tür ins Schloss fiel, öffnete ich die Augen. Peter war nicht mehr da.
»Na, wie fühlt sich das an?«, fragte Jenny.
»Mehr als gut«, strahlte ich.
Jenny schrubbte meine Beine, während sie mir erklärte, das sei perfekt für die Durchblutung. Dann waren meine Haare an der Reihe. Ich freute mich über das Haarewaschen. Ehrlich! Ich hatte halblanges Haar, dass ich gelegentlich mit einem Gummi zusammenhielt oder hoch-steckte. Seit ich erwacht war, hatte ich das nicht mehr gekonnt. Erst als Jenny mich aus dem Wasser gehoben und in warme, trockene Badetücher gehüllt hatte, kam Peter zurück. Er baute sich vor mir auf und grinste triumphierend, als er ein Stück Stoff vor meinen Augen präsentierte.
»Das ist zwar kein Nachthemd, aber vielleicht ziehst du mein Shirt ja der puren Nacktheit vor.«
Er fasste es an den Schulternähten und schüttelte es auf.
Natürlich stand sein Name darauf. Doch der niedliche Teddy, der mir jetzt entgegenlachte, brachte mich zum Schmunzeln.
»Danke, Peter, Sie sind...«, ich suchte nach den passenden Worten. Schließlich hatte auch mein Kopf sich sechs Wochen lang ausgeruht und musste erst wieder trainiert werden.
»Einmalig und fast perfekt«, ergänzte er.
»Ja«, bestätigte ich. Das war er. Er hatte es innerhalb einer Stunde geschafft mich aufzubauen, mir einen sehnlichen Wunsch zu erfüllen und mich zum Lachen zu bringen. »Und das ist wirklich Ihr Shirt?«, zweifelte ich dennoch.
»Dein Shirt! Klar! Manchmal arbeite ich auf der Kinderstation. Kommt Ihr zwei jetzt allein zurecht? Ich muss kurz zur Besprechung.«
»Natürlich«, entgegnete Jenny.
Jenny war sehr nett. Sie hatte sich in dem straffen Klinikalltag tatsächlich Zeit für mich genommen. Sie gab mir das Gefühl, dass es ihr wichtig war, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Als ich trocken war und von Kopf bis Fuß eingecremt duftete, kämmte sie mein Haar. Ich tolerierte inzwischen sogar das etwas aufgestellte Kopfteil des Lifters.
»Die Frisur mache ich dir im Bett, Stella. Ich halte es hier drin nicht mehr länger aus«, pustete sie.
Die Luft im Bad war heiß, feucht und neblig. Im Flur hingegen schlug mir kalte Luft entgegen.
»Oh, haben wir einen Neuzugang, Schwester Jenny?«,
fragte Professor Winter, als er den Flur entlang eilte und für einige Sekunde innehielt. Er lächelte und zwinkerte mir zu.
»Nein, Professor Winter, ich habe Stella nur durch den Vollwaschgang gejagt.«
»Sehr schön«, meinte er, während er bereits weitereilte.
Die Luft in meinem Zimmer war angenehm frisch und das Bett neu bezogen. Jenny packte mich hinein und machte sich mit dem Föhn daran, mein Haar zu frisieren.
Sie war ein Engel. Ich staunte nicht schlecht, als sie mir ein dezentes Make-up verpasste. Ich fühlte mich wunderbar, einfach gut und glücklich.
»Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann«, sagte ich und spürte Tränen der Rührung in meinen Augen.
»Jetzt fang bloß nicht an zu heulen, bevor du in den Spiegel geschaut hast«, sagte sie energisch.
Ich schniefte und zwinkerte, bevor ich ein strahlendes Lächeln aufsetzte. Das fiel mir in diesem Augenblick nicht schwer. Ich wollte Jenny nicht enttäuschen und mich nicht vor meinem Spiegelbild erschrecken.
Schließlich hielt Jenny einen großen Spiegel vor mich.
Mein Herz klopfte vor Aufregung. Ich hatte fast Angst davor, mein Spiegelbild zu sehen. Doch als ich hineinsah, lächelte mir ein bekanntes Gesicht entgegen, das ich aufmerksam musterte.
»Danke Jenny«, flüsterte ich. »Danke.«
Nur gut, dass ich mich vorher nicht hatte sehen können, dachte ich und musste grinsen.
In dem Augenblick öffnete sich die Zimmertür. Peter erschien. Er starrte mich an. Nur einen Augenblick.
»Wow«, sagte er. »Prinzessin Stella, sind Sie bereit für
die Audienz?«
»Sind sie etwa schon da?«, fragte ich erschrocken.
»Ja. Ich habe sie bereits seit fünf Minuten davon abgehalten, dieses Zimmer zu betreten.«
»Danke, Peter!«
Jenny packte rasch alle Utensilien auf den Lifter, den sie gemeinsam mit Peter, hinausschob.
Ich atmete tief durch und blickte angespannt zur Zimmertür.
*****
Kaum drei Sekunden später klopfte es.
»Herein«, sagte ich.
Ein fremder Mann und eine ebenso fremde Dame betraten das Zimmer. Beide grüßten freundlich. Ich betrachtete beide skeptisch, denn sie trugen keine Uniformen.
»Guten Tag, Frau Fröbel. Mein Name ist Kamith. Das ist meine Kollegin Bergmann. Wir haben ein paar Fragen an Sie«, begann der Mann, der sich mit Namen vorgestellt hatte, ganz sachlich.
Sein Blick verriet nichts. Er war schätzungsweise um die fünfzig Jahre und wirkte sportlich. Die Frau war wesentlich jünger. Sie hatte ihre blonden Haare hoch-gesteckt und lächelte mich an.
»Schön, dass Sie wach sind, Frau Fröbel. Wie geht es Ihnen?«, fragte sie mitfühlend.
»Setzen Sie sich doch«, entgegnete ich. Dann können wir uns auf gleicher Höhe in die Augen sehen, dachte ich.
Die beiden nickten und holten sich tatsächlich die Stühle heran. Ich war etwas erleichtert. Schließlich waren das die Leute, die mir helfen wollten oder auch sollten.
»Können Sie sich an irgendetwas erinnern«, fragte Kamith.
Ich überlegte angestrengt. Das hatte ich bereits so oft getan. Doch wirkliche Zusammenhänge konnte ich in meinen Gedanken nicht finden.
»Es ging alles so plötzlich«, begann ich leise zu erzählen.
»Ich war auf dem Weg von meiner Arbeit zum Supermarkt. Es war schon spät und dunkel. Ich war hungrig und hatte nichts mehr zu Hause. Ich hoffte, dass ich es noch schaffen würde, bevor der Markt schließt.«
»Sie hatten es also sehr eilig?«
»Ja.«
»So eilig, dass Sie das Auto nicht gesehen haben?«
»Nein!« Was wollte mir der Polizist, oder was immer er war, unterstellen? »Was soll das?«, fragte ich empört.
»Nun«, redete die Bergmann weiter. »Nun, in diesem Sinn war die Aussage des Autofahrers. Er sagte, Sie waren so schnell unterwegs gewesen, dass Sie plötzlich wie aus dem Nichts vor ihm aufgetaucht sind. Außerdem trugen Sie dunkle Kleidung.«
Ich spürte das verräterische Kribbeln meiner unterdrückten Wut durch meinen Körper fahren, während sie sprach.
»Ich fuhr auf dem Radweg!«
»Natürlich, Frau Fröbel. Doch der Radweg kreuzte an der Unfallstelle die Fahrbahn«, gab Kamith zu bedenken. Ich mochte ihn nicht.
»Auch wenn Sie Vorfahrt hatten, waren Sie verpflichtet, Ihr Fahrzeug und sich selbst ausreichend zu beleuchten.«
»Ich hatte vorschriftsmäßiges Licht am Fahrrad. Das weiß ich ganz genau, denn ich hatte es am Tag zuvor vom Händler technisch überprüfen lassen.«
Kamith nahm das zur Kenntnis. Er nickte.
Frau Bergmann klärte mich schließlich auf. Endlich!
»Frau Fröbel, die Aussage des Autofahrers, der Sie angefahren hat, steht gegen die Ihre. Deshalb sind wir mit den Ermittlungen beauftragt, um den Unfall zu rekonstruieren und die Schuldfrage eindeutig zu klären.«
»Wer hat Sie damit beauftragt?«, fragte ich skeptisch.
»Wir gehen davon aus, dass Sie eventuell eine Mitschuld tragen. Die Haftpflichtversicherung ihres Unfallgegners übrigens auch. Die Schuldfrage muss von Rechts wegen in jedem Fall eindeutig geklärt werden.«
Ich wollte aus einem Impuls heraus im Bett hochfahren.
Doch eine unsichtbare Kraft war stärker als mein Wille und drückte mich zurück. Mir wurde schwindlig.
»Ich kann verstehen, dass es Ihnen kaum möglich ist, sich an Einzelheiten zu erinnern. Versuchen Sie es bitte, indem Sie uns einfach alles erzählen, was Ihnen einfällt.
Auch wenn es noch so unwichtig erscheint«, sagte Frau Bergmann mitfühlend. Sie schien etwas Verständnis für meine Lage zu haben.
»Davon, wie wir die Schuldfrage beurteilen, hängen unter anderem auch Ihre Ansprüche gegenüber dem Autofahrer ab«, fügte Kamith hinzu.
»Sie wissen also genau, wer das war?«, fragte ich stoisch.
Ich fühlte weder Freude noch Genugtuung. Alles war unwirklich. Der Kerl war heil davon gekommen. Aber ich würde mein Leben lang dafür büßen müssen.
»Ja«, nickte Kamith. Er blickte mir direkt in die Augen, schien meine stille Frage zu verstehen und schüttelte kaum merklich den Kopf. Ich verstand, dass er mir den Namen des Fahrers nicht sagen durfte oder wollte. Was hätte mir auch irgendein Name genutzt.
»Immerhin ist er bei Ihnen geblieben, hat Erste Hilfe geleistet und hat den Notarzt gerufen.«
»Ist das nicht seine Pflicht gewesen?«, fragte ich mit sarkastischem Unterton.
»Ja, das auch«, entgegnete Kamith und atmete tief durch.
»Bitte erzählen Sie uns, was Ihnen zum Unfallhergang einfällt, Frau Fröbel«, bat Kamith eindringlich und gab mir eine Visitenkarte.
Ich nahm sie, doch ich schob sie unbeachtet unter die Decke.
»Ich sah grelles Licht aufblitzen und spürte im selben Augenblick, wie ich durch die Luft flog. Ich versuchte noch, mich irgendwo festzuhalten. Aber da war nichts.
Plötzlich ein dumpfer Schlag, Schmerzen, der Geschmack von Blut in meinem Mund. Dann nichts mehr. Gar nichts«, berichtete ich leise. »Irgendwie dachte ich, es sei ein Alptraum. Jetzt weiß ich, dass es Realität war.«
Die beiden Menschen vor meinem Bett hatten aufmerksam zugehört und schwiegen eine Weile. Vielleicht warteten sie, ob ich ihnen noch etwas erzählen wollte.
Sie drängten mich in keiner Weise, was ich ihnen hoch anrechnete. Meine Gefühle kursierten zwischen Unsicherheit und Hoffnung.
»Das alles tut uns ehrlich leid, Frau Fröbel«, sagte Frau Bergmann mitfühlend.
Ich glaubte ihr, denn was sie sagte klang ehrlich.
Anschließend erhob sie sich. Kamith auch. Beide verabschiedeten sich, nicht ohne mir gute Genesung zu wünschen. Ich bedankte mich höflich.
Als sie das Zimmer verlassen hatten, war ich wieder allein. Allein mit meinen Gedanken, die mich bis zum Abend nicht mehr losließen und mich die ganze lange Nacht hindurch beschäftigten.
Kapitel 2
Stella boxt sich durch
Dementsprechend hing ich am nächsten Morgen in den Seilen. Die Müdigkeit war pünktlich mit dem Sonnenaufgang am darauffolgenden Morgen gekommen und quälte mich nun. Auch Peter tat das. Er kannte kein Erbarmen. Im Gegenteil. Er schien sich außerordentlich zu amüsieren.
»Das kommt davon, wenn man die ganze Nacht auf Partys herumhängt«, stichelte er.
Ich wusste nur zu gut, dass er mich damit aufziehen wollte. »Neidisch?«, konterte ich deshalb.
Anerkennend verzog Peter das Gesicht. Dann grinste er.
»Ja natürlich. Was dachtest du denn?«
»Kannst du tanzen?«
»Klar! Und du?«
»Du Scheusal!«, rief ich und schleuderte ihm mein Kissen entgegen, das er lässig auffing.
»Wow, was für ungeahnte Kräfte. War das das Zeug in deinem Kaffee oder war es das Gras letzte Nacht?«
»Weder noch!«
Peter schüttelte mein Kissen auf.
»Dort über dir ist ein Griff. Zieh dich daran rauf, wenn du dein Kissen wiederhaben willst«, befahl er.
Widerspruch zwecklos. Ich versuchte es. Ich musste mich anstrengen, den Griff überhaupt zu erreichen. Peter wartete unbeeindruckt. Er machte keine Anstalten, mir zu helfen. Ich kämpfte. Mein Stolz verbot mir, um Hilfe zu bitten. Als ich den Griff endlich fassen konnte, umklammerte ich ihn, so fest ich konnte. Bloß nicht wieder loslassen, dachte ich. Das war mühsam und kräftezehrend.
»Geschafft, Stella! Perfekt. Schau genau dorthin, wohin du willst. Fixiere den Punkt mit deinen Augen, damit dir nicht gleich schwindlig wird«, sagte er leise.
Du hast gut reden, antworteten meine Gedanken. Ich begann zu schwitzen. Meine Arme zitterten und meine Hände verkrampften sich. Selbst mein Bauch protestierte gegen diese Tortur. Meine nicht mehr vorhandenen Bauchmuskeln begannen zu schmerzen.
»Super!«, rief Peter begeistert und stopfte mir endlich das Kissen in den Rücken.
Dann fuhr er das Kopfteil meines Bettes so weit hinauf, dass ich mich anlehnen konnte. Ich schnaufte, nicht vor Wut, aber vor Sauerstoffmangel. Peters lächelndes Gesicht tauchte direkt vor meinen Augen auf.
»Du kannst jetzt loslassen, Stella«, sagte er sanft.
Das tat ich. Meine verkrampften Hände schmerzten.
Peter musste das wissen, denn er massierte sie, sodass sie kurze Zeit später wieder vollkommen locker waren.
Das fühlte sich gut an.
»Ich sitze!«, bemerkte ich ungläubig.
»Ach, ja?«, tat Peter überrascht.
Jetzt trat er zwei Schritte zurück und betrachtete mich.
»Tatsächlich«, bestätigte er.
Ich strahlte vor Freude von tief innen heraus. Ich hatte es geschafft! Ich allein!
»Danke«, sagte Peter.
»Wofür?«
»Für dein Lächeln. Das rettet mir den Tag.«
»Ach, das sagst du doch jeder«, grinste ich frech.
»Stimmt. Ich werde sogar dafür bezahlt«, grinste er frech zurück.
Ich setzte meinen Schmollmund auf und verzog die Augenbrauen.
»Aber keine andere ist so charmant wie du«, fügte er hinzu. Ich seufzte und das muss wohl ziemlich niedergeschlagen geklungen haben.
»Was ist?«
»Das wird mir wohl niemand mehr sagen.«
»Da wäre ich nicht so sicher«, zweifelte Peter.
Ich lenkte unser Gespräch in andere Bahnen.
»Erzähl mir bitte was von dir, was von der Klinik und erzähl, ob jemand mich besucht hat, während ich geschlafen habe.«
Peter begann zu erzählen. Er entpuppte sich als wahre Quasselstrippe und das tat mir gut. So erfuhr ich einiges über die Welt da draußen und über mich selbst. Tatsächlich hatte mich jemand besucht. Doch Peter wusste nicht, wer diese Leute gewesen waren. Er konnte sie auch nicht beschreiben, weil er sie selbst nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Als er mir jedoch von einem jungen Mann erzählte, horchte ich auf. Meine Gedanken wühlten alles um und ich platzte förmlich vor Neugier. Doch auch über diesen Besucher konnte Peter mir nichts sagen, das mich der Lösung des Rätsels näherbringen könnte.
Ich hatte nicht gedacht, dass die Zeit so schnell vergehen kann. Noch bevor unser Gespräch zu Ende war, hatte ich meine physiotherapeutische Übungseinheit für diesen Tag erfüllt und Peter musste weiter. Doch ich wollte noch nicht aufhören. Meine Motivation war gerade erst richtig erwacht. Peter aber meinte: »Allzuviel ist ungesund. Die Dosis macht den optimalen Erfolg aus. Der Professor würde mir persönlich den Hals umdrehen, wenn wir jetzt nicht aufhören.«
»Okay. Dann bis morgen«, erwiderte ich und lächelte tapfer.
*****
Von nun an kämpfte ich jeden Tag für jeden noch so kleinen Fortschritt, um wieder auf die Beine zu kommen, die nicht funktionieren wollten. Die Kommissarin Bergmann hatte mich noch mehrmals besucht und mir mitgeteilt, dass die Schuldfrage inzwischen geklärt war. Ich war tatsächlich zu 20 Prozent an dem Unfall schuldig!
Nicht zu fassen!
Ich versuchte, zu überlegen, was das für nachteilige Folgen für mich bedeuteten konnte.
Irrsinn!, schalten meine Gedanken. Dem Kerl ist nichts passiert, er ist völlig unversehrt und hält es nicht mal nötig, mich zu besuchen… oder nach mir zu fragen!
Ich schwor Rache. Ich wollte diesem Idioten, der mich aus meinem Leben geschossen hatte, gegenübertreten.
Ich wollte ihm meine Meinung entgegenschleudern und ihn verklagen, damit er seines Lebens nicht wieder froh wurde.
Es war Winter, als ich eingeliefert worden war. Den Rest davon hatte ich verschlafen. Ich hatte mir manchmal gewünscht, Winterschlaf halten zu dürfen, dachte ich und musste schmunzeln. Inzwischen hatte der Frühling Einzug gehalten, wenn auch noch nicht im Kalender. Der März hatte gerade begonnen und er brachte neben Sonnenschein und Vogelgezwitscher auch die unbändige Ungeduld mit, hinauszugehen. Ich wollte nicht mehr im Bett bleiben. Ich wollte nicht länger in diesem Zimmer bleiben. Meine Freundin hatte mir ein paar Sachen gebracht. Doch sie hatte wahllos Dinge aus meinem Kleiderschrank eingepackt, die nicht alle meinen Vorstellungen entsprachen. Aber ich wollte nicht meckern.
Ich war froh, dass ich etwas zum Anziehen hatte und dass Peter endlich meinem unnachgiebigen Betteln nach Freiheit nachgegeben hatte.
Eines schönen Tages war es dann soweit. Endlich! Ich saß allein und freihändig auf dem Bettrand, ohne dass mein Kreislauf mir einen Strich durch die Rechnung machte. Erwartungsvoll blickte ich zu dem Rollstuhl, der vor meinem Bett parkte. Obwohl ich dieses Ding vom ersten Augenblick an hasste, war der im Moment die einzige Möglichkeit, mich halbwegs selbstständig fortzubewegen. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich die Herrin über diesen Stuhl sein würde, der alles machen müsste, was ich wünschte.
Prinzessin Stella und ihr Diener.
Na ja, dieses Ding konnte nicht alles, das war mir schon klar. Aber er würde mich zumindest dorthin bringen, wo ich hinwollte. Peter, der Physiotherapeut, lächelte mir zuversichtlich entgegen, als er den Raum betrat.
»Super, Stella! Na dann... Auf in den Kampf!«, trällerte er fröhlich.
»Du hast lange genug im Bett herumgelegen.«
Ich atmete tief durch und lächelte böse.
Peter schien meine Gedanken lesen zu können.
»Ich zeige dir wie du auf deinen Thron kommst, um die Welt zu erobern. Glaub aber nicht, dass ich immer da sein werde, um dich dahinein zu bugsieren. Das ist dein Job.«
Ich brummte missmutig. Mein Humor hielt sich momentan in Grenzen. Peter aber lachte, doch er lachte mich nicht aus.
»Glaubst du, dass ich mit dem Ding auch meinen Job machen kann? Oder vielleicht den ganzen Tag in einem stupiden Büro stundenlang an einem Schreibtisch sitzen und langweiligen Papierkram erledigen?«
»Wie wäre es mit Politesse? In dem Job kannst du dich jeden Tag an allen möglichen Autofahrern rächen«, grinste er frech.
Ich schnaufte.
Wahrscheinlich deshalb baute Peter sich vor mir auf und stemmte die Hände in die Hüften. Ich wusste inzwischen, dass er nur ein Jahr älter als ich war. Peter hatte eine gute Figur und braunes, lockiges Haar. Aus seinem runden Gesicht funkelten seine braunen Pupillen mich direkt an. Er konnte nicht ernst sein. Sein Gesicht wirkte immer fröhlich, selbst wenn er einmal nicht lächelte, so wie gerade jetzt.
»Was glaubst du? Glaubst du etwa, dass die Welt ihre Farben verliert, nur weil über uns gerade Nacht ist?
Bevor du dich in eine langweilige, graue Maus verwandelst und verkriechst, solltest du vielleicht warten, bis die Sonne wieder aufgeht. In der frischen Morgenluft klaren meist auch unsere vernebelten Gedanken wieder auf. Danach kannst du dich mit dem Rollstuhl immer noch einen Abhang hinabstürzen. Aber glaub mir, du wärest die Erste.«
Meine Augenbrauen hoben sich ungläubig.
»Nicht bevor ich diesen Idioten, der mir das angetan hat, nackt ausgezogen habe!«