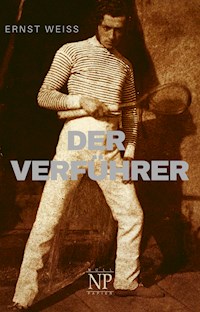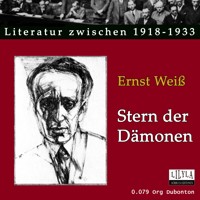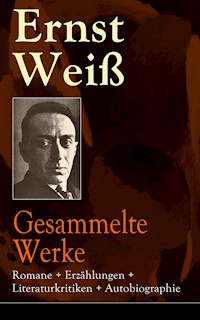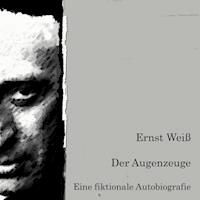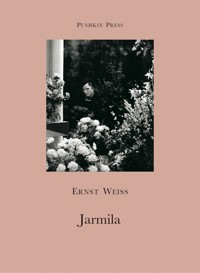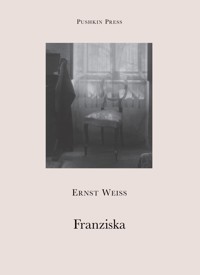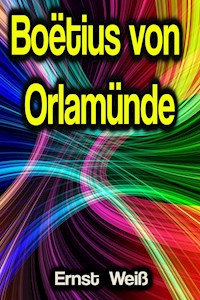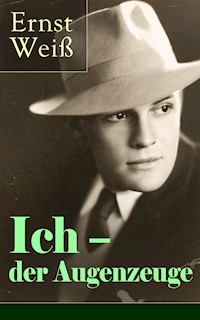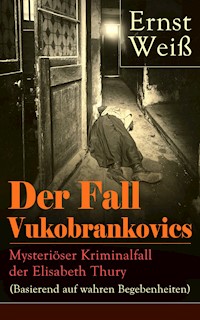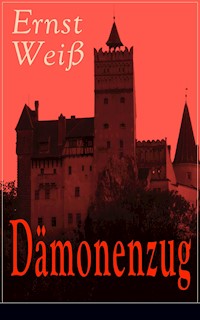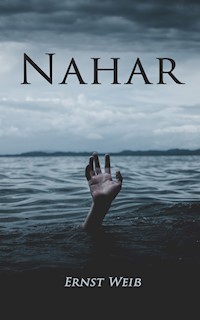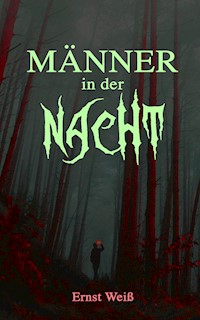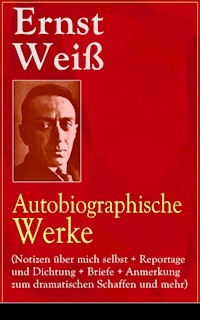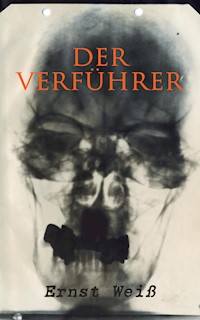Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses eBook: "Die Feuerprobe" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Und dabei ist es nicht allein Schwäche nach plötzlichem Schrecken, was mich hier hält. Liege ich nicht hier wie ein Mensch, der sich in seinem Heim gesichert, behütet und behaglich zur Ruhe begeben hat, einer tickenden Uhr an der Kopfwand seines Bettes lauschend? Auf meinen aneinandergeschmiegten Lippen koste ich den unbeschreiblichen Geschmack der verdienten Müdigkeit. Meine Brust zieht den Frieden in einem langen lösenden Zuge ein." Ernst Weiß (1882-1940) war ein österreichischer Arzt und Schriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Feuerprobe
Erstes Kapitel
Dies ist Wirklichkeit, kein Traum.
Heute morgen zwischen drei und vier Uhr, zwischen Nacht und Dämmerung wurde auf einem Platz in Berlin ein Mann aufgefunden.
Dieser Mann ist es, der diesen Bericht schreibt. Er darf sich nicht Ich nennen, weil er seinen Namen nicht weiß und keine klare Erinnerung an das Vergangene hat. Streng genommen, dürfte er überhaupt nicht berichten, da nichts von dem, was hier folgt, Anspruch auf unbedingte Richtigkeit erheben kann. Ist es denn unbedingt richtig, daß dieses Erwachen Wirklichkeit, kein Traum ist? Wer dürfte darauf die Hand ins Feuer legen? Wohl, ich will es. Ich kann es. Ich habe mehr als bloß meine Hand ins Feuer gelegt, in ein großes Feuer, von dem noch viele Menschengeschlechter erzählen werden. Aber nicht von mir werden sie berichten. Denn wie sollen künftige Menschen meinen Namen kennen, wenn selbst ich ihn nicht weiß? Ich weiß nicht, wer ich war, nicht, wer ich bin. Wer es ist, der diesen Bericht schreibt und der dies »Wirklichkeit, keinen Traum« nennt. Niemand spricht im Augenblick des Erwachens oder Gefundenwerdens zu ihm, auch er selbst nicht zu sich. Denn wie kann hier auf Erden jemand zu sich sprechen, der seinen Namen, seine ganze frühere Existenz bis in die letzte, zarteste Erinnerung, und sei sie noch so weit und ungefähr, vergessen hat? Und wäre er wenigstens wie ein Tier des Waldes unter offenem Himmel erwacht! Dem Tier des Waldes schadet seine Namenlosigkeit nicht. Es lebt, auf der Jagd nach Speise und Liebe, auch ohne Namen zufrieden dahin, zuzeiten durch seinen Instinkt zu seinesgleichen getrieben, durch die Witterung des gleichen Bluts. Wäre ich unter offenem Himmel aufgefunden worden, dann hätte ich den Trost gehabt, ich sei nur durch Zufall verloren. Aber ich fürchte, ich bin durch eine höhere Absicht, eine stärkere Macht, die mir nie und nimmer klar werden wird, meines Ich beraubt worden. Zur schwersten Demütigung hat man mich in einer Bedürfnisanstalt erwachen lassen.
Rings breitet sich der große viereckige Platz mit der Kirche aus roten Ziegeln aus, und in ihrem Umkreis glimmen im Licht der Bogenlampen die niedrigen, mit Zinkblechplatten gedeckten Fischverkaufshallen. Auf dem Platze selbst gibt es noch vom letzten Wochenmarkt her leere, schräg übereinander hingestürzte Kisten. Sie sind nicht namenlos, denn sie tragen, in schwarzen, großen Buchstaben eingebrannt oder eingezeichnet, Firmenbezeichnungen, Kreuze und Zeichen. An vielen Stellen sehe ich Haufen feuchtgewordener Holzwolle und zerknitterten Papiers, endlich etwas ebenso Namenloses wie ich. Spärlich dazwischen verstreut liegen faulige Früchte und Reste verdorbenen Gemüses. Der Platz ist menschenleer. Den Himmel kann ich nicht sehen. Ich liege mit dem Oberkörper in dem rechtwinkligen Wandelgange, der um das Innere des Ortes herumführt. Ist es Hohn oder soll es Güte des Schicksals sein, wenn mein Haupt auf dem knisternden, weichen, wie ein geöffnetes Blumenblatt ausgebreiteten Kragen meines Mantels ausruhen darf? Dreißig Zentimeter über der Erde beginnt die deckende und verbergende Blechwand des kleinen schwarzen Hauses, die durch dünne Eisenträger gestützt wird. Auf der Innenseite der Blechwand sieht man in Manneshöhe elektrisch beleuchtet den Text eines Plakates, welches besagt, man solle im Interesse der öffentlichen Schicklichkeit noch in der Anstalt seine Kleider in Ordnung bringen. Zwischen der Erde und der Blechwand ist gerade so viel Raum, daß der schmale Kopf eines Menschen hindurchschlüpfen kann. Dies muß mein erstes sein. Aber noch habe ich nicht die Kraft dazu. Ich drehe bloß meinen Kopf zur Seite und sehe nach dem Platz hinaus, welcher trotz der Reste vom Wochenmarkt doch die Sauberkeit eines kühlen Augustmorgens bewahrt hat. Es münden breite Straßen ein, ein mäßig ansteigender Hügel scheint in der Nähe zu sein, der Platz selbst ist von Bogenlampen beleuchtet. Jetzt eben wird er von einem lauen Westwind überweht, mit einem fernen Duft von Wein und Nelken angehaucht.
Noch kann ich nicht mit unbedingter Sicherheit erkennen, ob die Dämmerung Morgendämmerung ist, die Zeit zwischen drei und vier, wie ich es in den ersten Sätzen sagte, oder Abenddämmerung. Aber die Wahrscheinlichkeit spricht für den Morgen, denn abends ist solch ein Platz sicher noch belebt und bleibt es bis nach Mitternacht. Jetzt aber kommt bloß eine schlanke und doch etwas üppige Frau vorüber, sie hat Eile, sie geht ganz nahe an mir vorbei, sieht mich aber nicht. Ich aber sehe ihre blaß blutfarbenen, glatten Schuhchen. Ich atme das pfirsichartige Parfüm ein, das sie umgibt. Trotz ihrer Eile weicht sie bei jedem Schritte vorsichtig dem Schmutze aus, wobei die feinen, wie gemeißelten Knöchel in den seidenen Strümpfen zart aneinanderstreifen. Die Frau scheint sich, nach den Bewegungen ihres Körpers zu schließen (die Züge ihres Gesichtes kann ich von unten nicht sehen), öfters umzublicken, als fliehe sie vor jemand. Aber niemand kommt ihr nach. Dann bleibt der Platz leer. Erst nach einer Weile erscheint umherschnüffelnd ein magerer, stachelhaariger Hund, der mit seinen dürren, sehnigen Pfoten ein paar Früchte halb spielend, halb zornig vor sich herrollt und dazu in sonderbarem Rhythmus kläfft, als spräche er in seiner Hundesprache, allen anderen unverständlich und auch sich selbst nicht klar bewußt, etwas ihm sehr Wichtiges aus. Mit seinen dunkelbraunen, aus dem struppigen Haar feucht hervorglänzenden Nüstern scheint er etwas zu suchen, aber ich bin es nicht. Denn er stolpert ungeschickt über meinen Kopf und springt, in seiner Überraschung die Augen zusammenkneifend und plötzlich verstummend, über mein Haupt, als wäre es ein grauer Stein. Mein Gesicht ist kalt, ich fühle es. Vielleicht nach einer durchwachten Nacht? Ich habe zuviel getrunken und nachher in diesem schmutzigen Ort das Bewußtsein verloren? Ich habe in diesem schmutzigen Ort das Bewußtsein wiedergewonnen? So wäre dies also ein Wachtraum? Ich weiß es nicht. Mein Gesicht ist eisig, wenn ich es mit meiner Hand berühre. Eisig vielleicht infolge der unbeschreiblichen Bestürzung, mich hier in dieser schmutzigen Atmosphäre zu finden und dabei unfähig zu sein, ihr sofort zu entrinnen. Denn immer noch liege ich auf dem Boden, als wäre ich gefangen innerhalb der eisernen Mauern der Anstalt. Wie lange soll das noch währen? Und mehr noch! So schmutzig es hier ist, etwas zwingt mich dennoch, besonders tief zu atmen, die Luft ganz in mich hineinzuziehen. In dem Innenraume herrscht scharfer Geruch nach dem desinfizierenden Öl. Außen auf dem offenen Platze atmet man etwas wie Blumengeruch und dazu, sollte man es glauben – einen leisen Brandgeruch. Sollte es nachts irgendwo gebrannt haben? Draußen ist alles still. Es erhebt sich über dem asphaltierten Platz ein milchig umsponnener, grüner, zart wolkenloser Himmel mit seltenen, weit verstreuten Sternen ...
Noch liege ich, wie von Schrecken gelähmt, an der schmutzigen Stätte. Aber jetzt atme ich mit Freude schon reinere Luft. Mein linkes Knie schmiegt sich mit einer sehr feinen, aber mit jedem Augenblick des Liegens deutlicher und süßer werdenden Liebkosung in den weichen Raum unterhalb des rechten Knies, und beide Glieder ergänzen sich derart, daß sich die scharfen Knochenkanten des einen in die weiche Muskelhülle des andern einfügen. Dies ist nicht gleichgültig für mich. Versteht man dies nicht? Versteht man es nicht, wie es einem Mann zumute ist, dem man den Namen und die Erinnerung genommen hat? Und damit jede Orientierung in dieser auch für den Verstandesmenschen grauenhaft verworrenen Welt? Muß einem solchen Menschen nicht alles Tatsächliche, das zu Protokoll gegeben werden kann ... (wie komme ich zu dem Ausdruck Protokoll? Ich bin doch nicht vor Gericht?) Muß mir nicht jede Feststellung doppelt, dreifach wichtig sein? In meiner jetzigen Lage ist ein Mann dankbar für jeden Fingerzeig, der ihm hilft, die Spur seines Ich aufzunehmen. Er muß wie ein Hund jeder auch noch so verdeckten Witterung nachspüren. Er will doch zu sich selbst kommen. Ausnahmslos wird er jede Fährte aufnehmen, die einigermaßen klar ist, sei es, daß sie auf einen Brandherd deutet oder auf eine Blume oder auf einen Sternenhimmel oder auf eine schlanke Dame, die, in ihren Duft wie in einen weiten Abendumhang gehüllt, an ihm vorüberschwebt. Ist es meine Geliebte, meine spätere Frau? Verdankt sie ihre leicht sommerliche Fülle einem Kinde, ihrem ersten und einzigen? Habe ich mit ihr vor einem Altar gestanden, habe ich sie heimgeführt, um immer bei ihr zu bleiben, habe ich mich auf ihren Anblick nach einer mühseligen Tagesarbeit in meinem Unternehmen gefreut, habe ich sie abends zu Festen und Gesellschaften begleitet? Habe ich ihr bei der schweren, viele Stunden dauernden, angesichts ihrer hochgestellten Hüften besonders gefahrvollen Geburt beigestanden? Habe ich in ihre schönen, von den vielen Schmerzen noch feuchten Hände das kostbare Schmuckstück hineingelegt, das von meinem Vater stammt, und habe ich dann, zum erstenmal wieder seit langer Zeit, ein Lächeln um ihre schmalen und doch zauberhaft schönen Lippen gesehen? Habe ich auf sie bauen können? Habe ich ihr trauen können? Die Welt ist groß. Übergroß für mich. Ist es Berlin, wo ich mich wiederfinde? Auf einem Plakat in der Anstalt war es gedruckt, aber wem kann man glauben? Vielleicht lese ich die richtigen Buchstaben falsch ab? Vielleicht fabuliere ich, während ich alles mit dem kältesten Verstände festzustellen glaube? Vielleicht verfolge ich mich mit meinem Wahn? Vielleicht verfolge ich andere? Verfolgungswahn? Größenwahn? Vielleicht ist es heute nacht nicht das erstemal, ich habe vielleicht schon früher eine Anstalt kennengelernt, aber damals war es keine offene Anstalt. Mir ist, als hätte ich einen mir sehr teuren Menschen einmal in eine solche Anstalt begleitet. War es mein Bruder? Wenn die Irren toben, ja, auch dann, wenn die Irren bloß irren, dann kann man nur wünschen, daß sie schlafen. Wenn man sie überhaupt heilen kann, heilt man sie nur durch Schlaf. Aber oft erwachen die Irren vor der Zeit aus ihrem todesartigen Schlafe. Manchmal finden sie sich dann in einer helleren Zwischenzeit wieder, verlassen von dem Wärter, aber nicht von ihm vergessen. Der Irre hat in der Nacht gekämpft, er weiß nicht, mit wem, er weiß nicht, warum. Jetzt fühlt er nur die Kratzwunden im Gesicht und an den Händen, die glühend heiß sich anfühlen. Noch ist es Nacht. Der Irre kann dies hinter den eisernen Jalousien einer Tobsuchtszelle nicht sehen, ebensowenig wie den Himmel. Langsam kommt die Morgendämmerung durch die Fugen. Nur eine stumpf graue, betonierte Zimmerdecke hat der Irre über sich, die er vielleicht bis zum Augenblick seines Todes über sich wiederfinden wird. Der Irre möchte sprechen, seinem Bruder sich mitteilen, den lichten Moment auskosten und an dessen Ewigkeit glauben. Aber er kann jetzt zu niemandem sprechen, auch nicht zu sich selbst. Daß er von allen Menschen verlassen ist, könnte er ertragen. Aber auf seiner Brust liegt ein solch krankhafter und durch keinerlei Selbsttrost zu lösender Druck, daß der Unselige bloß ein Knie an das andere preßt, den Kopf ein wenig hervorreckt, später einmal freier zu atmen hofft und die Luft, den verbrauchten Dunst des fast hermetisch abgeschlossenen, selten gelüfteten Raumes trüben Herzens tiefer in die aufseufzende Brust einzieht.
Ist es gleichgültig, ob ein Ich sich in einer solchen Lage wiederfindet oder ob es sich wiederfindet wie ich, wie er, der sagen durfte: »Dies ist Wirklichkeit, kein Traum. Heute, morgens zwischen drei und vier Uhr, zwischen Nacht und Dämmerung wurde auf einem Platz in Berlin ein Mann aufgefunden.« Wer so sprechen kann, soll er seinem rätselhaften Schicksal danken? Darf er ihm fluchen? Muß er das Wohlwollende der Welt anerkennen? Kann er alle Angst, alles Grauen vor dem Früheren beiseite lassen?
Ich schreibe hier die Detektivgeschichte einer Seele. Ich führe das Fahndungsprotokoll eines Daseins. Ich klammere mich an jedes winzige Merkmal mit allen Sinnen, wittere einen Brand, von dem noch niemand etwas sieht, noch auch weiß ... Ich kann nicht wissen, wo ich meine wahre Existenz zurückgelassen habe. Aber verspricht mir diese »wahre Existenz« ein hohes Glück? Erwartet mich in dieser »wahren Existenz« eine herrliche Frau, eine dunkelblonde Helena als Braut, oder die Königin aus dem »Sommernachtstraum« und dazu auch noch das schönste und zärtlichste, das bezauberndste Kind? Wartet man auf mich? Würde man mich in möglichster Schnelligkeit aufsuchen, wüßte man nur, wo ich bin? Wer ich bin! Ich, der mit seinem schmalen Kopfe unter der rostigen Blechwand gerade nur hindurchgeschlüpft ist, ich, den der bissige, kläffende Hund eben nur geschont hat. Vielleicht war es ein von der Polizei auf fliehende Verbrecher abgerichtetes Tier, das mich nur deshalb nicht verbellt hat, weil der üble, penetrante Geruch der Anstalt es verwirrt hat ...
Wer ist dieser Ich? Ratlos und erinnerungslos verliere ich mich in jede mir erreichbare Einzelheit, mit allem Scharfsinn belauere ich die alltäglichen Dinge, mit allem Fleiß stelle ich die gleichgültigen Tatsachen fest, selbst die verschiedenen Gerüche in der Anstalt und rings um sie, sogar die eingezeichneten Buchstaben und Zeichen auf den hölzernen Kisten. Ich wende meinen Kopf nach allen Seiten. Ich möchte mich schnell erheben und wage es nicht. Ach! Man verzeihe mir diesen Ausruf! Es ist das Geständnis meines Versagens, der Beweis, daß ich mich nicht mehr beherrsche. Wer wird mir glauben, mir, dem doch selbst ich kaum zu glauben vermag!
Alles ist Zweifel, und Zweifel bin ich. Vergebens stelle ich das Wort »Wirklichkeit« an die Spitze von verworrenen Berichten. Ich fühle es mit drückender Angst, niemand wird meine Lage begreifen können, ja, nicht einmal diese »drückende Angst« wird mir jemand nachempfinden können. Den andern wird mein Zurückblicken nach meinem verlorenen Ich und nach der traumhaften Schönheit und stetigen Güte meiner Gattin, nach der reinen Lieblichkeit meines Kindes nur als wahnsinniges Fabulieren erscheinen oder, noch schlimmer für mich, als Ausflucht vor dem Gericht des eigenen Gewissens. Nicht ohne Grund die Worte Protokoll, Fahndung, eiserne Mauer und Gericht.
Wäre es für einen erwachsenen Mann nicht beschämend zu weinen, dann wäre mein eisiges Gesicht längst von warmen Tränen übergössen. Und doch! Noch einmal und nicht zum letzten Mal »und doch« – Tränen können niemals helfen, auch männliche nicht. Wer wollte sie, und wären sie selbst in Gegenwart des Richters vergossen, in das strenge Protokoll einer Gerichtsverhandlung eintragen – und trüge man sie selbst ein, wer würde sie mir als mildernden Umstand anrechnen? Wären diese Tränen imstande, die mir innerlich verlorene Gattin »durch reine Menschlichkeit«, also durch Mitleid, von der längst beschlossenen Untreue abzuhalten? Und hätte mich diese Untreue zu einem Verbrechen gebracht, würden dann diese Tränen den Richter zu einer nicht verdienten Milde bestimmen? Aber wenn ich sie jetzt vergieße, und ich kann es nicht – selbst wenn ich sie vergösse, auch dann wären sie doch nur heiße Tropfen auf dem kühlen Stein, auf dem ich immer noch liege. Gefallen und noch nicht erhoben. Von allen Menschen verlassen. Keinen Menschen sehend. Von keinem gesehen. Alle um Antwort fragend und getröstet von keinem.
Und dabei ist es nicht allein Schwäche nach plötzlichem Schrecken, was mich hier hält. Liege ich nicht hier wie ein Mensch, der sich in seinem Heim gesichert, behütet und behaglich zur Ruhe begeben hat, einer tickenden Uhr an der Kopfwand seines Bettes lauschend? Auf meinen aneinandergeschmiegten Lippen koste ich den unbeschreiblichen Geschmack der verdienten Müdigkeit. Meine Brust zieht den Frieden in einem langen lösenden Zuge ein. Bin ich nicht wie einer, der sich auf seinem dem Fenster nahen Ruhebett beim Betrachten des gestirnten, wolkenlosen Himmels zuviel zugemutet hat und dem dabei die Augen übergegangen sind? So hat er sich dem Schlafe hingegeben, innerhalb seines Hauses, im eigenen Bette, an der Seite seiner schönen Frau, umflüstert von den schnellen, leichten Atemzügen seines ersten und einzigen Kindes, das zwischen ihm und seiner geliebten Frau liegt und dessen sehr gelöster, kleiner Mund einen Hauch von duftenden Nelken ausströmt. So könnte es sein.
Es ist aber nicht so. Ich, ein ehemals vielleicht sehr willensstarker Mann, bin wie von einem unbekannten Schlafmittel betäubt. Die Eingeweide meiner Seele hat mir mitleidslos eine fremde, übermächtige Hand herausgerissen. Herausgerissen? Woher kommt mir dieses fürchterliche Bild? Wo habe ich so Schauerliches gesehen? Oder habe ich es selbst getan? Habe ich Tiere gequält oder zugesehen, wie ein anderer es tat, und habe ihm nicht die Hände hindernd festgehalten, weil ich trotz allem zu sehr an ihm hing? Also so etwas Fürchterliches dulden aus Liebe? Ist das alles Hohn? Strafe? Was kann sein und was nicht?
Mit allem, was ich jetzt bin, was ich jetzt habe, an diesem frühen Morgen, Spätsommer 1928, auf dem weiten, menschenleeren Platz, halb unter der Wand der Anstalt verborgen – da bin ich der zweifelnde Mensch, der verzweifeln muß. Ich bin blasser als ein Stern letzter Ordnung am Mittag. Wenn der Sternkundige aus seinen Berechnungen auch tausendmal wüßte, daß der Stern in Wirklichkeit hier existiert, vergebens würde er ihn im leeren, flirrenden Mittagszenit suchen. Ich liege da, hinfälliger als ein von der Liebe und vom Juli ausgeschöpfter Schmetterling. Ich schweige. Ich bin nichtssagender als eine Notiz in einer alten Zeitung, wie deren hier viele umherliegen, von den Markthelfern auf dem Platze mit anderem Kehricht zusammengehäuft.
So ist es. Wer aber wird mir helfen zu suchen, bis ich mich endlich finde? Ich kann nicht so weiterleben. Muß dieses fragwürdige Dasein in der Mitte zwischen Komik und Tragik nicht einmal einen Sinn bekommen? Nur der Sinn fehlt. Man hat sicherlich bemerkt, daß ich in Tatsachen ersticke. Aber nirgends ein Wort, das man versteht, nirgends ein Name, der etwas bedeutet. An keinem Ort ist ein Halt, überall nur das irrende, verlorene Ich. Hier bin ich bloß ein fremder Körper, ein sinnloses Hindernis, wenn die Menschen kommen ..., und doch habe ich nicht die Kraft, mich zu erheben, bevor ich weiß, wer ich bin. Ich will erst gehen, wenn ich weiß, wer ich bin. Was ist es anderes als der Name, was uns von den myriadenhaft wuchernden und myriadenhaft vergehenden Pflanzen unterscheidet? Was erhebt uns über die ebenso namenlos lebenden und ebenso unerkennbar einander folgenden Generationen der Tiere des Waldes?
Im Anfang war der Name (oder heißt es »der Sinn«?) – so beginnt das Evangelium Johannes. Freilich endet es nicht hier, sondern dort, wo es ruft: »Den Frieden lasse ich Euch, meinen Frieden gebe ich Euch!« So rettet Jesus und hilft.
Wird bei mir Anfang und Ende vergebens sein? Wie gern möchte ich an den guten Willen der übermächtigen Gewalt, an die wohlwollenden Absichten und Zwecke der Gottheit glauben, wie selig gern möchte ich die unausschöpfbare Milde einer Vorsehung entgegennehmen, aber wie soll mir Gott allhier helfen, woran soll er mich erkennen, wenn ich nicht meinen Namen und meine Erinnerung besitze und darin meinen Teil an der Unsterblichkeit?
Ich habe hier keinen Feind. Wer sollte sich an mir rächen wollen? Meinen Vorteil habe ich auf Kosten anderer nie gesucht. Ich habe mich nie berauscht. Habe immer in Klarheit leben wollen. Keine Frau sollte es geben, von der ich mich im Bösen geschieden habe. Sollte nicht? Ist dies sicher? Hat es nicht gegeben? Bloß der Schatten einer vorübereilenden Frau hat mich gestreift. Ich sah sie, sie mich nicht. Einen ganz feinen, oberirdischen oder unterirdischen Brandgeruch habe ich zwischen dem Geruch des Schmutzes und der Blumen gewittert. Zum Ordnen meiner selbst wurde ich aufgefordert. Das sind die Tatsachen.
Aber alle Tatsachen, die ich ordnen könnte, sie werden mir, so fürchte ich, in meiner Einsamkeit nicht helfen. Eine solche Einsamkeit hat kein Mensch erlebt, auch der letzte Überlebende in der havarierten Maschinenkammer eines auf den Meeresgrund gesunkenen Torpedobootes nicht. Auf keiner Guanoinsel, auf keinem pflanzenlosen Korallenriffe fand ein schiffbrüchiger Seefahrer sich so verlassen vor. Ich verlassen vom Ich. Nur ein Irrer kann sich so verirrt haben.
Laßt mich sprechen! Laßt mich fragen: Ist dieses ein Angsttraum, ist dies Wirklichkeit? Wer ist die Frau? Wie kam ich hierher? Wird es Feuer geben? Gibt es Frieden in den Sternen über uns? Ist der Schmutz echt, sind die Blumen echt? Bin ich es? Wer wird gerettet? Wer bleibt verloren?
Nur Schweigen als Antwort. Kein Mensch rings um mich.
Zweites Kapitel
Eine solche Einsamkeit habe noch kein Mensch erlebt, sagte ich. Aber vielleicht bin ich nicht der einzige, dem ein solches Schicksal der Verlassenheit widerfahren ist.
Der Wind weht mir von dem Platze her, wo tagsüber die Blumenzelte und Obstbuden gestanden haben mögen, den Rest einer Zeitung zu. Ich kann den Inhalt eines einzelnen Bogens noch gut lesen. Draußen ist noch tiefe Dämmerung, aber in der Anstalt brennt elektrisches Licht. Das Blatt hat sich infolge der Nachtfeuchtigkeit etwas geworfen, ich streiche es glatt zwischen den Flächen meiner etwas geröteten Hände. Es enthält eine Tagesnotiz. »Gestern«, sagt die Notiz, »ist ein etwa dreijähriges Kind, das ohne Begleitung umherirrte, auf der Straße aufgegriffen worden.« Welch ein Wort, dieses »aufgegriffen«. Wer schreibt dies? Ist es vielleicht der Protokollführer eines Kriminalgerichts, ein Mensch, der blutige Überfälle, Betrügereien, Brandstiftungen, Morde gewohnt ist und solche zu protokollieren weiß, aber nicht die Erlebnisse und Erleidnisse eines unschuldigen Kindes? Oder ist es ein Menschenfreund, am Vormundschaftsgerichte ehrenamtlich tätig, ein älterer, kränklicher Mann, selbst ehelos und kinderlos und doch der leidenschaftlichste und gütigste Freund der Kinder? Oder ist es ein Offizier der Heilsarmee, männlich oder weiblich, einer von denen, die aus dem unterschiedslosen Helfen einen militärisch organisierten Dienst gemacht haben? Oder ist es der Finder dieses Kindes in eigener Person? Sei es, wer es sei. Niemand sollte so herzensroh sein, daß er ein dreijähriges Kind mit rauhen Händen aufgriffe. Ich weiß nichts von diesem Kinde. Auch wenn es mein eigenes wäre, auch dann wüßte ich nichts, denn mit meiner eigenen Vergangenheit ist mir auch die der Meinen verlorengegangen.
Der Ort, wo man das Kind gefunden hat, könnte ein freier Platz sein, wie dieser hier, ein ödes Stück Asphalt inmitten der Riesenstadt Berlin, aber ebensogut auch einer der vielen, fast grenzenlosen Straßenzüge, doppelt grenzenlos in Anbetracht der Kleinheit und Dürftigkeit eines hilflosen dreijährigen Kindes. Die Häuser in solchen Straßen tragen oft dreistellige Hausnummern, die aber das Kind ebensowenig lesen kann wie seinen eigenen Namen, und sähe es diesen auch vor sich.
Ich sehe dieses Kind vor mir, wenn ich die Augen schließe. Jetzt hält es sich kaum noch auf seinen fleischlosen, abgezehrten Beinchen aufrecht. Es zieht sein Röckchen sich über die Knie hinab, als friere es. Auffinden? Gut! Es ist gut, gefunden zu werden. Aufgreifen? Vielleicht ist doch dieses energische Aufgreifen noch besser, so roh es klingt, vielleicht doch das Richtige. Denn das Kind will fliehen. Es hat zwar jetzt um seinen kleinen, sehr gelösten Mund einen Ausdruck von großem Ernst, aber in Wirklichkeit ist es nicht sehr besonnen und klug, denn es will fliehen, als wäre es nicht schon ohnehin von aller Welt verlassen. Man muß es greifen, man muß es richtig fassen, um seiner sicher zu sein, mit einem energischen Griff, den es spürt. Nun beginnt es zu weinen. Darauf will man nicht achten. Man will das Kind vor allem beruhigen. Man bindet ihm daher die Schuhbändchen zusammen, die sich beim Laufen aufgelöst haben. Dabei preßt einer der Helfer das kleine, dreieckige Gesichtchen des Kindes mit dem winzigen Naschen und dem etwas betonteren Kinn an sich.
Das Kind mußte viel gelaufen sein, es mußte fliehend aller Welt und allen Großen, jedem Vater, jeder Mutter, jedem Menschen mißtraut haben. Oder ist es nicht vor Menschen geflohen, sondern vor einem Naturereignis, einer von oben gewollten Katastrophe, einem Brande, den ich noch immer in der Luft spüre, auch wenn man nichts von ihm sieht? Auch die Gürtelschnalle aus honigfarbenem Horn hat sich dem Kinde bei der heftigen Atmung der Flucht gelockert. Nun zieht man sie fester an. Die Flucht ist zu Ende. Man muß das Kind mit einem klaren und ganz selbstverständlichen Lächeln sicher machen, damit es sagen kann, wer es ist, wo es wohnt.
Das Kind fliegt an seinem ganzen schmächtigen Körperchen, sei es von den Anstrengungen des Laufes, sei es aus innerer Erregung. Nirgends ein Schutzmann. Es ist früh am Morgen. Plötzlich umstehen das keuchende Kind zahlreiche Menschen, meist Angestellte der nahen Reichsdruckerei, unter denen besonders ein großer Mann mit weiter, blauer Arbeitsschürze hervorsticht. Noch hat sich das Kind nicht gefaßt, obwohl es schon Minuten stillsteht, es blickt ratlos zum Himmel empor, einem blaßblauen Augusthimmel, es sieht sich in der Gegend um, einer öden, gottverlassenen Gegend der Weltstadt Berlin, in einem elenden, aber dichtbevölkerten Quartier. Vielleicht ist es die Gegend der Alten Jakobstraße, eines stundenlangen Straßenzuges ohne elektrische Straßenbahn und fast ohne Autoverkehr, wenigstens so früh am Morgen. Erst später kommen die Fuhrwerke von der großen Markthalle zurück, die in der Nähe liegt. Das Kind weint jetzt nicht mehr. Es ist zu sehr entkräftet. Es steht aufrecht da mit der ganzen Tapferkeit der ganz Unmündigen. Es hat kein Hütchen oder Mützchen auf, man sieht sein helles, sehr weiches Haar, welches das Köpfchen reich wie ein Tierhaupt umstreichelt. Die Leute sind im ersten Augenblick verstummt vor Staunen. Zu so ungewohnter Stunde in der menschenleeren, dämmrigen Straße ein drei- bis vierjähriges Kind aufzufinden, überrascht sie sehr. Das Kind, mit dem Erdboden wie ein Häufchen Elend verwachsen, betrachtet sie aufmerksam, während es den Blick von unten nach oben richtet. Endlich beginnt einer zu fragen, aber er bringt nur etwas von »Amsterdam« in Erfahrung. Also wird wohl das kleine Mädchen aus Amsterdam in Holland stammen, oder es heißt Amsterdam. Möglicherweise hat es aber auch das Wort Amsterdam von seinen Angehörigen als letztes gehört und hat dieses Wort statt des unersetzlichen Namens behalten. Denn ein anderes Wort hat es noch nicht über die Lippen gebracht. Die anderen wollen es besser machen und fragen geradezu: »Wie heißt du?« Ein zweiter: »Wo ist dein Vater? Wo wohnt er?« Das Kind hält Weinen wieder für das Beste. Winzig inmitten der ratlosen Männer, sieht es, ebenso ratlos, an ihren hohen Beinen empor und versucht dann mit einer listigen Bewegung, ja, mit einer Andeutung eines spitzbübischen Lächelns ihnen wieder zu entkommen, vielleicht vom Boden aufzufliegen wie ein Federchen im Wind oder ihnen zu entfliehen wie ein Traum. Weiß es nicht, daß es endlich jetzt und vielleicht zum erstenmal jetzt in guten Händen ist? Es sind große rote Hände, die der Mann in der blauen Arbeitsschürze besitzt. Vielleicht hält das Kind diese Schürze für einen Frauenrock. Zu diesem Mann hätte es wohl am ehesten Vertrauen. Denn fast könnte es scheinen, als kehre das Kind freiwillig von seiner aussichtslosen Flucht zurück, so leicht läßt es sich von diesem Manne wieder einfangen, der es einfach mit seinen langen Armen an dem Gürtelchen erwischt, ohne sich von der Stelle zu rühren. Blitzschnell hat sich dieser vergebliche Fluchtversuch vollzogen. Jetzt folgen die Fragen der Männer einander mit solcher Schnelle, daß kaum ein Erwachsener Zeit fände, sie zu beantworten, geschweige denn ein verschüchtertes, vielleicht ausgehungertes, gegen Fremde sicherlich sehr scheues Kind. »Sag schnell, wer du bist!« »Wie heißt sie denn?« »Kleines, leg doch los! Keine Angst! Wir meinen es gut, nicht?« »Bist doch mit deiner Mutti gekommen?« »Wem wird sie wohl gehören? Hier aus der Gegend vielleicht? Kenne keine Seele da!« »Amsterdam? Amsterdam ist weit. Amsterdamer Straße gibt es nicht. Jedenfalls nicht im Zentrum.« »Familie Amsterdam, vielleicht im Telephonbuch? Im Adreßbuch sicher.« Und als das Kind, schweigsam in dem Redeschwall, mit seinen großen graugrünen Augen aufblickt, sagt der Mann in blauer Schürze mit etwas veränderter Stimme, auf welche das Kind sofort hinhorcht, während es das Köpfchen, wie es alte Leute tun, etwas auf die Schulter neigt: »Kind, hast du schon etwas gegessen?« Das Kind antwortet auch auf diese Frage nicht, aber schnell ist etwas Leben in das blasse und kühle dreieckige Gesichtchen des Kindes gekommen, sobald es das kleine Eßpaketchen sieht. Das Kind möchte lachen oder etwas sagen, schließt aber die Lippen, tut keines von beidem, sondern schmiegt nur sein dichtbewachsenes, reich mit blondem Haar umlocktes Köpfchen noch einmal an die Knie des Mannes, es hebt sein Händchen nach dem Brot, wartet aber dann doch bescheiden. Die andern setzen ihre Fragen und Bemerkungen fort: »Man muß das Kind zur nächsten Revierwache bringen!« »Was für eine Hundsgemeinheit, solch kleines Kind ohne Schutz auf die Straße zu lassen!« »Wo mag es nur umhergeirrt sein? Ist mir doch so, als hätte ich es schon gestern gegen Abend gesehen in Haushöfe hineingehen!« »In Kohlenkeller auch.« »Bodenlose Infamie!« ... »Es kommt aber doch öfter vor.« »Ja, aber daß es solche Menschen gibt! Eigentlich Menschen sind das gar nicht. Hat sie denn keine Mutter?« »Ich dachte erst, sie bettelt und die Mutter wartet nebenbei.« »Ja, in diesen Zeiten versäuft mancher Mann alles. Am Morgen nach dem Lohntag sieht man ihn liegen, Gott weiß wo. Die Kinder aber läßt man hungern, in Lumpen umhergehen, betteln und vagabundieren.« »Gekleidet ist es ja soweit ganz nett.« »So einem Wurm schenkt jeder gern eine Kleinigkeit. Ich sage nicht nein.« »Sehr niedlich, aber ein kleiner Idiot. Taubstumm. Aber jetzt los! Wir müssen wieder an die Arbeit!« »Ich gehe heim. Die Mutter wird sicherlich irgendwo in der Nähe lauern.« »Jetzt, paßt alle auf, Kinder, bekomme ich heraus, wie die Kleine heißt: also Mädi, wie ist es nun, hör mal genau zu! Klara, Martha, Maria, Lene, Hedwig, Lissy, Käte, Grete, Gaby, Erna, Charly ist jetzt auch in der Mode ...« »Ach Unsinn! Ist das unsere Sache?«
Inzwischen hat der Mann in blauer Schürze dem Kinde etwas zu essen gegeben, ein mit feingeschnittenem Speck belegtes halbes Brötchen. Das Kind lacht und ißt. Die meisten Männer haben sich wieder entfernt, bloß zwei Leute aus der Druckerei, zu denen sich ein stiller, weil vom Nachtdienst übermüdeter Polizist gesellt hat, sind geblieben.
Die Kleine scheint, nachdem der Hunger gestillt ist, rosiger und voller geworden. Sie streift mit dem Handrücken sich über die Lippen, und mit dieser Bewegung ist sie verschönt zum Nichtwiedererkennen. Sie beginnt jetzt ungefragt zu reden. Das Stimmchen ist merkwürdig tief für das Alter, dabei aber voll und weich. Je länger und lebhafter das Kind spricht und lacht, desto unverständlicher wird den drei Menschen der Sinn der Worte. Es ist weder englisch noch französisch, eher ein wenig bekannter deutscher Dialekt. Voll von Anklängen vertrauter Art und ohne ein einziges genau erkennbares Wort. Besitzt dieses Kind den für sein Alter normalen Sprachschatz und verwendet es ihn nur nicht? Oder gebraucht es lieber in diesem wichtigen Augenblick eine selbsterfundene Sprache, wie es Kinder manchmal im Spiel tun? Jedenfalls hat das Kind nun alles gesagt, es nickt zur Bestätigung mit dem blonden Köpfchen und lächelt jetzt, zwar müde, aber in voller Zuversicht. Es vermißt jetzt weder Vater noch Mutter, noch das gewohnte Haus und sein Bettchen. Nur nach Ruhe sehnt es sich. Es hat nicht nur seinen Namen, sondern wahrscheinlich auch alle Schrecknisse der letzten Nacht vergessen. Das heißt viel. Es ist offenbar schon seit gestern abend von zu Hause fort, es hat sich vor fremden Menschen, vor fremden Häusern und sogar vor Kohlenkellern nicht gescheut. Sogar ein gesundes, kräftiges Kind kann man an der Hand seines Vaters oder seiner Mutter nur schwer dazu bewegen, in ein düsteres Kellergewölbe hinabzusteigen, da muß es für ein so zartes, scheues Kind des größten Mutes bedurft haben, wenn es sich, wie die Augenzeugen berichten, in einen Kohlenkeller hinabgewagt hat. Oder es ist in den Keller getrieben worden durch Angst vor irgendeiner Gewalttat, durch das Schaudern vor einem gewalttätigen Familienzwist, durch den ersten Funken eines Brandes, der möglicherweise durch Unvorsichtigkeit der Eltern ausgebrochen ist? Und haben die Eltern das Kind allein gelassen? Jedes andere Kind hätte sich, nach dem Vater und der Mutter schreiend, vor den Kellereingang in die Mitte der dämmrigen, schlüpfrigen, nächtlichen Straße gesetzt, mit seinen von Tränen nassen Händchen unaufhörlich die Augen reibend, wie es kleine Kinder oft tun. Und nach dem vergeblichen Rufen hätte es, immer noch mechanisch weinend, die Augen geschlossen, trotz seiner Angst, und hätte sich endlich wie ein kleiner graubrauner Igel mitten auf dem Straßendamm oder an der Bordschwelle zusammengerollt. So hätte es jedem Automobil (ganz frei von Automobilverkehr ist auch nachts keine Straße im Mittelpunkt der Stadt Berlin) zum Opfer fallen müssen, denn wer wollte spätabends oder nachts in der schlecht beleuchteten Alten Jakobstraße ein Kind noch rechtzeitig erblicken, wenn es, wie ein graues Häufchen Unglück mit dem Erdboden verwachsen, verlassen dahockt? Keine Mutter wird, solange noch ein Atom Leben in ihr ist, ihr Kind einer solchen Gefahr aussetzen. Jede Mutter würde ihrem Kinde überallhin gefolgt sein, kann doch das Kleine weite Entfernungen auch auf der unsinnigsten und blindesten Flucht nicht erreichen. Muß man daraus schließen, daß die Mutter des im übrigen gepflegten, wenn auch durch die nächtliche Wanderung schmutzig gewordenen Kindes tot ist, vielleicht ermordet durch Messerstiche ihres Mannes, dem sie Anlaß zur Eifersucht gegeben hat? Soll man glauben, daß der Vater, der bis dahin eifrig für das Kind gesorgt hat, jetzt auf der Flucht in der Stadt umherirrt, die ersten Morgenzeitungen erwartend, in denen schon seine Tat geschildert und das Todesschicksal seiner Frau beschrieben ist, die er vielleicht zwar schwer verwundet, aber doch noch lebend verlassen zu haben glaubt? Das Kind könnte wohl etwas von diesen Ereignissen berichten, aber es schweigt. Nun spricht es weder in der allgemein verständlichen noch in seiner selbsterfundenen Sprache ein Wort. Es zeigt sich auf seinem Gesichtchen eine Art Zufriedenheit. Von Zeit zu Zeit fährt es sich mit dem winzigen Handrücken über die Lippen, sich wie ein Kätzchen putzend, dann aber bohrt es sich auch mit beiden Fäustchen in die Augengruben, ein Zeichen, daß es müde und erschöpft ist. Man muß das Kind hindern, und der Mann in blauer Schürze erfaßt die beiden Händchen und öffnet sie zerstreut, als hoffe er, in ihrem Innern einen Zettel mit allem Wissenswerten zu finden. Sie sind außen und innen schmutzig, von Kohlenstaub (oder doch von den Spuren eines Brandes?) befleckt. Aber darüber nachzudenken hat er jetzt keine Zeit. Er ist mit dem Kinde allein geblieben. Am längsten hat der Polizist ausgeharrt, aber zum Schluß hat auch er das verlorene Kind dem Manne überlassen. Das Kind blickt zu diesem auf, als kenne es ihn seit langem. Der Mann zieht sich jetzt die blaue Schürze aus, unter welcher er glücklicherweise sein Jackett trägt. Das Kind hilft ihm, die etwas verknotete Schnalle der Schürze zu lösen. Der Mann, durch die zarte Berührung der winzigen Hand im Rücken sonderbar erschüttert, beugt sein sehr großes, blasses Gesicht zu dem Kinde hinab. Er hat weiche, weite Lippen, er will mit dem Kinde sprechen, besinnt sich aber, daß er sich ihm doch nicht verständlich machen könne. Er führt das Mädchen nun die Alte Jakobstraße entlang, wobei der Unterarm des Mädchens in seiner riesigen, etwas geröteten Hand fast verschwindet. Beinahe trägt er jetzt das namenlose Kind, da das arme Wesen seine Mattigkeit nun erst zu empfinden scheint und die mageren Beinchen schleifend über den Asphalt nachschleppt.