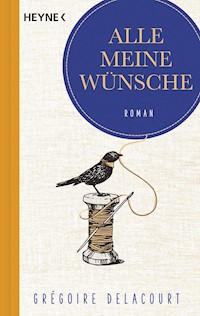9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Mit siebenundvierzig hatte ich noch immer keine Stirnfalten, keine Augenfalten, keine Lachfalten, kein graues Haar, keine Augenringe; ich blieb dreißig und verzweifelt.« Martine führt mit Ende zwanzig ein glückliches Leben. Sie hat studiert, mit André den Richtigen gefunden, ihn geheiratet und einen Sohn zur Welt gebracht. Die Zukunft ist für sie ein großes Versprechen. Doch als sie mit dreißig plötzlich aufhört zu altern, gerät alles ins Wanken. Was nach dem unerreichbaren Traum so vieler Frauen klingt, wird für Martine Wirklichkeit – und zu einer ungeahnten Zerreißprobe, auch für ihre Familie. Denn wer will für immer jung sein, wenn die Liebsten altern? Der neue Roman des Bestsellerautors Grégoire Delacourt ist eine mitreißende Parabel auf unser bizarres Streben nach ewiger Jugend, auf die Schönheit des Alters und die alles überwindende Kraft der Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Grégoire Delacourt
Die Frau, die nicht alterte
Roman
Aus dem Französischen von Katrin Segerer
Atlantik
Für meine Mutter –
sie altert schon viel zu lange nicht mehr
und liebte die Sieben
La femme qui est dans mon lit
N’a plus vingt ans depuis longtemps (…)
Et c’est son cœur
Couvert de pleurs
Et de blessures
Qui me rassure.
Die Frau dort vor mir in den Laken
Ist längst schon keine zwanzig mehr (…)
Es ist ihr Herz
Von tiefem Schmerz
Und Leid zerschrammt
Das mich entspannt.
Georges Moustaki, Sarah
Eins bis fünfunddreißig
Mit einem Jahr sah ich genauso alt aus, wie ich war.
Ein bezauberndes Zweiglein von vierundsiebzig Zentimetern, mit einem Idealgewicht von neun Komma drei Kilo und einem Kopf von sechsundvierzig Zentimetern Umfang, der mit blonden Locken und bei Wind zusätzlich mit einem Mützchen bedeckt war.
Seitdem ich abgestillt war, trank ich einen halben Liter Kuhmilch pro Tag. Meine Kost war um ein paar Gemüsesorten, Sättigungsbeilagen und Proteine reicher geworden. Als Snack zwischendurch gab es selbst gemachtes Fruchtkompott, manchmal mit Stückchen, die auf der Zunge zerschmolzen wie Sorbet.
Mit einem Jahr tat ich auch meine ersten Schritte, davon existiert ein Beweisfoto. Und während ich wie ein tollpatschiges Rehkitz herumhüpfte und über Teppiche und gegen den Couchtisch stolperte, segneten Colette und Matisse das Zeitliche, Simone de Beauvoir erhielt den Prix Goncourt, und Jane Campion kam zur Welt, ohne zu ahnen, dass sie mich neununddreißig Jahre später tief bewegen würde, indem sie ein Klavier an einen neuseeländischen Strand stellte.
Mit zwei Jahren war meine Wachstumskurve der ganze Stolz meiner Eltern und des Kinderarztes.
Mit drei Jahren ergänzten vier große Backenzähne die Sammlung in meinem Mund, die schon acht Schneidezähne, vier kleine Backenzähne und vier Eckzähne umfasste. Trotzdem mahlte Maman mir auch weiterhin alle Nüsse und Mandeln, damit ich mich nicht verschluckte.
Ich maß inzwischen fast einen Meter, sechsundneunzig Zentimeter, um genau zu sein, und mein Gewicht war statistisch bemerkenswert: vierzehn Kilo, gleichmäßig verteilt. Mein Kopfumfang betrug laut Untersuchungsheft zweiundfünfzig Zentimeter, und Papas Einsatz in Algerien wurde verlängert. Er schickte uns traurige Briefe und Fotos von sich im Kreis seiner Freunde – sie rauchen, lachen fröhlich oder lächeln melancholisch, sind zweiundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig Jahre alt und wirken wie Kinder, die sich als Erwachsene verkleidet haben.
Als würden sie nicht mehr altern.
Mit fünf Jahren war ich eine echte Fünfjährige. Ich rannte, sprang, radelte, tanzte, kletterte, war fingerfertig, konnte gut malen, diskutierte gerne, interessierte mich für alles, warf mit Kraftausdrücken um mich, zog mich an wie eine Siebenjährige und war stolz darauf. In Algier gab es einen Staatsstreich, und Papa kam zurück nach Hause.
Ihm fehlte ein Bein, und ich erkannte ihn nicht wieder.
Mit sechseinhalb Jahren fielen mir die Schneidezähne aus, und mein Lächeln wurde zur dümmlichen Grimasse. Eisengeschmack im Mund, die kleine Maus, die mir ein paar Francs unters Kopfkissen legte.
Mit acht Jahren war ich hundertvierundzwanzig Zentimeter groß und wog zwanzig Kilo. Ich trug Jerseyblusen, Karoröcke, Bubikragen und sonntags ein Kleid aus Seidentaft. Auf meinem Haar saßen Schleifen wie Schmetterlinge. Maman fotografierte mich gerne, sie sagte immer, Schönheit sei nicht von Dauer, sie entfliege wie ein Vogel einem Käfig, es sei wichtig, sich an sie zu erinnern, ihr zu danken, dass sie uns auserwählt hat.
Maman war meine Prinzessin.
Mit acht Jahren wurde ich mir meiner sexuellen Identität bewusst.
Ich konnte Traurigkeit und Enttäuschung, Freude und Stolz, Wut und Eifersucht unterscheiden. Ich war traurig, weil Papa mich trotz seiner neuen Prothese nicht auf den Schoß zu nehmen wagte. Ich freute mich, wenn er gute Laune hatte. Dann spielte er Long John Silver, erzählte mir von Schätzen, Meeren und Wundern. Ich war enttäuscht, wenn er Schmerzen hatte, wenn er schlecht gelaunt war, wenn er sich in den jähzornigen und bedrohlichen Long John Silver verwandelte.
Mit neun Jahren lernte ich in der Schule, wie die Menschen sich am Vorabend der Revolution fortbewegt hatten, wie Léon Gambetta mit einem Heißluftballon aus Paris geflohen war, und über unseren Köpfen kreiste ein Russe durchs All – später sollte ein zweihundertfünfundsechzig Kilometer großer Mondkrater nach ihm benannt werden.
Mit zehn Jahren sah ich haargenau aus wie eine Zehnjährige. Ich träumte von einem Pony wie Jane Banks aus Mary Poppins – den Film hatten wir alle zusammen im Cinéma Le Royal geschaut. Und von einem Geschwisterchen, aber Papa wollte kein Kind mehr in diese Welt setzen, die Kinder tötete.
Er redete nie über Algerien.
Er hatte eine Anstellung als Glaser gefunden – »als Seiltänzer auf der Trittleiter«, sagte er lachend, »von einem Bein weniger lasse ich mich doch nicht unterkriegen!« Er stürzte oft, schimpfte auf das fehlende Bein, und jede erklommene Sprosse war ein Erfolg, »ich tue es für deine Mutter, damit sie merkt, dass ich kein Krüppel bin.« Er schaute sich gern bei den Leuten zu Hause um, beobachtete sie. Es beruhigte ihn, dass das Leid überall war. Dass auch andere Jungen in seinem Alter mit unheilbaren Wunden aus Algerien heimgekehrt waren, mit herausgerissenen Herzen, versiegelten Lippen, festgeklebten Lidern, um die Gräuel nicht noch einmal durchleben zu müssen.
Er verglaste das Schweigen, verschloss es wie eine Verletzung.
Maman war schön.
Manchmal kam sie mit roten Wangen nach Hause. Dann zerschlug Long John Silver einen Teller oder ein Glas, nur um sich gleich darauf unter Tränen für seine Tollpatschigkeit zu entschuldigen und die Scherben seines Kummers aufzufegen.
Mit zehn Jahren maß ich hundertachtunddreißig Komma drei Zentimeter und wog zweiunddreißigeinhalb Kilo, meine Körperoberfläche betrug fast einen Quadratmeter – ein Atom im Universum. Ich war anmutig, trällerte Da Doo Ron Ron und Be Bop A Lula in der gelben Küche, um meine Eltern zum Lachen zu bringen, und eines Abends nahm Papa mich auf sein Bein.
Mit zwölf Jahren begannen meine Brüste zu wachsen.
Dank einer gewissen Mary Quant aus England trug Maman nun Röcke, die ihre Knie entblößten und später auch einen Großteil der Schenkel. Ihre Beine waren lang und blass, und ich betete, dass meine später einmal genauso aussehen würden.
Manchmal kam sie abends gar nicht nach Hause, aber Papa zerschlug kein Geschirr mehr.
Bei seiner Arbeit lief es gut. Er reparierte nicht länger nur Rahmen oder ersetzte Scheiben, die durch Unwetter oder böse Absicht zu Bruch gegangen waren, sondern baute auch Fenster in all die modernen Häuschen ein, die rings um die Stadt aus dem Boden schossen und neue Familien, Automobile, Kreisverkehre und Gauner anlockten.
Am liebsten hätte er unsere Wohnung aufgegeben und wäre ebenfalls in eins dieser Häuschen gezogen. »Die haben Gärten und große Badezimmer und voll ausgestattete Küchen«, erzählte er, »deine Mutter wäre glücklich.« Das war alles, was er wollte. Bis es so weit wäre, tröstete er sich mit einem Grandin-Caprice-Fernseher, und wir schauten gebannt Spielshows und Musiksendungen, Le Mot le plus long, Le Palmarès des chansons, ohne ein Wort über sie zu verlieren, ohne auf sie zu warten, ohne Freude.
Dann wurde ich dreizehn.
An einem Abend im Frühsommer ging Maman mit einer Freundin ins Royal, um das neueste Werk eines jungen neunundzwanzigjährigen Filmemachers zu sehen, Ein Mann und eine Frau.
Als sie das Kino verließ, lachte sie, sang, tanzte auf der Straße, und ein ockergelber Ford Taunus erfasste sie.
Sie hatte gerade erst ihren fünfunddreißigsten Geburtstag gefeiert.
Ich hatte sie für unsterblich gehalten.
Mit dreizehn Jahren bin ich urplötzlich gealtert.
Mir war kalt.
Das Zimmer war schlecht beleuchtet, und Maman lag auf einem ziemlich hart wirkenden Bett, die langen Beine, der Körper unter einem weißen Laken. Ihre Schönheit war noch da, sie selbst war entflogen. Später habe ich erfahren, wie die Bestatter dieses friedliche Bild, die Illusion des Lebens erschaffen: subkutane Injektionen, um das erschlaffte Fleisch – Ohrläppchen, Wangen, Kinn – aufzupolstern und das natürliche Aussehen des Gesichts wiederherzustellen. Damit konnte man den Verstorbenen auch neue Rundungen verleihen, falls sie vor ihrem Ableben viel Gewicht verloren hatten.
Das war bei Maman nicht der Fall. Sie war einfach fortgerissen worden. Abgetrennt.
Papa weinte. Ich umschlang seinen großen, einbeinigen Piratenkörper. Wir wärmten einander in der Stille.
Ich weinte nicht, weil Maman mir eingebläut hatte, dass Tränen hässlich machen.
Irgendwann schlüpfte Papa aus seinem Mantel und deckte Maman damit zu. »Sonst verkühlt sie sich noch«, sagte er, dabei verkühlte er sich an jenem Tag.
Sein Herz erstarrte zu Eis.
Ich traute mich in diesem schrecklichen Raum nicht, mit Maman zu reden – in einer dunklen Ecke ein Strauß geruchloser, taufreier Plastikblumen, ein Buch für Klagerufe, die sie niemals lesen würde, das röchelnde Hicksen der Klimaanlage.
Die Worte stauten sich in meiner Brust, erstickten in meiner Kehle, entwichen meinen Lippen in einer wattigen Wolke, ich verabschiedete mich von ihr, als würde ich in den Krieg ziehen, und zog hinaus auf die Straße, zum Lärm der mörderischen Autos, der Wärme des Frühlings, dem Geruch des nahenden Sommers, und plötzlich war Papa neben mir, eine mächtige Eiche.
Im Café an der Ecke orderte er ein gewaltiges Glas Bier und leerte es in einem Zug. Ich trank einen Diabolo. Anschließend bestellte er einen Kir, ihr Lieblingsgetränk, das er auf dem Tisch stehen ließ, und als der Schwips und der Schmerz sich vermischten, stieß er hervor: »Sie ist nicht erst fort, seit sie nicht mehr da ist.«
Mit dreizehn Jahren begriff ich, was Einsamkeit bedeutet.
Später kam die Familie. Mamans Bruder aus Talloires, der Rallyewagen zusammenschraubte, in Begleitung einer Frau, die nicht die seine war – sie hatte Ähnlichkeit mit der Sängerin des Sommerhits La Maison où j’ai grandi, den Maman und ich immer hysterisch in unsere Kochlöffelmikros gebrüllt hatten. Und Papas Eltern aus Valenciennes, mit Haut so fahl wie der Himmel im Norden und Augen so dunkel wie Schiefer; sie waren zusammengewachsen, zwei Seepocken auf einem Felsen. Sie machten sich Sorgen um ihren Sohn. »Wird bestimmt nicht leicht, wieder wen zu finden mit dem Mädel und bloß einer Stelze«, sagte der eine. »Verflucht schwer«, bestätigte die andere.
Und das war’s.
Unsere Familie war eine vom Aussterben bedrohte Art. Eine Blume, die sich am Morgen nicht mehr öffnete.
Nach der Beerdigung gab es einen Leichenschmaus bei uns zu Hause, und Mamans Freunde brachten Kuchen und Andenken mit, weil man sich an das Schöne erinnern muss, um sich aufrecht zu halten. Am Leben zu bleiben.
Marion, mit der Maman den Film von Claude Lelouch gesehen hatte, schenkte mir ein Foto. Es war ein Farbbild, ein Schnappschuss, aufgenommen mit einer Polaroid-Kamera. Maman vor dem Royal. Maman, die mich anlächelt. Maman mit ihrem roten Pony und dem Cardin-Kleid. Zwei Stunden vor dem Ford Taunus. Schön. So schön. Unsterblich schön.
Mit dreizehn Jahren erfuhr ich am eigenen Leib, dass Schönheit nicht von Dauer ist.
Mit fünfzehn Jahren wirkten sich meine pubertären Hormone zum Glück nicht auf meine Laune, meine seelische Verfassung oder mein Verhalten aus.
Ich fühlte mich nicht unwohl in meiner Haut, war weder aggressiv noch rebellisch noch aufgedreht noch überempfindlich noch rührselig – obwohl ich zugegebenermaßen am Ende von Die Reifeprüfung bitterlich weinen musste, als Dustin Hoffman »Elaine! Elaine! Elaine!« schrie, aber das hatte andere Gründe.
Mit fünfzehn Jahren war ich zu einem bildhübschen jungen Mädchen herangewachsen, in grausamer Abwesenheit meiner Mutter, ohne ihre Ratschläge in Sachen Mode, Make-up oder erste Enthaarungsversuche. Niemand sagte mir, was ich dürstenden Männern in Papas Alter erwidern sollte, die mich auf eine Limonade einladen wollten, oder den charmanten, übereifrigen, ungeschickten Jungs in meinem Alter, die von Unbekanntem, Zufällen und vor allem von Brüsten träumten und mit stockender Stimme den neuesten Dylan zum Besten gaben: I’ll Be Your Baby Tonight.
Maman hatte nicht genug Zeit gehabt, um mir vom Hunger der Männer, vom Seufzen der Frauen zu erzählen.
Mit fünfzehn Jahren litt ich zum ersten Mal an Liebeskummer.
Ich schrieb einen Abschiedsbrief an meinen Peiniger und einen zweiten an die Welt, die mich ganz offensichtlich kein bisschen verstand.
Dann klaute ich Papa eine in Wachspapier eingewickelte Rasierklinge. Als ich sie packte, quoll ein Blutstropfen aus meiner Daumenkuppe, ich erstarrte, und alles kehrte wieder zur Normalität zurück.
Ich vermisste Maman. Ihre Arme, ihr Atem hatten mich verwaist zurückgelassen, mir fehlte jede ihrer Poren, jedes Haar, jede Silbe, die sie mir nicht hatte schenken können. Genau wie Papa lief ich nur noch auf einem Bein.
Das seine trug ihn schließlich zu Françoise, vierzig, geschieden, ein Sohn – Michel – in meinem Alter. Die freundliche Verkäuferin aus dem Schuhgeschäft Chat Noir bei den alten Halles war entsetzt darüber, dass Papa immer gleich ein Paar kaufen musste, obwohl er nur den linken anzog. Dieses Entsetzen ließ sein Eisherz antauen, ein paar Verheißungen, warmen Wind und andere Annehmlichkeiten eindringen, und er nahm, wenn man so will, das Bein in die Hand und stürzte sich in ihre offenen Arme.
Mit sechzehn Jahren wuchs ich weiter.
Ich war jetzt einen Meter fünfundsechzig groß, wog zweiundfünfzig Kilo – Hosen saßen an mir wie an Twiggy, zumindest laut der Verkäuferin der Nouvelles Galeries – und trug einen toupierten Pferdeschwanz. In Paris flogen die Pflastersteine, man verbot das Verbieten, schrie nach Liebesspielen statt Kriegslust, und das unterstützte ich voll und ganz, o ja! Ein hübscher, ein wenig älterer Junge hatte es mir nach ein paar Küssen und einer gewagten Berührung sogar schon vorgeschlagen, aber ich hatte mich noch nicht getraut zu verschenken, was ich nur einmal verschenken konnte.
In diesem Jahr wurden die Abiturprüfungen wegen des allgemeinen Chaos mündlich abgehalten, und die überwiegende Mehrheit der Gymnasiasten hatte zu Beginn des Sommers den Abschluss in der Tasche.
Im September heiratete Papa Françoise. Michel wurde mein Stiefbruder. Alles an ihm war düster. Er schaute mich an, ohne mich zu sehen. Wir waren nie Freunde geworden, blieben Bekannte.
Schließlich zogen wir doch noch in die Vorstadt, in eins der Häuschen mit Garten, großem Badezimmer, voll ausgestatteter Küche und Gaskamin, in dem Maman laut Papa glücklich gewesen wäre. Aber das war vor allem gewesen. Vor Anouk Aimée. Vor Jean-Louis Trintignant. Vor dem Strand, dem weißen Mustang und der Musik von Francis Lai.
Mit fast siebzehn Jahren verliebte ich mich Hals über Kopf in Steve McQueen, als ich Bullitt im Royal sah, und in Jean-Marc Delahaye, als er Mamy Blue auf der Gitarre spielte. Es war einfacher, mich dem Zweiten hinzugeben.
Das Ganze fand bei ihm statt, in seinem schmalen Bett im kleinen Jungenzimmer mit den Stickern von Castrol, MV Augusta und Yamaha an der Tür und den Postern des Rennfahrers Giacomo Agostini an der Decke – Romantik pur. Als Jean-Marc sich glücklich und zuvorkommend zurückzog und in Worte zu fassen versuchte, was wir gerade erlebt hatten, schlüpfte ich eilig in meine Klamotten und flüchtete.
Draußen auf der Straße lachte, sang und tanzte ich, ein heranrasendes Auto wich hupend aus, und ich wusste, dass du, Maman, mir an diesem Tag ganz nah warst, dass du mit mir getanzt hast, dass ich deine Freundin geworden bin.
Ich kam mit roten Wangen nach Hause, aber Long John Silver zerschlug nichts.
Er meinte nur: »Du wirkst außer Atem, Martine« – Gott, wie ich meinen Vornamen hasste –, und ich fing an zu schluchzen, antwortete, dass Maman mir fehle, dass es immer noch genauso wehtue, und er stand auf, schenkte einen Schluck Cassissirup in ein Glas, füllte es mit Weißwein auf und stellte es auf den Tisch. Er sagte: »Es tut mir leid, Martine, ich gebe mir Mühe«, er sagte: »Ich weiß, dass man nur eine Maman hat«, und einen Moment lang war sie bei uns.
Dann kamen Françoise und Michel. Wir deckten den Tisch, ich wärmte das Gratin auf, machte einen Salat, und die Worte flogen zwitschernd hin und her – Françoise erzählte von ihrem Tag im Chat Noir, Papa lauschte ihr lächelnd, Michel schwärmte von einer Mobylette, die er irgendwann einmal besitzen wollte, »mit automatischer Dimoby-Kupplung und Drehmomentwandler, fast dreiundfünfzig Kilometer pro Stunde, stell dir vor, Henry!«, und Papa nickte wohlwollend, während er mich verstohlen anschaute. In seinem Blick erkannte ich zum ersten Mal, dass er mich liebte, so gut er konnte.
Michel und ich hielten möglichst viel Abstand voneinander, nicht aus Bosheit, sondern aus Gleichgültigkeit.
Die feinfühlige Françoise ihrerseits nahm immer Papas rechten Arm, ging auf der Seite, auf der sein Bein in der Nähe von Palestro in der Kabylei von einer Haubitze fortgerissen worden war. Sie war seine Krücke. Sie war sein Flügel.
Papa liebte sie, aber diese Liebe, das wurde mir nach und nach klar, war anders als das Verzehren, das ihn mit Maman verbunden hatte.
Mit Maman war die Liebe ein Schmiedeofen gewesen, Eisen, auf das man einhämmert, Raserei, Funken, Brandwunden, Balsam. Eine grenzenlose Leidenschaft, bis zum algerischen Kugelhagel – der Körper kehrte zurück, hatte aber allen Taumel, allen Jubel verloren. Die Lust war der Stille gewichen. Die Impotenz zerfraß Papa. Und wenn Maman abends mit roten Wangen nach Hause kam, nicht weil sie ihren behinderten Mann betrogen hätte, sondern weil sie die Pein gebannt hatte, fachte das fehlende Bein ihn an. Er versuchte, die Glut mit Alkohol zu löschen, aber die Wunden schwelten weiter. Ich glaube, er schrie, weil er Angst hatte. Er zerbrach Dinge, weil sein Körper zerbrochen war. Weil sein Herz in Scherben lag.
Mit siebzehn Jahren sah ich, wie mein Vater endlich sein Lächeln wiederfand.
Dann Lille.
Die Université Catholique, das erste Studienjahr Literaturwissenschaften im sehenswerten Gebäude in der Rue Jean-Bart.
Ich war fast achtzehn, trug flatternde Röcke, die manchmal meine langen, blassen Beine entblößten – danke, Maman –, beschäftigte mich mit dem Theater des achtzehnten Jahrhunderts, Goldoni, Favart, Marivaux, der Semiotik des Bildes und Latein.
Abends trafen sich etwa zwanzig von uns im neu eröffneten Pubstore mit seiner lustigen, bullaugendurchlöcherten Kupferfassade. Dort trank ich meine ersten Cocktails, rauchte meine ersten Zigaretten und ein bisschen Gras, begegnete Träumern, die die Welt und die Grenzen der menschlichen Seele erweitern wollten. Zwei von ihnen schloss ich vorübergehend in die Arme, aber nie ins Herz, und dann kam Christian mit seinem Charme, den glänzenden Augen, für die ich trotz der sorgsam ausgewählten Kleider, der violett oder grün oder blau bemalten Nachthimmellider, der glossigen Lippen, die zum Küssen einluden, trotz der brennenden Haut unsichtbar war – die tiefe Wunde der Gleichgültigkeit.
So schwankte ich durch die Tage und Nächte, das Leben erschien mir endlos, und diese Unermesslichkeit war berauschend. Wir entdeckten amerikanische Independentfilme im Kino-Ciné, diskutierten bis zum Morgengrauen über Vietnam, hörten Joan Baez und Ohio von Neil Young in Dauerschleife, glaubten, wir könnten die Welt verändern, Wörter wie Leid, Hunger, Ungerechtigkeit