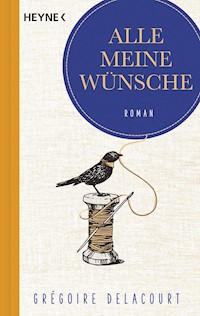9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit sieben Jahren schreibt Édouard sein erstes Gedicht. Wie charmant! Die Familie ist entzückt, von jetzt an steht fest: Édouard ist der Dichter der Familie. Doch für ihn beginnt damit der unaufhaltsame Abstieg: Die Jahre vergehen, und vergebens versucht er diesen einen Moment reiner Liebe und Bewunderung wiederauferstehen zu lassen. Nichts will ihm gelingen: Er wählt die falsche Frau und muss machtlos zusehen, wie seine Familie zerbricht. Statt Schriftsteller wird er Werbetexter, trotz seiner Erfolge fühlt er sich als Versager. »Schreiben heilt«, hat sein Vater immer gesagt – wird Édouard schließlich die Worte finden, die ihn und seine Liebsten zu heilen vermögen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Grégoire Delacourt
Der Dichter der Familie
Roman
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Atlantik
Für Henry und Françoise; man weiß nie.
Ich war der Richtige zu wissen, wie zerstörerisch Bücher sein können, und doch kannte ich kein zuverlässigeres Mittel, diejenigen, die wir am meisten lieben, bei uns zu behalten.
Lionel Duroy,Le Chagrin
Siebzig
Mit sieben schrieb ich Reime.
Mama
du bist kein Lama
Papi
und du kein Okapi
Oma
du singst Paloma
Opi
alle machen Pipi
Mit sieben erlebte ich meinen ersten literarischen Erfolg. Die erwähnte Mama schloss mich in die Arme. Der Papi, die Oma und der Opi applaudierten.
Komplimente ertönten. Es wurde auf mich angestoßen. Bedeutende Worte wurden gesagt. Welch eine Begabung! Die hat er von seinem Großvater Pierre, der 1941 diesen so schönen Brief aus Mauthausen geschrieben hat. Ein Dichter. Ein siebenjähriger Rimbaud.
Eine Träne erschien auf der Wange meines Vaters; eine langsame, schwere Träne. Quecksilber.
Die Blicke veränderten sich. Das Lächeln dauerte an. Mit vier armen Reimen war ich zum Dichter der Familie geworden.
Mit acht hatte ich nichts mehr zu schreiben.
Die Anmut der weiblichen Reime, die ich dann näher kennengelernt hatte, erlaubte mir eine Zeitlang, den anderen etwas vorzumachen. Ich sehe mich noch in der blassgelben Küche unseres Hauses in Valenciennes, in der Hand ein gefaltetes Blatt Papier und meine Eltern vor mir (was sich auf Papier reimt), die voller Bewunderung die Bestätigung der Dichtkunst und der Genialität erwarteten.
Ich glaube,
Dort oben auf der Gaube
Sah ich eine Taube
Meine Schwester begann zu schreien. Mein Bruder flog bis zum First des Buffets empor. Meine Mutter sprang auf und rannte zu den Schnitzeln, die gerade anbrannten.
Mein Vater dagegen rührte sich nicht. Ein seltsamer Schimmer leuchtete in seinen grünen Augen. Er nickte unmerklich mit dem Kopf. Heute weiß ich, dass meine Worte darin umherschwirrten.
Später, als ich im Bett lag, fragte er mich, ob ich das folgende, außerordentliche Wort kennen würde, das nur ein paar wenige Menschen aussprechen können, ohne zu stolpern. Jenes Wort, das den Normalsterblichen vom Dichter unterscheidet:
»Transsubstantiation.«
Mir verschlug es die Sprache.
»Das ist der Begriff, der die Verwandlung einer Substanz in eine andere bezeichnet. Der Glaube in deinem Gedicht ist die Religiosität. Über die Gaube richtet sie sich in die Höhe und verwandelt sich in die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes. Wie bist du darauf gekommen?«
»Ich weiß nicht, Papa, das kam ganz von allein.«
Er gab mir einen Kuss auf die Stirn.
»Dann mach weiter. Lass die Dinge sich schreiben.«
Mit neun Jahren war ich einer von denen, die zu früh Talent hatten.
Erinnern Sie sich. Joselito. Heintje. Les Poppys. Paddy und Maite Kelly. Santiana. Kenji Swada.
Die Wörter nutzten sich ab, während ich älter wurde.
Ich hörte zum ersten Mal den Ausdruck Strohfeuer und begriff, dass Wörter, selbst wenn sie hübsch oder ländlich waren, grausam sein konnten.
Mit neun Jahren lernte ich den Niedergang kennen.
Schreibt Unsinn, kommentierte die Grundschullehrerin. Einen pädagogischen Berater zu Rate ziehen. Die Worte der Direktorin gaben mir den Rest. Muss wiederholen. Eine Therapie in Erwägung ziehen.
Als mein zehnter Geburtstag herandämmerte, versammelten meine Eltern sich zum Konklave.
Einen Tag und eine Nacht lang vereinten sich die Rauchspiralen der Gitanes des einen mit denen der Royale Menthols der anderen zum Nebel eines Strafgerichts. Mein Bruder, meine Schwester und ich saßen hinter der Wohnzimmertür, bekamen rote Augen wie Drogenabhängige und den ausgehungerten Magen der Verurteilten, während wir auf den Urteilsspruch warteten. Mehrmals breitete mein um dreihundertdreiundsechzig Tage jüngerer Bruder seine Flügel aus und brummte Lieder von Tino Rossi. Meine kleine Schwester, die sich gewöhnlich schrill äußerte, begann mit tiefer Stimme zu sprechen. Ich wiederum schrieb das Gedicht der letzten Apokalypse auf ein Blatt Toilettenpapier:
Adieu Valenciennes
Adieu ohne Sinn
Adieu was ich bin
Ein neuer Tag wollte anbrechen.
Im Wohnzimmer gingen die Zigaretten aus. Husten trat an die Stelle des Worts. Das Konklave ging zu Ende. Man würde uns Geschwister auseinanderreißen.
Mit Ringen unter den Augen, grauer Haut, schwerer Zunge, fettigem Haar traten unsere Eltern aus dem Nebel; sie wirkten plötzlich alt.
»Édouard wird aufs Internat gehen.«
Meine Worte vermochten nichts auszurichten. Weder die groben noch die feinen. Noch die jähzornigen, die zuckrigen, die lässigen oder gehässigen.
Herbst 1970, eine tödliche Jahreszeit für meine Kollegen. Mauriac. Dos Passos. Mishima. Bald auch Jean Follain.
Am ersten Schultag schaffte mein Vater es am Steuer seiner Citroën DSuper 5 in weniger als zwei Stunden nach Amiens.
Stellen Sie sich eine Szene in einem Claude-Sautet-Film vor.
Der Wagen hüpft über die Route Nationale, er scheint zu fliegen. Das macht die hydropneumatische Federung – die Tausende von Menschen dazu bringen wird, sich zu übergeben. Der Mann am Steuer zündet sich eine Zigarette am Stummel der vorangegangenen an, er hört nie zu rauchen auf. Er ähnelt Michel Piccoli. Die Scheiben sind geschlossen – wegen der Aerodynamik (das ist zu dieser Zeit ein neues Wort, das mit leichtem Respekt oder misstrauisch verzogenem Gesicht ausgesprochen wird). Neben dem Fahrer sitzt, nicht auf Anhieb zu sehen, weil noch sehr klein und von Rauch eingehüllt, das Kind. Der totgeborene Dichter. Der Schriftsteller, der nicht schreibt. Das Strohfeuer.
»Es ist hart, ich weiß«, sagt der Gitanes-Raucher plötzlich. »Ich habe auch geweint, als ich nach Algerien aufgebrochen bin. Bei meiner Rückkehr hatte ich keine Tränen mehr.«
Und weil die Zigaretten ihm die Kehle austrocknen, stoppt der Fahrer den modernen Wagen vor einem Café an der Place de la Gare von Amiens. Es ist neun Uhr dreißig. Schulbeginn ist um zehn.
»Wir haben noch Zeit«, murmelt Michel Piccoli.
Er bestellt ein dunkles Pelforth, eine heiße Schokolade, zwei Croissants. Dann erscheint, wie durch Zauberei, ein Taschenbuch in seinen Händen. Der Buchschnitt ist orange. Die Gouache auf dem Umschlag zeigt eine bäuerliche Tischgesellschaft im Freien. Ein alter Mann füllt einem blonden jungen Mann das Glas; hinter ihnen posiert ein Hirsch, voller Stolz auf sein Geweih. Es ist ein Roman von Giono. Bleibe, meine Freude.
»Für dich. Du wirst sehen, schreiben heilt.«
Das Kind sieht seinen Vater an, ohne etwas zu begreifen. Heilt wovon? Der Vater spürt die Verwirrung, lächelt, aber erklärt nichts; schon jetzt. Das Kind liebt sein seltenes Lächeln.
Sie kommen natürlich zu spät. Michel Piccoli hilft seinem Sohn, das letzte Bett im Schlafsaal zu beziehen, neben der Tür zu den Toiletten. Seine geschickten Gesten ähneln denen seiner Frau in dem Film, wenn sie die Betten der Kinder in ihrem großen Haus bezieht, das auf einen Garten hinausgeht.
Der Vater begleitet seinen Sohn auf den Gang, dort hören sie, dass der Namensaufruf schon im Gang ist, und das Kind kann nicht umhin, das Homonym zu bemerken. Aber der Raucher lächelt nicht mehr, so verschreckt ist er plötzlich von dem Gefühl, das ihn überkommen hat, seinen Kleinen zu verlassen. Er dreht sich rasch um, läuft zum aerodynamischen Wagen. Ohne seinem Sohn die Chance zu lassen, ihm zu sagen, dass seine Tränen im Auto vom Zigarettenrauch kamen und dass ich, ja, dass ich traurig war.
Cut.
Der Generalpater setzte den Roman von Giono auf den Index.
Er konfiszierte das einzige Geschenk, das mir mein Vater jemals gemacht hatte, und damit den Schlüssel zum Geheimnis. Schreiben heilt.
Wir lebten in einer Welt, in der bald schon ein Mensch über den Mond spazieren und in der Mariah Carey, die Sängerin mit den fünf Oktaven, zur Welt kommen würde, und doch wurde ein sechsunddreißig Jahre zuvor geschriebenes Buch von einem Verbitterten konfisziert.
Um mich an dem Verbitterten zu rächen, wurde ich daher zum Verfasser anonymer Nachrichten.
Ich fing klein an. Schäbig.
Die vier Wörter meiner ersten anonymen Nachricht kratzte ich mit der Spitze eines Bic-Kulis in den Gips der Turnhallentoiletten.
Moncassarge ist ein Arsch
Warum Moncassage (dem ich noch dazu des Reimes wegen ein r verpasst hatte)? Weil er ein Großer war; ein Schüler aus der Achten, düster, wortkarg, ungesellig. Weil er einen Schnurrbart hatte, einen schwarzen Streifen über dem Mund. Und weil anonyme Nachrichten dazu dienen, diejenigen auf Abstand zu halten, die uns ängstigen.
Die elf Wörter der nächsten anonymen Nachricht wurden mit dem Schlüssel unseres Hauses in Valenciennes auf das hölzerne Pult von Moncassage geritzt.
Der Pater General
zeigt gern einmal
den nackten Hintern im Lokal
Und die zwei der letzten mit Wasserfarbe auf die Tür zum Zeichenraum gemalt.
Édouard – Bastard!
(Ich hatte es für raffiniert gehalten, eine gegen mich gerichtete Beleidigung zu verfassen, um von einem möglichen Verdacht abzulenken.)
Übrigens sollten meine Rachenachrichten sich nicht auf das Internat beschränken. Nein. Sie sollten auch jene treffen, die meine Worte erst beweihräuchert und dann geopfert hatten.
Die folgenden richteten sich an meine Mutter. Ich schrieb mit der linken Hand – wir hatten gerade das Wort Graphologie gelernt, und der Lehrer hatte erwähnt, dass es sich um eine Wissenschaft handelte, die es erlaube, die Persönlichkeit zu erkennen und Mörder zu entlarven.
Misstraue, Hexe, den sich überlassenen Söhnen
Stets kehrn sie zurück, dem Schicksal zu höhnen
Das Söhnen/höhnen kam mir ein bisschen platt vor, aber ich konnte nicht anders. Drei Jahre zuvor hatte ich Lama und Mama, Opi und Pipi gewagt und hatte dafür Liebe empfangen.
Seitdem hatte man sie mir wieder genommen.
Flankiert vom Turnlehrer, einem kräftigen Kerl, der einen Blumennamen trug, versammelte der Generalpater alle Schüler im Ehrenhof. Er wies auf die Beleidigungen hin, die an den Wänden der Schule aufgetaucht waren.
Er fand strenge Worte für die dumme Feigheit anonymer Verfasser. Sein Gesicht war rot, vollständig rot; an seiner Schläfe war eine Ader geschwollen, man sah dort das Blut rauschen wie einen tobenden Fluss.
Und dann begann er plötzlich zu lachen. Noch immer hallt sein Lachen in mir wider; das Lachen eines Dämons. »Aber ich bin kein Schwachkopf, ihr Bande von Schwachköpfen!«, schrie er, »wirklich nicht, wie viele unter Ihnen kennen Stanislas-André Steeman?« Wir sahen uns an, suchten besagten Steeman in unseren Reihen. »Eine Bande von Schwachköpfen, und dazu noch ungebildet! Wer hat Der Mörder wohnt Nr. 21 gelesen?« Hier und da ertönte Gelächter. Die Ader des Paters schwoll jetzt so sehr an, dass es bedrohlich wurde; die Schüler in seiner Nähe wichen einen Schritt zurück.
Plötzlich zischte er zwei Spitznamen. »Monsieur Arsch! Monsieur Bastard! Hierher, auf der Stelle!«
Spöttisches Lachen ertönte. Moncassage und ich näherten uns dem Inquisitor. Selbstzufrieden lächelte der Kirchenmann; er würde zwei schwarze Schafe zähmen.
»Sie sind zwei kleine Schlauköpfe«, flüsterte er, als wir dicht bei ihm standen. »Und Schlaukopf, Monsieur Bastard, reimt sich auf …?«
Ich machte große Augen.
»Hohlkopf. Was Sie betrifft, mit Ihrem Teufelsgesicht, Monsieur Arsch: Lügen Sie nicht.«
Da bildete Moncassage mit seiner Hand einen Revolver, richtete ihn auf den Kopf des Generalpaters und drückte ab.
Dieser lautlose Schuss löste eine noch schrecklichere Stille aus. Ein Schüler hatte einen Priester getötet, und der Priester war immer noch am Leben.
Die Waffe wurde wieder zur Hand, die der Mörder mit dem dünnen Schnurrbart mir lächelnd entgegenstreckte. Ich schreckte zurück. Warum wehrte er sich nicht gegen die Beschuldigung, der Verfasser der anonymen Nachrichten zu sein? Würde er etwas im Gegenzug verlangen? Etwas Schreckliches? Hostien zu stehlen? Sein Freund zu werden? Sein Sklave? Aber sein Lächeln war schön. Ich ergriff die ausgestreckte Hand.
»Ich wusste es«, rief der Inquisitor aufstampfend. Er war im siebten Himmel. »Ich wusste es!«
In dem Roman von Steeman gab es nicht einen, sondern drei Mörder, die sich gegenseitig deckten.
Moncassage und ich mussten vier Wochenenden in Folge im Internat bleiben. Unsere Eltern wurden vom Abt einbestellt; zum nächsten Schuljahr würde Moncassage der Besuch des Internats verboten, seine Tat würde in seinem Zeugnisheft vermerkt werden, und ich sollte von nun an in der Zelle schlafen. Das war ein an den Schlafsaal angrenzendes Zimmer. Es wurde die Zelle genannt, weil man darin allein war, und allein sein in einem Jesuitenkolleg bedeutete, angesteckt worden zu sein, ansteckend zu sein. Ein Aussätziger.
In Valenciennes beschloss meine Mutter, gedemütigt von meinem Drohbriefchen und schockiert über meine Komplizenschaft mit diesem Moncassage mit seiner Mördervisage (der Reim stammt von ihr, nicht von mir), ich sei kein Kind wie die anderen. Nicht, dass sie mich als den anderen überlegen ansah, sie ordnete mich eher in die Kategorie von Kindern ein, die anders sind. Im Sinne von gefährlich. »Können Sie sich vorstellen, Herr Doktor, mit sieben war er so sanft, so blond, da hatte er die Haut eines Mädchens, schrieb Gedichte, war das Glück seiner Familie, der reinste Engel, und drei Jahr später bedroht er die Familie, bedient sich seiner Gabe, um uns zu ängstigen, er lässt sich mit einem Spitzbuben ein und versetzt ein ganzes Internat in Angst und Schrecken, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, umso mehr, als es seinem Vater, das bin ich mir schuldig, Ihnen zu sagen, nicht sehr gut geht.« Das bin ich mir schuldig. Was für ein merkwürdiger Ausdruck.
Frühling 1971.
Gestreifte Jerseyblusen von Frank et Fils und die extrem kurzen Röcke von Cacharel sind in Mode, vor allem aber die Psychoanalyse. Die dritte Ausgabe der ein Jahr zuvor von Jean-Bertrand Pontalis gegründeten Nouvelle Revue de Psychanalyse erscheint; meine Mutter ist süchtig danach.
Mit elf Jahren gehe ich also nach einer vorübergehenden und stürmischen Karriere als Dichter jeden Donnerstag- und Samstagnachmittag zu Sitzungen bei einem gewissen Doktor Fromentin hinter dem Bahnhof von Amiens. Der Mann ist nicht unangenehm. Er ähnelt dem Autor Didier Decoin, zu der Zeit, als der den Roman Abraham de Brooklyn schrieb. Ein großer schwarzer Schreibtisch trennt uns. Auf dem schwarzen Schreibtisch liegt ein weißes Blatt. In der Hand des Doktors ein dicker silberner Füllfederhalter, lang wie der Hals eines Vogels, den seine Finger erwürgen. Er redet nicht. Und da auch ich nicht rede, geschieht nichts. Er verschreibt mir Valium und Mogadon. Ich verliere die Lust am Schreiben, am Lachen, am Nachhausefahren, am Reden.
Die Lust am Leben.
Mein Vater ist zu diesem Zeitpunkt fünfundvierzig.
Er ist allein in den Alpen, in Le Corbier, mitten im Massif des Sybelles, er ist schon mehrere Monate allein. Er kommt auch nicht zum zehnten Geburtstag meines Bruders zurück oder zu meinem elften.
Wie jedes Jahr organisiert meine Mutter nur ein Fest für uns beide, weil wir nur zwei Tage auseinander sind, wie sie sagt – tatsächlich sind es dreihundertdreiundsechzig. Es sind sehr wenige Kinder da, viele Erwachsene, Männer. Sie lacht viel. In ihrem Courrèges-Kleid ist sie sehr schön; ihre Lippen sind rosa und glänzen, wenn ein Mann sie zum Lachen bringt und wenn derselbe Mann ihr Feuer hinhält, um ihre Zigarette anzuzünden, klammern sich ihre Finger an seine Hand und scheinen sie nie wieder loslassen zu wollen.
An diesem Tag sah ich, wie meine Mutter uns verließ.
Ich sah ihre neuen Gesten, hörte ihr durchdringendes Lachen. Ich sah sie schön, leichtfertig und untreu. Ich sah sie glücklicher mit anderen als mit uns, als mit meinem Vater, und das war wie ein Geschenk, das sie uns machte, ohne es zu merken. Sie zeigte uns, dass sie ohne uns leben konnte, dass wir uns darauf vorbereiten mussten. Es würde eine Zeit kommen, zu der alles, was wir waren, nicht mehr wäre. Was verband, konnte sich auch lösen, sagte ihr Lachen. Sie gab zu verstehen, dass Risse am Ende immer größer werden.
Dass eine Familie niemals andauert.
Da bekam ich Angst, und mir wurde kalt. Ich verbrachte den Tag an meinen siamesischen Zwilling gedrückt. Die flatterhafte Schönheit unserer Mutter hypnotisierte ihn. Fromentins Mogadon machte mich benommen. Warum war unser Vater schon so lange in Le Corbier? Warum hatten wir keinen Brief von ihm erhalten? Unsere Großmutter väterlicherseits hatte uns aufgefordert, für ihn zu beten, weil es »im Geschäft« schwierig geworden sei; wegen all dieser Barbaren, die sich mit ihren Supermärkten und Kleidern für dreißig Francs vor den Toren der Städte breitmachten, mit ihren Konfektionshemden für achtzehn Francs, ihren Stores zu siebzig Francs den laufenden Meter einschließlich Stange und Montage, diese Ganoven, die uns alle umbringen würden.
Als Geschenk bekamen wir eine Jouef-Modelleisenbahn. Die Gleise bildeten ein Oval, die BB27-Lok und ihr einziger Waggon drehten sich daher hoffnungslos um sich selbst. Mein Bruder lachte. Ich nicht.
Meine Mutter kam zu mir: »Dein Papa ist krank, Édouard, er hat eine Depression.«
»Wird er sterben?«
»Er hätte sterben können, aber er kommt zurück. Weißt du, was ihm guttun würde? Wenn du ihm schriebest.«
Aber ich schreibe nicht mehr, Mama, nicht mehr, seitdem der verbitterte Pater mich dazu verurteilt hat, während meiner Arrest-Wochenenden Die innere Burg der heiligen Theresa von Avila abzuschreiben. Nicht mehr, seitdem die Briefe, die ich dir geschickt habe, unbeantwortet blieben. Nicht mehr seit dem Valium, dem Mogadon.
Ich schreibe nicht mehr.
»Denk daran. Es ist dein Vater.«
Ich verbrachte also meine Hausaufgabenstunden in der Zelle damit, kurze Nachrichten an ihn zu kritzeln. Ich suchte Reime auf Glück. Reime auf komm zurück. Mein Vater fehlte mir, der Rauch seiner Zigaretten, seine Traurigkeit.
Ein paar Wochen später schickte ich ihm eine Postkarte nach Le Corbier. Auf der Vorderseite die Fassade des Rathauses von Valenciennes, das den deutschen Bomben von 1940 standgehalten hatte. Auf die Rückseite nichts Besseres als die drei Wörter. Ich liebe dich.
Er kam ein paar Monate später abgemagert und braun gebrannt zurück; über der Stirn war sein Haar lichter geworden. Seine grünen Augen hatten ihre Spottlust wiedergefunden. Wir weinten alle. Claire sang einen Abzählreim, mein Bruder schenkte ihm einen Lampenschirm aus orangefarbener Wolle, den er (zum Muttertag) in der Schule verfertigt hatte, und ich ein Buch mit Karikaturen von Jacques Faizant. Er nahm uns einen nach dem anderen in die Arme, dankte uns; dankte Gott, wieder bei uns zu sein, schwor, dass alles wieder in Ordnung kommen würde, dann wandte er sich an mich. Er redete langsam und artikulierte genauer als nötig. Man hätte meinen können, er hätte lange nach Worten gesucht, die präzise und bedeutend sein sollten: »Und dir, Édouard, danke ich dafür, dass du mir das Leben gerettet hast.«
Meine Mutter zuckte mit den Schultern und verschwand im Wohnzimmer, wohin sie sich gerne zurückzog, um ihre Royale Menthols zu rauchen. In dem Augenblick, als unser Vater nach Hause gekommen war, war ihre Schönheit vergangen.
Er übernahm das Geschäft wieder. Ordnete bedeutende Vergrößerungsarbeiten an – die die Gesamtverkaufsfläche, wie er ausführte, auf eintausendsechshundertneunundfünfzig Quadratmeter vergrößern würde. Wir hatten sogar die Ehre eines Besuchs von Jacques Anquetil, »dem Engel des Fahrrads«, dem Champion mit fünf Tour-de-France-Siegen, der seine erste Kollektion von Trainingsanzügen bei uns vorstellte. Er schenkte mir einen, signierte ihn mir unter dem Beifall des Personals und den gerührten Blicken der Verkäuferinnen. Die berühmte Unterschrift verschwand beim ersten Waschen, und die Tinte des Filzstiftes hinterließ einen nicht zu entfernenden Fleck an einer Stelle, die mir nicht enden wollenden Spott im Turnunterricht eintrug.
Drei Wörter hatten meinen Vater ins Leben zurückgebracht.
Ich wagte nicht, ihn zu fragen, was geschehen war. Hatte es mit der Schönheit unserer Mutter zu tun? Mit seiner Tränenlosigkeit seit der Rückkehr aus Algerien? War sein Herz abgestumpft, litt meine Mutter darunter? Wir sprachen nicht darüber. Nichts war geschehen.
Unsere Mutter blieb im Wohnzimmer eingeschlossen, verloren im Mentholnebel. Abends waren ihre Augen rot, als hätte sie geweint.
Morgens brach unser Vater immer früher ins Geschäft auf. Wir gewöhnten uns daran, ihn nur noch selten zu sehen. Wir sahen unsere Eltern nur noch sonntags zusammen, bei unserer Großmutter väterlicherseits, bei einem Braten und Bratäpfeln. Mein Vater sprach nur vom Geschäft; man hatte den Eindruck, allein dafür blieben ihm Worte und alle anderen, alle Worte, die vom Wetter, von Musik, den neuesten Nachrichten erzählten, seien verschwunden. Er berichtete von dem Vorhaben, eine Vereinigung der Innenstadt-Händler zu gründen: »Wir werden uns verteidigen, wir werden nicht zulassen, dass die Supermärkte alles diktieren!« Meine Mutter hörte nicht zu. Sie rührte weder den Braten noch die Bratäpfel an. Sie rauchte ein ganzes Päckchen Zigaretten, mit müder Miene, schon so weit weg.
Dann brach der Abend herein; mein Vater fuhr mich zum Bahnhof von Valenciennes, drückte mich an sich, murmelte: »Das tut mir wirklich leid, verzeih mir«, und mit feuchten Augen lief ich auf den Bahnsteig, um dort auf den Zug nach Amiens zu warten, ohne es je gewagt zu haben, ihm die tausendmal geübten Worte zu sagen: »Sprich mit mir, Papa.«
Wir verstummten. Der Gipfel für eine Familie, die über ihren eigenen Dichter verfügte.
Die Psychoanalyse hatte in unserer Familie verheerende Folgen.
Meine Mutter redete nicht mehr, weil sie sich ihre Worte für ihren Analytiker aufsparte, einen gewissen Boucher in Lille. Mein Vater schwieg, weil er wusste, dass Worte zwar heilen, aber auch verletzen, zerstören können. Und wir wagten es nicht mehr, Fragen zu stellen. Den Mund aufzumachen, konnte eine Katastrophe auslösen.
Beispiel.
In der blassgelben Küche, die meine kindlichen Anfänge als Schriftsteller erlebt hatte und die sich unserer Freude erinnerte, als wir noch manchmal eine komische und unbeschwerte Familie gewesen waren, ganz wie die Familien in den Filmen von Frank Capra, fragte ich eines Abends beim Essen meine Eltern: »Bedeutet das Schweigen, dass wir uns nicht mehr liebhaben?«
Daraufhin herrschte zunächst Schweigen, das versteht sich von selbst, dann flogen Gegenstände.
Claire begann zu brüllen, erreichte bislang ungeahnte Höhen. Mein Bruder ahmte sie unter Tränen nach; verängstigt drückte er sich an sie, verschwand in ihr. Sie flüchteten unter dem Bombenhagel und rannten in sein Zimmer. Gelähmt blieb ich da.
Man muss gesehen haben, wie seine Eltern sich prügeln, um zu begreifen, dass ein Kind den Wunsch entwickeln kann zu sterben.
Ich legte mich unter den Tisch. Ein verängstigter Welpe.
Meine Mutter lief aus der Küche, schlug die Tür zu. Später stand mein Vater langsam von seinem Stuhl auf. Seine Beine zitterten. Von jetzt an war er ein sechsundvierzigjähriger Greis. Er machte sich daran, die zerbrochenen Wörter vom Boden aufzulesen, Salzstreuer, Teller, Glas, Wasserkrug, Auflaufform. Er würde die verstreuten Wörter wieder zusammenkleben. Dann würde er sie an ihren ursprünglichen Ort zurückräumen, in der richtigen Ordnung, um daraus einen Satz zu bilden, der besagt, dass alles gut geht, ja, dass alles wieder in Ordnung kommt. Mit der Zeit würde er versuchen, die Narben der Wörter zu verbergen. Er würde sie weit ins Dunkel des Schranks schieben, bis zum Vergessen.
Als er den kleinlauten Welpen sah, bückte er sich, streckte die Hand aus. Das war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Dieser unerwartete Mangel an Schamgefühl lehrte mich, dass es in diesem Augenblick einen Schmerz gab, der noch größer war als meiner. Seiner. Ich ließ mich daher von ihm hinausführen. Zurück zum Licht.
Der Sommer 1971 war verbrecherisch. Louis Armstrong, Jim Morrison, Pierre Flament.
Der Erste erlag einem Herzanfall, der Zweite ebenso, auch wenn etliche dem LSD und dem FBI die Schuld zuschoben, und was den Dritten betrifft, meinen Großvater mütterlicherseits, so erlosch er in der Stille der Krankheit des Vergessens. Er hatte die Namen seiner drei Töchter vergessen. Er hatte sich Reis ins Ohr gesteckt, um ihn zu essen. Er zog die Wasserspülung nicht mehr. Er hatte seine Frau gefragt, wer sie sei; vor allem hatte er gegluckst, als er das Lachen von der Fernsehmoderatorin Denise Fabre hörte.
Die Mutter und die Töchter waren zu Beginn des Jahres zusammengekommen und hatten den Mann, der wieder Kind geworden war, in eine belgische Einrichtung geschickt, wo er zu atmen vergaß.
Als ich seinen toten Körper sah, hatte ich den Eindruck, ich sähe den Ast eines Baumes. Er war so mager, so knorrig. Die Haut schien zu groß für sein Gesicht, sie hing baumelnd herunter wie ein Crêpe-Teig. Es war faszinierend. Mein erster Toter. Meine Mutter weinte. Meine Augen waren trocken. Sie griff nach meiner Hand, wir verließen das Krankenhauszimmer. Draußen war es sehr heiß. Sie setzte sich auf eine Bank im Park, hielt mich fest vor sich. Sah mich lange an, ordnete dann mein Haar; ihre Hand zitterte.
»Du bist schön«, sagte sie mir, »ich bin heute hässlich. Es ist schrecklich, ich habe keinen Papa mehr. Man ist so hässlich, wenn man keinen Papa mehr hat.«
In diesem Augenblick war ich zu jung und hatte zu wenig Talent, um Worte zu finden, die sie überzeugt hätten, dass kein Vater auf dieser Welt eine hässliche Tochter hat. Die Sonne trocknete ihre Tränen und ließ zwei Salznarben auf ihren Wangen zurück. Sie schloss mich einen Augenblick in die Arme, dann stand sie auf, ging zu ihrem Citroën Dyane. »Na komm, beeil dich!«
In diesem Moment wurde mir klar, dass die Kindheit sich entfernte.
Im Wagen schlug sie mir vor, ich solle ein paar Zeilen schreiben, die ich bei der Totenmesse vorlesen könnte. Ich sagte nichts. Ich betrachtete die Landschaft. Ich betrachtete die Äste. Arme. Beine. Rümpfe. Großvaterstücke. Mir wurde schlecht. Sie hielt abrupt an, damit ich mich draußen übergeben konnte, und wartete hinter dem Steuer; die Michelin-Karte, die sie als Fächer nutzte, ließ ihr rotes Haar flattern. Sie war blass und verschwommen.
Plötzlich hupte sie ihre Ungeduld heraus. Ich stieg wieder ein, mit trockenem, stinkendem Mund.
Ich schrieb die ganze Nacht. Fand im Larousse: Mauthausen, Name eines von den Nazis in Österreich geschaffenen Arbeitslagers (die restlichen Informationen mussten mit den Löwenzahnsamen des Larousse-Logos in alle Winde verstreut worden sein). Seit den Nürnberger Prozessen waren die Bilder um die Welt gegangen. Das Grauen, das Entsetzen, das Krebsgeschwür, die Scham, der Schmutz der Menschen. Die Überlebenden waren lebende Tote. Die Krankheit des Vergessens war eine Gnade, die meinem Großvater gewährt worden war. Zwar löschte sie auch die Bilder des Glücks aus, Kinder, die im Sommer über den Strand von Knokke-le-Zoute rennen und »Fang uns, Papa!« rufen, oder das Bild einer Frau, die ihn anlächelt, während sie Zitronenwasser einschenkt, vor allem aber vernichtete sie die Bilder der Finsternis. Die Krankheit, die ihn umgebracht hatte, hatte ihn zugleich gerettet.
Das schrieb ich, damit meine Mutter nicht traurig war.
Das Begräbnis fand vier Tage später in der Kirche Saint-Michel-de-Valenciennes statt. Das Kirchenschiff war schwarz vor Menschen. Man hörte Weinen und das Stabat Mater