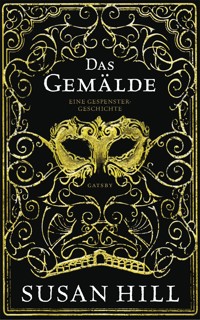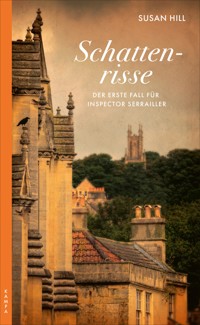Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der aufstrebende junge Anwalt Arthur Kipps reist aus London in den Norden, in das kleine Dorf Crythin Gifford, um der Beerdigung einer verstorbenen Klientin beizuwohnen und ihren Nachlass zu regeln: Mrs. Alice Drablow von Eel Marsh House, wohnhaft in einem abgelegenen Haus im Moor. Was zunächst wie eine routinemäßige Abwicklung der Formalitäten scheint, entwickelt sich zu einem Strudel von Ereignissen und lang gehüteten Geheimnissen, die schrecklicher sind als jeder Albtraum: ein Schaukelstuhl im verlassenen Kinderzimmer, das unheimliche Klappern von Pferdehufen, der Schrei eines Kindes im Nebel und - für Kipps das Schlimmste - immer wieder eine Frau in Schwarz. Die Ein- heimischen sind nicht bereit, über die beunruhigenden Ereignisse zu sprechen, und Kipps ist gezwungen, die wahre Identität der Frau in Schwarz auf eigene Faust herauszufinden. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Hill
Die Frau in Schwarz
Roman
Aus dem Englischen von Lore Straßl
Kampa
Für Pat und Charles Gardner
Heiligabend
Es war Heiligabend, halb zehn. Vom Esszimmer, wo wir gerade das erste festliche Mahl der Feiertage zu uns genommen hatten, ging ich durch den Flur zum Wohnzimmer von Monk’s Piece, in dem meine Familie am Kamin saß, hielt inne und beschloss, kurz nach draußen zu gehen, wie ich es abends oft tue.
Ich bin schon immer gerne im Dunkeln rausgegangen, um frische Luft zu schnappen, egal, ob sie lau war und nach den Blumen des Hochsommers duftete oder beißend nach herbstlichen Feuern und verrottendem Laub roch oder stechend kalt von Frost und Schnee war. Ich schaue auch gern zum Nachthimmel hinauf, ganz gleich, ob der Mond scheint und die Sterne glitzern oder die Schwärze des Himmels vollkommen ist. Ich liebe es, in die Dunkelheit vor dem Haus zu blicken. Ebenso gerne lausche ich den nächtlichen Rufen der Tiere, dem Heulen des auf- und abschwellenden Windes, dem Geräusch von Regentropfen in den Obstbäumen, und ich genieße es, wenn ein Windstoß vom flachen Weideland im Flusstal den Hang zu mir heraufeilt.
Heute roch ich sofort – und es wurde mir gleich leichter ums Herz –, dass sich das Wetter änderte. Die ganze vergangene Woche hatte es geregnet, und Nebelschwaden hatten das Haus und die Gegend verhüllt. Vom Fenster aus konnte man nicht weiter als ein bis zwei Meter in den Garten sehen. Es war ungemütlich und trüb, als wollte es nie so richtig Tag werden. Da machte Spazierengehen keine Freude, zum Jagen war die Sicht zu schlecht, und die Hunde waren ständig schmutzig. Im Haus mussten den ganzen Tag die Lampen brennen, und die Wände der Vorratskammer, der Remise und des Kellers waren feucht und rochen muffig, die Feuer wollten nicht richtig brennen und qualmten.
Seit vielen Jahren beeinflusst das Wetter meine Stimmung, und ich muss gestehen, ohne die Fröhlichkeit und Geschäftigkeit im Haus wäre ich niedergeschlagen und teilnahmslos gewesen. Ich hätte die Vorweihnachtszeit nicht genießen können und mich ununterbrochen über meine Empfindlichkeit und Wetterabhängigkeit geärgert. Aber da schlechtes Wetter Esmé erst recht reizt, etwas zu unternehmen, waren die Weihnachtsvorbereitungen in diesem Jahr noch umfangreicher und überschwänglicher als sonst.
Ich trat aus dem Schatten des Hauses und sah mich im Mondlicht ein wenig um. Monk’s Piece steht auf einem Hügel, der sanft von dem Bach Nee ansteigt, der sich von Norden gen Süden durch diese fruchtbare, geschützte Gegend schlängelt. Unter uns dehnt sich Weideland aus, da und dort von kleinen Mischwäldern unterbrochen. Hinter dem Haus jedoch erstreckt sich eine völlig andere Gegend: mehrere Quadratkilometer Heideland, das von Dickicht durchzogen ist; ein Fleckchen Wildnis inmitten gut bewirtschaftetem Ackerland. Bis zur nächsten, gar nicht so kleinen Ortschaft sind es nur drei Kilometer, und elf bis zu einem größeren Ort. Und doch hat man hier das Gefühl, abgelegen und viel weiter von jeglicher Zivilisation entfernt zu sein.
Ich sah Monk’s Piece zum ersten Mal an einem Hochsommernachmittag, als ich mit Mr Bentley in seiner Kalesche unterwegs war. Mr Bentley war damals noch mein Chef, aber inzwischen bin ich der Sozius der Anwaltsfirma, in der ich als junger Mann als Anwaltsgehilfe angefangen hatte (und bei der ich auch mein ganzes Arbeitsleben blieb). Er näherte sich zu jener Zeit dem Alter, in dem es ihm angebracht erschien, die Zügel der Verantwortung nach und nach aus seinen Händen in meine gleiten zu lassen, obwohl er auch weiterhin wenigstens einmal die Woche nach London in unsere Kanzlei kam, bis er schließlich mit zweiundachtzig Jahren starb. Er hatte das Landleben dem in der Stadt immer mehr vorgezogen. Nicht, dass er gern auf die Jagd ging oder angelte, aber er übernahm mit Freude Ehrenämter, machte den Schöffen, Kirchenvorsteher, Beirat und dies und das für alle möglichen Ausschüsse und Komitees. Ich war sowohl erleichtert wie erfreut gewesen, als er mich schließlich, nach so vielen Jahren, zum Sozius machte, fand aber auch, dass es mir zustand, weil ich wahrhaftig mehr als meinen Beitrag an schwerer Arbeit geleistet und einen großen Teil der Verantwortung bei der Leitung der Firma getragen hatte, mit keineswegs angemessener Entschädigung – zumindest nicht, was meine Position betraf.
So kam es, dass ich an einem Sonntagnachmittag neben Mr Bentley saß und den Blick über hohe Weißdornhecken auf die grüne verschlafene Landschaft genoss, während er sein Pferd langsam zurück zu seinem ziemlich hässlichen und überladenen Herrenhaus traben ließ. Es kam selten vor, dass ich mich zurücklehnen durfte und nichts tun musste. In London lebte ich nur für meine Arbeit und hatte nur wenig Freizeit, in der ich Aquarelle studierte und sammelte. Ich war damals fünfunddreißig und seit neun Jahren Witwer. Ich hielt nichts von gesellschaftlichen Verpflichtungen und neigte, obwohl ansonsten in guter Verfassung, zu gelegentlichen nervösen Zuständen, die meinen Erlebnissen zuzuschreiben waren, von denen ich noch erzählen werde. Die Wahrheit ist, ich bin früh alt geworden, verknöchert, farblos, freudlos – ein lustloser Langweiler.
Ich sagte zu Mr Bentley, wie angenehm und ruhig dieser Tag sei, und nachdem er mir einen verstohlenen Blick zugeworfen hatte, antwortete er: »Sie sollten sich hier vielleicht auch etwas anschaffen. Ein hübsches Cottage. Dort unten zum Beispiel.« Er deutete mit seiner Peitsche auf eine kleine Ortschaft, die sich an eine Biegung des Flusses schmiegte und deren weiß getünchte Häuser in der Nachmittagssonne schliefen. »Fahren Sie übers Wochenende raus aufs Land, machen Sie Spaziergänge, genießen Sie die gute Luft und frische Landeier und Sahne.«
Auch wenn die Vorstellung ihren Reiz hatte, fand ich, dass sie nicht zu mir passte. So lächelte ich nur, atmete den würzigen Duft der Wiesen ein, sah zu, wie die Pferdehufe Staub aufwirbelten, und dachte nicht weiter darüber nach. Zumindest nicht, bis wir zu einem Weg kamen, der an einem lang gestreckten, perfekt proportionierten steinernen Haus auf einer Hügelkuppe vorbeiführte, von dem man eine Aussicht über das ganze Flusstal und kilometerweit bis zur blauen Silhouette der Berge in der Ferne genießen konnte.
In diesem Augenblick berührte mich etwas, das ich nicht so recht beschreiben kann, ein Gefühl, eine Sehnsucht … nein, es war mehr als das: ein Wissen, eine Gewissheit, die mich erfasste, so klar und deutlich, dass ich unwillkürlich aufschrie und Mr Bentley bat anzuhalten. Noch bevor wir standen, sprang ich aus der Kalesche und eilte auf einen kleinen grasbewachsenen Hügel, von dem ich zu dem Haus hinaufschaute, das so schön war und genau richtig, dort, wo es stand, ein schlichtes Haus und doch so beeindruckend. Ich ließ meinen Blick über das Land dahinter schweifen. Ich hatte nicht das Gefühl, je zuvor hier gewesen zu sein, war aber der festen Überzeugung, dass ich wiederkommen würde, dass das Haus bereits mein war, unsichtbar mit mir verbunden. An einer Seite floss ein Bach vorbei, der sich durch die Wiese dahinter zum Fluss hinabschlängelte.
Mr Bentley bedachte mich aus der Kalesche mit einem seltsamen Blick. »Ein schönes Anwesen«, rief er mir zu. Ich nickte, aber ich hätte beim besten Willen nicht über die Gefühle, die mich überkamen, sprechen können. So wandte ich ihm den Rücken zu und stieg ein paar Meter den Hang hinauf, bis ich den Eingang zu dem alten verwahrlosten Obstgarten sehen konnte, der hinter dem Haus lag und am anderen Ende in hohes Gras und wirres Dickicht überging. Dahinter wiederum erspähte ich offenes Brachland. Diese Überzeugung, die ich bereits beschrieben habe, hielt mich fest in ihrem Bann, und ich erinnere mich, dass sie mich erschreckte, denn ich war nie sonderlich phantasievoll gewesen und war schon gar nicht hellseherisch veranlagt. Tatsächlich habe ich seit jenem merkwürdigen Erlebnis bewusst vermieden, über irgendwelche auch nur entfernt übersinnlichen Dinge nachzudenken, und mich an das Sachliche, Sichtbare und Greifbare gehalten.
Trotzdem war ich unfähig, mich dem Glauben oder eher der vollkommenen Gewissheit zu entziehen, dass dieser Besitz eines Tages mein Zuhause sein, dass ich früher oder später der Eigentümer sein würde. Als ich es schließlich akzeptierte und mir auch eingestand, erfüllte mich ein tiefer innerer Frieden und eine ungeheure Zufriedenheit, wie ich beides seit vielen Jahren nicht mehr gespürt hatte. Mit leichtem Herzen kehrte ich zu der Kalesche zurück, wo Mr Bentley mehr als neugierig auf mich wartete. Dieses überwältigende Gefühl, das mich bei der Betrachtung von Monk’s Piece erfüllt hatte, blieb mir erhalten, wenngleich nicht mehr so vordergründig, als ich am Nachmittag nach London zurückkehrte. Ich hatte Mr Bentley gebeten, mich sofort zu benachrichtigen, falls dieser Besitz zum Kauf angeboten würde.
Einige Jahre später war es so weit. Ich setzte mich noch am selben Tag mit dem Makler in Verbindung, und wenige Stunden später, ohne zuvor noch einmal zu dem Haus gefahren zu sein, erklärte ich mich bereit, den geforderten Preis zu zahlen, und bekam den Zuschlag. Wenige Monate vorher hatte ich Esmé Ainley kennengelernt. Unsere Zuneigung zueinander war stetig gewachsen, aber da immer noch der Fluch der Unentschlossenheit in allen gefühlsmäßigen Dingen auf mir lastete, hatte ich über meine Absichten geschwiegen. Ich war jedoch so vernünftig, den Erwerb von Monk’s Piece als gutes Omen zu werten, und eine Woche, nachdem ich formell der Eigentümer geworden war, reiste ich mit Esmé dorthin und machte ihr unter den Bäumen des Obstgartens einen Heiratsantrag. Auch da war mir das Glück hold. Sie gab mir ihr Jawort. Kurz nach unserer Vermählung zogen wir nach Monk’s Piece, und ich glaubte wirklich, dass ich dem langen Schatten der vergangenen Ereignisse endlich entronnen war, und Mr Bentleys Miene und der Wärme seines Händedrucks entnahm ich, dass auch er es glaubte und dass ihm eine Last von den Schultern genommen war. Er hatte sich, zumindest teilweise, die Schuld für das gegeben, was mir widerfahren war – immerhin war er es gewesen, der mich nach Crythin Gifford, zum Eel Marsh House und zur Beerdigung von Mrs Drablow geschickt hatte.
Doch nichts von alldem hätte – zumindest meinen bewussten – Gedanken ferner liegen können, als ich an diesem Heiligabend vor der Tür meines Hauses die kalte Nachtluft einsog. Seit gut vierzehn Jahren war Monk’s Piece ein wahrhaft glückliches Zuhause – für mich, für Esmé und für ihre vier Kinder aus erster Ehe mit Hauptmann Ainley. In der ersten Zeit hatte ich nur an den Wochenenden und Feiertagen heimkommen können, aber das Leben in London und die Geschäfte dort begannen mich bereits von dem Tag an zu verdrießen, als ich den Besitz erstand, und ich war froh, als ich mich bei der ersten Gelegenheit ganz aufs Land zurückziehen konnte.
Und nun hatte sich meine Familie zu Weihnachten wieder in unserem glücklichen Zuhause zusammengefunden. Gleich würde ich die Haustür öffnen und ihre Stimmen aus dem Wohnzimmer hören – wenn meine Ehefrau mich nicht schon zuvor rief und mir besorgt erklärte, dass ich mich erkälten würde. Es war in der Tat sehr kalt und mittlerweile vollkommen aufgeklart. Der Himmel war mit Sternen bedeckt, und der Vollmond hatte einen frostigen Heiligenschein. Die Feuchtigkeit und der Nebel der vergangenen Woche hatten sich wie Einbrecher in der Nacht davongestohlen, die Gartenwege und die Steinmauer des Hauses schimmerten bleich, und mein Atem rauchte in der Luft. Oben in den Mansardenzimmern schliefen Isobels drei kleine Söhne – Esmés Enkel –, und an ihren Bettpfosten hingen Strümpfe. Die Kleinen würden zwar morgen noch nicht von Schnee überrascht werden, aber wenigstens würde der Weihnachtstag klar und freundlich sein.
Etwas hing in dieser Nacht in der Luft, etwas, das mich an meine Kindheit erinnerte und mit der Aufregung in Verbindung stand, mit der mich die kleinen Jungs angesteckt hatten, so alt ich auch war. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass mein Seelenfrieden gestört und meine Erinnerungen, die ich für immer vergessen glaubte, wieder geweckt werden würden. Dass ich erneut Bekanntschaft mit Todesangst und psychischem Terror machen würde, wenn auch nur in eindringlichen Erinnerungen und Träumen, wäre mir in diesem Augenblick unmöglich erschienen.
Ich gönnte mir einen letzten Blick auf die frostklirrende Dunkelheit, seufzte zufrieden, rief nach den Hunden und kehrte ins Haus zurück. Ich freute mich auf eine Pfeife und ein Glas guten Malt Whisky neben dem prasselnden Feuer im Kreis meiner Familie. Als ich durch den Flur zurück ins Wohnzimmer ging, überkam mich ein Wohlgefühl, wie ich es während meines Lebens in Monk’s Piece regelmäßig erlebt habe, ein Gefühl, das ganz natürlich in ein anderes übergeht – eine tiefe Dankbarkeit. Und natürlich war ich dankbar beim Anblick meiner Familie vor dem Kamin, wo Oliver das Feuer zu bedrohlicher Höhe schürte, als er einen dicken Ast eines alten Apfelbaums nachlegte, den wir im vergangenen Herbst im Obstgarten gefällt hatten. Oliver ist Esmés ältester Sohn und hat immer noch eine verblüffende Ähnlichkeit sowohl mit seiner Schwester Isobel (die neben ihrem Ehemann, dem bärtigen Aubrey Pearce, saß) als auch mit seinem nächstjüngeren Bruder Will. Alle drei haben englische Gesichter, mit einem Hang zu Rundlichkeit und mit kastanienbraunen Wimpern und Brauen, der Haarfarbe ihrer Mutter, ehe die grauen Fäden immer mehr zunahmen.
Isobel war erst vierundzwanzig, doch bereits Mutter von drei kleinen Söhnen und entschlossen, noch mehr zu gebären. Sie hatte die gemessene Art einer Matrone und neigte dazu, nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihren Mann und ihre Brüder zu bemuttern und ein wachsames Auge auf sie zu haben. Sie war die vernünftigste, verantwortungsbewussteste Tochter, die man sich nur vorstellen kann, liebevoll und liebenswert. In dem ruhigen und besonnenen Aubrey Pearce schien sie den idealen Partner gefunden zu haben. Doch manchmal ertappte ich Esmé dabei, wie sie ihre Tochter versonnen anblickte, und einmal hatte sie mir, aber nur mir, gestanden, dass sie sich wünschte, Isobel wäre ein bisschen weniger gesetzt, etwas lebhafter, gar leichtsinnig.
Um ehrlich zu sein, ich würde es mir nicht wünschen. Ich würde mir gar nichts wünschen, was die Oberfläche dieser ruhigen, friedlichen See auch nur im Geringsten aufwühlte.
Oliver Ainley, jetzt neunzehn, und sein Bruder Will, nur vierzehn Monate jünger, waren vom Wesen her ähnlich ernsthaft. An diesem Abend aber wirkten sie übermütig wie Welpen, und tatsächlich ließ Oliver Anzeichen von Reife vermissen, wie man sie bei einem Studenten im ersten Jahr in Cambridge erwarten durfte, der einmal, wenn er meinem Rat folgte, Anwalt werden würde. Will lag auf dem Bauch vor dem Kamin, sein glühendes Gesicht in die Hände gestützt. Oliver saß in der Nähe, und hin und wieder stießen sie sich wie aus heiterem Himmel mit den langen Beinen an und benahmen sich, als wären sie wieder zehn.
Der jüngste Ainley, Edmund, saß etwas abseits von allen anderen. Das tat er fast immer, was nichts mit Unfreundlichkeit oder Verdrießlichkeit zu tun hatte, sondern an seiner anspruchsvollen Natur und seiner Zurückhaltung lag, einem inneren Verlangen, mit sich allein zu sein. Das hatte ihn schon immer von Esmés Familie abgehoben, genau wie sein Aussehen, denn im Gegensatz zu den anderen war er sehr hellhäutig, hatte eine lange Nase, tiefschwarzes Haar und blaue Augen. Er war jetzt fünfzehn. Ihn kannte ich am wenigsten, verstand ihn so gut wie gar nicht und fühlte mich in seiner Gegenwart fast unbehaglich. Und trotzdem liebte ich ihn seltsamerweise mehr als die anderen.
Das Wohnzimmer in Monk’s Piece ist lang und niedrig, hat an beiden Enden allerdings hohe Fenster, durch die am Tag sowohl von Norden wie von Süden viel Licht fällt. Heute Abend waren die Vorhänge zugezogen und das Zimmer mit frischen Tannenzweigen geschmückt, die Esmé und Isobel am Nachmittag zugeschnitten hatten. Beeren und sowohl rote als auch goldene Bänder zierten sie. Am Ende des Zimmers stand der geschmückte Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen, darunter waren die Geschenke ausgebreitet. Esmé hatte weiße Chrysanthemen auf mehrere Vasen verteilt, und auf einem runden Tisch in der Mitte des Zimmers war eine Pyramide aus vergoldeten Früchten errichtet. In einer Schale daneben lagen Orangen, die rundum mit Nelken gespickt waren und deren würziger Geruch sich mit dem der Tannenzweige und dem des Feuers zu einem richtigen Weihnachtsduft vermischte. Ich ließ mich in meinem Armsessel nieder, schob ihn ein wenig von der Feuerglut weg und widmete mich dem Stopfen meiner Pfeife, einer Beschäftigung, die mich stets beruhigte. Während ich das tat, wurde mir bewusst, dass ich die anderen mitten in einer lebhaften Unterhaltung unterbrochen hatte und dass zumindest Oliver und Will ungeduldig waren fortzufahren.
»Nun«, sagte ich, während ich zunächst vorsichtig an meiner Pfeife sog. »Lasst euch durch mich nicht stören.«
Eine weitere Pause setzte ein. Esmé schüttelte den Kopf und beugte sich lächelnd über ihre Stickerei.
Schließlich stand Oliver auf und schaltete rasch alle Lampen im Zimmer aus, nur die Kerzen am Christbaum ließ er brennen, sodass wir uns, als er zurückkehrte, lediglich in unmittelbarem Feuerschein sehen konnten. Esmé blieb nichts anderes übrig, als ihre Stickerei zur Seite zu legen – was sie allerdings nicht ganz ohne Protest tat.
»Wenn schon, dann sollten wir es auch richtig machen«, sagte Oliver zufrieden.
»Oh, ihr Jungs …«
»Komm schon, Will, du bist dran, oder?«
»Nein, Edmund ist dran.«
»Dann lasst uns beginnen«, sagte der jüngste der Ainley-Brüder mit merkwürdig tiefer Stimme.
»Ist es denn unbedingt nötig, dass das Licht aus ist?«, fragte Isobel, als rede sie mit kleinen Kindern.
»Ja, Schwesterherz, unbedingt, wenn du die richtige Atmosphäre haben willst.«
»Aber ich bin mir ja gar nicht sicher, ob ich das will!«
Oliver seufzte theatralisch. »Fangt endlich an!«
Esmé beugte sich zu mir herüber und flüsterte: »Sie erzählen Geistergeschichten.«
»Ja«, sagte Will, und seine Stimme hüpfte vor Aufregung und Lachen gleichermaßen. »Genau das Richtige für Heiligabend. Es ist eine alte Tradition.«
»Ein einsames Landhaus, die Gäste kauern in einem dunklen Zimmer um den Kamin, der Wind heult vor den Fenstern …«, begann Oliver.
»Na, dann mal los«, sagte Aubrey gut gelaunt.
Und das taten sie. Oliver, Edmund und Will versuchten, einander mit den furchterregendsten, gruseligsten Geschichten zu übertreffen, die sie voller Dramatik zum Besten gaben. Und wahrhaftig erfand einer gespenstischere Einzelheiten als der andere. Sie erzählten von schleimigen Steinmauern in leer stehenden Burgen und efeuüberwucherten Klosterruinen bei Mondschein, von zugemauerten Kerkern und geheimen Verliesen, von übel riechenden Leichenhallen und vergessenen Friedhöfen, von unheimlichen Schritten auf knarrenden Treppen, von unsichtbaren Fingern, die ans Fenster klopften, von Heulen und Kreischen, Ächzen und Stöhnen, dem Klirren von Ketten, von vermummten Mönchen und enthaupteten Reitern, von wallenden Nebelschwaden und plötzlichen Windstößen, von durchscheinenden Geistern und Gespenstern in Leichentüchern, von Vampiren und Bluthunden, von Fledermäusen, Ratten und Spinnen, von im Morgengrauen aufgefundenen Toten, von Frauen, deren Haar über Nacht ergraute, von tobenden Irren, von verschwundenen Leichen, von verwünschten Nachkommen. Die Geschichten wurden immer grausiger, wilder und verrückter, und bald wurden die eingeschobenen Schreie und das Ächzen, die für Gänsehaut sorgen sollten, zu Lachanfällen, als jeder, selbst die vernünftige Isobel, grässliche Details beitrug.
Anfangs war ich belustigt und hörte geduldig zu, doch allmählich fühlte ich mich als Außenseiter in ihrem Kreis. Ich versuchte, meine wachsende Unruhe zu unterdrücken, die aufsteigende Flut von Erinnerungen zu dämmen. Schließlich war es nur ein aufregender Zeitvertreib, ein harmloses Spiel für junge Leute in der Weihnachtszeit und auch eine alte Tradition, wie Will zu Recht bemerkt hatte. Nichts daran sollte mich quälen, mich beunruhigen. Es war nichts, was ich missbilligen konnte. Ich wollte kein Spielverderber sein, kein alter, phantasieloser, verknöcherter Mann in ihren Augen. Ich sehnte mich danach, bei ihrem harmlosen Vergnügen entspannt mitmachen zu können. Aber innerlich trug ich einen bitteren Kampf aus und wandte den Kopf vom Feuerschein ab, damit niemand mein Gesicht sehen konnte, das, wie ich wusste, anfing, mein Unbehagen zu verraten.
Wie zur Betonung von Edmunds gespenstischem Heulen zerfiel plötzlich das riesige, eben noch von Flammen umgebene Scheit in einem Sprühen von Funken und Asche, und es wurde noch dunkler im Zimmer und mit einem Mal totenstill. Ich schauderte. Ich wollte aufstehen und jedes einzelne Licht anmachen, wollte das Glitzern und Funkeln des bunten Christbaumschmucks sehen, wollte, dass das Feuer wieder prasselnd loderte. Ich wollte die Kälte vertreiben, die in mich kroch, und die Angst, die meine Brust umschloss. Doch ich vermochte mich nicht zu rühren, die Angst hatte mich gelähmt, wie damals. Es war ein in Vergessenheit geratenes, einst nur zu vertrautes Gefühl.
Edmund forderte mich plötzlich auf: »Du bist an der Reihe, Stiefvater.«
Sofort stimmten die anderen in sein Drängen ein, sogar Esmé.
»Nein, nein«, versuchte ich scheinbar humorvoll abzuwehren. »Das ist nichts für mich.«
»Ach komm, Arthur …«
»Du musst doch zumindest eine Geistergeschichte kennen, jeder kennt eine …«
O ja, und ob ich eine kannte! Die ganze Zeit, während ich ihren grausigen Geschichten gelauscht hatte, konnte ich nur an eines denken: Ach, ihr habt ja alle keine Ahnung! Was ihr euch da zusammenreimt, ist Unsinn. So ist es nicht! Nicht so blutrünstig und primitiv – nicht so … lachhaft! Die Realität sieht ganz anders aus, sie ist viel entsetzlicher!
»Ach, komm schon!«
»Sei kein oller Spielverderber!«
»Arthur?«
»Komm schon! Du wirst uns doch nicht enttäuschen?«
Als ich es nicht länger ertrug, stand ich auf und sagte:
»Es tut mir leid, aber ich muss euch wohl enttäuschen. Ich kann euch keine Geschichte erzählen!« Mit diesen Worten drehte ich mich um und verließ rasch das Zimmer und schließlich das Haus.
Etwa fünfzehn Minuten später kam ich wieder zu mir und fand mich mit hämmerndem Herzen und fast atemlos auf dem Brachland hinter dem Obstgarten wieder. In meiner ungeheuren Erregung war ich einfach blindlings losgelaufen. Nun versuchte ich erst einmal, mich zu beruhigen, und setzte mich auf einen moosgepolsterten alten Stein. Ich begann, tief und gleichmäßig zu atmen, bis sich meine innere Anspannung löste, mein Pulsschlag regelmäßiger und mein Kopf klarer wurde. Nach einer kurzen Weile nahm ich meine Umgebung wieder wahr und bemerkte, wie weit der Himmel mittlerweile war, wie die Sterne funkelten, wie schneidend die Luft wehte und wie schön das Gras zu meinen Füßen im Tau glitzerte.
Meine Familie musste verwirrt und bestürzt sein, denn sie kannte mich als ausgeglichenen Mann, den nichts schnell aus der Ruhe brachte. Sie fragten sich sicherlich, warum ich wegen ein paar lächerlicher Geschichten so ausfallend reagierte. Wie sollten sie mein Benehmen auch verstehen können! Ich musste rasch zu ihnen zurück und versuchen, mein unhöfliches Verhalten wiedergutzumachen, den Vorfall irgendwie abzutun und dafür zu sorgen, dass die ausgelassene Stimmung zurückkehrte. Was ich nicht konnte, war, ihnen den Grund für mein Benehmen zu erklären. Nein, doch ich würde fröhlich sein und ruhig, um meiner lieben Ehefrau willen. Aber nicht mehr.
Sie hatten mich einen Spielverderber genannt, hatten versucht, mich dazu zu bringen, die eine Geistergeschichte zu erzählen, die ich doch gewiss, wie jeder Mensch, kannte. Damit hatten sie recht. Ja, ich kannte eine Geschichte, eine wahre Geschichte über Spuk und das Böse, über Angst und Verwirrung, über Grauen und Tragödie. Aber es war keine Geschichte, die man gleichmütig zur Unterhaltung in der Weihnachtszeit am Kamin erzählte …
Insgeheim hatte ich immer gewusst, dass ich dieses Erlebnis nie würde vergessen können, dass es stets mit meinem Ich verwoben und untrennbarer Teil meiner Vergangenheit sein würde. Aber ich hatte gehofft, dass ich mich zumindest nie mehr bewusst daran erinnern müsste. Wie eine alte Narbe machte es sich hin und wieder bemerkbar, aber immer weniger schmerzhaft und immer seltener, und im Lauf der Zeit fand ich mein inneres Gleichgewicht, meine seelische Gesundheit wieder und sogar ein neues Glück. In letzter Zeit war es nicht viel mehr als das leichte Kräuseln der Oberfläche eines Teichs gewesen – nur noch der Hauch einer Erinnerung. Heute Nacht jedoch verdrängte es alles andere. Ich wusste, dass ich keine Ruhe mehr haben würde, dass ich, in kalten Schweiß gebadet, wach liegen und jene Zeit, jene Ereignisse, jene Orte in Gedanken aufs Neue erleben würde.
Ich stand auf und lief weiter durch den Garten. Morgen war Weihnachten. Konnte ich denn nicht wenigstens in dieser gesegneten Zeit davon frei sein? Gab es keine Möglichkeit, die Erinnerung und die Wirkung, die sie auf mich hatte, in Schach zu halten, so wie ein Schmerzmittel oder eine Wundsalbe körperliche Leiden zumindest zeitweise vergessen lassen kann? Und dann, während ich so zwischen den im Mondlicht silbergrau schimmernden Obstbäumen stand, überlegte ich, wie man einen alten Geist vertreibt, der nicht zu spuken aufhört. Durch Exorzismus. Nun gut, dann sollte auch meiner exorziert werden, indem ich meine Geschichte erzählte, nicht laut am Kamin, nicht zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib – nein, dazu war sie zu ernst und zu real. Ich würde sie niederschreiben, mit aller Sorgfalt und in jeder Einzelheit. Ich würde meine eigene Geistergeschichte schreiben. Vielleicht würde ich mich so befreien können und endlich genießen, was immer das Leben noch für mich bereithielt.
Mir war von Anfang an klar, dass niemand außer mir die Geschichte je zu Gesicht bekommen sollte – zumindest nicht solange ich lebte. Ich war es, der unter dem Spuk gelitten hatte, wenngleich ich nicht der Einzige gewesen war, o nein, aber sicherlich der Einzige, der noch am Leben war. Und meine Erregung und Qual an diesem Abend verrieten, dass mich das Ganze immer noch zutiefst verschreckte und deshalb auch ich allein es war, der eines Exorzismus bedurfte.
Ich blickte zum Mond und dem hellen Polarstern auf. Heiligabend. Dann betete ich, ein von Herzen kommendes, schlichtes Gebet um meinen Seelenfrieden und um die Kraft und Ausdauer, während dieser bestimmt schlimmsten Aufgabe meines Lebens durchzuhalten. Ich bat um Segen für meine Familie und um eine friedliche Nachtruhe für uns alle. Denn obwohl ich meine Gefühle wieder unter Kontrolle hatte, graute mir vor den noch bevorstehenden Stunden der Dunkelheit.
Die Antwort auf mein Gebet war die Erinnerung an ein paar Zeilen eines Gedichts, an Zeilen, die ich einst auswendig gelernt, aber inzwischen längst vergessen hatte. Später zitierte ich sie vor Esmé, und sie erkannte sie.
Es heißt, wenn das heilige Fest wiederkehrt,
Wenn wir die Geburt unseres Erlösers feiern,
Werden die Vögel singen die ganze Nacht.
Und es heißt, dass kein Geist
Sich unter die Lebenden wagt,