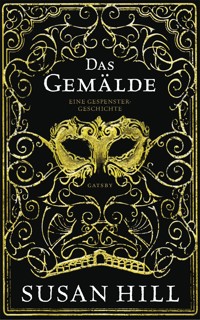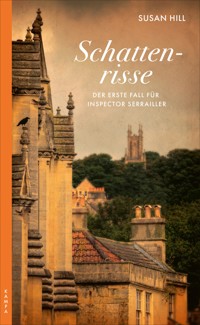
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: EIn Fall für Inspector Serrailler
- Sprache: Deutsch
Im englischen Städtchen Lafferton scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Bis zu dem Morgen, als eine Frau spurlos im Nebel verschwindet. Die Polizei möchte den Fall schnell zu den Akten legen, nur die junge Ermittlerin Freya Graffham hat ein ungutes Gefühl bei der Sache. Zusammen mit ihrer heimlichen Liebe, dem gleichermaßen schöngeistigen wie rätselhaften Polizeichef Simon Serrailler, macht sie sich an die Ermittlungen. Dann verschwinden weitere Menschen und ein Hund. Ihre Spuren verlieren sich auf dem mysteriösen Hügel mit den »Hexensteinen«. Während Freya Graffham noch fieberhaft versucht, eine Verbindung zwischen den Vermissten herzustellen, gerät sie plötzlich selbst in Gefahr. Kann Inspector Simon Serrailler den Fall lösen, bevor das nächste Unglück geschieht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Hill
Schattenrisse
Auftritt für Inspector Simon Serrailler
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
Kampa
Für meinen innig geliebten Geist
The various haunts of men
Require the pencil, they defy the pen.
Der Menschen vielfältige Refugien
Bedürfen des Bleistifts, verweigern sich der Feder.
George Crabbe, The Borough
Das Tonband
Letzte Woche habe ich einen Brief von dir gefunden. Ichdachte, ich hätte keinen einzigen aufgehoben. Ich dachte, ich hätte alles von dir vernichtet. Aber diesen einen habe ich offenbar übersehen. Ich habe ihn zwischen Steuererklärungen gefunden, die älter als sieben Jahre waren und daher weggeworfen werden konnten. Ich wollte den Brief nicht lesen. Kaum sah ich deine Handschrift, wurde mir übel. Ich warf den Brief in den Mülleimer. Aber später habe ich ihn wieder herausgeholt und ihn doch gelesen. Darin hast du dich mehrfach beschwert, dass ich dir nie etwas erzählen würde. »Du hast mir nie mehr etwas erzählt, seit du ein kleiner Junge warst«, hast du geschrieben.
Wenn du nur wüsstest, wie wenig ich dir selbst damals erzählt habe. Du wusstest fast gar nichts von mir.
Nachdem ich deinen Brief gelesen hatte, begann ich nachzudenken, und mir ging auf, dass ich dir jetzt vieles erzählen kann. Ich muss es dir erzählen. Es wird mir guttun, endlich einige Geständnisse abzulegen. Viel zu lange habe ich meine Geheimnisse für mich behalten.
Schließlich kannst du jetzt nichts mehr dagegen unternehmen.
Seit mir dein Brief in die Hände gefallen ist, habe ich viel Zeit damit verbracht, einfach nur dazusitzen, mich zu erinnern und mir Notizen zu machen. Es kommt mir so vor, als hätte ich eine Geschichte zu erzählen.
Also fange ich an.
Als Erstes muss ich dir sagen, dass ich schon sehr früh gelernt habe, wie man lügt. Es mag noch andere Lügen gegeben haben, aber die erste, an die ich mich erinnern kann, ist die Lüge über den Pier. Ich ging dorthin, auch wenn ich behauptete, es nicht zu tun, und das nicht nur einmal. Ich ging sehr oft hin. Ich sparte Geld oder fand es im Rinnstein. Dauernd schaute ich in den Rinnstein, nur für den Fall. Manchmal, wenn es keine andere Möglichkeit gab, stahl ich Geld; eine Brieftasche, einen Geldbeutel, eine Handtasche – für gewöhnlich lagen sie einfach herum. Dafür schäme ich mich heute noch. Es gibt kaum etwas Verachtenswerteres, als Geld zu stehlen.
Aber, verstehst du, ich musste immer wieder dorthin, um die Hinrichtung zu sehen. Ich konnte mich nicht lange fernhalten. Nachdem ich sie gesehen hatte, war ich ein paar Tage lang befriedigt, aber dann wurde der Drang, sie sehen zu müssen, wieder stärker, wie ein ständiger Juckreiz.
Du erinnerst dich doch an den Guckkasten, oder? Die Münze wurde in den Schlitz gesteckt und fiel nach unten, bis sie auf die verborgene Klappe prallte, die alles in Bewegung setzte. Zuerst ging das Licht an. Dann kamen drei kleine Figuren mit ruckhaften Bewegungen in die Hinrichtungskammer: der Pfarrer mit seinem Chorhemd und der Bibel, der Henker und, zwischen ihnen, der Verurteilte. Sie blieben stehen. Die Bibel des Pfarrers ruckte hoch, sein Kopf nickte, danach fiel die Schlinge herunter, und der Henker trat mit einem Ruck vor, hob die Arme, nahm die Schlinge und legte sie dem Verurteilten um den Hals. Dann öffnete sich unter dessen Füßen die Falltür, und er fiel und baumelte dort für ein paar Sekunden, bevor das Licht wieder ausging und alles vorbei war.
Ich habe keine Ahnung, wie oft ich mir das angesehen habe, aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen, weil ich jetzt vorhabe, dir alles zu erzählen.
Erst als der Guckkasten abmontiert wurde, hörte es auf. Eines Tages ging ich zum Pier, und der Kasten war nicht mehr da. Ich möchte dir erklären, wie ich mich gefühlt habe. Wütend – ja, ich war sicherlich wütend. Aber ich spürte auch eine Art verzweifelter Enttäuschung, die lange Zeit in mir brodelte. Ich wusste nicht, wie ich sie loswerden sollte.
Ich habe all die Jahre gebraucht, um das herauszufinden.
Kommt es dir nicht seltsam vor, dass mir seitdem Geld unwichtig ist, mir über die bloßen Notwendigkeiten hinaus nichts bedeutet? Ich verdiene ziemlich viel, aber es ist mir egal. Das Meiste gebe ich weg. Vielleicht hast du die ganze Zeit gewusst, dass ich ungehorsam war und zum Pier ging, denn du hast mal gesagt: »Ich weiß alles.« Das machte mich wütend. Ich brauchte Geheimnisse, Dinge, die nur mir gehörten und niemals dir.
Aber jetzt will ich mit dir reden. Ich möchte, dass du Dinge erfährst, und wenn ich immer noch Geheimnisse habe – was der Fall ist –, möchte ich sie mit dir teilen. Und jetzt kann ich entscheiden, was ich dir erzähle und wie viel und wann. Jetzt bin ich derjenige, der entscheidet.
1
Ein Donnerstagmorgen im Dezember. Halb sieben. Immer noch dunkel. Neblig. So war es den ganzen Herbst über gewesen, mild, feucht, bedrückend.
Angela Randall fürchtete sich nicht vor der Dunkelheit, aber zu dieser trostlosen Uhrzeit und am Ende einer schwierigen Nachtschicht durch die dicke Nebelsuppe heimzufahren, war anstrengend. Im Stadtzentrum waren bereits Menschen auf den Beinen, doch die wenigen Lichter wirkten wie ferne, flauschige kleine Inseln aus Bernstein, deren Glühen weder Licht noch Trost spendete.
Sie fuhr langsam. Am meisten fürchtete sie sich vor Radfahrern, die plötzlich vor ihr auftauchten, aus der Dunkelheit oder dem Nebel, für gewöhnlich ohne reflektierende Streifen an der Kleidung, oftmals sogar ohne Licht. Sie war eine recht gute, aber keine selbstsichere Fahrerin. Die Angst, nicht so sehr vor dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto, sondern davor, einen Fahrradfahrer oder Fußgänger zu überfahren, war immer gegenwärtig. Sie hatte allen Mut zusammennehmen müssen, um überhaupt Fahren zu lernen. Manchmal dachte sie, es sei das Mutigste, dass ihr je abverlangt werden würde. Sie wusste, wie viel Entsetzen und Schock und Trauer ein tödlicher Autounfall bei den Hinterbliebenen auslöste. Immer noch hörte sie das Klopfen an der Haustür, sah die Polizeihelme durch die Milchglasscheibe.
Damals war sie fünfzehn gewesen. Jetzt war sie dreiundfünfzig. Es fiel ihr schwer, sich an ihre Mutter als lebendigen Menschen zu erinnern, gesund und glücklich, denn die Bilder wurden für immer von diesen anderen überlagert – das so sehr geliebte Gesicht, zerschlagen und zusammengeflickt, und der kleine, flache Körper unter dem Laken im kalten, blau-weißen Licht der Leichenhalle. Niemand sonst hatte Elsa Randall identifizieren können. Angela war ihre nächste Angehörige. Sie hatten eine Einheit gebildet, waren einander alles gewesen. Angelas Vater war gestorben, als sie ein Jahr alt war. Sie hatte kein Foto von ihm. Keine Erinnerung.
Mit fünfzehn war sie plötzlich auf niederschmetternde Weise vollkommen allein gewesen, hatte aber in den folgenden vierzig Jahren gelernt, das Beste daraus zu machen. Keine Eltern, Geschwister, Tanten oder Cousinen. Die Vorstellung einer Großfamilie war ihr völlig fremd.
Bis vor Kurzem hatte sie geglaubt, sie käme nicht nur sehr gut mit dem Alleinleben zurecht, sondern wolle es auch nie mehr anders haben. Für sie war es ein natürlicher Zustand. Sie hatte wenig Freunde, mochte ihre Arbeit, hatte ein Fernstudium absolviert und gerade mit einem zweiten begonnen. Vor allem segnete sie den Tag vor zwölf Jahren, als es ihr endlich gelungen war, aus Bevham wegzuziehen und mit ihrem Ersparten, zusammen mit dem Erlös aus dem Verkauf ihrer Wohnung, das kleine Haus im zwanzig Meilen entfernten Lafferton zu kaufen.
Lafferton war genau das Richtige für sie. Der Ort war klein, aber nicht zu klein, hatte breite, begrünte Straßen, ein paar hübsche viktorianische Reihenhäuser und im Kathedralenhof schöne georgianische Häuser. Die Kathedrale selbst war prachtvoll – Angela nahm von Zeit zu Zeit am Gottesdienst teil –, und es gab gute Geschäfte, gemütliche Cafés. Ihre Mutter hätte außerdem gesagt, mit diesem komischen, steifen kleinen Lächeln, dass Lafferton »eine angenehm gehobene Einwohnerschicht« habe.
Angela Randall fühlte sich wohl in Lafferton, angekommen, zu Hause. Sicher. Als sie sich im Frühling dieses Jahres verliebt hatte, war sie zuerst verwirrt gewesen, ein Neuling auf dem Gebiet dieser überwältigenden, alles verzehrenden Gefühle, war aber rasch zu der Überzeugung gelangt, dass ihr Umzug nach Lafferton Teil eines Plans war, der zu diesem Höhepunkt führte. Angela Randall liebte mit einer Versunkenheit und Hingabe, die inzwischen ihr Leben beherrschten. Bald, das wusste sie, würde es auch das Leben des anderen beherrschen. Wenn er akzeptierte, was sie für ihn empfand, wenn sie bereit war, ihre Gefühle zu enthüllen, wenn der Augenblick stimmte.
Bevor sie ihn kennengelernt hatte, war ihr das Leben allmählich etwas hohl vorgekommen. Furcht vor zukünftiger Krankheit, Gebrechlichkeit, Alter war am Rande ihres Bewusstseins aufgetaucht und hatte sie angegrinst. Es hatte sie erschreckt, in ein Alter zu kommen, das ihre Mutter nie erreicht hatte. Sie hatte das Gefühl, kein Recht darauf zu haben. Aber seit diesem Tag im April, als sie ihn kennenlernte, war die Hohlheit einer intensiven und leidenschaftlichen Gewissheit, dem festen Glauben an das Schicksal gewichen. An Einsamkeit, Alter und Krankheit verschwendete sie keinen Gedanken mehr. Sie war gerettet worden. Schließlich war dreiundfünfzig nicht dreiundsechzig oder dreiundsiebzig, sondern die Blüte des Lebens. Mit fünfzig war ihre Mutter regelrecht alt gewesen. Heutzutage blieben die Menschen viel länger jung.
Als sie die schützenden Mauern des Stadtzentrums hinter sich ließ, schlossen sich Dunkelheit und Nebel um das Auto. Sie bog in die seltsamerweise nur Domesday genannte Straße und dann links in den Devonshire Drive. In einigen Schlafzimmern der großen Einfamilienhäuser brannte Licht, das aber nur trüb durch den Nebel schien. Sie reduzierte das Tempo auf dreißig und dann auf fünfundzwanzig Stundenkilometer.
Bei diesem Wetter ließ sich unmöglich erkennen, dass dies einer der anziehendsten und begehrtesten Stadtteile Laffertons war. Sie wusste, wie glücklich sie sich schätzen konnte, das kleine Haus im Barn Close gefunden zu haben, eins von nur fünf Häusern hier, und noch dazu zu einem Preis, den sie aufbringen konnte. Es hatte nach dem Tod des alten Paares, das hier über sechzig Jahre lang gewohnt hatte, mehr als ein Jahr lang leer gestanden. Damals war Barn Close noch keine Sackgasse gewesen, und die meisten der beeindruckenden Häuser am Devonshire Drive waren erst später gebaut worden.
Das Haus war nie modernisiert worden und hatte sich in ziemlich schlechtem Zustand befunden, aber Angela Randall war kaum hinter der jungen Immobilienmaklerin eingetreten, da hatte sie gewusst, dass sie hier leben wollte.
»Ich fürchte, es müsste einiges daran getan werden.«
Doch das alles spielte keine Rolle, weil das Haus sie sofort auf ganz besondere Weise umfing.
»Hier haben glückliche Menschen gelebt«, sagte sie.
Die junge Frau warf ihr einen seltsamen Blick zu.
»Ich möchte ein Angebot abgeben.«
Sie ging in die frostige kleine, nilgrün gestrichene Küche mit dem Emaillegasherd und den braun lackierten Küchenschränken und sah daran vorbei aus dem Fenster, auf das Feld hinter der Hecke und den dahinter aufragenden Hügel. Die Wolken jagten das Sonnenlicht darüber, neckend, ließen die grünen Hänge erst aufleuchten, um sie dann wieder zu verdunkeln, wie spielende Kinder.
Zum ersten Mal seit jenem Klopfen an der Tür vor so vielen Jahren hatte Angela Randall etwas gespürt, das sie nach kurzem Zögern als Glück erkannte.
Ihre Augen brannten vor Müdigkeit und der Anstrengung, im wabernden Nebel durch die Windschutzscheibe zu schauen. Die Nacht war hart gewesen. Manchmal waren die alten Leute ganz ruhig und friedlich, und sie wurden kaum gerufen. Dann sahen sie nur alle zwei Stunden nach dem Rechten und sortierten ansonsten Wäsche oder erledigten andere Routinearbeiten, die ihnen die Tagschicht hinterlassen hatte. In solchen Nächten hatte Angela Randall im Personalraum des Pflegeheims einen Großteil ihrer Aufgaben für das Fernstudium erledigen können. Aber in der letzten Nacht war sie kaum dazu gekommen, ihre Bücher zu öffnen. Fünf Heimbewohner, einschließlich einiger der gebrechlichsten und schwächsten, waren an einer akuten Virusgrippe erkrankt, und um zwei Uhr hatten sie Dr. Deerborn rufen müssen, die eine der alten Damen direkt ins Krankenhaus bringen ließ. Mr Gantleys Medikamente hatten umgestellt werden müssen, und die neuen Tabletten hatten ihm Albträume beschert, wilde, Angst einjagende, schreiende Albträume, von denen die Bewohner der beiden angrenzenden Zimmer wach wurden. Miss Parkinson hatte wieder geschlafwandelt und war bis zur Haustür gelangt, hatte sie aufgeschlossen und entriegelt und war schon halb den Weg hinunter, bis irgendjemand – in der Aufregung über all die Krankheitsfälle – es bemerkte. Demenz war nicht schön. Man konnte nur Schadensbegrenzung betreiben und für sichere Unterbringung sorgen, natürlich zusammen mit einer sauberen, angenehmen Umgebung, vernünftigem Essen und freundlicher Betreuung. Angela Randall fragte sich, wie sie damit fertig geworden wäre, wenn ihre Mutter, hätte sie weitergelebt, eine Krankheit bekommen hätte, die einem die eigene Identität raubt – Persönlichkeit, Gedächtnis, Geist, Würde, die Fähigkeit, sich auf andere zu beziehen –, alles, was das Leben lebenswert macht, kostbar und wertvoll. »Sie nehmen mich doch hier auf, nicht wahr«, hatte sie mehr als einmal spaßhaft zu Carol Ashton gesagt, der Leiterin vom Four-Ways-Pflegeheim, »falls ich je so werden sollte?« Sie hatten gelacht und über etwas anderes gesprochen, aber Angelas Frage war wie die eines Kindes gewesen, das Bestätigung und Schutz sucht. Nun ja, darum brauchte sie sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Sie würde nicht allein alt werden, in welchem Zustand auch immer, das wusste sie nun.
Als sie das Ende des Devonshire Drive erreichte, riss der Nebel auf und verwandelte sich von einer dichten Bank in dünnere Schwaden und Schleier, die sich um die Motorhaube des Wagens wanden. Jetzt wurden dunkle Flecken sichtbar, in denen Häuser und Straßenlaternen in deutlichem Orange und Gold leuchteten. Nach dem Abbiegen in den Barn Close konnte Angela Randall ihr eigenes, weiß gestrichenes Gartentor erkennen. Sie stieß einen langen Seufzer aus, entspannte Nacken und Schultern. Ihre Hände krampften sich schweißnass um das Lenkrad. Doch sie war zu Hause. Vor ihr lagen ein langer Schlaf und vier freie Tage.
Als sie aus dem Auto stieg, legte sich der Nebel wie feuchte Spinnweben auf ihre Haut, aber vom Hügel wehte eine leichte Brise auf sie zu. Vielleicht würde sich dadurch der Nebel völlig auflösen, bis sie bereit war, im ersten Morgenlicht wieder hinauszugehen. Sie war müder als gewöhnlich nach dieser schlimmen Nacht und der unerfreulichen Fahrt, aber es wäre ihr nie eingefallen, den üblichen Ablauf zu verändern. Angela Randall war eine ordentliche Frau mit festen Gewohnheiten. In letzter Zeit war nur eines passiert, was den um sie aufgebauten schützenden Kokon durchbrochen und Unordnung und Chaos prophezeit hatte. Doch in diesem Fall schmeckte die Aussicht auf Unordnung und Chaos süß, und sie hatte es, zu ihrer eigenen Verwunderung, begrüßt.
Trotzdem hielt sie sich zunächst weiterhin an ihren Ablauf. Außerdem würde es sich sofort bemerkbar machen, wenn sie das Laufen auch nur einen Tag ausfallen ließe. Sie würde sich beim nächsten Mal etwas weniger geschmeidig fühlen, etwas weniger leicht atmen können. Der Doktor hatte ihr geraten, Sport zu treiben, und sie vertraute ihm blind. Selbst wenn er von ihr verlangt hätte, sich kopfüber drei Wochen lang an einen Ast zu hängen, hätte sie es getan. Aber keine Sportart reizte sie, darum hatte sie mit dem Laufen begonnen – zuerst nur flottes Gehen, dann Jogging, wobei sie ihre Geschwindigkeit stets gesteigert hatte und mittlerweile täglich drei Meilen lief.
»Ein ausgeglichenes Leben«, hatte er gesagt, als sie ihm erzählte, dass sie sich für ein zweites Fernstudium angemeldet hatte.
»Man muss sich sowohl um den Geist wie auch den Körper kümmern. Ein altmodischer Ratschlag, aber deswegen kein schlechter.«
Sie betrat ihr aufgeräumtes, blitzsauberes Haus. Die Teppiche, ein Luxus, für den sie sorgsam gespart hatte, waren dick und exakt ausgemessen. Als sie die Haustür schloss, umfing sie die Stille, die sie so sehr genoss, eine weiche, tiefe Stille, wattiert, tröstlich.
Alles war an seinem Platz. In gewissem Sinne war das Haus bis vor Kurzem ihr Leben gewesen und mehr, als jede Familie, jedes menschliche Wesen oder Haustier ihr hätte geben können. Auf beruhigende Weise war es genau so, wie sie es am Abend zuvor verlassen hatte. Es gab niemanden, der etwas hätte umstellen können. Angela Randall verließ sich auf Barn Close 4, und es hatte sie nie enttäuscht.
Während der nächsten Stunde aß sie ein Müsli mit klein geschnittener Banane und trank eine Tasse Tee. Ein Ei auf Toast mit einer Scheibe magerem Speck, Tomaten und mehr Tee würden nach dem Laufen folgen. Jetzt deckte sie alles mit einem Tuch ab, die Pfanne, den Brotlaib, die Butter, füllte den Wasserkessel auf, leerte und spülte die Teekanne aus. Alles war bereit für später, nach dem Lauf und der Dusche.
Sie hörte sich die Nachrichten im Radio an und las die Titelseite der Zeitung, die der Zeitungsbote gerade gebracht hatte, ging dann nach oben in ihr hellblaues Schlafzimmer, zog ihre Uniform aus, warf sie in den Wäschekorb, streifte ein sauberes, frisch gebügeltes weißes T-Shirt und einen hellgrünen Trainingsanzug über, dazu weiße Socken und Laufschuhe. Das gebürstete Haar wurde von einem weißen Elastikstirnband zurückgehalten. Sie steckte sich drei eingewickelte Traubenzucker in die Tasche und hängte sich den Ersatzhausschlüssel an einem Band unter der Trainingsjacke um den Hals.
Als sie die Haustür hinter sich schloss, war in den Nachbarhäusern mehr Licht zu sehen, und über dem Hügel brach eine dünne, nasskalte Morgendämmerung an. Der Nebel hing immer noch in der Luft, waberte zwischen den Bäumen und Büschen an den Hängen, wirbelte hoch, wurde dichter, verzog und lichtete sich wieder.
Aber in den Häusern waren die Vorhänge noch nicht zurückgezogen. Keiner schaute aus dem Fenster, begierig darauf, den Tag zu erblicken, zu sehen, was passierte oder wer schon draußen war. So ein Morgen war es nicht. An der Ecke zum Barn Close, ein paar Meter von ihrem Haus entfernt und am Anfang des Weges, der zum Feld führte, verfiel Angela Randall in einen leichten Dauerlauf. Ein paar Minuten später lief sie in vollem Tempo, gleichmäßig, zielbewusst und weitgehend unbeobachtet über die offene Grünfläche und auf den Hügel zu, wo sie, nach ein paar weiteren Metern, in einer plötzlichen dichten, klammen, jedes Geräusch dämpfenden Nebelschwade verschwand.
2
Sonntagmorgen, Viertel nach fünf, und draußen stürmte es. Cat Deerborn hob beim zweiten Klingeln ab.
»Dr. Deerborn.«
»Oje …« Die ältliche Stimme versagte. »Entschuldigen Sie, ich störe Sie nur ungern mitten in der Nacht, entschuldigen Sie …«
»Dafür bin ich ja da. Wer ist dran?«
»Iris Chater. Es geht um Harry – ich hab ihn gehört. Und als ich runterkam, machte er so komische Geräusche beim Atmen. Und er sieht aus … na ja … Irgendwas stimmt mit ihm nicht, Dr. Deerborn.«
»Ich bin gleich da.«
Der Anruf kam nicht unerwartet. Harry Chater war achtzig. Er hatte zwei schwere Schlaganfälle hinter sich, war Diabetiker mit einem schwachen Herzen, und vor Kurzem hatte Cat ein langsam wachsendes Karzinom im Darm diagnostiziert. Eigentlich gehörte er ins Krankenhaus, aber er und seine Frau hatten darauf bestanden, dass er zu Hause besser aufgehoben sei. Was, dachte Cat, während sie leise die Haustür hinter sich schloss, höchstwahrscheinlich auch stimmte. Er war auch zufriedener in dem Bett, das sie unten im Vorderzimmer für ihn hatten aufstellen lassen, wo er die Gesellschaft seiner beiden Wellensittiche genoss.
Rückwärts fuhr sie auf die Straße hinaus. Die Bäume um die Koppel bogen sich im Wind, tauchten kurz im Scheinwerferlicht auf, aber die Pferde waren sicher im Stall untergebracht, und Cats Familie lag in tiefem Schlaf.
Heutzutage wurden kaum noch Wellensittiche gehalten außer von ganz besonderen Vogelliebhabern. Käfigvögel waren aus der Mode gekommen, genau wie Pudel. Cat versuchte sich zu erinnern, während sie einem heruntergefallenen Ast auswich, wann sie zum letzten Mal jemanden mit einem Pudel gesehen hatte, zurechtgestutzt wie die Wollpompons, die Sam und Hannah im Kindergarten angefertigt hatten. Was hatten sie sonst nach an Basteleien mit nach Hause gebracht? Cat stellte im Kopf eine Liste zusammen. Vom Dorf Atch Sedby bis Lafferton waren es acht Meilen, es war stockdunkel, regnete in Strömen, und weit und breit war kein anderes Auto auf der Straße; jahrelang hatte sich Cat, um ihr Gedächtnis zu trainieren und beim Nachtdienst wach zu bleiben, gezwungen, laut Gedichte aufzusagen, die sie in der Schule gelernt hatte … »Von Eule und Katz«, »Ein Wetter, wie’s der Kuckuck mag«, »Ich hatte einen Silberpenny und einen Aprikosenbaum« … und, aus den Examensjahren, Szenen aus Heinrich V. und Monologe aus Hamlet. Radio zu hören schien sie nur schläfriger zu machen, aber Lyrik oder chemische Formeln oder Kopfrechnen hielten sie wach. Oder Listen. Wollpompons, dachte sie, und Nudelbilder und Ferngläser aus Klopapierrollen; Muttertagskarten mit Osterglocken aus gelbem Seidenpapier, schiefe Bastkörbchen, Tiere aus Pappmaché, Mosaike aus kleinen Fetzen gummierten Buntpapiers.
Der Mond kam hinter den jagenden Wolken hervor, als sie gerade nach Lafferton einbog und die Kathedrale vor sich aufragen sah, den großen Kirchturm im Silberlicht, die Fenster mit rätselhaftem Glanz.
Langsam und still zieht der Mond
Silbern er am Himmel thront …
Ihr wollte einfach nicht einfallen, wie es weiterging.
Die Nelson Street gehörte zu zwölf sich kreuzenden Reihenhausstraßen, die als The Apostles bekannt waren. In Nummer 37, fast am Ende der Straße, brannte Licht.
Harry Chater würde vermutlich innerhalb der nächsten Stunde sterben. Das erkannte Cat, als sie in das stickige, vollgestellte kleine Vorderzimmer trat, in dem das Gasfeuer hoch aufgedreht war und der halb antiseptische, halb übel riechende Krankheitsgeruch in der Luft hing. Harry war ein einstmals kräftiger Mann, der jetzt geschrumpft und in sich zusammengesunken war und den all seine Stärke und ein großer Teil seiner Lebenskraft verlassen hatten.
Iris Chater setzte sich wieder auf den Stuhl neben Harrys Bett und nahm seine Hand, rieb sie sanft zwischen ihren Händen, wobei ihr furchtsamer Blick zwischen seinem faltigen, grauen Gesicht und dem von Cat hin- und herflackerte.
»Nun komm, Harry, schau mal, wer hier ist. Dr. Deerborn kommt dich besuchen, Dr. Cat … Darüber freust du dich doch immer.«
Cat kniete sich neben das niedrige Bett und spürte die Hitze des Gasfeuers in ihrem Rücken. Über dem Wellensittichkäfig hing ein goldfarbenes Samttuch mit Fransen, und die beiden Vögel waren still.
Cat konnte nicht viel für Harry Chater tun, aber sie würde auf keinen Fall einen Krankenwagen rufen und Harry zum Sterben wegschicken, vermutlich auf einer harten Rolltrage im Krankenhaus von Bevham. Sie konnte es ihm so angenehm wie möglich machen, das Sauerstoffgerät aus dem Auto holen, um Harry das Atmen zu erleichtern, und bei den beiden bleiben, wenn sie nicht anderswohin gerufen wurde.
Cat Deerborn war vierunddreißig, eine junge Allgemeinärztin. Sie stammte aus einer vier Generationen zurückreichenden Arztfamilie und hatte die Überzeugung geerbt, dass manche der alten Methoden immer noch die besten sind, wenn es um einzelne Patienten geht.
»Nun komm, Harry.« Als Cat mit dem Sauerstoffgerät zurückkam, streichelte Iris Chater die eingefallenen Wangen ihres Mannes und redete leise mit ihm. Sein Puls war schwach, sein Atem ging unregelmäßig, seine Hände waren sehr kalt. »Sie können doch etwas für ihn tun, Dr. Deerborn?«
»Ich kann es ihm bequemer machen. Helfen Sie mir nur, ihn etwas höher zu betten, Mrs Chater.«
Von draußen drückte der Sturm gegen die Fenster. Das Gasfeuer flackerte. Wenn Harry länger als die nächste Stunde oder so durchhielt, würde Cat die Gemeindeschwester herbitten.
»Er leidet doch nicht, oder?« Iris Chater hielt immer noch die Hand ihres Mannes. »Das kann doch nicht angenehm sein mit dieser Maske über seinem armen Gesicht.«
»Dadurch fällt ihm das Atmen leichter. Ich glaube, er hat es so bequem wie möglich, wissen Sie.«
Die Frau sah Cat an. Auch ihr Gesicht war grau und faltig vor Anspannung, die Augen tief eingesunken, die Haut darunter aufgequollen und lila vor Müdigkeit. Sie war neun Jahre jünger als ihr Mann, eine adrette, energiegeladene Frau, doch jetzt sah sie so alt und krank aus wie er.
»Das war doch kein Leben mehr für ihn, schon seit dem Frühjahr nicht.«
»Ich weiß.«
»Es war ihm zuwider … abhängig zu sein, schwach zu sein. Er hat nicht mehr gegessen. Ich hab es kaum geschafft, ihm mehr als einen Löffel voll einzuflößen.«
Cat rückte die Sauerstoffmaske auf Harrys Gesicht zurecht. Seine Nase war gebogen und ragte hervor, da die Wangen zu beiden Seiten eingefallen waren. Der Schädel war deutlich unter der fast transparenten Haut zu erkennen. Selbst mithilfe des Sauerstoffs fiel ihm das Atmen schwer.
»Harry, Lieber …« Seine Frau strich ihm über die Stirn.
Wie viele solcher Paare gibt es heute noch?, dachte Cat. Seit über fünfzig Jahren verheiratet und immer noch zufrieden in ihrer Zweisamkeit? Wie viele aus ihrer Generation würden das durchhalten, alles so nehmen, wie es kommt, weil man das so tat, weil man es versprochen hatte?
Sie stand auf. »Ich glaube, wir könnten beide eine Tasse Tee vertragen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich in Ihrer Küche herumkrame?«
Iris Chater wollte ebenfalls aufstehen. »Du meine Güte, das kann ich doch nicht zulassen, Dr. Deerborn. Ich mach das schon.«
»Nein«, erwiderte Cat sanft, »bleiben Sie bei Harry. Er weiß, dass Sie bei ihm sind. Er möchte, dass Sie bleiben.«
Sie ging hinaus in die kleine Küche. Jedes Bord, jede Fläche war nicht nur mit Küchenutensilien und dem üblichen Geschirr vollgestellt, sondern auch mit Nippes und Zierrat, Kalendern, Figürchen, Bildern, gerahmten Sprüchen, Honigtöpfen in Form von Bienenkörben, Eierbechern mit lächelnden Gesichtern, Thermometern in Messinghaltern und Uhren mit Blumenmuster. Auf der Fensterbank senkte ein Plastikvogel den Kopf, um aus einem Wasserglas zu trinken, als Cat ihn berührte. Sie konnte sich vorstellen, wie begeistert Hannah davon wäre – fast so sehr wie von der rosa Häkelpuppe, deren Rock die Zuckerdose bedeckte.
Cat zündete den Gasherd an und füllte den Wasserkessel. Draußen ließ der Wind ein Tor zuknallen. Das Haus passte zu seinen Bewohnern und sie zu ihm – wie Hände in Handschuhe. Wie konnten sich andere über Becher mit Porträts der königlichen Familie und Handtücher mit dem Aufdruck Zu Hause ist’s am besten und Desiderata lustig machen?
Sie betete darum, dass ihr Handy nicht klingelte. Zeit mit einem sterbenden Patienten zu verbringen – etwas so Gewöhnliches zu tun, wie in dieser Küche Tee aufzugießen, einem ganz gewöhnlichen Paar über die folgenschwerste und belastendste aller Trennungen hinwegzuhelfen –, rückte die Mühen und zunehmenden administrativen Bürden einer Allgemeinpraxis an den richtigen Platz. Die Medizin veränderte sich oder wurde von den grauen Männern verändert, die sie nur noch verwalteten, aber nicht mehr verstanden. Viele von Cat und Chris Deerborns Kollegen wurden zynisch, waren ausgebrannt und demoralisiert. Es wäre leicht, einfach nachzugeben, Patienten in der Sprechstunde wie am Fließband abzufertigen und den Bereitschaftsdienst einer Vertretung zu überlassen. So bekam man nachts genug Schlaf – und sehr wenig Befriedigung durch die Arbeit. Dazu hatte Cat keine Lust. Was sie jetzt tat, war nicht kosteneffektiv, und niemand konnte einen Preis dafür benennen. Harry Chater beim Sterben zu helfen und sich so gut es ging um seine Frau zu kümmern, waren die Aufgaben, auf die es ankam, und ihr ebenso wichtig wie ihnen.
Sie goss den Tee auf und griff nach einem Tablett.
Eine halbe Stunde später, während seine Frau die eine Hand hielt und seine Ärztin die andere, machte Harry Chater seinen letzten, unsicheren Atemzug und starb.
Die Stille in dem erstickend warmen Raum war immens, eine Stille, die eine besondere Qualität besaß, wie Cat bei Sterbenden immer wieder feststellte, als hätte die Erde für einen Augenblick aufgehört, sich zu drehen, und als seien alle Trivialität und Dringlichkeit aus der Welt verschwunden.
»Danke, dass Sie geblieben sind, Dr. Deerborn. Ich bin froh, dass Sie hier waren.«
»Ich auch.«
»Jetzt gibt es viel zu tun, oder? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.«
Cat griff nach der Hand der Frau. »Das hat keine Eile. Bleiben Sie so lange bei ihm sitzen, wie Sie wollen. Reden Sie mit ihm. Verabschieden Sie sich von ihm auf Ihre eigene Weise. Das ist jetzt das Wichtigste. Der Rest kann warten.«
Als sie ging, hatte der Sturm nachgelassen. Es war kurz vor Tagesanbruch. Cat stand neben dem Auto und kühlte ihr Gesicht nach der Hitze im Vorderzimmer der Chaters. Der Mann vom Beerdigungsinstitut war unterwegs, und Iris Chaters Nachbarin war bei ihr. Der Friede war vorbei, und all die trübsinnigen, notwendigen Dinge, die bei einem Todesfall zu erledigen sind, liefen an.
Ihre Aufgabe war beendet.
Von der Nelson Street brauchte man an einem Sonntagmorgen nur zwei Minuten bis zum Kathedralenhof. Es gab einen Frühgottesdienst mit Abendmahl um sieben Uhr, an dem Cat teilzunehmen beschloss, nachdem sie zu Hause angerufen hatte.
»Hallo. Du bist ja wach.«
»Ha ha!« Chris Deerborn hielt den Hörer von sich weg, damit Cat das vertraute Geräusch ihrer miteinander rangelnden Kinder hören konnte.
»Und du?«
»Geht so. Harry Chater ist gestorben. Ich bin bei ihnen geblieben. Wenn es dir recht ist, gehe ich zum Frühgottesdienst und trinke hinterher bei meinem Bruder Kaffee.«
»Simon ist zurück?«
»Er muss gestern Abend angekommen sein.«
»Mach das. Ich geh mit den beiden raus zu den Ponys. Du hast sicher einiges mit Si zu besprechen.«
»Ja, wegen Dads Siebzigstem …«
»Da wirst du vorher eine spirituelle Stärkung brauchen.« Chris war Atheist, respektierte zwar im Allgemeinen Cats Gläubigkeit, konnte sich jedoch ab und zu eine scharfe Bemerkung nicht verkneifen. »Tut mir leid wegen Harry Chater. Das Salz der Erde, die beiden.«
»Er hatte genug. Ich bin nur froh, dass ich dort war.«
»Du bist eine gute Ärztin, weißt du das?«
Cat lächelte. Chris war ihr Mann, aber auch ihr ärztlicher Partner und, wie sie fand, ein besserer Kliniker, als sie je sein würde. Berufliches Lob von ihm bedeutete ihr viel.
Die Seitentür der Kathedrale von St. Michael and All Angels schloss sich fast geräuschlos. Vieles von dem großen Gebäude lag im Dunkeln, aber in einer Seitenkapelle brannten Licht und Kerzen. Cat blieb stehen und schaute hinauf in den hohen Raum, der sich zum Fächergewölbe des Dachs zu bauschen schien. Hier im Halbdunkel zu stehen, war, als wäre man Jonas im Bauch des Wals. Wie anders war es heute als bei ihrem letzten Besuch; damals war die Kirche voll besetzt gewesen mit amtlichen Würdenträgern und einer für einen königlichen Gottesdienst herausgeputzten Gemeinde. Musik hatte den Raum erfüllt, bunte Banner und festliche Messgewänder hatten ihm Farbe verliehen. Diese ruhige, intime Zeit am Morgen gefiel Cat besser.
Sie fand einen Platz unter den bereits knienden zwei Dutzend Menschen, während der Küster den Priester zum Altar geleitete.
Ohne die Kraft, die sie aus ihrem Glauben bezog, hätte sie ihre Aufgaben als Ärztin nicht bewältigen können. Die meisten anderen, die sie kannte und mit denen sie arbeitete, schienen auch so bestens zurechtzukommen, und sie stach auch aus ihrer Familie hervor – obwohl Simon, dachte sie, ihre Überzeugung noch am ehesten teilte.
Auf dem Weg zur Kommunionbank fiel ihr lebhaft das letzte Mal wieder ein, als ihr Bruder und sie hier Seite an Seite gesessen hatten. Das war bei der Beerdigung der drei jungen Brüder gewesen, die von ihrem Onkel ermordet worden waren. Simon war aus beruflichen Gründen hier gewesen, als Leiter der polizeilichen Ermittlungen, Cat als die Ärztin der Familie. Der Gottesdienst war herzzerreißend gewesen. Auf der anderen Seite hatte Paula Osgood gesessen, als forensische Pathologin am Tatort und bei der Obduktion tätig, und hatte Cat später gestanden, dass sie ihr zweites Kind erwartete. Cat fragte sich nach wie vor, wie Paula es geschafft hatte, mit professioneller Distanz und Ruhe die drei kleinen Leichen zu obduzieren, ermordet mit einer Axt und einem Fleischermesser. Menschen wie Paula, Polizisten wie Simon – das waren diejenigen, die alle Kraft und Unterstützung brauchten, die sie bekommen konnten. Dagegen war Cats Beruf als Allgemeinärztin in einem so freundlichen Ort wie Lafferton ein Klacks.
Der kurze Gottesdienst endete, und Rauchwölkchen von den gelöschten Kerzen schwebten auf Cat zu … Sie erhob sich. Eine Frau, die bereits den Gang hinunterging, fing Cats Blick auf und direkt danach noch eine zweite. Beide lächelten.
Cat blieb noch ein paar Sekunden, ließ die anderen vorausgehen und schlüpfte dann rasch aus der Tür auf der anderen Seite des Mittelgangs. Von hier aus konnte sie über den Kirchplatz entkommen und den Pfad zum Kathedralenhof einschlagen, bevor es jemandem gelang, sie abzufangen und entschuldigend um eine inoffizielle Beratung zu bitten.
Außer den Geistlichen der Kathedrale wohnte jetzt kaum noch jemand in den schönen georgianischen Häusern des kleinen Hofs, die größtenteils in Büros umgewandelt worden waren.
Das Haus, in dem Simon Serrailler wohnte, hatte Fenster, die auf den Innenhof und, auf der anderen Seite, zum Fluss Gleen hinausgingen, einem ruhigen Flüsschen, das durch diesen Teil Laffertons floss. Der Eingang zu St. Michael’s 6 befand sich auf dieser Seite, neben einer gewölbten Eisenbrücke, die zum gegenüberliegenden Treidelpfad führte. Eine Entenschar paddelte darunter herum. Weiter oben trat ein Schwan Wasser. Im Frühjahr konnte man von Simons Fenster aus Eisvögel an den Ufern schwirren sehen.
Case und Chaundy. Anwälte
Diözesanbüro
Parker, Phipps, Burns. Steuerberater
Davies, Davies. Anwaltssozietät
Cat drückte auf die oberste Klingel über den Messingschildern, neben einem schmalen, elegant beschrifteten Holzschild. Serrailler.
Da sie ihren Bruder gut kannte – und besser hätte ihn wohl niemand kennen können –, hatte es sie nie überrascht, dass er es vorzog, allein im obersten Stock eines Hauses zu wohnen, unter sich Büros, die meist leer waren, wenn er zu Hause war, und nur mit Enten, dem dunklen Wasser vor dem Fenster und den Kirchenglocken als Gesellschaft.
Si war anders – anders als seine beiden Drillingsgeschwister Cat und Ivo, und auch ganz anders als ihre Eltern und die sonstige Serrailler-Familie. Er war schon immer ein Sonderling gewesen, schon in frühester Kindheit, hatte nie so recht zu einer Familie lärmender, streitlustiger, immer zu Streichen aufgelegter Mediziner gepasst. Wie so ein stiller, selbstzufriedener Mann zur Polizei passte, und das auch noch außerordentlich gut, war ein weiteres Rätsel.
Im Haus war es düster und still. Cats Schritte hallten auf der Holztreppe, die immer höher hinaufführte, vier schmale Stockwerke. An jeder Etage drückte sie auf den Schalter des Treppenlichts, das immer ausging, bevor sie den nächsten Absatz erreichte. Serrailler. Dieselbe Schrift wie auf dem Schild an der Klingel.
»Cat! Hallo!« Ihr Bruder mit seinen ein Meter zweiundneunzig beugte sich herab und schloss Cat in die Arme.
»Ich musste einen frühen Hausbesuch machen und war dann im Frühgottesdienst.«
»Also möchtest du hier frühstücken.«
»Zumindest Kaffee trinken. Ich glaube, ich bring jetzt noch nichts anderes runter. Wie war’s in Italien?«
Simon ging in die Küche, aber Cat folgte ihm noch nicht, wollte erst dieses Zimmer genießen. Es erstreckte sich über die ganze Länge des Hauses und hatte hohe Fenster. Von der Küche konnte man einen Blick auf den Hügel erhaschen.
Die weiß gestrichenen Fensterläden waren zurückgeklappt. Auf den lackierten alten Ulmendielen lagen zwei große, wertvolle Teppiche. Licht floss herein auf Simons Zeichnungen und seine wenigen, sorgfältig ausgewählten Möbelstücke, die souverän Antikes mit klassischer Moderne vereinten. Hinter diesem großen Raum befanden sich ein kleines Schlafzimmer und ein Badezimmer, dann gab es noch die schmale Küche. Alles war auf das hier ausgerichtet, auf diesen einen ruhigen Raum, und Cat kam, dachte sie, aus denselben Gründen hierher, aus denen sie in die Kirche ging – Frieden, Ruhe, Schönheit, zum geistigen wie auch visuellen Aufladen ihrer Akkus. Nichts an der Wohnung ihres Bruders hatte auch nur entfernte Ähnlichkeit mit Cats unordentlichem Bauernhaus, immer laut und unaufgeräumt, voller Kinder, Hunde, Gummistiefel, Zaumzeug und medizinischer Zeitschriften. Sie liebte das Haus, dort befand sich ihr Herz, waren ihre tiefsten Wurzeln. Aber ein kleiner, lebenswichtiger Teil ihrer selbst gehörte hierher, an diesen Zufluchtsort aus Licht und Friedlichkeit. Vermutlich war es das, womit sich Simon seine geistige Gesundheit erhielt und was es ihm möglich machte, seinen oftmals anstrengenden und bedrückenden Beruf so gut auszuüben, wie er es tat.
Auf einem Tablett trug er eine Cafetiere und Becher herein und stellte es auf den Buchenholztisch am Fenster, das auf den Kathedralenhof und die Rückseite der Kirche hinausging. Cat legte ihre Hände um den warmen Keramikbecher und hörte zu, wie ihr Bruder von Siena, Verona und Florenz erzählte, wo er gerade jeweils vier Tage verbracht hatte.
»War es immer noch warm?«
»Goldene Tage, kühle Nächte. Genau richtig, um tagsüber draußen zu arbeiten.«
»Kann ich schon etwas anschauen?«
»Ist noch alles verpackt.«
»Na gut.«
Sie dachte nicht daran, Simon zu drängen, ihr seine Zeichnungen zu zeigen, bevor er diejenigen ausgewählt hatte, die er für die besten und vorzeigbarsten hielt.
Nach dem Schulabschluss war Simon auf die Kunstakademie gegangen, gegen den Wunsch, den Rat und alle Ambitionen ihrer Eltern. Nie hatte er auch nur das geringste Interesse an Medizin gezeigt, anders als jeder Serrailler seit Generationen, und kein Druckmittel hatte ihn dazu bringen können, sich in der Schule länger als notwendig mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Er hatte gezeichnet. Er hatte immer gezeichnet. Auf die Kunstakademie war er gegangen, um zu zeichnen – nicht um Fotos zu machen, Mode zu entwerfen oder Computergrafik zu lernen, und schon gar nicht, um Installation oder Konzeptkunst zu studieren. Er zeichnete hervorragend, Menschen, Tiere, Pflanzen, Gebäude und merkwürdige Winkel aus dem Alltagsleben, auf Straßen, Märkten und allen möglichen öffentlichen Plätzen. Cat mochte seinen inspirierten Strich und die Kreuzschraffierungen, seine raschen Skizzen, die wunderbar beobachteten und ausgeführten Details. Zweimal im Jahr und wann immer er ein Wochenende dazwischen freimachen konnte, flog er zum Zeichnen nach Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland oder noch weiter weg. Er hatte Wochen in Russland verbracht, einen ganzen Monat in Lateinamerika.
Aber er hatte die Kunstakademie nicht abgeschlossen. Er war enttäuscht und desillusioniert gewesen. Niemand, sagte er, wollte, dass er zeichnete, oder war auch nur im Geringsten daran interessiert, Zeichnen zu unterrichten oder zu fördern. Stattdessen war er aufs King’s College in London gegangen und hatte Jura studiert, hatte das Erste Staatsexamen abgelegt und war sofort bei der Polizei eingetreten, seiner anderen Leidenschaft seit der Kindheit. Rasch war er zur Kriminalpolizei gekommen und mit zweiunddreißig zum Detective Chief Inspector befördert worden.
Bei der Polizei war der Künstler, der seine Arbeiten mit Simon Osler – Osler war sein Mittelname – signierte, unbekannt, ebenso wie DCI Simon Serrailler jenen unbekannt war, die zu seinen Verkaufsausstellungen in Orten fern von Bevham und Lafferton kamen.
Cat füllte ihren Becher auf. Sie hatten sich über Simons Urlaub, Cats Familie und den örtlichen Klatsch unterhalten. Was jetzt folgte, würde schwieriger werden.
»Da ist noch was, Si.«
Er blickte auf, hatte ihren Tonfall bemerkt, bekam einen wachsamen Gesichtsausdruck. Wie merkwürdig, dachte Cat, dass er und Ivo die männlichen Drillinge und doch so unterschiedlich sind, als wären sie nicht einmal Brüder. Simon war seit Generationen der Einzige mit blondem Haar, obwohl er Serrailler-Augen hatte, dunkel wie Schlehen. Sie selbst war erkennbar Ivos Schwester, wenn auch sie alle ihn jetzt nicht mehr oft sahen. Ivo arbeitete seit sechs Jahren als fliegender Arzt im australischen Outback und fühlte sich dort pudelwohl. Cat bezweifelte, dass er je wieder nach Hause kommen würde.
»Dad hat nächsten Sonntag Geburtstag.«
Simon sah auf die ziehenden Wolken über der Kirche. Er schwieg.
»Mum lädt uns zum Mittagessen ein. Du kommst doch, oder?«
»Ja.« Seine Stimme verriet nichts.
»Ihm wird das viel bedeuten.«
»Das bezweifle ich.«
»Sei nicht kindisch. Hör auf damit. Du weißt, dass du in der Menge untertauchen kannst – wir werden weiß Gott genügend sein.«
Sie ging, um ihren Kaffeebecher im Stahlbecken auszuspülen. Simons Küche, in der kaum jemals mehr als Kaffee und Toast zubereitet wurde, war schwierig einzubauen gewesen und hatte ein kleines Vermögen gekostet. Cat fragte sich oft, wozu.
»Ich muss nach Hause und Chris beim Ponydienst ablösen. Arbeitest du morgen wieder?«
Simons Gesicht entspannte sich. Sie waren wieder auf sicherem Terrain. Zwei Wochen im Ausland, völlig abgeschnitten von zu Hause und seiner Arbeit, waren mehr als genug für ihn, wie Cat wusste. Ihr Bruder lebte für seine Arbeit und sein Zeichnen – und darüber hinaus für sein Leben hier in dieser Wohnung. Sie akzeptierte alles an ihm und wünschte sich nur gelegentlich, dass es da mehr gäbe. Von einer Sache wusste sie, aber sie sprachen nur darüber, wenn er das Thema anschnitt. Was er selten tat.
Sie umarmte ihn erneut und ging dann rasch. »Bis nächsten Sonntag.«
»Ich werde da sein.«
Nachdem seine Schwester gegangen war, duschte Simon Serrailler, zog sich an und machte sich eine weitere Kanne Kaffee. Nachher würde er auspacken und die Arbeiten aus Italien begutachten, aber davor rief er im Kriminaldezernat Lafferton an. Er musste erst am nächsten Tag offiziell wieder zum Dienst erscheinen, doch er konnte nicht bis dahin warten, um sich auf den neusten Stand bringen zu lassen, nachzuhören, welche Fälle, wenn überhaupt, in seiner Abwesenheit abgeschlossen worden waren, und, wichtiger noch, herauszufinden, was es Neues gab. Zwei Wochen waren eine lange Zeit.
Das Tonband
Hast du eigentlich je gemerkt, wie sehr ich den Hund gehasst habe? Wir hatten nie ein Haustier. Und dann, als ich eines Nachmittags aus der Schule kam, war er da. Ich sehe dich immer noch in deinem Sessel sitzen, den braunen Lederhocker unter deinen Füßen, deine Brille und das Büchereibuch auf dem Tischchen neben dir. Im ersten Moment bemerkte ich ihn nicht. Ich ging zu dir, um dich wie immer zu küssen, und da sah ich ihn – den Hund. Ein sehr kleiner Hund, aber kein Welpe.
»Was ist das?«
»Mein Hund.«
»Warum hast du den?«
»Ich wollte schon immer einen haben.«
Die Augen des Hundes, schimmernd wie Perlen, funkelten unter langen seidigen Fellsträhnen hervor. Ich hasste ihn.
»Ist er nicht süß?«
Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich den Hund hasste, ihn hasste, weil er dein Schoßtier war und du ihn geliebt hast, aber ich hasste ihn auch um seiner selbst willen. Der Hund saß auf deinem Schoß. Der Hund leckte dein Gesicht mit seiner rosa Zunge ab. Der Hund fraß dir Leckerbissen aus der Hand. Der Hund schlief in deinem Bett. Der Hund hasste mich genauso wie ich ihn. Das wusste ich.
Aber seltsam genug, wenn es den Hund nicht gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht nie entdeckt, was ich werden wollte, was mein Schicksal war.
Ich weiß, dass du dich an den Tag erinnerst. Ich lag auf dem Kaminvorleger und neckte den Hund, wedelte mit den Fingern unter seiner Nase, bis er zuschnappte, dann riss ich sie weg. Ich wurde sehr gut darin, genau den richtigen Moment abzupassen, und ich weiß, dass er mich nie gekriegt hätte, wenn ich auf dieselbe Weise weitergemacht, dieselbe Sache immer und immer wieder getan hätte. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Später war ich wegen meiner eigenen Dummheit wütend auf mich. Ich lernte daraus, einen Plan aufzustellen und mich an ihn zu halten. Ich lernte sehr viel an diesem Tag, nicht wahr, und das aus einem einzigen Fehler. Statt mit meinen Fingern unter der Nase des Hundes zu wedeln, beugte ich mich vor und machte ein Knurrgeräusch, dachte, damit würde ich ihn verwirren und er würde Angst vor mir bekommen. Ich wollte, dass er Angst vor mir hatte. Stattdessen sprang er hoch und biss mich ins Gesicht, riss mir ein Stück aus der Oberlippe.
Ich war sicher, dass du den Hund einschläfern lassen würdest, weil er mir das angetan hatte, aber du sagtest nur, ich sei selbst schuld.
»Vielleicht wird dich das lehren, ihn nicht zu necken«, hast du gesagt. Kannst du verstehen, wie sehr mich das verletzte? Kannst du das?
Ich war noch nie im Krankenhaus gewesen. Du hast mich mit dem Bus dorthin gebracht, ein sauberes Taschentuch an meine Lippe gedrückt. Ich wusste nicht, wie es in einem Krankenhaus zugehen würde. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein so aufregender, schöner und gefährlicher Ort sein würde, aber gleichzeitig ein Ort größter Behaglichkeit und Sicherheit. Ich wollte für immer zwischen den weißen Betten und schimmernden Rolltragen und mächtigen Menschen bleiben.
Was sie mit mir machten, tat weh. Sie betupften meine Lippe mit einem Antiseptikum. Ich mochte den Geruch. Dann nähten sie die Oberlippe. Der Schmerz war unbeschreiblich, doch ich mochte den Arzt, der die Wunde vernähte, und die Schwester mit dem strahlend weißen Häubchen, die meine Hand hielt. Du bist draußen geblieben.
Also, verstehst du, die Tatsache, dass du den Hund mehr geliebt und mich mit ihm betrogen hast, spielte am Ende keine Rolle, denn ich hatte meinen Weg gefunden. Ich kann dir den Betrug sogar verzeihen, weil deiner nicht der schlimmste war. Der kam später. Deinen Betrug habe ich überwunden, aber den anderen nie, weil ich von dem betrogen wurde, was ich lieben musste. Dich habe ich nie geliebt.
Das hab ich dir nie gesagt. Aber jetzt erzähle ich dir alles. Darüber sind wir uns doch einig, nicht wahr?
3
Donnerstagmorgen, und das erste Licht kommt gerade durch den taubengrauen Nebel. Milde Luft.
Auf dem Hügel, einer samtig grünen Insel, die aus einem dunstigen Meer aufsteigt, sind alle Bäume kahl, aber Büsche und Dornenranken, die wie Körperhaare in den Mulden und Senken sprießen, sind voller Beeren und haben die letzten Blätter noch nicht abgeworfen. Auf halber Höhe des Hügels befinden sich die Wernsteine, uralte aufragende Steine, die wie drei Hexen um einen unsichtbaren Kessel hocken. Bei Tageslicht laufen die Kinder dazwischen herum, fordern sich gegenseitig heraus, die pockennarbige Oberfläche zu berühren, und in der Mittsommernacht versammeln sich hier vermummte Gestalten zum Tanzen und Singen. Aber sie werden ausgelacht und gelten als harmlos.
Um diese frühe Stunde rennen ein paar Jogger den Hügel hinauf und um ihn herum, mit wuchtigen Schritten, immer allein, ohne irgendetwas zu bemerken. Heute sind es zwei Männer in ihren federnden Schuhen. Keine Frau. Als das Licht heller wird und sich die Nebeldecke zurückzieht, rasen drei junge Männer auf Mountainbikes den sandigen Pfad zur Kuppe hinauf, strengen sich an, schnaufen und keuchen, steigen aber nicht ab.
Ein alter Mann führt seinen Yorkshireterrier aus und eine Frau ihre beiden Dobermänner, rund um die Wernsteine und in flottem Tempo wieder den Pfad hinab.
Nachts mögen sich Menschen auf dem Hügel aufhalten, aber nicht die Jogger und die Mountainbiker.
Später geht die Sonne auf, blutrot über den verkümmerten Büschen und Ranken und dem moosigen Gras, berührt die Wernsteine, gleitet über Fetzen verwehten Papiers, die weiße Blume eines fliehenden Kaninchens, eine tote Krähe.
Niemand entdeckt etwas Ungewöhnliches auf dem Hügel. Menschen gehen, laufen, fahren dort herum, finden aber nichts, melden nichts Alarmierendes. Es ist wie immer, die stehenden Steine, die Baumkronen, die kein Geheimnis preisgeben. Fahrzeuge bleiben auf den gepflasterten Wegen, und außerdem hat es geregnet; Reifenspuren sind längst verwischt.
4
Debbie Parker lag im Bett, eng zusammengerollt, die Knie angezogen. Draußen vor ihrem Fenster schien die Sonne, hell für einen Dezembermorgen, aber Debbies Vorhänge waren dunkelblau und fest zugezogen.
Sie hörte Sandys Wecker, Sandys Duschwasser, Sandys Radiosender BEV, nichts davon bedeutete ihr etwas. Wenn Sandy zur Arbeit gegangen war, konnte Debbie weiterschlafen, einen stillen Morgen verschlafen, die Sonne ausschließen, den Tag, das Leben.
Nach dem Aufwachen gab es immer einen Sekundenbruchteil, in dem sie sich gut fühlte, normal fühlte, »Hey, es ist Tag, los geht’s«, bevor die erdrückende, düstere Trübsal über ihr Gedächtnis kroch wie ein einsickernder Tintenfleck über ein Löschblatt. Vormittage waren schlimm, und seit sie ihren Job verloren hatte, wurden sie noch schlimmer. Debbie wachte mit Kopfschmerzen auf, die ihren Geist vernebelten, sie herunterzogen und den halben Tag andauerten. Wenn sie die enorme Anstrengung unternahm, aufzustehen und im Ort herumzulaufen – irgendetwas zu tun –, ließen die Schmerzen langsam nach. Im Lauf des Nachmittags hatte sie dann das Gefühl, damit zurechtzukommen. Abends lief es oft richtig gut. In der Nacht nicht, selbst wenn sie ein paar Drinks zu sich genommen hatte und zwar nicht fröhlich, aber zumindest ohne viel nachdenken zu müssen ins Bett fiel. Um drei wachte sie mit einem Ruck auf, das Herz schlug zu schnell, sie schwitzte vor Angst.
»Debbie …«
Geh weg. Komm nicht rein.
»Zehn vor acht.«
Die Tür öffnete sich, Licht fiel auf die Wand.
»Tee?«
Debbie bewegte sich nicht, sagte nichts. Geh weg.
»Nun komm schon …«
Die Vorhänge wurden aufgerissen, mit einem Geräusch, als würden ihr alle Zähne gezogen. Sandy Marsh, munter, quirlig, hellwach – und besorgt. Sie setzte sich auf Debbies Bettrand.
»Ich sagte, ich hab dir Tee gebracht.«
»Mir geht’s gut.«
»Das stimmt nicht.«
»Doch.«
»Vielleicht geht es mich nichts an, aber ich finde, du solltest zum Arzt gehen.«
»Ich bin nicht krank«, murmelte Debbie in die dumpfigen Mulden der Bettdecke.
»Du bist auch nicht gesund. Schau dich doch an. Vielleicht hast du diese Sache, die man SAD nennt – eine saisonal abhängige Depression … Wir haben Dezember. Es ist eine Tatsache, dass sich im Dezember und Februar mehr Leute umbringen als im restlichen Jahr.«
Debbie setzte sich auf, warf die Decke mit einem wütenden Ruck zurück. »Oh, toll. Danke.«
Sandys strahlendes, frisch geschminktes Gesicht verzog sich sorgenvoll. »Entschuldige. Tritt mich. Tut mir leid. O Gott.«
Debbie weinte, vornüber auf ihre Arme gestützt. Sandy umarmte sie.
»Du kommst zu spät«, schniefte Debbie.
»Ist doch egal. Du bist wichtiger. Komm.«
Schließlich stand Debbie auf und schlurfte in die Dusche. Aber vor der Dusche kam der Spiegel.
Die Akne war schlimmer geworden. Ihr ganzes Gesicht war vernarbt und verunstaltet von einem schlimmen, entzündeten Ausschlag, der sich über ihren Hals bis zu den Schultern hinunterzog. Vor Monaten war sie deswegen einmal beim Arzt gewesen. Er hatte ihr eine übel riechende, gelbe Tinktur gegeben, die sie zweimal am Tag auftragen sollte. Das Zeug hatte ihre Kleider beschmiert, das Bettzeug stinken lassen und an den Pickeln überhaupt nichts bewirkt. Sie hatte die Tinktur nicht aufgebraucht und war auch nicht wieder in die Praxis gegangen. »Ich hasse Ärzte«, sagte sie zu Sandy, als sie in der Küche mit den selbst zusammengebauten Küchenschränken saßen, deren Türen ständig herausfielen.
Sie kannten sich seit der Grundschule, waren in derselben Straße aufgewachsen und hatten vor acht Monaten zusammen die Wohnung gemietet, als Sandys Mutter wieder geheiratet hatte und das Zusammenleben schwierig geworden war. Aber was viel Spaß zu werden versprach, war irgendwie nie eingetreten. Debbie hatte ihren Job verloren, als die Baugesellschaft ihre Büros in Lafferton schloss, und dann war die Schwärze in sie hineingekrochen.
»Ärzte geben einem doch nur jede Menge Tabletten, die einen fertigmachen.«
Sandy tunkte ihren Teelöffel in den Teebecher und zog ihn wieder heraus, tunkte ihn ein und zog ihn heraus.
»Na gut. Vielleicht kannst du zu jemand anderem gehen.«
»Wem denn?«
»Diesen Leuten, die im Bioladen Reklame machen.«
»Was? Wie dieser gruselige Akupunkteur? Heiler und Kräuterfritzen? Ziemlich abgedreht.«
»Tja, viele schwören darauf. Schreib dir doch einfach ein paar Namen auf.«
Sobald Debbie draußen war, fühlte sie sich besser, fast heiter. Sie betrat den Zeitungskiosk und kaufte sich ein Notizbuch und einen Kuli, ging die Perrott zum Bioladen entlang, schaute zum Hügel über den Dächern hinauf, dessen Kuppe in zitronengelbes Sonnenlicht getaucht war.
Der Bioladen lag in der Alms Street, in der Nähe der Kathedrale. Vielleicht geht’s mir bald wieder gut, dachte Debbie. Ich könnte was für mich tun, zehn Kilo abnehmen, eine andere Salbe für meine Pickel finden. Ein neues Leben.
Die Karten waren eine über die andere gepinnt, hingen kreuz und quer an der Korktafel; sie musste sie hochheben und mehrere umstecken, damit sie Namen und Telefonnummern abschreiben konnte. Alexander-Technik, Reflexzonenmassage, Heilen nach Brandon, Akupunktur, Chiropraktik. Sich da durchzufinden dauerte ewig. Schließlich schrieb sie vier Adressen auf – Aromatherapie, Reflexzonenmassage, Akupunktur und Kräuterheilkunde – und, nach kurzem Zögern, noch eine weitere … die Adresse und Telefonnummer von jemandem namens Dava. Sie fühlte sich von der Karte angezogen, ein tiefes, intensives Blau, bestäubt mit winzig kleinen Sternen. DAVA. SPIRITUELLES HEILEN. KRISTALLE. INNERE HARMONIE. LICHT. GANZHEITLICHE THERAPIE.
Gebannt starrte sie die Karte an, spürte, wie sie in das tiefe Blau hineingezogen wurde. Es machte etwas mit ihr, da gab es keinen Zweifel. Als sie den Bioladen verließ, fühlte sie sich – anders. Besser. Die blaue Karte blieb ihr im Gedächtnis, und von Zeit zu Zeit, wenn sie tagsüber daran dachte, schien etwas davon auf sie überzugehen. Auf jeden Fall zog sich die Schwärze ein wenig zurück, wie ein kauerndes Wesen am Rande ihres Bewusstseins, und blieb dort.
5
»Ich möchte mit einem leitenden Beamten sprechen, bitte. Jemandem von der Kriminalpolizei.«
Ein Pflegeheim mit fünfzehn älteren Menschen in allen Stadien der Demenz zu führen, hatte Carol Ashton gelehrt, geduldig und resolut zu sein, ähnlich wie eine Lehrerin, die kleine Kinder unterrichtet – zwei Aufgaben, dachte sie oft, die viel gemeinsam haben. Sie war auch geschickt darin, selbst die Widerspenstigsten dazu zu bringen, schließlich das zu tun, was sie wollte. All das begriff der diensthabende Beamte rasch.
»Sie dürfen nicht denken, dass wir Vermisstenfälle auf die leichte Schulter nehmen.«
»Sicher nicht. Aber ich weiß auch, dass der Name der vermissten Person zusammen mit einer sehr kurzen Beschreibung in eine Liste aufgenommen und an verschiedene Dienststellen verteilt wird, wonach – außer es handelt sich um ein Kind oder eine aus anderen Gründen besonders schutzlose Person – nicht mehr viel passiert.«
Sie irrte sich nicht.
»Das eigentliche Problem ist, Mrs Ashton, dass eine erstaunlich große Anzahl von Personen als vermisst gemeldet wird.«
»Ich weiß. Und ich weiß ebenfalls, dass sehr viele gesund und munter wieder auftauchen. Auch das Wort ›Ressourcen‹ ist mir mehr als vertraut. Trotzdem möchte ich gerne mit jemandem sprechen, der die Angelegenheit weiterverfolgt. Und wie ich schon sagte, ich will damit nicht die uniformierte Polizei herabsetzen, wenn ich um ein Gespräch mit einem Detective bitte.«
Sie wandte sich ab und setzte sich auf die Bank an der Wand. Der Bezug war an manchen Stellen aufgeplatzt, und graues Polstermaterial quoll hervor.
Da sie befürchtet hatte, einige Zeit warten zu müssen, hatte Carol Ashton sich ein Buch mitgebracht, aber sie kam kaum über den ersten Absatz hinaus. Der diensthabende Beamte hatte in ihr eine Frau erkannt, die er erst loswerden würde, wenn sie bekam, wonach sie verlangte.
»Mrs Ashton? Ich bin Detective Sergeant Graffham. Würden Sie bitte mit mir kommen?«
Dämlich, dachte Carol, sich davon überraschen zu lassen, dass es eine Frau war, aber obwohl es viele weibliche Polizisten gab, waren Detectives in ihrer Vorstellung immer Männer. Genau wie Krankenschwestern Frauen waren.
Der Raum, in den sie geführt wurde, war hingegen keine Überraschung – ein schäbiges kleines Kabuff mit einem Metalltisch und zwei Stühlen, in Beige gehalten. Hier würde man alles gestehen, nur um wieder herauszukommen.
»Wie ich höre, sind Sie sehr besorgt um eine Ihrer Angestellten, die seit ein paar Tagen nicht zur Arbeit erschienen ist?«
Ein hübsches Mädchen – kurzes Haar, scharfe Gesichtszüge, große Augen.
»Angela – Angela Randall. Nur klingt das irgendwie falsch – Angestellte.«
DS Graffham schaute auf ein Blatt Papier vor sich. »Tut mir leid, ich habe die Unterlagen gerade erst bekommen …«
»Na ja, sie ist schon eine Angestellte. Sie arbeitet bei mir. Es klang nur so unpersönlich. Ich habe gute Beziehungen zu all meinen Mitarbeitern.«
»Ich verstehe – die Amtssprache. Gut, fangen wir von vorne an. Erzählen Sie mir alles über Angela Randall … Aber kann ich Ihnen erst mal etwas Warmes zu trinken anbieten? Leider nur aus diesem schrecklichen Automaten.«
Die wird es weit bringen, dachte Carol Ashton, rührte mit einem Plastikstab, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Löffel hatte, ihren Tee um. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, dass man sie nicht als zu emotional und zu locker … zu, ja, zu interessiert einschätzt. DS Graffham lehnte sich zurück, verschränkte die Arme, sah Carol direkt an, wartete. Sie schien tatsächlich ernsthaft interessiert zu sein.
»Ich leite ein Pflegeheim für Demenzpatienten.«
»Alzheimer?«
»Im Großen und Ganzen, ja.«
»Ich hoffe, Sie wissen, wie sehr Sie gebraucht werden. Meine Großmutter ist letztes Jahr daran gestorben. Die Pflege, die sie bekommen hat, war absolut unwürdig. Wo ist das Heim?«
»In der Fountain Avenue. Das Four Ways.«
»Und Mrs Randall arbeitet dort?«
»Miss Randall. Angela. Ja. Sie ist seit fast sechs Jahren bei uns und seit vier Jahren als ständige Nachtwache eingeteilt. Sie ist diese Art Mensch, von der man nur träumen kann, ehrlich gesagt – scheut keine Arbeit, ist fürsorglich, verlässlich, fällt fast nie wegen Krankheit oder anderer Gründe aus, und da sie alleinstehend ist, ohne jeden Anhang, war es ihr recht, nur Nachtwachen zu übernehmen. Das ist selten.«
»Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?«
»Na ja, ich bin natürlich nicht immer … Unterschiedliche Schichten und freie Tage, also kann es durchaus passieren, dass wir uns eine ganze Woche nicht sehen. Aber ich weiß selbstverständlich, wann sie ihren Dienst versieht. Dafür gibt es das Berichtsbuch und andere Angestellte, die mit ihr Dienst haben. Tatsächlich habe ich sie aber an dem Tag gesehen, als sie zum letzten Mal gearbeitet hat. Sie hat mich mitten in der Nacht angerufen, und ich bin ins Heim gekommen. Ich wohne nur fünf Häuser entfernt. Einige Patienten waren krank geworden, und ich wurde gebraucht. Angela hatte Dienst.«
»Wie wirkte sie?«
»Ziemlich erschöpft, wie wir alle in der Nacht … Uns blieb nicht viel Zeit zum Plaudern. Aber sie war wie immer. Sehr ruhig und verlässlich.«
»Ihnen ist also nichts Ungewöhnliches an ihr aufgefallen?«
»Nein, überhaupt nicht. Und es wäre mir aufgefallen.«
»Und am nächsten Abend ist sie nicht zur Arbeit gekommen?«
»Nein, sie hatte keinen Dienst. Sie hatte das Wochenende und zwei weitere Tage frei. Das ist so geregelt, damit jede Angestellte von Zeit zu Zeit eine längere Pause einlegen kann. Sie brauchen das. Angela hatte also erst in der Woche darauf wieder Dienst, und da hatte ich ein paar Tage frei. Als ich zurückkam, lag ein Bericht vor, dass sie vier Nächte lang nicht zum Dienst erschienen war und sich auch nicht krankgemeldet hatte. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Ich hatte schon Angestellte, die einfach nicht auftauchten und auch nicht Bescheid gesagt haben, und die habe ich entlassen. So was geht bei uns nicht. Unsere Patienten haben das nicht verdient. Aber Angela Randall würde so etwas nie tun.«
»Und was haben Sie unternommen?«
»Sie angerufen – mehrmals. Immer wieder. Es wurde nie abgenommen, und sie hat keinen Anrufbeantworter.«
»Waren Sie bei ihr zu Hause?«
»Nein. Nein, war ich nicht.«
»Warum denn nicht?« DS Graffham blickte sie scharf an.
Carol Ashton fühlte sich unbehaglich – schuldig sogar, obwohl sie dafür keinen Grund sah. Aber die junge Frau hatte einen so klaren, festen Blick, forschend, eindringlich. Carol fragte sich, wie lange ein Verbrecher das wohl aushalten würde.
»Mrs Ashton, ich kann Ihnen nicht helfen – und das will ich –, wenn Sie mir nicht helfen.«
Carol rührte und rührte in den Teeresten herum. »Ich möchte nicht …, dass es falsch klingt.«
Die Polizistin wartete.
»Angela ist sehr verschlossen …, eine äußerst zurückhaltende Person. Sie ist unverheiratet, aber ich habe keine Ahnung, ob sie verwitwet oder geschieden ist oder nur alleinstehend. Es mag seltsam erscheinen, dass ich das in den sechs Jahren nie herausgefunden habe, aber sie ist einfach nicht der Mensch, den man nach so etwas fragen kann, und sie spricht nie über sich selbst. Sie ist sehr freundlich, doch sie gibt nichts preis, und man kann bei ihr die Grenze leicht überschreiten. Man stellt eine Frage oder macht eine Bemerkung, auf die jeder andere ohne nachzudenken reagieren würde, aber sie – verschließt sich, verstehen Sie? Man kann es an ihren Augen erkennen … Eine Warnung. Halt dich fern. Als ginge ein Rollladen runter. Daher war ich nie bei ihr zu Hause und, soweit ich weiß, auch keine ihrer Kolleginnen. Und – na ja, ich würde sie nicht einfach besuchen. Anrufen ja, aber mehr nicht. Das klingt lächerlich.«
»Eigentlich nicht. Es gibt solche Menschen. Meiner Erfahrung nach führen sie ein sehr einsames Leben. Sie machen oft den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen, vielleicht irgendein dunkles Geheimnis, aber das trifft nur in den seltensten Fällen zu, es ist meist nur ein Schutzmechanismus. Wissen Sie, ob sie irgendwelche Angehörigen hat?«
»Nein. Sie hat nie jemanden erwähnt.«
»Gab es Krankheiten … Depression?«
»Nein. Sie war nie krank. Vielleicht mal eine starke Erkältung. In solchen Fällen fordere ich die Angestellten auf, zu Hause zu bleiben. Unsere Patienten sind sehr anfällig.«
»Nichts, was ihren Zustand plötzlich verschlimmern könnte, wie Diabetes oder eine Herzkrankheit?«
»Nein. Das weiß ich sicher, wegen ihrer Arbeit. Nichts dergleichen.«
»Wie alt ist sie?«
»Dreiundfünfzig.«
»Sie haben darüber bestimmt schon nachgedacht, ist Ihnen irgendwas aufgefallen, was an Miss Randall in den letzten paar Wochen … letzten paar Monaten anders war?«
Carol zögerte. Da gab es etwas. Oder nicht? Etwas und nichts. Im Raum war es sehr still. DS Graffham rutschte nicht herum oder machte Notizen, sie saß nur da, ihren irritierend eindringlichen Blick auf Carol gerichtet.
»Es ist wirklich schwer zu beschreiben …«
»Versuchen Sie es.«
»Nichts wurde je ausgesprochen … Das muss ich betonen … Es ist nur … nur so ein Gefühl. Nur so ein Eindruck, den ich bekam.«
»Gerade das ist oft sehr wichtig.«
»Ich will es nicht aufbauschen … Es ist alles so vage. Aber ein- oder zweimal dachte ich, sie wirkt ein bisschen … distanziert? Abgelenkt? Ich weiß nicht …, als sei sie meilenweit fort. Das hatte ich früher nie an ihr bemerkt. Sie war immer ganz da. Hören Sie, machen Sie bitte nicht zu viel daraus … Es passierte nur ein- oder zweimal, ich will damit nicht andeuten, dass sie sich seltsam benahm, natürlich nicht.«
»Glauben Sie, dass sie sich wegen irgendwas Sorgen machte?«
»Nein. Das war es nicht, oder ich glaube es zumindest nicht … Ach, ich weiß nicht. Vergessen Sie es. Es ergibt keinen Sinn.«
»Ich glaube, doch.«
»Ich hätte sie zu Hause aufsuchen sollen, nicht wahr? Und wenn sie nun krank geworden ist?«
»Vermutlich wird sie Nachbarn haben. Sie trifft keine Schuld.«
»Was passiert jetzt?«
»Wir schicken jemanden hin, um nachzusehen.« DS