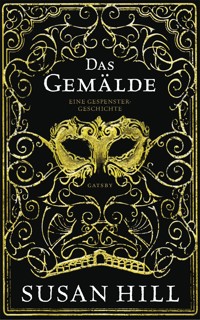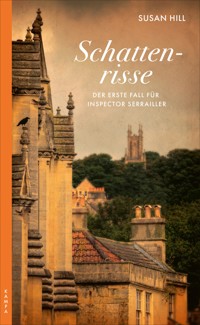Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gatsby
- Sprache: Deutsch
Warings heißt das Anwesen in der Nähe von Derne. Damals, als das riesige viktorianische Landhaus gebaut wurde, war Derne groß. Jetzt lebt kaum noch jemand dort. Joseph Hooper hat das hässliche Haus von seinem Vater geerbt und ist mit seinem Sohn Edmund eingezogen. Josephs Verhältnis zu Edmund ist unterkühlt, aber er weiß sehr wohl, dass ein Elfjähriger nicht ohne Spielgefährten aufwachsen sollte. Das tut einem Kind nicht gut. Ein Glücksfall, dass sich die verwitwete Mrs Helena Kingshaw als Haushälterin bei ihm bewirbt und bald mit ihrem ebenfalls elfjährigen Sohn Charles in Warings einzieht. Ein Glücksfall? Wirklich? Edmund betrachtet die neuen Bewohner als Eindringlinge und Charles als seinen Intimfeind, den es unter allen Umständen zu vertreiben gilt. Wie besessen verteidigt Edmund sein Revier, belauert seinen Widersacher, deckt seine Schwächen auf und macht sie sich gnadenlos zunutze. Was die Erwachsenen für ein Spiel und kindliche Streiche halten (wollen), wird bald bitterer Ernst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Hill
Wie tief ist das Wasser
Roman
Aus dem Englischen von Ellen Krahe
Gatsby
1
Vor drei Monaten war seine Großmutter gestorben, danach waren sie in dieses Haus gezogen.
»Ich will dort nicht wieder wohnen, bevor es mir nicht gehört«, hatte sein Vater gesagt. Doch der alte Mann lag nach seinem zweiten Schlaganfall ein Stockwerk höher im Bett und lebte noch, machte aber keine Mühe.
Man brachte den Jungen zu ihm.
»Fürchte dich nicht«, sagte sein Vater nervös. »Er ist ein sehr alter Mann und nun sehr krank.«
»Ich fürchte mich nie.« Und das war auch die Wahrheit, obwohl sein Vater es nicht geglaubt hatte.
Joseph Hooper fand, dass es sehr rührend wäre, wenn drei Generationen zusammenlebten, eine davon auf dem Totenbett, der älteste Sohn des ältesten Sohnes des ältesten Sohnes. Denn in seinen mittleren Jahren hatte er ein Gefühl für Dynastien entwickelt.
Aber es war nicht rührend. Der alte Mann hatte geröchelt, etwas gesabbert und war nicht aufgewacht. Das Krankenzimmer roch säuerlich.
»Ach ja«, hatte Mr Hooper gesagt und dabei gehustet. »Er ist wirklich sehr krank. Aber ich bin froh, dass du ihn gesehen hast.«
»Warum?«
»Na, weil du sein einziger Enkel bist. Sein Erbe vermutlich. Ja. Es gehört sich so.«
Der Junge sah zum Bett hinüber. Seine Haut ist schon tot, dachte er, sie ist alt und vertrocknet. Aber er sah, dass die Knochen der Augenhöhlen und der Nase und des Kiefers durchschimmerten. Alles an ihm, von den Haarstoppeln bis zu dem gefalteten Bettlaken, war bleich und grauweiß.
Edmund Hooper sagte: »Er sieht genauso aus wie einer seiner toten alten Nachtfalter.«
»So spricht man nicht! Hab Ehrfurcht.«
Er führte seinen Sohn hinaus. Allerdings kann auch ich erst jetzt Ehrerbietung zeigen, dachte er, und mich meinem Vater gegenüber angemessen benehmen, weil er stirbt, er ist fast schon fort.
Edmund Hooper ging die große Treppe in die getäfelte Diele hinunter; er hielt nichts von seinem Großvater. Doch später erinnerte er sich an das nachtfalterähnliche Weiß der sehr alten Haut.
Und nun waren sie umgezogen; Joseph Hooper war Herr in seinem eigenen Haus.
Er sagte: »Ich werde oft in London sein. Ich kann nicht die ganze Zeit hier wohnen, auch nicht in deinen Ferien.«
»Das ist doch nichts Neues, oder?«
Er wich dem Blick seines Sohnes gereizt aus. Ich tue mein Bestes, dachte er, aber es ist keine leichte Aufgabe, ohne eine Frau.
»Na, wir werden uns etwas überlegen«, sagte er. »Ich sehe zu, dass du einen Freund bekommst und jemanden, der in diesem Haus für uns sorgt. Es muss bald etwas geschehen.«
Ich will nicht, dass etwas geschieht, keiner soll hierherkommen, dachte Edmund Hooper, als er hinten im Garten unter den Eiben entlangging.
»Du solltest lieber nicht in das rote Zimmer gehen, ohne mich zu fragen. Ich behalte den Schlüssel hier bei mir.«
»Ich würde da nichts anrichten, warum kann ich nicht reingehen?«
»Ach – da sind recht viele wertvolle Dinge. Das ist alles. Wirklich.« Joseph Hooper seufzte, er saß an seinem Schreibtisch in dem Zimmer, das auf den Rasen hinausging. »Und – ich glaube nicht, dass der Raum interessant für dich ist.«
Fürs Erste sollte das Haus so bleiben, wie es war, bis er entscheiden würde, von welchen Möbeln er sich trennen und welche von ihren eigenen er herbringen wollte.
Er blätterte unruhig in den Papieren auf seinem Tisch, fühlte sich von ihnen belastet und wusste nicht, wo er anfangen sollte. Obwohl er Schreibarbeiten gewohnt war. Aber die Angelegenheiten seines Vaters waren ungeordnet hinterlassen worden, das Drumherum des Todes beschämte ihn.
»Kann ich denn jetzt den Schlüssel haben?«
»Darf …«
»Okay.«
»Den Schlüssel für das rote Zimmer?«
»Ja.«
»Nun …«
Mr Joseph Hooper langte nach der kleinen Schreibtischschublade, unter der, wo der Siegellack aufbewahrt wurde. Aber dann sagte er: »Nein, nein, du solltest wirklich lieber in der Sonne Kricket spielen gehen oder so etwas, Edmund. Du hast schon alles im roten Zimmer gezeigt bekommen.«
»Es ist niemand da, mit dem ich Kricket spielen könnte.«
»Na, das wird sich bald ändern, du sollst einen Freund haben.«
»Außerdem mag ich Kricket nicht.«
»Edmund, mach bitte keine Schwierigkeiten, ich habe eine Menge zu tun, ich kann keine Zeit für alberne Auseinandersetzungen verschwenden.«
Hooper ging hinaus und wünschte, er hätte nichts gesagt. Er wollte nicht, dass sich etwas änderte, niemand sollte hierherkommen.
Aber er wusste, wo der Schlüssel war.
Er ist wie seine Mutter, dachte Joseph Hooper. Er hat die gleiche Art, nichts erklären zu wollen, diese Heimlichtuerei, den gleichen harten und kühlen Blick. Vor sechs Jahren war Ellen Hooper gestorben. Die Ehe war nicht glücklich gewesen. Wenn sein Sohn, der ihr so ähnlich sah, in der Schule war, fiel es ihm manchmal schwer, sich zu erinnern, wie sie ausgesehen hatte.
Joseph Hooper machte sich wieder an die Beantwortung des Briefs, der auf seine Anzeige hin gekommen war.
Das Haus, das Warings hieß, hatte der Urgroßvater des Jungen gebaut, es war also noch nicht alt. Zu jener Zeit war das Dorf sehr groß gewesen, und der erste Joseph Hooper hatte viel Land besessen. Jetzt war das Dorf kleiner geworden, die Leute waren in die Städte abgewandert, wenige Menschen waren neu zugezogen und kaum neue Gebäude entstanden. Derne ähnelte nun einem alten, geschäftigen Hafen, von dem die Küste abgerückt war. Das ganze Land der Hoopers war Stück für Stück verkauft worden. Aber Warings stand noch, es war auf einem Abhang gebaut, der sich hinter dem Dorf erhob, und es lag von allen anderen Häusern ziemlich weitab.
Der erste Joseph Hooper war Bankier gewesen und hatte es schon mit dreißig Jahren, als er das Haus gebaut hatte, zu etwas gebracht. »Ich schäme mich nicht dafür«, hatte er seinen Freunden in der Stadt erzählt. Und er hatte wirklich mehr dafür ausgegeben, als er sich eigentlich leisten konnte. Er hoffte hineinzuwachsen, wie ein Kind in übergroße Schuhe. Er war ein ehrgeiziger Mann. Er hatte eine jüngere Tochter aus niederem Adel als seine Braut hierhergebracht und war dabei, eine Familie zu gründen und seine Stellung zu festigen, um sich das Haus leisten zu können, das er gebaut hatte. Seine Erfolge hatten ihm aber keine Gewinne eingebracht, sodass das umliegende Land, das ihm gehörte, Stück für Stück wieder verkauft werden musste.
»Das ist die Geschichte von Warings«, hatte der jüngere Joseph Hooper seinem Sohn erzählt, als er ihn feierlich durch das Haus geführt hatte. »Du solltest sehr stolz sein.«
Hooper verstand nicht, warum. Es war ein gewöhnliches Haus, dachte er, ein hässliches Haus, nichts, womit man angeben konnte. Aber der Gedanke, dass es seines war, der Gedanke an eine Familientradition, gefiel ihm.
Sein Vater sagte: »Du wirst schon noch verstehen, was es bedeutet, ein Hooper zu sein, wenn du älter bist.«
Dabei dachte er, was bedeutet es denn wirklich, ihm selbst bedeutete es nur wenig. Und er schreckte vor dem Ausdruck in den Augen seines Sohnes zurück, vor seinem wissenden Blick. Er war der Sohn seiner Mutter.
Warings war hässlich. Es war ohne jeden Reiz, ziemlich groß und sehr verwinkelt, aus dunkelroten Ziegelsteinen gebaut. Vor der Hausfront und zu beiden Seiten breitete sich der Rasen aus, der zu dem Kiesweg hin abfiel und dann zu einem Pfad, es gab keine Bäume oder Blumenbeete, die das kahle Grün belebten. Entlang der Einfahrt und hinter dem Haus drängten sich zwischen den Eiben die großen Rhododendronbüsche.
Die Eiben hatten hier schon gestanden, bevor das Haus Warings gebaut wurde, denn der erste Joseph Hooper hatte ihre Festigkeit und Dichte bewundert sowie die Tatsache, dass sie so langsam wuchsen und die langlebigsten Bäume waren. Er hatte auch die Rhododendronbüsche gepflanzt, nicht wegen ihrer kurzen, eindrucksvollen Farbenpracht im Mai und Juni, sondern wegen ihrer dunkelgrünen lederartigen Blätter und ihrem zähen Stamm, ihrem kräftigen Aussehen. Er liebte ihre gedrungene Form, die man schon von der Einfahrt aus sehen konnte.
Im Haus war alles so, wie man es erwartete, die hohen Räume mit den schweren Schiebefenstern, die eichengetäfelten Wände und Türen und das eichene Treppenhaus, die massiven Möbel. Man hatte wenig an der ursprünglichen Einrichtung verändert.
Joseph Hooper hatte einen Teil seiner Kindheit, bevor er in die Schule kam und seine Ferien, in diesem Haus verbracht. Er hatte es nicht gemocht, hatte keine guten Erinnerungen an Warings. Doch jetzt, als er einundfünfzig war, gestand er sich ein, dass er ein Hooper war, der Sohn seines Vaters, und so hatte er angefangen, die Gediegenheit und das Düstere zu bewundern. Es ist ein reizendes Haus, dachte er.
Denn er wusste, dass er selbst ein kraftloser Mensch war, der keine besondere Stärke oder imposante Eigenschaft besaß, ein Mann, den man mochte und den man gewähren ließ, doch den man nicht sonderlich beachtete, ein Mann, der versagt hatte – aber nicht dramatisch wie jemand, der aus großer Höhe stürzt und dadurch Aufmerksamkeit erregt. Er war ein langweiliger Mensch, ein Mensch, der durchkam. Er dachte, ich kenne mich selbst und bin deprimiert über das, was ich weiß. Aber jetzt, nachdem sein Vater tot war, konnte er vor diesem Haus so bestehen, dass es ihm Bedeutung wie auch Rückhalt verlieh, er konnte von »Warings – mein Haus auf dem Land« sprechen, und das entschädigte ihn für vieles.
Ein schmaler Pfad führte zwischen den Eiben in ein kleines Wäldchen. Dieses Wäldchen und ein Feld dahinter waren alles, was von dem Land der Hoopers übrig geblieben war.
Von Edmund Hoopers Zimmer aus, hoch oben an der Rückseite des Hauses, konnte man das Wäldchen sehen. Er hatte sich dieses Zimmer ausgesucht.
Sein Vater hatte gesagt: »Schau dir doch die anderen an, sie sind so viel größer und heller. Du solltest lieber das alte Spielzimmer nehmen.« Aber er wollte dieses haben, ein schmales Zimmer mit einem großen Fenster. Über ihm war nur das Dachgeschoss.
Als er aufwachte, sah er einen riesigen Mond, weshalb er zuerst dachte, dass es schon dämmerte und er die Gelegenheit verpasst hätte. Er stand auf. Ein leichter, anhaltender Windzug wehte durch die Zweige der Eiben und durch die Ulmen und Eichen im Wäldchen; er hörte auch die hohen Gräser auf dem Feld rauschen. Das Mondlicht, das durch einen schmalen Spalt zwischen zwei Bäumen drang, fiel auf den Bach, der mitten durch das Feld floss, sodass man ab und zu, wenn die Zweige sich bewegten, ein Schimmern des Wassers sah. Edmund Hooper sah hinunter. Die Nacht war sehr warm.
Draußen auf dem Flur war kein Mondlicht, und er tastete sich in der Dunkelheit vorwärts, zuerst durch das mit Teppichen ausgelegte obere Treppenhaus und dann über die letzten beiden Treppen mit dem blank polierten Eichenboden. Er ging überlegt und sicher und hatte keine Angst. Aus dem Zimmer, wo sein Vater schlief, hörte man keinen Laut. Mrs Boland kam nur tagsüber. Mrs Boland mochte Warings nicht. Es sei zu dunkel, sagte sie, und rieche unbewohnt und nach alten Dingen, wie ein Museum. Deshalb hatte sie angefangen, Licht und frische Luft hereinzulassen, wo sie nur konnte. Aber Derne lag sehr tief, und die Luft in jenem Sommer war stickig und schwer.
Hooper durchquerte die große Diele, auch hierhin kam, weil sie an der Vorderseite des Hauses lag, kein Licht. Hinter ihm zog sich das Holz der Treppen, auf die er getreten war, mit einem Knarren zurück.
Zuerst wusste er nicht, welcher Schlüssel es war. Da lagen drei zusammen in der linken Schublade. Aber einer war länger und hatte einen roten Farbklecks am Rand. Rote Farbe für das rote Zimmer.
Es lag auf der Rückseite und ging zum Wäldchen hinaus, sodass er es, als er die Tür öffnete, in vollem Mondlicht sah, fast taghell, obwohl man am Tag immer das Licht anzünden musste, weil die Eibenzweige vor den Fenstern hingen.
Edmund trat ein.
Der Raum war von dem ersten Joseph Hooper als Bibliothek geplant worden, und überall standen noch die vom Boden bis zur Decke reichenden Glasvitrinen, mit Büchern gefüllt. Aber in diesem Haus las nie jemand. Nicht einmal der erste Joseph Hooper hatte es getan.
Edmund Hooper hatte sich die Titel einiger Bücher angesehen, damals, als man ihn hierherbrachte, damit er seinen sterbenden Großvater sah, aber sie hatten ihn nicht interessiert. Es waren gebundene Jahrgänge des Banker’s Journal und der Stockbroker’s Gazette und Gesamtausgaben viktorianischer Romanschriftsteller, die nie aufgeschlagen worden waren.
Sein verstorbener Großvater hatte begonnen, das rote Zimmer zu benutzen. Er war Schmetterlingssammler gewesen; er hatte das Zimmer mit Schaukästen für Nachtfalter und Schmetterlinge gefüllt. Es war wie ein Saal in einem Museum, denn hier lag kein Teppich auf dem polierten Eichenboden, und die Schaukästen standen in zwei langen Reihen, von einem Ende bis zum anderen. Es gab auch flache Schubladen mit Insekten, die man aus Nischen in den Wänden herausziehen konnte.
»Dein Großvater war einer der bedeutendsten Sammler seiner Zeit«, hatte Joseph Hooper gesagt, als er den Jungen herumführte. »Er war in der ganzen Welt bekannt und geachtet. Diese Sammlung ist sehr viel wert.«
Aber was für einen Nutzen hat sie wirklich, dachte Joseph Hooper, welchen Nutzen, warum sollte ich sie nicht verkaufen? Er hasste sie zutiefst. In seiner Kindheit war er im Sommer Nachmittag für Nachmittag hierhergebracht und durch den Raum geführt worden, von Vitrine zu Vitrine, man hatte ihm Vorträge gehalten und ihn belehrt, er hatte zusehen müssen, wie die Insekten aus den giftig riechenden Flaschen mit Pinzetten herausgenommen und ausgebreitet und dann durch ihren Hornpanzer mit einer Nadel auf einen Karton gespießt wurden.
Sein Vater hatte gesagt: »Dies wird alles dir gehören, du musst den Wert von dem kennenlernen, was du erben wirst.«
Er hatte nicht gewagt, dagegen aufzubegehren, er war in den Ferien immer in das rote Zimmer gegangen, hatte Interesse geheuchelt, sich Kenntnisse angeeignet und seine Furcht verborgen. Bis er schließlich, als er älter wurde, Ausreden fand, um seine Ferien nicht im Haus verbringen zu müssen.
»Es ist leicht für dich, es zu verachten und die Schultern zu zucken«, hatte sein Vater gesagt, als er merkte, was sein Sohn davon hielt. »Du erkennst nicht, was ein Mann hier geleistet hat. Ich bin eine international anerkannte Autorität, aber dir imponiert das nicht. Gut, dann möchte ich erleben, wie du dir selbst auf irgendeinem Gebiet einen Namen machst.«
Joseph Hooper hatte gewusst, dass ihm das nie gelingen würde.
Er versuchte, sein Gewissen zu beruhigen, indem er nun selbst seinen Sohn belehrte. »Es ist wunderbar, wenn ein Mensch auf diese Art weltberühmt wird«, sagte er.
»Sein Leben lang hat dein Großvater seine ganze freie Zeit dafür hingegeben – es war nämlich nicht sein Beruf, sondern nur sein Hobby, und er war beruflich sehr eingespannt. Alle Energie, die er übrig hatte, verwandte er darauf, diese Sammlung aufzubauen.«
Sollte ein Junge denn nicht stolz auf die Bedeutung seiner Familie sein?
Edmund Hooper war durch das rote Zimmer gegangen und hatte alles genau angesehen und nichts gesagt.
»Ich habe gesehen, wie du Schmetterlinge in Marmeladengläsern und Ähnlichem gefangen hast«, sagte Joseph Hooper.
»Das ist doch wohl ein Zeichen von Interesse, ich glaube fast, dass du mehr in seinen Spuren wandeln wirst, als ich es jemals getan habe.«
»Die Schmetterlinge waren nur so eine Mode im letzten Semester. Wir haben Larven gesammelt und beobachtet, wie sie ausgeschlüpft sind. Jetzt interessiert sich keiner mehr dafür.«
Er ging zum Fenster und sah in das Wäldchen, das vom ersten schweren Sommerregen gepeitscht wurde. Er sagte nicht, ob ihn die steifen Falter in ihren Schaukästen interessierten oder nicht.
»Warum hast du mir das nicht schon früher gezeigt?«
»Du warst hier – du wurdest als Baby hierhergebracht.«
»Das ist Jahre her.«
»Ja – allerdings.«
»Du warst wohl damals mit Großvater zerstritten.«
Joseph Hooper seufzte. »So was sagt man nicht, damit brauchen wir uns jetzt nicht zu beschäftigen.«
Aber er verstand ein wenig, als er den Jungen ansah, wie es seinem eigenen Vater gegangen war, er fühlte das Bedürfnis, etwas wiedergutzumachen. Ich bin kein harter Mann, dachte er, ich muss meinem eigenen Sohn gegenüber mehr nachsehen, als er es mir gegenüber musste. Denn er wusste, dass er bei dem Versuch, Edmund für sich zu gewinnen, von Anfang an versagt hatte.
Der kleine Schlüssel, der zu allen Vitrinen passte, wurde in einer Bibel auf einem der unteren Regale aufbewahrt.
Zuerst ging Hooper leise in dem Raum auf und ab und betrachtete alle Falter, die auf weißem Karton ausgebreitet waren, und die Etikette darunter. Die Namen gefielen ihm – Falken-Falter, Lakai-Falter, Seidenfalter. Er las sich einige leise vor. Kalt schien der Mond durch das Fenster aufs Glas.
Oberhalb der hölzernen Wandtäfelung des roten Zimmers hingen die Tiere, der Hirschkopf mit seinem Geweih, das über den Eingang ragte, die Behälter mit grauen Fischen vor dem gemalten Hintergrund von Tang und Wasser und die ausgestopften Körper von Wiesel, Hermelin und Fuchs, mit Glasaugen und in künstlichen Posen.
Wegen der langen letzten Krankheit des alten Mannes und der Nachlässigkeit der Haushälterin waren sie schon lange nicht gereinigt worden. Mr Hooper hatte gesagt, dass die Tiere verkauft werden sollten, die Familie hatte keinen Grund, stolz auf sie zu sein, sie waren alle von dem ersten Joseph Hooper gekauft worden, der seine Bibliothek in der Art eines Jägers hatte ausstatten wollen.
Hooper blieb vor einem Kasten am hintersten Ende des Raums stehen, neben dem vorhanglosen Fenster. Er schaute auf die flachen, zerbrechlichen Gestalten hinunter.
Er war fasziniert, sie erregten ihn. Er drehte den kleinen Schlüssel im Schloss und hob den Glasdeckel hoch. Er war sehr schwer und ließ sich kaum bewegen, weil er lange nicht benutzt worden war. Eine Wolke verbrauchter, stickig riechender Luft schlug ihm entgegen.
Der allergrößte Falter lag in der Mitte des Kastens – Acheroptia atropos – er konnte gerade noch die Schrift auf der Pappe entziffern, die Tinte war in der Sonne zu einem Dunkelgelb verblasst. Totenkopfschwärmer.
Er streckte seine Hand aus, legte seinen Finger unter den Stecknadelkopf und zog sie aus dem dicken gestreiften Körper heraus. Sofort löste sich der ganze, seit Jahren tote Falter auf und zerfiel zu einem weichen, formlosen Haufen dunklen Staubs.
2
»Heute kommt Besuch«, sagte Joseph Hooper. »Nun wirst du einen Freund haben.«
Er war nämlich sehr beeindruckt gewesen von den reizenden Briefen von Mrs Helena Kingshaw, von ihrer Aufrichtigkeit und ihrem leichten Ton und später von ihrer Stimme am Telefon. Sie war verwitwet, siebenunddreißig Jahre alt, und sie sollte, wie er es genannt hatte, eine »inoffizielle Haushälterin« werden. Mrs Boland würde das Putzen und Kochen besorgen.
»Vielleicht wäre es Ihnen recht, wenn Sie zunächst einmal den Sommer über kämen«, hatte er geschrieben. »Um zu sehen, wie Sie und Ihr Junge sich einleben und wie wir alle miteinander auskommen.«
Mrs Helena Kingshaw hatte geantwortet: »Warings klingt ganz so, als wäre es das Zuhause, das wir suchen.«
Joseph Hooper war sehr gerührt gewesen. An jenem Abend hatte er seine eigene dünne Gestalt in dem großen Drehspiegel gemustert. »Ich bin ein einsamer Mann«, hatte er gesagt und sich hinterher nicht geschämt, dass er es sich eingestanden hatte.
»Er heißt Charles Kingshaw, und er ist genau in deinem Alter, er ist fast elf. Du musst dir Mühe geben, ihn gut aufzunehmen und nett zu ihm zu sein.«
Edmund Hooper ging langsam die vier Treppen zu seinem Schlafzimmer hinauf. Es regnete wieder sehr heftig, und dicke blaugraue Wolken hingen tief über dem Wäldchen. Er hatte an diesem Tag dort hineingehen wollen, aber das Gras würde zu nass sein.
Und nun kam ein Junge mit seiner Mutter, und immer würde jemand im Haus sein, der ihn beobachtete. Sie würde anfangen, ihnen Spiele vorzuschlagen und sie auf Ausflüge zu schicken, das machten die Mütter von einigen Jungen in seiner Schule. Er hatte sich vor Kurzem einmal gefragt, ob er die Abwesenheit seiner eigenen Mutter spüren und sich Dinge wünschen müsste, die nur sie ihm geben könnte. Aber er hatte sich einfach nicht vorstellen können, was für Dinge das sein könnten. Er hatte keinerlei Erinnerung an sie.
Sein Vater hatte gesagt: »Ich weiß, dass du nicht sehr glücklich bist, dass wir nur aus einer misslichen Lage das Beste machen. Aber du musst immer zu mir kommen und mir alles erzählen, du darfst dich nicht fürchten zuzugeben, wenn etwas nicht in Ordnung ist.«
»Mir geht es ganz gut. Es ist wirklich alles in Ordnung.« Er hasste es, wenn sein Vater so mit ihm sprach, er wollte sich die Ohren zuhalten, um ihn nicht zu hören. »Es ist alles in Ordnung.« Und er sagte nur die Wahrheit. Aber Joseph Hooper suchte die Nuancen unter der Oberfläche, er war sehr besorgt, denn man hatte ihn gewarnt, wie sehr der Junge leiden würde.
Hooper war dabei, in seinen Händen Knetmasse für eine neue Schicht des geologischen Modells zu formen, das auf einem Brett neben dem Fenster stand. Er dachte an den Jungen mit dem Namen Kingshaw, der kommen würde.
»Es ist mein Haus«, dachte er. »Es ist privat, ich bin zuerst hier gewesen. Niemand sollte hierherkommen.«
Aber er würde nichts von sich verraten, er konnte den anderen Jungen ignorieren oder ihm ausweichen oder ihn abschrecken. Das kam darauf an, wie er war. Es gab tausend Möglichkeiten.
Er legte einen flachen Streifen dunkler Knetmasse dorthin, wo die Schicht auf der Anleitung angegeben war. Das Modell war gewölbt wie ein Grabhügel, wie einer von denen in der Heide. Wenn es fertig war, würde er es wie einen Kuchen aufschneiden, und dann würde man alle Schichten sehen können. Danach könnte er an seiner Karte von der Schlacht bei Waterloo weitermachen. Er hatte so viel zu tun, und er wollte alles allein machen, er wollte den Jungen Kingshaw nicht hier haben. An dem Nachmittag, als sie mit dem Auto ankamen, schloss er seine Tür ab. Aber er beobachtete sie, stellte den Spiegel so, dass er auf die Einfahrt hinuntersehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Sie standen alle etwas aufgeregt herum. Kingshaw hatte rotes Haar. Sein Vater hatte »Edmund!« durch das ganze Haus gerufen. »Edmund! Wo dein Freund doch jetzt angekommen ist, möchte ich wirklich nicht, dass du dich irgendwo versteckst, du benimmst dich sehr schlecht. Komm bitte jetzt her. Edmund!«
Joseph Hooper war ziemlich durcheinander, denn die Ankunft dieser Frau beunruhigte ihn plötzlich, er erschrak über das, was er getan hatte. Sie sollten hier heimisch werden, sie sollten alle zusammen im gleichen Haus leben, und er würde vielleicht darunter leiden, würde womöglich die Folgen eines furchtbaren Fehlers erfahren.
Er ist sich selbst gar nicht so sicher, dachte Mrs Helena Kingshaw, die auch seit einigen Jahren viel allein gewesen war.
»Edmund, du kommst jetzt sofort runter!«
Edmund Hooper nahm ein kleines Stück Papier vom Tisch, schrieb etwas darauf und befestigte es dann sorgfältig an einem Klumpen grauer Knetmasse. Er sah wieder aus dem Fenster. Der Junge, Charles Kingshaw, schaute hinauf und sah das plötzliche Blinken des Spiegels. Hooper ließ die Knetmasse fallen, sie fiel senkrecht wie ein Stein hinunter. Er entfernte sich vom Fenster. Kingshaw bückte sich.
»Komm, Charles, hilf mir bitte bei den Koffern, wir können nicht alles Mr Hooper überlassen.« Mrs Kingshaw trug ein jadegrünes Kostüm und war etwas besorgt, dass man es vielleicht für zu schick halten könnte.
»Oh – was ist das, was hast du gefunden?« Sie wollte so gern, dass es ihm hier gefallen würde, dass er sich hier bald zu Hause fühlen würde.
Ich wollte nicht kommen, dachte Kingshaw. Ich wollte nicht hierherkommen, es ist wieder ein fremdes Haus, in das wir nicht wirklich gehören. Er hatte den Klumpen Knetmasse fallen gelassen. »Nichts, es ist nichts. Es ist nur ein Kieselstein.«
Als er hinter seiner Mutter in die dunkle Diele ging, gelang es ihm, das Stück Papier zu entfalten.
ICH WOLLTE NICHT, DASS IHR HERKOMMT, stand darauf.
»Ich möchte Ihnen jetzt Ihre Zimmer zeigen«, sagte Mr Hooper. Kingshaw stopfte die Botschaft ängstlich in seine Hosentasche.
Hooper sagte: »Warum bist du gekommen?«, und sah ihn vom anderen Ende des Zimmers aus an. Kingshaw wurde rot. Aber er behauptete sich und sagte nichts. Ein kleiner runder Tisch war zwischen ihnen. Sein Reisekoffer und ein kleinerer standen auf dem Fußboden. »Warum musstet ihr einen neuen Platz zum Wohnen finden?«
Schweigen. Hooper dachte, jetzt verstehe ich, warum es besser ist, ein Haus wie Warings zu haben, ich verstehe, warum mein Vater herumgeht und das dicke Schlüsselbund festhält. Wir wohnen hier, es gehört uns, wir gehören hierher. Kingshaw hat keine Bleibe.
Er ging um den Tisch herum zum Fenster. Kingshaw trat zurück, als er kam.
»Angsthase!«
»Nein.«
»Wenn mein Vater stirbt«, sagte Hooper, »wird mir dieses Haus gehören. Ich werde der Hausherr sein. Alles wird mein sein.«
»Das ist doch nichts. Es ist nur ein altes Haus.«
Hooper dachte bitter an das Land, das sein Großvater hatte verkaufen müssen. Er sagte ruhig: »Unten ist etwas sehr Wertvolles. Etwas, das du noch nie gesehen hast.«
»Was denn?«
Hooper lächelte und sah weg, zum Fenster hinaus, er wollte es nicht sagen. Und er war sich nicht ganz sicher, wie viel Eindruck die Faltersammlung wirklich machen würde.
»Mein Großvater ist in diesem Zimmer gestorben. Erst vor Kurzem. Er lag und starb in dem Bett da. Jetzt ist es dein Bett.« Das stimmte nicht.
Kingshaw ging zu dem Koffer und kniete sich davor.
»Wo habt ihr vorher gewohnt?«
»In einer Etagenwohnung.«
»Wo?«
»London.«
»Eure eigene Wohnung?«
»Ja – nein. Also sie war in dem Haus von jemand.«
»Ihr wart also nur Mieter?«
»Ja.«
»Sie gehörte nicht wirklich euch.«
»Nein.«
»Warum hat dein Vater euch kein richtiges Haus gekauft?«
Kingshaw stand auf. »Mein Vater ist tot.« Er war wütend, nicht verletzt. Er wollte seine Faust gegen Hooper erheben, traute sich aber nicht.
Hooper zog die Augenbrauen hoch. Er hatte sich das von einem Lehrer in der Schule abgeguckt. Er hielt es für eine eindrucksvolle Art zu schauen.
»Und meine Mutter kann es sich eben nicht leisten, uns ein Haus zu kaufen. Das können wir nicht ändern.«
»Dein Vater hätte euch Geld hinterlassen sollen, oder? Hatte er kein Haus?«
»Doch, er hatte eins. Das musste verkauft werden.«
»Warum?«
»Weiß ich nicht.«
»Um alle seine Schulden zu bezahlen.«
»Nein, nein.«
»Kannst du dich an deinen Vater erinnern?«
»Oh ja. Also – ein bisschen. Er war früher Pilot. Er war bei der Luftschlacht um England dabei. Ich habe …« Kingshaw kniete sich wieder hin und fing an, fieberhaft seinen Schottenkoffer zu durchsuchen. »Ich habe ein Bild von ihm.«
»Ist es ein Bild von ihm in der Schlacht?«
»Nein. Aber …«
»Ich glaub dir sowieso nicht, du bist ein Lügner, die Luftschlacht um England war im Krieg.«
»Das weiß ich auch, jeder weiß das.«
»Das ist schon Jahre her, Dutzende von Jahren. Das ist Geschichte. Er kann nicht dabei gewesen sein.«
»Er war dabei, ganz bestimmt.«
»Wann ist er denn gestorben?«
»Hier ist das Bild, guck – das ist mein Vater.«
»Wann er gestorben ist, habe ich gefragt.« Hooper kam bedrohlich näher.
»Vor ein paar Jahren. Ich war ungefähr fünf. Oder sechs.«
»Dann muss er ja schon ganz schön alt gewesen sein. Wie alt war er?«
»Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ziemlich alt. Guck doch, das ist das Bild.« Kingshaw hielt ihm eine kleine braune Brieftasche hin. Er wünschte sehnlichst, dass Hooper es ansah und ihm glaubte, er fühlte, dass er irgendwie Eindruck auf dieses Haus machen musste, dass man ihm etwas glauben musste. Kurz darauf bückte Hooper sich und nahm das Bild. Er hatte etwas anderes erwartet, jemanden, der mutig und interessant aussah. Aber es war nur ein kahlköpfiger, leichenblasser Mann mit einem Muttermal am Kinn.
»Er ist alt«, sagte er.
»Das habe ich ja gesagt. Als er an der Luftschlacht um England teilgenommen hat, war er zwanzig. Das war im Krieg.«
Hooper sagte nichts. Er warf das Bild zurück in den Koffer und ging zurück zum Fenster. Kingshaw wusste, dass er gewonnen hatte, aber er fühlte sich nicht wie der Gewinner; Hooper hatte ihm kein Zugeständnis gemacht.
»Wo gehst du zur Schule?«
»In Wales.«
Hooper zog die Augenbrauen hoch. »Es gibt vermutlich hundert Schulen in Wales. Mehr als hundert.«
»Sie heißt St Vincent’s.«
»Ist es eine richtige Schule?«
Kingshaw antwortete nicht. Er hockte noch auf dem Boden neben seinem Koffer. Er hatte anfangen wollen auszupacken, aber nun wollte er es nicht mehr. Auspacken würde alles so endgültig machen, als ob er die Tatsache akzeptiert hätte, dass er hierbleiben würde, als ob an eine Zukunft zu denken wäre. Er war durch Hooper scharf zur Besinnung gebracht worden.
»Bilde dir gar nicht ein, dass ich überhaupt hierherkommen wollte.«, sagte er.
Hooper dachte nach. Er erinnerte sich daran, wie man ihm von dem Tod seines Großvaters erzählt hatte. Er hatte gesagt: »Ich will in diesem Haus nicht wohnen.«
Er stieß das Fenster auf. Es hatte aufgehört zu regnen. Der Himmel hatte die Farbe von schmutzigen Sixpence-Stücken. Der Rhododendron glänzte noch von der Feuchtigkeit, die ganze Einfahrt entlang.
»Mach lieber mal das Fenster zu«, sagte Kingshaw. »Das ist jetzt mein Fenster.«
Hooper wandte sich um, hörte den neuen Ton in seiner Stimme und überlegte, was das bedeutete, aber er hörte auch ein ängstliches Zittern. Er hob seine Fäuste und ging auf Kingshaw los.
Der Kampf war wortlos und heftig und rasch vorbei. Kingshaw putzte seine blutende Nase und untersuchte dann sein Taschentuch. Sein Herz klopfte. Er hatte nie vorher so gegen einen Jungen gekämpft. Er fragte sich, wie die Zukunft nun sein würde.
Draußen im unteren Flur hörte er die Stimme seiner Mutter, die Mr Hooper fröhlich antwortete, und dann das Schlagen einer Tür. Es ist ihre Schuld, dass wir hergekommen sind, dachte er, es ist ihre Schuld.
Hooper stand wieder neben dem Fenster. Es war noch offen. Eine Zeit lang sprach keiner von ihnen. Kingshaw wünschte sich, dass er ginge.
»Denk nicht, dass du immer bei mir sein musst«, sagte Hooper. »Ich habe meine eigenen Sachen zu tun.«
»Aber ich soll, hat dein Vater gesagt.«
»Du tust, was ich sage.«
»Sei nicht albern.«
»Ich verdresch dich noch mal, pass nur auf.«
Kingshaw trat zurück. »Du brauchst wirklich nicht zu denken, dass ich hierherkommen wollte«, sagte er. »Bilde dir nicht ein, dass ich gern hier bin.«
Obwohl er erwartet hatte, dass er sich eingewöhnen würde. Er hatte nicht mit Hooper gerechnet. Er fing an, die Sachen aufzusammeln, die aus seinem Schottenkoffer gefallen waren.
»Ist deine Schule ein richtiges Internat?«
»Ja.«
»Aber wie kann deine Mutter es sich leisten, ein Internat für dich zu bezahlen, wenn sie es sich nicht leisten kann, in einem Haus zu wohnen?«
»Ich glaube … Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist kostenlos.«
»Keine Schule ist kostenlos.«
»Doch, es gibt welche.«
»Nur Schulen für arme Leute. Internate sind nicht kostenlos.«
»Es ist … Ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Vater hat ihnen eine Menge Geld gezahlt, als ich dort eingetreten bin. Ich glaube, er hat die ganzen Gebühren auf einmal bezahlt, und deshalb kostet es jetzt nichts. Ja, das hat er gemacht, ich weiß es.«
Hooper sah ihn kalt an. Er hatte gewonnen, und Kingshaw wusste es. Jetzt konnte Hooper es sich leisten, sich abzuwenden und das Thema fallen zu lassen.
Kingshaw überlegte, ob nun so eine Art von Waffenstillstand zwischen ihnen bestand, ob er irgendwie ein Recht erworben hatte hierzubleiben. Er war hergekommen mit dem Vorsatz, sich mit Hooper zu vertragen, so wie er mit den meisten Menschen auskam, weil das sicherer war. Er war zu verletzlich, er konnte es nicht riskieren, sich Feinde zu machen.
Aber Hooper war anders, Kingshaw war einer solchen Feindseligkeit noch nie begegnet. Er war dadurch und durch Hoopers Selbstsicherheit verwirrt und wusste nicht, was er tun sollte, und er schämte sich, weil er es nicht wusste. Es war, wie als er zum ersten Mal zur Schule gegangen war und versucht hatte, sich zurechtzufinden, die anderen beobachtet hatte, um zu lernen, wie man sich verhielt.
Ich bin hergekommen, und es gefällt mir nicht, wollte er sagen. Ich will nicht hierbleiben, ich möchte irgendwo allein sein in unserer eigenen Wohnung, nicht in der von jemand anderem, wir leben immer in Wohnungen anderer. Aber ich kann nicht weggehen, ich muss hierbleiben, warum können wir nicht das Beste daraus machen? Er war bereit, sich Mühe zu geben, er würde sogar, wenigstens jetzt, sagen, dass er tun würde, was Hooper wollte, ihn als Herrscher in seinem Reich anerkennen würde. Aber er konnte nichts davon in Worte fassen, sogar sich selbst gegenüber nicht, es waren nur einzelne Gefühle, die wie kleine Wellen übereinanderschlugen. Er war verwirrt.
Hooper sah ihn über den Tisch hinweg an. Auf seiner linken Backe zeigte sich eine blaue Stelle, die leicht anschwoll, dort, wo Kingshaws Faust gelandet war. Hooper sah aus wie der ältere der beiden Jungen, obwohl er kleiner war. Aber es lag etwas Besonderes in seinem Gang und im Ausdruck seiner Augen.
Er wartete einen Augenblick und ging dann langsam aus dem Zimmer. An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Du brauchst noch lange nicht zu denken, dass du hier erwünscht bist«, sagte er. »Dies ist nicht dein Zuhause.«
Nachdem Hooper gegangen war, stand Kingshaw lange Zeit einfach da. Ich habe niemanden, dachte er. Und der ganze Sommer lag noch vor ihm. Nach einer Weile musste er weinen, aber ganz lautlos, und er schluckte heftig und versuchte aufzuhören. Er konnte nicht aufhören. Aber er würde nichts sagen, er konnte auch niemandem etwas sagen.
Schließlich hörte er auf. Er sollte lieber seine übrigen Sachen auspacken und einräumen. Seine Mutter hatte ihn hergebracht, sie war darüber sehr aufgeregt gewesen und hatte ihm gesagt, dass ein Gebet erhört worden sei. Er schämte sich für die Art, wie sie gesprochen hatte.
Er ging langsam zum Fenster. »Es ist jetzt mein Fenster«, sagte er und zog es zu.
Als er sich wieder dem Zimmer zuwandte, dachte er daran, was Hooper ihm über seinen Großvater erzählt hatte, dass er hier, in diesem Zimmer, in diesem Bett, gestorben sei. Kingshaw kam nicht auf den Gedanken, das anzuzweifeln. Er versuchte, nicht daran zu denken, welche Ängste noch kommen würden.
»Edmund, warum hast du dich hier eingeschlossen? Öffne bitte sofort die Tür.«
Hooper stand ganz ruhig, drehte immerzu den Bleistift im Anspitzer herum und beobachtete, wie sich das Holz auf der Seite herauswickelte, wie ein Falter, der aus der Larve kriecht.
»Ich weiß genau, dass du da drin bist, du brauchst nicht so zu tun, als ob du nicht da wärst.«
Schweigen.
»Edmund!«
Irgendwann musste er die Tür öffnen.
»Was tust du hier und warum schließt du dich ein? Ich finde es nicht normal, sich so zu benehmen. Du solltest draußen sein und frische Luft schnappen, du solltest Charles Kingshaw das Dorf zeigen.«
Ein großes Blatt weißes Papier war an die Wand geheftet, es war mit seltsamen Linien und kleinen farbigen Punkten bemalt, die einzelne Blöcke bildeten. In einer Ecke stand:
Grün = Napoleons Infanterie
Blau = Napoleons Kavallerie
Rot =
Joseph Hooper betrachtete es. Aber er fühlte, dass er hier nicht erwünscht war, sein Sohn stand da, warf den Bleistiftspitzer von einer Hand in die andere und wartete.
»Aber so hat kein Schlachtfeld je ausgesehen, das …« Er machte eine Bewegung – denn er wollte reden, er wollte sich nicht wie ein Eindringling fühlen, wie ein Fremder im Zimmer seines Sohnes. Er dachte, wir sollten einander nahestehen, wir haben nur noch uns beide, ich sollte frei mit ihm reden können. Aber noch mehr als alles andere machte ihn die penibel gezeichnete Karte seines Sohnes wütend, er wollte sagen, es ist nichts, nichts, dieser ordentliche, saubere, sorgfältige kleine Plan, er wollte ihm sagen, wie es wirklich war, er wollte ihm ein Bild geben von Menschen und Blut und Pferden, von dem Donner und dem Gestank der feuernden Kanonen und den Schmerzensschreien, dem furchtbaren Durcheinander. Aber er fand keinen Anfang. Edmund Hooper stand trotzig da und beobachtete ihn.
»Wo ist Charles Kingshaw?«
»Er kann überall sein. Ich weiß nicht, wo.«
»Das solltest du aber wissen, Edmund, du solltest bei ihm sein. Dein Benehmen gefällt mir gar nicht. Warum bist du nicht bei ihm?«
»Weil ich nicht weiß, wo er ist.«
»Bitte widersprich mir nicht.«
Hooper seufzte.
Joseph Hooper dachte, wenn er älter wäre, könnte ich mit ihm fertig werden, wenn er älter und anders wäre, könnte man alles verstehen und es sich mit seinem Heranwachsen erklären. So könnte man es wenigstens deuten. Aber er ist noch ein Kind, er ist noch nicht einmal elf.
»Dann such ihn eben, führ ihn herum, zeig ihm das Haus und das Dorf und so weiter, damit er sich – na ja, zu Hause fühlt. Es liegt mir sehr daran, dass er das tut. Ja. Dies ist jetzt sein Zuhause.«
»Oh. Sie bleiben also?«
»Sie werden bestimmt den Sommer über hierbleiben. Und ich bin ganz sicher …« Seine Stimme erstarb, als er in der Tür stand. Er wollte seinem Sohn nicht sagen, was er fühlte, wie sehr er wünschte, dass alles hier Mrs Helena Kingshaw gefallen würde.
Wie alt mein Vater aussieht, dachte Edmund Hooper. Er hat ein schmales Gesicht.
»Ich möchte, dass du dich mit Charles und mit Mrs Kingshaw verträgst. An manchen Tagen werde ich erst spät zurückkommen, und manche Nächte werde ich ganz in London verbringen müssen. Du wirst …«
»Was?«
»Nun – Die Kingshaws sind hier, es ist alles in Ordnung. Du wirst Gesellschaft haben.«
Hooper wandte sich ab.
»Edmund, du benimmst dich sehr unhöflich gegenüber einem Gast.«
»Ich dachte, du hast gesagt, es ist sein Zuhause. Wenn es sein Zuhause ist, kann er kein Gast sein, oder?«
Vielleicht sollte ich ihn schlagen, dachte Joseph Hooper, wenn er so mit mir spricht. Vielleicht ist es sehr unklug, ihn die Oberhand gewinnen und ihm seine Frechheiten durchgehen zu lassen. Ich mag seine hochmütige Art nicht. Ich sollte mich besser durchsetzen. Aber er wusste, dass er es nicht tun würde. Er hatte zu lange darüber nachgedacht, und nun konnte er nichts mehr tun. Ich habe versucht, die Fehler meines Vaters zu vermeiden, sagte er zu sich, aber ich habe nur erreicht, sie durch viele eigene zu ersetzen.
Seine Frau hatte sich ausgekannt, und sie war gestorben, ohne ihm Regeln zu hinterlassen, die er befolgen konnte. Er warf es ihr vor.
Er entfernte sich.
Hooper fügte noch zwei Kreise peinlich genau zu einem dreieckigen Block hinzu, auf der rechten Seite seiner Karte. Er malte sie sehr langsam aus, immer rundherum. Er steckte dabei seine Zunge aus dem Mund und atmete schwer auf das Papier wie ein kleines Kind. Dann ging er nach unten.
»Du musst jetzt mit mir mitkommen.«
»Wohin?«
»Das wirst du sehen.«
Er hatte Kingshaw im Gewächshaus gefunden, wie er mit einem Stock in den Geranientöpfen herumstocherte. Es war sehr heiß.
»Los, komm.«
»Wenn ich aber nicht will.«
»Du musst, ganz einfach, mein Vater hat es gesagt. Und wenn dich jemand dabei erwischt, wie du hier die Blumen schlägst, gibt es sowieso Ärger.«
»Ich habe sie nicht geschlagen.«
»Hast du wohl, hier sind Blütenblätter auf den Boden gefallen, guck.«
»Sie fallen runter. Sie fallen ganz allein runter.«
Die Sonne stach durch das Glas auf Kingshaws Gesicht. Die Haut an seinem Hals war schon rot verbrannt. Aber er mochte das Gewächshaus. Es roch nach altem, trockenem Laub und nach abblätternder Farbe, wo die Sonne auf eine morsche grüne Bank fiel. Es gab auch eine Menge Spinnweben. Niemand schien hierherzukommen.
Hooper wartete in der offenen Tür. Er hatte nicht erwartet, dass Kingshaw ihm nicht gehorchen würde.
»Also ihr geht jetzt beide das Grundstück besichtigen!«, sagte Mrs Kingshaw, als sie in der Tür erschien. Sie hatte den gleichen strahlenden, hoffnungsvollen Ausdruck, mit dem sie in Warings angekommen war. Es darf nicht schiefgehen, das ist meine Chance, und ich werde sie nicht verpassen. Ich will, dass wir alle glücklich werden.
Also mussten sie gehen, schlurften langsam aus dem Treibhaus hinaus und den Weg hinunter, einer hinter dem anderen, von Mrs Kingshaw beobachtet. Keiner sprach.
»Bilde dir nicht ein, dass ich dir irgendwas zeigen will. Ich laufe jetzt los, und du hältst besser mit mir Schritt.«
»Warum gehst du wieder ins Haus? Ich hab doch das ganze Haus gesehen, oder?«
»Mein Vater hat gesagt, ich soll dir alles zeigen, und tue ich nicht immer alles, was mein Vater sagt?« Hooper machte ein spöttisches Gesicht und lief los, durch die Haustür, über den Flur, das eichene Treppenhaus hinauf, in die Zimmer hinein und wieder heraus, eins nach dem anderen, und er knallte die Türen dabei. Dazu leierte er seine Erklärungen herunter.
»Das ist das Zimmer meines Vaters, das ist ein Gästezimmer, hier werden die Koffer aufbewahrt, das ist das Wohnzimmer deiner Mutter, jetzt gehen wir die hintere Treppe rauf, das ist das Badezimmer, das ist ein Schrank, das ist noch ein Badezimmer …« Bumm, Bumm, Bumm, Bumm, Knall, Knall, Knall …
Nach einer Weile hörte Kingshaw auf, ihm zu folgen. Er setzte sich auf die unterste Stufe der hinteren Treppe. Es war sehr dunkel und kühl.
Er dachte, ich möchte von Hooper wegkommen, ich möchte einen Bach oder einen Wald finden, ganz für mich allein. Alles, nur hier weg. Aber er traute sich nicht, einfach allein aus dem Haus zu gehen.
Er hörte, wie Hooper in dem Flur über ihm die Türen auf- und zuknallte. Dann war er plötzlich wieder da, stand oberhalb von Kingshaw auf der Steintreppe.
»Du solltest mir folgen.«
»Na und? Ich muss deinen Befehlen nicht gehorchen.«
»Ich zeige dir das Haus!«, sagte Hooper hochmütig.
»Du bist ein Idiot, es ist dumm, wie du dich benimmst.«
Hooper kam sehr langsam die Treppe hinunter, er setzte behutsam einen Fuß vor den anderen und zögerte bei jedem Schritt. Kingshaw hörte seinen Atem. Er wandte sich nicht um. Hoopers Beine in den Jeans tauchten hinter seinem Kopf auf. Hielten an. Kingshaw brauchte nur eine Hand zu bewegen, um ihn herüberzuziehen, ihn an den Knien zu packen und aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass er das Treppenhaus hinunterstürzen würde. Er war entsetzt, dass ihm dieser Gedanke kam. Er bewegte sich nicht.
Hooper ging weiter, mit gespielter Umsicht an ihm vorbei, vermied es sogar, dass sich ihre Kleider berührten. Irgendwo huschte eine Maus über die Dielen und verschwand unter einer Tür.
Hooper ging weg, die nächste Treppe hinunter und dann den Flur entlang, der zurück in den Hauptteil des Hauses führte. Nach einem Augenblick hörte Kingshaw das Öffnen und Schließen einer Tür. Von irgendwoher, wahrscheinlich aus der Küche, ertönte Musik im Radio.
Eine lange Zeit blieb er sitzen.
3
Ein Pfad führte durch das holprige Feld hinter dem Haus, und dahinter waren noch mehr Felder, die nach allen Richtungen hin abfielen und durcheinandergewürfelt waren wie Kopfkissen. Es waren vielleicht zwei Meilen bis zum Galgenholz, das oben auf dem Kamm entlanglief. Ein steiler Abhang, der mit lichtem Buschwerk bewachsen war, trennte es vom eigentlichen Wald.
Das war im Westen, östlich von Warings lag das Dorf Derne und sonst nur flaches Ackerland, das sich bis zur ersten Hauptstraße erstreckte.