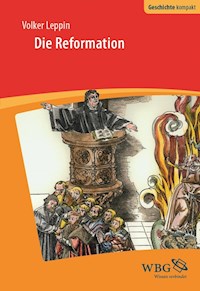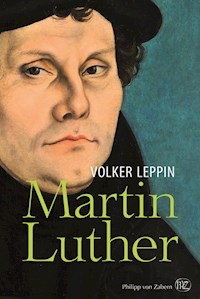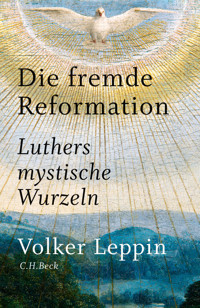
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Reformation gilt als Zäsur, mit der das Mittelalter endet. Volker Leppin zeigt demgegenüber, dass der junge Luther einer von vielen mystischen Schriftstellern war, und führt uns eine Reformation vor Augen, die viel mittelalterlicher und fremder ist, als es die Meistererzählungen von diesem „Umbruch“ wahrhaben wollen. Der Thesenanschlag zu Wittenberg, die Urszene der Reformationsgeschichte, hat nicht stattgefunden. Vielmehr hat Luther an diesem Tag ein „Disputationszettelchen“ verschickt, so wie es akademischer Brauch war. Diese und viele andere überraschende Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn man Luther konsequent in seinem spätmittelalterlichen Umfeld betrachtet. Rechtfertigungslehre und „Priestertum aller Gläubigen“, Predigtgottesdienst, Papstkritik und landesherrliches Kirchenregiment – all dies war selbstverständlicher Teil des spätmittelalterlichen Spektrums an Positionen und Protesten. Neu war allerdings die Art, wie Luther diese Elemente miteinander verband und von unterschiedlichen Interessengruppen zum Vordenker erhoben wurde. Erst diese Gemengelage führte zur Zuspitzung des Konflikts mit Rom. Vergessen und verdrängt wurden dabei Luthers mystische Wurzeln. Volker Leppin ruft sie anschaulich in Erinnerung und gibt Luther den spätmittelalterlichen Kontext zurück, der ihm von Protestanten wie Katholiken seit Jahrhunderten vorenthalten wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Leppin
Die fremde Reformation
Luthers mystische Wurzeln
C.H.Beck
Zum Buch
Die Reformation gilt als Zäsur, mit der das Mittelalter endet. Volker Leppin zeigt demgegenüber, dass der junge Luther einer von vielen mystischen Schriftstellern war, und führt uns eine Reformation vor Augen, die viel mittelalterlicher und fremder ist, als es die Meistererzählungen von diesem «Umbruch» wahrhaben wollen. Sein wunderbar klar geschriebenes Buch ist eine Einladung, Luthers mystische Wurzeln und damit eine bis heute verdrängte Dimension der Reformation neu zu entdecken.
Kein Thesenanschlag zu Wittenberg, kein dramatisches Turmerlebnis des Reformators Martin Luther, kein harter Bruch mit dem Mittelalter. Vieles hat nicht oder nicht so stattgefunden, wie es immer wieder gerne erzählt wird Solche überraschenden Erkenntnisse lassen sich gewinnen, wenn man Luther konsequent in seinem spätmittelalterlichen Umfeld betrachtet. Rechtfertigungslehre und «Priestertum aller Gläubigen», Predigtgottesdienst, Papstkritik und landesherrliches Kirchenregiment – all dies war selbstverständlicher Teil des spätmittelalterlichen Spektrums an Positionen und Protesten. Neu war allerdings die Art, wie Luther diese Elemente miteinander verband und von unterschiedlichen Interessengruppen zum Vordenker erhoben wurde. Erst diese Gemengelage führte zur Zuspitzung des Konflikts mit Rom. Vergessen und verdrängt wurden dabei Luthers mystische Wurzeln. Volker Leppin ruft sie anschaulich in Erinnerung und gibt Luther den spätmittelalterlichen Kontext zurück, der ihm von Protestanten wie Katholiken seit Jahrhunderten vorenthalten wird.
Über den Autor
Volker Leppin ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen, Mitglied der Sächsischen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftlicher Leiter des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen sowie Präsident des Mediävistenverbands. Für seine Forschung zum späten Mittelalter wurde er u.a. mit dem Ruprecht-Karls-Preis der Universität Heidelberg, dem Hanns-Lilje-Preis der Göttinger Akademie der Wissenschaften und dem Gerhard-Hess-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Einer größeren Leserschaft wurde er mit seiner Luther-Biographie bekannt, in der er die autobiographische Überlieferung Martin Luthers kritisch hinterfragt.
INHALT
EINLEITUNG
I: LUTHERS SPÄTMITTELALTERLICHE FRÖMMIGKEIT
Johann von Staupitz, der Beichtvater
Johannes Tauler und die spätmittelalterliche Mystik
Buße, Reue, Ablass
Entdeckungen, Bekehrungen, Inszenierungen
II: VON DER MYSTISCHEN LEKTÜRE ZU DEN 95 THESEN
Süßester Trost
«Theologia deutsch» und «Die sieben Bußpsalmen»
Staupitz, Luther, Güttel: Die Propagierung der mystischen Sünden- und Gnadentheologie
Humanistische Netzwerke und Disputationen gegen die Scholastik
Was ist neu an den 95 Thesen?
Luthers Meditationen über das Leiden und Sterben
III: VON DER REFORM ZUR KIRCHENKRITIK
Wittenberg 1517: Briefe statt Thesenanschlag
Ein Streit um die Wahrheit – und um den Papst
Die Entdeckung des Publikums
Heidelberg 1518: Zwischen Scholastik und Humanismus
Augsburg 1518: Die Lösung von der Kirche zeichnet sich ab
IV: KETZER HIER, ANTICHRIST DORT
Mäzene und Machthaber: Die Päpste der Renaissance
Rom 1518: Die Ausweitung der päpstlichen Macht
Sola scriptura: Mit der einen Autorität gegen die Autoritäten
Augsburg 1518 und die dreifache Exkommunikation
Leipzig 1519: Für oder gegen den Papst?
Zürich 1521: Klagen gegen Zwingli
Wittenberg 1520: «Gegen die fluchwürdige Bulle des Antichrist»
Worms 1521: Luther als christusgleicher Märtyrer
V: TRANSFORMATIONEN DER MYSTIK
Mystischer Geist und Gottes Wort
Der Umbau der Sakramentenlehre
Taufe und Abendmahl
Die Befreiung der Sakramente
Die Freiheit eines Christenmenschen
VI: VON DER MYSTIK ZUR POLITIK
Luther und der «christliche Adel»
Alle Getauften sind Priester
Krieg für die Reformation: Franz von Sickingen
Zwei Reiche, zwei Regimente
Die Reformation der Bürger: Das Beispiel Nürnberg
Zwingli und das Wurstessen in Zürich
Bäuerliche Reformation
Die Reformation der Fürsten
Kirchenordnungen und Katechismen
VII: MYSTISCHE WEGE JENSEITS VON LUTHER
Ein innerweltliches Mönchtum
Karlstadts mystische Radikalisierung
Müntzers chiliastische Vision
Täufer und Spiritualisten
Luthers domestizierte Mystik
Was ist lutherisch?
EPILOG
ANHANG
ANMERKUNGEN
Einleitung
I Luthers spätmittelalterliche Frömmigkeit
II Von der mystischen Lektüre zu den 95 Thesen
III Von der Reform zur Kirchenkritik
IV Ketzer hier, Antichrist dort
V Transformationen der Mystik
VI Von der Mystik zur Politik
VII Mystische Wege jenseits von Luther
Epilog
BILDNACHWEIS
PERSONENREGISTER
EINLEITUNG
Am Anfang war … Luther?
Wohl kaum – und der Reformator Martin Luther selbst hätte dies schon gar nicht behaupten wollen. Er wollte nicht der Erste sein und nicht der Letzte. Beides überließ er einem anderen, seinem Herrn Jesus Christus. Er war nur dessen Prophet, sah sich als Künder des Heils, das von Christus herkam, und des Endes, zu dem Christus wiederkommen würde. «Wie keme denn ich armer stinckender madensack datzu, das man die kynder Christi solt mit meynem heyloszen namen nennen?»,[1] so wies er den Gedanken ab, dass Christen sich Lutheraner nennen sollten.
Aber sie nannten sich so und tun dies bis heute – und manche von ihnen scheinen vergessen zu haben, dass Luther auch historisch nicht am Anfang stand. Dass Luther als Mensch des Mittelalters aufwuchs, daran zu denken fällt nicht leicht, wenn er immer wieder als Begründer der Neuzeit beschworen wird, erst recht im Vorfeld des Reformationsjubiläums. Es feiert sich leichter, wenn der Glanz eines Jubiläums auf einen verkappten Zeitgenossen fällt, als wenn man sich mühsam mit einem fernen Fremden auseinandersetzen muss.
Doch es hilft nichts: Luther ist uns Heutigen fremd.
Er ist nicht nur fremd in jenen Zügen, von denen man sich ohnehin gerne lösen will und die man daher gerne auf das Konto seines mittelalterlichen Erbes schreibt: in seinem unerträglichen Judenhass, in seinen Ausfällen gegen Türken oder den Papst. Auch die Wurzeln seines innersten Anliegens, der Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders, liegen für die Menschen des 21. Jahrhunderts fern. Sie entstammen der religiösen Bewegung der Mystik im späten Mittelalter – und es waren genau diese Grundlagen des späten Mittelalters, die Luther zu einer religiösen Botschaft formte, aus der Impulse zur Änderung von Kirche und Gesellschaft entstanden. Das Mittelalter ist mehr als eine Negativfolie für die reformatorische Botschaft, auch mehr als ein bloßer Rahmen von Voraussetzungen, derer Luther bedurfte, um als Held der Geschichte die Bühne zu betreten. Die kulturelle Welt des späten Mittelalters formte Martin Luther wie seine Anhänger. Wenigstens der Teil der Reformation, der sich trotz seiner Mahnungen mit seinem Namen verbindet, vergäße seine eigene Geschichte, wenn er sich von diesen mystischen Wurzeln lösen wollte. Wenn die Reformation dann weniger kämpferisch, weniger abgrenzend gegenüber anderen Formen des Christentums und weniger einseitig erscheint, mag der genauere Blick in die Vergangenheit auch einem offeneren Blick für die Gegenwart dienen.
So betrachtet kann man nicht einfach eine chronologische Abfolge schildern. Die folgenden Kapitel gehen daher nicht nach zählbaren Daten vor, sondern versuchen der Entwicklung der Reformation gerecht zu werden, indem sie unterschiedliche Aspekte aufgreifen, die sich zeitlich zum Teil überlagern. Dennoch wird sich bald zeigen, dass die Zeitabläufe sich wenigstens grob darin widerspiegeln – schließlich gilt auch hier die einfache, im Falle Luthers aber oft vergessene Regel: Am Anfang eines Geschehens weiß man oft nicht, was am Ende herauskommt.
Am Anfang war: die Mystik.
I
LUTHERS SPÄTMITTELALTERLICHE FRÖMMIGKEIT
Johann von Staupitz, der Beichtvater
Wittenberg um 1500: Das war ein kleines Nest «am Rande der Zivilisation», wie Luther später einmal sagen sollte.[1] Immerhin, es besaß ein Schloss, und ab 1502 wurde hier auch eine Universität aufgebaut, allerdings mit spärlichen Mitteln. Der Kurfürst war darauf angewiesen, die Anwesenheit von Orden geschickt zu nutzen, um eine eigentlich unterfinanzierte Hochschule in Gang zu bringen. Man war sich etwas schuldig; Friedrich der Weise (reg. 1486–1525) gehörte zu den ranghöchsten und mächtigsten Fürsten des Reiches. Mit viel Ehrgeiz und wenig Geld verfolgte er die Gründungspläne der Wittenberger Universität. Noch ehe die päpstliche Bestätigung eingetroffen war, öffnete die «Leucorea» ihre Pforten. Möglich wurde dies dadurch, dass einerseits die Pfründen des Allerheiligenstifts an der Wittenberger Schlosskirche zu ihrer Finanzierung genutzt wurden, andererseits das örtliche Kloster der Augustinereremiten Personal stellte. Hier bewährte sich die Zusammenarbeit mit einem Mann, den der Kurfürst wohl schon lange kannte: Johann von Staupitz (ca. 1468–1524). Möglicherweise wurden die beiden schon als Jugendliche zusammen in Grimma unterrichtet. Diese gemeinsame Erfahrung verband sie ebenso wie der adelige Hintergrund, der Johann von Staupitz auch bewusst blieb, als er um 1490, mit ungefähr zwanzig Jahren, in den Orden der Augustinereremiten eintrat.
Deren Gemeinschaft hatte sich im 13. Jahrhundert konstituiert und war neben Dominikanern und Franziskanern zu einem der wichtigen Bettelorden geworden. Diese Gruppe der Mendikanten zeichnete es aus, dass sie unter den «evangelischen Räten», die für Ordensangehörige verbindlich waren – Armut, Keuschheit und Gehorsam –, den ersten besonders betonte. Ihr Leben sollte besitzlos sein und dadurch in besonderer Weise die Alternative zu einer sich verweltlichenden Gesellschaft erkennbar machen, die, zumal in den Städten, zunehmend von Handel und Gewerbe und damit dem Streben nach Gewinn geprägt war. Bei Staupitz mag die Verachtung des Adeligen gegenüber dem emporkommenden Bürgertum auch eine Rolle gespielt haben, als er sich für den Eintritt in den Orden entschied. Im Zentrum aber stand die spirituelle Begeisterung für das Ideal eines Lebens in der Nachfolge Christi.
Sein adeliger Hintergrund, seine Ausbildung als Zögling aus vornehmer Familie sowie seine akademische Bildung dürften seinen Aufstieg im Orden beschleunigt haben: Er lehrte ab 1498 an der Tübinger Universität Theologie und stand gleichzeitig als Prior dem dortigen Konvent vor. Ab 1500 leitete er die Gemeinschaft in München, wechselte aber dann auf Wunsch Kurfürst Friedrichs nach Wittenberg, um hier Gründungsdekan der Theologischen Fakultät zu werden. Dass der Kirchenvater Augustin Patron der Universität wurde, dürfte auf ihn zurückgehen. Allerdings musste er sein Engagement für die Hochschule bald zurückstellen, denn 1503 wurde er zum Generalvikar der observanten Augustinereremiten in Deutschland gewählt. Wie in anderen Bettelorden hatten sich die «Observanten» von den «Konventualen» abgesetzt, denen sie vorwarfen, die Ordensregel nicht streng genug zu befolgen, also vor allem das Armutsgebot zu verletzen. Staupitz stand nun dem besonders strengen Zweig vor. Allerdings besaß er einen klaren Blick dafür, dass solche Streitigkeiten auf die Dauer nicht fruchtbar sein konnten. Um eine Vereinigung der konkurrierenden Ordenszweige zu ermöglichen, übernahm er auch die Leitung der sächsisch-thüringischen Ordenskongregation, die für den gemäßigten Weg stand.
Es scheint, dass hier recht bald sein junger Ordensbruder Martin Luther[2] auf seiner Seite stand und nicht – wie man lange Zeit annahm – im Protest gegen Staupitz, sondern zu dessen Unterstützung 1511/12 nach Rom reiste.[3] In dieser Zeit begann jedenfalls ein enges Vertrauensverhältnis: Als Staupitz 1512 seine Wittenberger Theologieprofessur aufgeben musste,[4] um mehr Zeit und Kraft für seinen Orden zu haben, wurde Luther sein Nachfolger – und zwischen beiden blieb ein vertrautes Verhältnis bestehen. Staupitz war Luthers Beichtvater und gab ihm entscheidende Ratschläge für sein spirituelles Leben und seine Theologie. Nicht umsonst hat Luther noch Jahrzehnte später erklärt: «Staupicius hat die doctrinam angefangen.»[5] Das konnte sich auf mancherlei beziehen – zum Beispiel darauf, dass sich Staupitz nach Luthers Erinnerungen besonders für die Verbreitung der Bibel im Orden eingesetzt hat.[6]
Dies ist ein weiterer Mosaikstein, der deutlich macht, wie irrig das in protestantischen Kreisen gerne gemalte Bild eines bibelvergessenen Mittelalters ist, das erst durch die Reformation zur Heiligen Schrift zurückgeführt werden musste. Lange vor Luther, seit 1466, waren in Deutschland achtzehn Vollbibeln mit unterschiedlicher dialektaler Gestaltung im Druck erschienen.[7] Die Bibel war gewiss kein unbekanntes Buch und Staupitz nicht der Einzige, der zu noch intensiverer Lektüre anregte. Ganz selbstverständlich hatte schon Zerbold van Zutphen (1367–1398) dafür votiert, dass Laien die Bibel in deutscher Sprache lesen sollten.[8] Er war ein Repräsentant der Devotio moderna, einer Frömmigkeitsbewegung, die vor allem im Mittelalter auf Verinnerlichung und vertiefte Aneignung der Glaubensinhalte hinwirkte und die auch noch den gelehrten Erasmus von Rotterdam beeinflusste. Dieser wurde für die Reformation nicht nur bedeutsam, weil er 1516 mit dem Novum Instrumentum eine Ausgabe des Neuen Testaments in seiner griechischen Originalsprache vorlegte, sondern auch weil er in einer Vorrede hierzu diejenigen scharf tadelte, «die nicht wollen, dass die göttlichen Schriften vom ungelehrten Menschen in einer Übersetzung in die Volkssprache gelesen werden».[9] Als Luther einige Jahre später, 1521/22, auf der Wartburg das Neue Testament übersetzte, befand er sich also ganz im Trend.
Die tiefe Verwurzelung in der Gedankenwelt seines Beichtvaters und Ordensoberen Staupitz reicht jedoch noch weiter. In welchem Ausmaß sich bei Staupitz bereits Gedanken finden, die später durch die reformatorische Bewegung aufgegriffen und weiter entfaltet werden konnten, zeigen insbesondere Predigten, die er gerade in jenem Jahr, in dem er seine Professur an Luther übergab, in Salzburg hielt: In der Fastenzeit 1512 predigte er in der damaligen Pfarrkirche über das Leiden Jesu Christi. Aufmerksame Zuhörerinnen waren die Nonnen von St. Peter, aus deren Kreis uns eine Abschrift erhalten ist. Sie zeigen Johannes Staupitz als einen Vertreter der «Frömmigkeitstheologie» in genau dem Sinne, in dem Berndt Hamm diese spätmittelalterliche Ausrichtung theologischer Gelehrsamkeit bestimmt hat: Das Wissen um die heiligen Dinge wird nicht spekulativ durchdrungen, sondern daraufhin zugespitzt, das geistliche Leben der Zuhörer und Zuhörerinnen zu beleben und zu vertiefen.[10] Passend zum Kirchenjahr – die Fastenzeit diente der Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern – zeichnete Staupitz das Leiden Jesu Christi nach, um vor allem eines deutlich zu machen: dass in diesem Leiden alles Leiden des Menschen aufgehoben ist.[11] Indem der Glaubende sich in das Mitleiden mit Christus findet, stößt er im innersten Kern auf die Barmherzigkeit Gottes selbst.[12] So entdeckt er den «allersüssist Jesus Christus»[13], außer dem es «kainen trost nit» für die Menschen gibt.[14] In seinem intensiven Nachvollzug des Leidens Christi spricht Staupitz diesen sogar unmittelbar an: «All tugent, alle genad ist in dir alain».[15]
Solche Formulierungen machen deutlich, warum Luther später sagen konnte, dass die doctrina mit Staupitz angefangen habe: Gerne wird der evangelische Glaube durch die sogenannten Exklusivpartikel zusammengefasst, in denen sich eine konzentrierte Beschreibung der zentralen Lehre von der Rechtfertigung des Sünders findet: Diese bewirkt Solus Christus («Christus allein»), Sola gratia («aus Gnade allein»), Sola fide («allein durch den Glauben»), und vermittelt wird dies Sola scriptura («allein durch die Schrift»). Auch die Predigten von Staupitz haben allein Christus im Blick und sprechen ausdrücklich von der «genad (…) alain». Hier formt sich in der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur aus, was später zur Unterscheidung von Konfessionen gebraucht wurde. Wer reformatorische Frömmigkeit gegenüber dem Mittelalter vor allem als etwas ganz Neues darstellen will, kommt angesichts solcher Belege in Schwierigkeiten, denn die reformatorische Frömmigkeit entstammt dem Mittelalter und lässt sich von diesem nur gewaltsam lösen. Dies gilt umso mehr, als bei Staupitz auch der reformatorische Kerngedanke begegnet, dass der Mensch zu seinem Heil nichts Eigenes beitragen kann: «Und umbsünst ist er dir geben die genad. Du gib auch umbsünst, was dir got umbsünst geben hat!»[16]
Dass in diesen Aussagen spätere reformatorische Theologie anzuklingen scheint, darf nicht dazu führen, sie von ihrem spätmittelalterlichen Umfeld abzuheben – im Gegenteil: Als Staupitz das Leiden und Sterben Jesu Christi gnadentheologisch deutete und von hier aus seelsorgerlich auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer einwirkte, befand er sich auf der Höhe der Zeit. Zahlreiche Handschriften und Drucke verbreiteten damals die «himmlische fundgrube» seines Ordensbruders Johann von Paltz, die zu einer Betrachtung des Leidens Christi anleiten sollte. Eine wertvolle Handschrift dieses Buches, die 1508 in Köln hergestellt wurde, lässt in ihren Illustrationen noch weitere Bezüge erkennen: Dargestellt wurden nicht allein dem biblischen Bericht folgende Szenen aus den letzten Tagen Jesu, sondern auch seine Leidenswerkzeuge, seine Wunden und Christus selbst in Gestalt des Ecce homo, der seinen geschundenen Leib vor Augen stellt.[17] Über solchen Bildern konnte man sich meditativ in jenes Mitleiden mit Christus versenken, das Staupitz empfahl. Auch großformatige Darstellungen der um ihren Sohn trauernden Maria, die Pietà bzw. das Vesperbild, oder der «Schmerzensmann» leiteten hierzu an. Auch von dem Wittenberger Maler Lukas Cranach, der sich im engen Umfeld Martin Luthers bewegte, sind zahlreiche Darstellungen dieser Art erhalten – oft mit ungebrochener Kontinuität zwischen der Zeit vor und nach Beginn der Reformation.
Lukas Cranach d. Ä., Christus als Schmerzensmann, um 1510/20 (Innenseite eines Altarflügels)
Die reiche Welt einer Besinnung auf den leidenden Christus macht das intensive Gespräch deutlich, das Luther immer wieder als eine wichtige Etappe seiner spirituellen Entwicklung beschrieben hat: Wohl im Jahre 1516 muss sich zugetragen haben, was Luther später, gewiss zugespitzt und gefärbt, berichtete:
Der leidende Christus war vor der Reformation so präsent wie danach. Für Lukas Cranach blieb er ein und derselbe: Christus als Schmerzensmann, 1540 (linke Flügelaußenseite des Kreuzigungstriptychons)
Ich klagte einmal meinem Staupitz über die Feinheit der Prädestination. Er antwortet mir: in den Wunden Christi wird die Prädestination verstanden und gefunden, nirgends anders, weil geschrieben steht: Diesen hört! Der Vater ist zu hoch. Aber der Vater hat gesagt: «Ich werde einen Weg geben, zu mir zu kommen, nämlich Christus.» Geht, glaubt, hengt euch an den Christum, so wirts sichs wol finden, wer ich bin, zu seiner Zeit. Das thun wir nicht, daher ist Gott für uns unverständlich, undenkbar; er wirt nicht begriffen, er will ungefast sein außerhalb von Christus.[18]
Das Problem, das Luther vor seinen Beichtvater brachte, ergab sich aus der Lehre des Ordenspatrons und Kirchenvaters Augustin: Nach ihm hatte Gott in seinem freien Entschluss vorherbestimmt, welchem Menschen das Heil zukommen sollte. Diese Prädestination stand für und vor Gott unverrückbar fest, war für den Menschen aber nicht erkennbar. Dieser befand sich vielmehr in der vertrackten Lage, an seinem Heilsstand nicht das Geringste ändern zu können. Noch so gute Lebensführung, Gebet und Suche nach Gott konnten an Gottes Willen nichts ändern. Gehörte man nicht zu den Erwählten, war man unausweichlich auf dem Weg in das ewige Verderben. Martin Luther war dieses Problem, das im späten Mittelalter zu gewichtigen scholastischen Abhandlungen geführt hatte, offenbar existentiell drängend bewusst. Die Antworten, die Augustin gab, konnten ihn nicht befriedigen, die Sorge um sein Seelenheil nahm ihm eine solche theologische Konstruktion nicht ab, im Gegenteil: Er fühlte sich bis aufs Innerste gefährdet.
Von hier aus lenkte ihn Staupitz auf jene spätmittelalterlichen Überzeugungen, die er wenige Jahre zuvor in Salzburg verkündigt hatte: dass am Leiden Christi das Heil hängt, in ihm allein. Seine Anweisung liest sich fast wie eine Hinführung zu einer Meditation über Bilder von den Wunden Christi – und zugleich bringt er in einem kühnen Griff die Möglichkeit, in Christus Gott anzuschauen, in Stellung gegen alle Versuche, sich Gott spekulativ zu nähern und dann gegebenenfalls an den Folgen der eigenen komplizierten Konstruktionen zu scheitern. Martin Luther sollte sich diesen Hinweis zeitlebens merken, nicht nur im ausdrücklichen Bericht davon, sondern auch in seinen theologischen Ausarbeitungen: Fast zwei Jahrzehnte später unterschied er in Auseinandersetzung mit Erasmus den «verborgenen Gott» von dem «offenbarten» – und drückte damit nichts anderes aus, als Staupitz ihm seinerzeit vermittelt hatte.[19] Für seine Entwicklung war dies wohl der Impuls, durch den er, der spätere Reformator, sich das Solus Christus von Staupitz aneignen konnte.
Dies kam allerdings nicht überraschend: Die Konzentration auf Christus, die nun eine existenzielle Dimension gewann, war ihm schon seit seinen ersten Wittenberger Vorlesungen ein Anliegen. 1513, kurz nach Übernahme des Lehrstuhls von Staupitz, begann er mit seiner ersten Psalmenvorlesung, den sogenannten Dictata in Psalterium. Dabei zeigte er den Ehrgeiz eines jungen Professors, die neuesten wissenschaftlichen Möglichkeiten zu nutzen: Wenige Jahre zuvor war das Quincuplex Psalterium des französischen Humanisten Jacques Lefèvre d’Étaples (1450/55–1536) erschienen, der sich wie viele Zeitgenossen in latinisierter Namensform Faber Stapulensis nannte. Der Psalter wurde hier philologisch sorgfältig in fünf unterschiedlichen lateinischen Versionen dargeboten, die es auch dem des Hebräischen gar nicht oder wenig Kundigen erlaubten, sich ein Bild von der möglichen Bedeutungsvielfalt des Originals zu verschaffen. Eines aber wollte Faber Stapulensis abwehren: die Auslegung der Rabbinen, denen er vorwarf, den wahren Sinn des Alten Testamentes gar nicht verstehen zu können, weil ihnen der maßgebliche Schlüssel hierzu fehle: Jesus Christus.[20] Diesen Grundansatz zur Deutung übernahm Luther fast wörtlich in die Ausgabe des Psalters, die er in Wittenberg für seine Vorlesung bei Rhau-Grunenberg drucken ließ: Christus als Schlüssel der Schrift.[21]
Im Laufe der folgenden Jahre, in denen er noch den Römerbrief und den Galaterbrief und ein weiteres Mal den Psalter auslegte, baute Luther den hermeneutischen Grundansatz immer weiter aus, dass die Schrift vor allem von Christus redet, und zwar, ganz im Sinne jener Frömmigkeitstheologie, die er bei Staupitz kennengelernt hatte, nicht abstrakt und spekulativ, sondern pro nobis: für uns und unser Heil. Wenn gelegentlich über das Medienphänomen Luther gesprochen wird, so gehört in gewisser Weise schon das, was hier geschah, dazu. Luther sprengte die tradierten Genregrenzen: Die Aufgabe der Predigt, den Glauben anzusprechen und anzuregen, und die Aufgabe der Vorlesung, den Text nach seinen inneren – und das hieß für die mittelalterliche Exegese vor allem: dogmatischen – Gehalten zu analysieren, lagen für ihn nicht weit auseinander.
Luther kam hier die Grundstruktur mittelalterlicher Auslegungskunst entgegen: die Lehre vom vierfachen Schriftsinn. Grundsätzlich konnte man im biblischen Text einen historisch-literalen von einem typologischen, einem moralischen und einem eschatologischen Sinn unterscheiden. Der erste, der historische, gab den unmittelbaren Sachgehalt des Textes unter seinen historischen Entstehungsumständen wieder. Dieser Sinn hatte sich schon im Mittelalter als derjenige herauskristallisiert, der jedenfalls bei sachlichen Differenzen den Ausschlag geben sollte. Der typologische Sinn diente dazu, in dem gegebenen historischen Text die ewigen Glaubensinhalte des Christentums wiederzufinden, auch wo diese nicht explizit genannt waren. So konnte etwa die Erwähnung des Jerusalemer Tempels im Alten Testament auf die Kirche der Christenheit vorausweisen. Das Individuum und seine Handlungsorientierung waren durch den moralischen Sinn angesprochen, und der eschatologische Sinn blickt auf die letzten Dinge, das Ende der Welt und das Jenseits voraus. Bei Luther schmolz dieses Schema auf zwei Dimensionen zusammen: den historischen Sinn, der für ihn aber auch bei den Psalmen – entgegen dem, was heutige historische Kritik hierzu zu sagen hat – von Christus selbst sprach, und eben jenes pro nobis, zu dem er den moralischen Sinn transformierte. Die anderen Sinnebenen wurden auf unterschiedliche Weisen in diese Doppelstruktur integriert. Der Exeget konnte nun so der Predigt dienen, der Prediger sehr unmittelbar aufgreifen, was die akademische Auslegung ihm anbot.
Dass Luther für diese Weise mit Faber Stapulensis einen der großen humanistischen Gelehrten seiner Zeit heranzog, passte bestens in die Entstehungsphase der Wittenberger Universität: Ganz offenkundig war sie in der Theologischen Fakultät, aber auch in den anderen Fakultäten vom Geist des Humanismus beseelt. Zurück zu den Quellen zu gehen, das war in Wittenberg geistiges Programm. Dass hieraus im theologischen Bereich der Gedanke des Sola scriptura entstehen würde, war daher alles andere als erstaunlich. Überhaupt wird in der jüngeren Forschung immer deutlicher, dass die reformatorische Bewegung, die sich nach und nach um Luther formierte, nur so entstehen und gedeihen konnte, wie sie es tat, weil sie in ihr Umfeld passte. So war es für die Stadt Wittenberg alles andere als ungewöhnlich, dass Konflikte mit kirchlichen Behörden aufbrachen.
Wenn die protestantische Erinnerungskultur im Nachhinein die Verhängung des Bannes über Martin Luther im Jahre 1521 zu einem durchschlagenden Ereignis stilisierte, wird man bedenken müssen, was Natalie Krentz nüchtern festhält: «Zeiten des Interdikts waren in Wittenberg in den (…) ersten Jahren des 16. Jahrhunderts eher die Regel als die Ausnahme».[22] Ein Interdikt bedeutete das Verbot von Gottesdiensten und Sakramentenspendung an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Verhängt durch den Bischof, stellte es eine Art von pauschaler und zugleich bedingter Exkommunikation dar. Die Anlässe hierfür waren zahlreich, das Anliegen des für Wittenberg zuständigen Bischofs von Brandenburg blieb stets gleich: seine Macht demonstrativ durchzusetzen. Dass die Universität dafür einen besonderen Störfaktor darstellte, war ihm auch schon lange vor Martin Luthers Auftreten bekannt: Ob nun Studenten in Bürgerhäusern randalierten, wie es für die Jahre 1508/09 dokumentiert ist, oder 1512 unterschiedliche Landsmannschaften aufeinander losgingen – unruhig waren sie allemal, und die Geistlichen unter ihnen zeichneten sich vor allem dadurch aus, dass sie sich, einmal ertappt, bemühten, allen Straffolgen zu entgehen, indem sie darauf verwiesen, dass für sie nicht das bürgerliche Recht gelte, sondern das kirchliche.[23]
So sehr Wittenberg am Rande der Zivilisation lag – als verschlafenes Provinznest wird man es sich nicht vorstellen dürfen. Luther kam 1512 in eine flirrende Atmosphäre, in der die junge Universität sozial noch keineswegs ohne weiteres in ihrer Umgebung etabliert war und intellektuell den Wind des Neuanfangs verspürte – und dies auf so faszinierende Weise, dass auch einer der wenigen Großen vor Ort, Johannes Staupitz, nicht zu denen gehörte, die alles beim Alten lassen wollten. Er führte Gespräche wie jenes über die Prädestination, von dem Luther später berichtete. Und er öffnete die Augen für weitergehende Literatur. In seinem Umfeld wurde so intensiv wie nirgends sonst in Deutschland zu dieser Zeit Johannes Tauler (gest. 1361) gelesen.[24]
Johannes Tauler und die spätmittelalterliche Mystik
Johannes Tauler gehörte zu den populärsten geistlichen Autoren des späten Mittelalters, wohl auch deswegen, weil sein prägendes Vorbild, Meister Eckhart (gest. 1328) durch die Bulle In agro dominico1329 wegen Häresie verurteilt worden war. Tauler bot gewissermaßen die kirchenkonformere Variante von dessen Mystik, die um die Vorstellungen von der Abgeschiedenheit der Seele gegenüber allem Irdischen und der Gottesgeburt im Innersten des Menschen kreiste. Seine Theologie läuft nicht auf eine Identität zwischen mystischer Seele und Gott hinaus, doch dehnte er die Möglichkeiten der religiösen Vorstellungswelt weit aus: In einer Fronleichnamspredigt schilderte er die Begegnung mit Jesus Christus selbst durch die Einnahme der Eucharistie. Jubelnd rief er aus: «Wir essent unsern Gott»,[25] und erklärte: «Nu ist enkein materielich ding das als nahe und inwendiklich den menschen kume als essen und trinken, das der mensch zuo dem munde in nimet»[26] («Nun gibt es keinen stofflichen Vorgang, der dem Menschen so nahe und vertraut wäre, als essen und trinken, das durch des Menschen Mund eingeht»). Die Drastik der Bilder lässt erahnen, was die Wirkung dieser Predigten ausmachte: Einerseits bestätigten sie die in der mittelalterlichen Sakramentenlehre tief verankerte Vorstellung, dass in den Abendmahlselementen, in Brot und Wein, Jesus Christus real präsent ist. Andererseits überstiegen sie alle kruden Vorstellungen, die sich hiermit verbinden konnten, indem sie aus dem äußeren Vorgang einen inneren machten: Indem die Glaubenden Christus essen, werden sie von ihm selbst gegessen[27] – nicht real und fleischlich, sondern geistlich durch ihre tiefe Zerknirschung und Reue.
Von solchen Texten geleitet konnten Menschen im späten Mittelalter Anweisungen für ihre rechte Haltung gegenüber Gott erhalten, ohne bei ihrer Kirche anecken zu müssen. Dem reichen Gebrauch Taulers kam entgegen, dass schon zu seinen Lebzeiten seine Predigten in der Reihenfolge des Kirchenjahres gesammelt wurden – offenbar ein praktisches Handbuch für Prediger, die sich dieser Texte bedienen konnten, um den Gemeinden den christlichen Glauben zu erläutern. Da das Kirchenjahr mit der Advents- und Weihnachtszeit beginnt, stand am Anfang des Zyklus eine Predigt über die Gottesgeburt. Tauler kannte diese auf drei Weisen: vor aller Zeit, innerhalb der Trinität, war der Sohn aus dem Vater geboren; in der Zeit, im Stall von Bethlehem, wurde Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren; und stets neu sollte er in der Seele der Glaubenden geboren werden. Das Thema, das tief in die mystische Vorstellung von der Gegenwart Gottes im Glaubenden hineinreichte, gab dann auch den Anlass, dass in manchen Ausgaben Taulers hinter diese Predigten eine Gruppe von Predigten über die Gottesgeburt rückte, die nach unserem heutigen Kenntnisstand gar nicht von Tauler stammten, sondern von Meister Eckhart. Unter fremdem Namen konnte dieser dann doch fortwirken, bis hin zu Martin Luther.
Dieser las Tauler in einem 1508 in Augsburg von Hans Otmar erstellten Druck, den ihm wohl sein Ordensbruder Johannes Lang (gest. 1548) geliehen hatte. Dass es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sein eigenes Buch war, hielt ihn nicht davon ab, reichlich Randbemerkungen anzufügen, die es noch heute ermöglichen, ihm beim Lesen über die Schulter zu schauen. Die Lektüre muss ihn fasziniert haben, regte ihn zu immer neuen eigenen Gedanken an und bestätigte zugleich, was er von Staupitz gehört und erfahren hatte: dass das christliche Leben vor allem durch eines ausgezeichnet ist: das Leiden.[28] Dieses Leiden aber war nun nicht so sehr oder nicht allein das Mitleiden mit Christus in der Passion, sondern Luther drang in tiefere Schichten vor. In der erwähnten Predigt über die Gottesgeburt hatte Tauler das Verhältnis zwischen dem Glaubenden und dem in ihm geborenen Gott beschrieben: «wann wenn zway sollnn ains warden/so muoß sich dz ain haltnn leidend/daz ander wirckent».[29] Luther notierte hierzu: «Merke, dass es viel nötiger ist Göttliches zu erleiden (pati) als es zu tun. Vielmehr sind Sinn und Verstand ihrer Natur nach auch eine passive Tugend (virtus passiva).»[30] Hier lohnt es sich, die lateinischen Worte genau anzusehen, denn als Martin Luther Jahrzehnte später den Kern seiner reformatorischen Erkenntnis beschrieb, da tauchte die hier leitende Vokabel wieder auf: Die iustitia passiva stand hier im Zentrum, die passive Gerechtigkeit.[31] Luther unterschied sie von der aktiven Gerechtigkeit, nach der der Mensch etwas leisten muss, damit Gott ihn als gerecht beurteilt. Passive Gerechtigkeit bedeute hingegen, dass Gott uns gerecht macht, ohne Leistung von unserer Seite. So war alles ganz auf Gott als den Akteur ausgerichtet, der Mensch konnte nur passiv Empfangender sein.
Die Lutherforschung hat lange versucht, herauszufinden, auf welchen Moment seiner theologischen Entwicklung Luther sich eigentlich mit dieser sehr späten Erinnerung bezog. Mit seinen Randbemerkungen zu Johannes Tauler ist auch nicht einfach der Moment gefunden, in dem ein «Durchbruch» stattgefunden hat. Tatsächlich wird es den einen Augenblick, in dem sich Luthers Theologie neu formierte, gar nicht geben. Seine Entwicklung vollzog sich allmählich. Aber das Faszinierende an seinen Randbemerkungen ist doch, dass sich hier gewissermaßen die Grundmelodie der späteren Rechtfertigungslehre findet: dass der Mensch ganz und gar auf Gott angewiesen ist. Diese Erkenntnis kam nur nicht plötzlich, sie stand auch nicht, wie es die protestantische Sicht gerne hätte, im Gegensatz zum Mittelalter, sondern sie entstand aus dem Geist der Mystik, wie er Luther in Taulers Predigten begegnete.
Von einer reformatorischen Erkenntnis oder dergleichen kann schon allein deswegen nicht gesprochen werden, weil das, was sich hier abzeichnete, noch fern von jener systematischen Durchdringung war, mit der Luther später die Grundstrukturen seines Denkens entwickelte und entfaltete. Hierzu half ihm die Lektüre von Paulus und Augustin, die aber nicht im Gegensatz zu seinem Taulerverständnis stand. Wie schon im späten Mittelalter vielfach üblich, las er vielmehr den Mystiker zusammen mit dem Apostel und dem Kirchenvater. So konnte er jene Taulersche Grundmelodie gleichzeitig in seiner Vorlesung über den Römerbrief entfalten.
Wie viel Luther aber in dieser gedanklichen Weiterentwicklung seiner Auseinandersetzung mit Tauler verdankte, zeigen einzelne Bemerkungen in den wenigen Notizen, die er an den Rand der Tauler-Ausgabe schrieb, überdeutlich, und ihre Wirkung hielt lange an. So erklärte er 1536 in seiner Disputatio de homine, dass der Mensch reine Materie Gottes zur Erfüllung seiner künftigen Form sei. Dies stellt eine kühne Umdeutung der aristotelischen Philosophie dar, die die ganze Natur anhand von Materie und Form beschreibt und analysiert. Luther stellte diese Begrifflichkeit, konträr zu ihrer Intention, in den Dienst der theologischen Lehre, dass der Mensch ganz und gar von Gott gestaltet werde und sein Ziel erst im Jenseits erlange.
Diese Wandlung sei, so heißt es in der verbreiteten Meistererzählung des Protestantismus, «unter biblischem Einfluß» erfolgt.[32] Das ist wohl wahr – wenn man sich bewusst hält, dass auch die spätmittelalterliche Theologie ohne eben diesen Einfluss nicht zu denken ist. So ist es aber wohl nicht gemeint, sondern eher im Sinne einer Entgegenstellung zum mittelalterlichen Erbe. Solche vereinfachenden Bilder werden rasch korrigiert, wenn man beachtet, dass die These aus der späten Disputation schon in den frühen, wohl um 1515 entstandenen Randbemerkungen zu Johannes Tauler vorgeformt ist: «Wir sind reine Materie, Gott ist der, der die Form macht, alles in uns nämlich wirkt Gott».[33] Der biblische Gedanke ist ein mystischer, der mystische Gedanke ein mittelalterlicher: Gott wirkt alles, der Mensch nichts. Diese Grundeinsicht steht schon fest – ebenso wie die besondere Bedeutung des Glaubens: «Also besteht das ganze Heil in der Aufgabe des Willens in allen Dingen, wie er hier lehrt, den geistlichen wie den weltlichen. Und im nackten Glauben an Gott (nuda fides in Deum)».[34] Wenn oben das Sola fide als Charakteristikum der ausgebildeten evangelischen Rechtfertigungslehre angesprochen wurde, so gilt: Den Ansatz hierzu finden wir in der Auseinandersetzung des mittelalterlichen Mönchs mit dem mittelalterlichen Mystiker. Was später, auch in Luthers Augen, als neu gilt, wurzelt im Alten – und trug doch maßgeblich zu jenen Änderungen bei, die in der Reformation die kirchliche und politische Landschaft Europas umpflügen sollten. So wenig diese einfach nur Folge einer theologischen Grundentscheidung waren, so sehr fanden sie doch in dem, was Luther hier las und gedanklich entfaltete, ihre Legitimation und ihr klares Ziel.
Buße, Reue, Ablass
Zunächst aber musste Luther selbst mit seinen Erkenntnissen zurechtkommen, die, so vielfältig sie waren, doch vor allem einen Kerninhalt besaßen: ein neues Verständnis der Buße. Buße, poenitentia, war eines der Zentralsakramente im mittelalterlichen Glaubensleben. Das IV. Laterankonzil hatte im Jahr 1215 eingeschärft, dass jeder Christ und jede Christin einmal im Jahr, vor dem Empfang der Eucharistie zu Ostern, vor den Beichtvater treten müsse. Dies war das mittlere von drei Stücken, aus welchen die Buße bestand: Reue des Herzens, Bekenntnis des Mundes und Wiedergutmachung durch das Werk. Bei der Deutung dieses Geschehens konnte man vor allem die Wiedergutmachung einschärfen – bei der es vielfach schlicht um Strafen ging. Wo die gebeichteten Sünden so groß waren, dass man den Ausgleich in dieser Welt nicht schaffen konnte, verschob sich dieser in den Zwischenort im Jenseits: das Fegefeuer, in welchem die Seelen noch weiter unter den Folgen ihrer Übeltaten leiden mussten, bis vollends alles abgeleistet war und sich ihnen endlich die Tür zum Himmel öffnete.
Hier hängt dann das Bußsakrament mit der im späten Mittelalter so virulenten Frage des Ablasses zusammen. Der Ablass war – jedenfalls dort, wo er korrekt gehandhabt wurde – ein Nachlass der Sündenstrafen. Streng genommen konnte er sich nur auf diejenigen Strafen beziehen, die auf Erden galten. Doch hatte Papst Sixtus IV. (1471–1484) im Jahr 1476 durch die Bulle Salvator noster einer weiterreichenden Hoffnung Tür und Tor geöffnet: Durch Fürbitte zumindest, per modum suffragii, wie es in einer unklaren Wendung hieß, sollte auch den Seelen im Fegefeuer Ablass zukommen.[35]