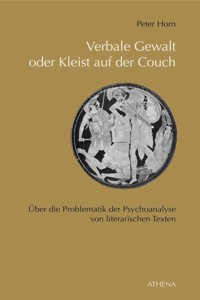Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: wbv Media GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Beiträge zur Kulturwissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer schon war der "Wahnsinn" das Kennzeichen des wahren Dichters. Selten hat man allerdings die psychiatrische Realität dieses Wahnsinns in ihrer Beziehung zum dichterischen Text untersucht. Paul Celan verbrachte den Großteil seiner letzten Lebensjahre in der Psychiatrie und beging 1970 Selbstmord. Dieses Buch geht den Fragen nach, welche individuellen Ursachen zu seiner Krankheit führten, welche Traumata in Celans Lyrik ihren Niederschlag gefunden haben und in welcher Weise die manisch-depressive Krankheit den Stil und den Inhalt vor allem seiner späten Lyrik geprägt hat. Wie die "Psychose" als Sprachstruktur und Thema in den Texten Paul Celans als Widersinnigkeit, Sinnlosigkeit und das Unaussprechliche dennoch zu einem Fascinosum seiner Lyrik in der Zeit der Gegenmenschlichkeit wird, ist Kern dieser Untersuchung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Horn
Die Garne der Fischer der Irrsee
Zur Lyrik von Paul Celan
Beiträge zur Kulturwissenschaft
Band 22
Peter Horn
Die Garne der Fischer der Irrsee
Zur Lyrik von Paul Celan
ATHENA
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1. Auflage 2011
Copyright © 2011 by ATHENA-Verlag, Mellinghofer Straße 126, 46047 Oberhausen www.athena-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagabbildung: © Sven Bähren – Fotolia.com
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Print) 978-3-89896-420-3 ISBN (ePUB) 978-3-89896-801-0
This material is based upon work supported financially by the National Research Foundation. Any opinion, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and therefore the NRF does not accept any liability in regard thereto.
I gratefully acknowledge that the University of Witwatersrand supported my research.
Edler als die Besonnenheit
Im Quell deiner Augen
leben die Garne der Fischer der Irrsee. (Lob der Ferne (G37))
Wie Fischer werfen sie Netze nach Irrlicht und Hauch! (Die letzte Fahne (G32))
Weil ich es entsetzlich finde, mit solchen Dingen Literatur zu machen
Celans Frau, Gisèle Celan-Lestrange, schreibt am 3. November 1964 an Paul Celan, sie sei in der Bibliothek von Moisville auf Pour un tombeau d’Anatole gestoßen, den Entwurf eines langen Gedichts von Mallarmé über den Tod seines Kindes. Sie schreibt, dieses Gedicht habe sie furchtbar aufgewühlt und sie habe beim Lesen sehr weinen müssen. Die Einführung von Jean-Pierre Richard »hat mich begeistert, aber auch sehr irritiert, weil ich es entsetzlich finde, mit solchen Dingen Literatur zu machen, und ich denke auch, dass man ein so schmerzliches, so persönliches, so mysteriöses und manchmal auch wegen seines unfertigen Charakters, da eher aus Notizen bestehend als vollendet, unverständliches Gedicht nicht, ohne indiskret zu sein, angehen, auseinandernehmen, deuten und analysieren kann.« (PC/GCL 1, 167) Gisèle Celan-Lestrange war besonders betroffen von diesem Gedicht, da ihr eigener erster Sohn, François, am 8. Oktober 1953, einen Tag nach der Geburt an den Folgen eines unsachgemäßen Einsatzes der Geburtszange gestorben ist.
Auch Celan selbst schreckte manchmal davor zurück, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Im Dezember 1957 übersetzte Paul Celan das Gedicht Nous deux encore von Henri Michaux, verzichtete dann aber auf die Veröffentlichung aufgrund der Einwände Michauxs. Das Gedicht ist engstens mit dem Tod von dessen Frau Marie-Louise Termet durch Verbrennungsverletzungen nach einem Unfall verbunden.
Es ist bekannt, dass Paul Celan sein Leben durch Selbstmord beendet hat. Man hat den Tod Celans »durch sein Scheitern als Dichter« (H25) zu begründen versucht. Obwohl es Gerüchte über Celans labilen psychischen Zustand gab (H24) war doch weniger bekannt, dass er 1962/63, 1965/66 (nach einem Mordversuch an seiner Frau Gisèle Celan-Lestrange), 1967 (nach einem Selbstmordversuch) und 1968/69 in psychiatrische Kliniken aufgenommen bzw. zwangseingewiesen wurde. (HZ371f.) Ein weiterer Mordversuch an seiner Frau durch Strangulation und ein Selbstmordversuch durch Aufschneiden der Pulsadern sind zeitlich nicht zu präzisieren; sie bleiben vage Hinweise (PC/CGL 2, 29). »Die fünf Internierungen Celans in psychiatrischen Kliniken ab 1962 lassen die fatale Verbindung von traumatischer und ästhetischer Existenz erahnen, die sich in Celans Leben und seine Texte eingraviert hat.«[1] Felstiner (2000, 260) zitiert zwei Briefe von Celan aus dem Jahr 1963: »Letztes Jahr um Weihnachten [1962] habe ich eine ziemlich schwere Depression durchgemacht, aber ich konnte mich wieder fangen und die Arbeit an der École Ende Januar wieder aufnehmen. Seither geht es wieder bergauf, es gibt zwar noch Höhen und Tiefen, der Schlaf ist nicht berühmt, aber ich arbeite und halte stand.«[2] Eines der Symptome einer »Manie« ist die Schlaflosigkeit[3] – »der Schlaf ist nicht berühmt«, schreibt Celan – und er wünscht sich: »In die Schlafgrätsche gehn, o einmal.« (G283) Weil er glaubte, Petre Solomon habe diesen Brief vielleicht nicht erhalten, schrieb Celan noch einmal: »Ich war letztes Jahr ziemlich krank: eine nervöse Depression (um den – vereinfachenden – Terminus des Mediziners zu gebrauchen).«[4] Felstiner stimmt dem zu: »›Vereinfachend‹, sagt Celan; denn die Krankheit kam von seiner Verbitterung über die deutsche Literaturindustrie; die Verbitterung stammte von den Ängsten durch die Plagiatsaffäre[5]; die Ängste rührten von dem her, was zwanzig Jahre zuvor geschehen war: Wie hätte man all dies klinisch diagnostizieren können?« Ohne Zweifel erschütterten die Vorwürfe von Claire Goll Celan »in seinen Grundfesten, der erste Klinikaufenthalt ist nicht zuletzt in diesem Zusammenhang zu sehen« (H22). Wie sehr Celan durch diese Anschuldigungen verletzt war, hat Yves Bonnefoy beschrieben: »Celan [brach] eines Abends in Tränen aus […], als er an Claire Golls Plagiatskampagne dachte.«[6] (Felstiner 2000, 260)
Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn Felstiner (2000, 294) schreibt, »Celans Zeilen trennen die Psyche von der Wissenschaft von ihr, da Kafka daran zweifelte, dass spirituelles Elend heilbar sei«, dann zeigt er mit Phrasen wie »spirituelles Elend« völliges Unverständnis für die Realität der Psychose. Allerdings sind Psychosen nicht »heilbar«, auch wenn eine medikamentöse Behandlung heute weitgehend möglich ist. Die Depression verdüstert für den, der sie erfährt, die ganze Welt; er ist in ein dunkles Loch versunken und um ihn her ist alles schwarz. Er ist unfähig, die kleinste Entscheidung zu treffen (Martin 2009, 102). Die gedämpften und geschwärzten Emotionen in einer Depression sind ein häufiges Thema der Lyrik Celans.
Wenn man daran geht, ein so traumatisches Thema zu bearbeiten – wie den »Wahnsinn« eines Dichters, Celans Psychose und deren Auswirkungen auf seine Dichtung –, dann tut man gut, sich die Aussage seiner Frau zu Herzen zu nehmen. Aber auch Celans Aussage über seine Kritiker: »Sie haben dich alle gelesen, jetzt tinten / sie dran« (G519).[7] In dem Gedicht Bei Wein und Verlorenheit (G126) schreibt Celan über die Reaktion seiner Leser und Kritiker: »Sie [die Menschen] duckten sich, wenn / sie uns über sich hörten, sie / schrieben, sie / logen unser Gewieher / um in eine / ihrer bebilderten Sprachen.«[8] Besonders problematisch ist es natürlich, Celans Lyrik mit einer Psychose in Zusammenhang zu bringen. Er selbst hat sich gegen eine solche Interpretation aus guten Gründen immer gewehrt – nicht nur wegen der vielen Vorurteile, die auch heute noch gang und gäbe sind, sondern auch weil »Geisteskranke« während der Nazizeit sterilisiert und ermordet wurden. In vielen Provinzen in China werden Psychotiker immer noch sterilisiert.
Man denke auch an die Aussage des rumänischen Lyrikers Ion Caraion (1970, 20) (der die ersten drei Gedichte Celans in AGORA veröffentlichte): »unersättlich drang er krampfhaft in mich, die Äußerungen derer, die vor allen Dingen einen großen Kranken in ihm sahen, in Zweifel zu stellen. Das Gegenteil war wahr, ich verdächtigte ihn einer von ihm ignorierten Gesundheit, der er, indem er sie grotesk auslegte, kunstvoll nachstellte.« Nach dem Tod Celans meinte er dann aber: »Der Irrtum lag bei mir.« (Zit. Meinecke 1970, 300) Er hatte recht, aber nicht nur, indem er einen Irrtum eingestand, auch in dem, was er über Celans Gesundheit sagte. Beides stimmt, denn so einfach sind Krankheit und Gesundheit bei dem, woran Celan litt, nicht auseinanderzuhalten. Am 23.8.1965 notiert Gisèle sich über Celans Zustand: »Mischung aus Weisheit und Irrsinn, Synthese des Gegensätzlichen. Konvulsionen der Leidenschaft –« (PC/GCL 2, 210) Sie hat immer versucht, sich so weit sie konnte verständnisvoll in ihn einzufühlen, auch wenn das manchmal sehr schwer war und ihre Kräfte überstieg: »Nichts von dem, was Dir geschieht, ist mir fremd«, schreibt Gisèle am 13. Februar 1966. Auch der Interpret kann das, was sich in Paul Celan abspielt, nicht als ein »Anderes« und »Fremdes« von sich entfernen. Eben den Abstand zu diesem »Anderen« und »Fremden« missbrauchte aber die Menschheit um zu definieren, wer im vollen Sinn »menschlich« war und wer nicht. Foucault (1997, 98ff.) hat gezeigt, wie die westliche Kultur den Wahnsinn als Gegenteil der Ratio beschrieben hat und dass das den Wahnsinn zu einem erschreckenden Phänomen gemacht hat – zu der tiefsten Angst, dass man wie der »Andere« werden könnte, dem die Vernunft genommen wurde. Er hatte gehofft, dass die westliche Kultur sich eines Tages anders definieren könnte.
»Kein Dichter ist ohne einen gewissen Wahnsinn zu denken«
Extreme Zustände wie eine Manie faszinieren uns und ziehen uns an, aber sie beunruhigen und erschrecken uns auch (Martin 2009, 4). Es ist vor allem der Exzess, der die Manie gegenüber der »normalen« Überschwänglichkeit kennzeichnet (Martin 2009, 199). Dass leidenschaftliche Stimmungen, ein zerbrochener Verstand und ein künstlerisches Temperament in einen ausgezeichneten und kreativen Wahnsinn verschweißt werden können, bleibt eine heftig umstrittene Auffassung. Die meisten finden den Gedanken, dass eine destruktive, oft psychotische und oft tödliche Krankheit wie eine manisch-depressive Psychose auch Vorteile haben könnte, gegenintuitiv (Jamison 1993, 3). Oder sie finden die Vorstellung, dass eine Krankheit einen Nutzen hat, dass die Irrationalität, der Un-Sinn, das Verrückt-Sein notwendig für die Gesundheit ist, selbst ver-rückt. (Duerr 1985, 198) Viele wehren sich auch dagegen, Künstler unter dem Aspekt ihres »Wahnsinns« zu diskutieren, weil sie der Auffassung sind, dass sie das verkleinert und das Künstlertum in ihnen erniedrigt. (Jamison 1993, 259) Ingeborg Bachmann (2010, 4/359) hat aus eigener Erfahrung und als Psychologin über den »Wahnsinn« als Krankheit im Zusammenhang mit dem Selbstmord von Sylvia Plath gesagt: »Nichts ist poetisch an [der] Krankheit, und die großen Kranken von Dostojewski bis Sylvia Plath wissen es, die Krankheit ist das schlechthin Entsetzliche, es ist etwas mit tödlichem Ausgang.«
Die Angst vor dem Wahnsinn ist der Schrecken, in das Auge einer geisteskranken Person zu schauen und dort keine verstehende Antwort zu entdecken. Der Wahnsinn der Depression ist der Abstieg in eine Dunkelheit und ein erschreckender Verlust von geistiger Klarheit. (Martin 2009, 8) Manchmal ist eine manisch-depressive Psychose eine berauschende und unglaublich kreative Erfahrung, doch meist eine sehr destruktive Kraft. Die melancholische (depressive) Seite der Krankheit ist die Quelle von unerträglichem Leiden, seelischer Zerstörung und sogar Tod. Die Manie in ihrer extremen Form kann nicht weniger gefährlich, gewalttätig, psychotisch und lebensgefährlich sein. Und dennoch gibt es wissenschaftliche und biografische Belege, die die manisch-depressive Krankheit mit dem künstlerischen Temperament verbinden (Jamison 1993, 240).
Der Psychoanalytiker Albert Rothenberg hat sich allerdings sehr kritisch über Studien geäußert, die einen Zusammenhang zwischen künstlerischer Kreativität und einer Psychopathologie behaupten. Auch Joyce Carol Oates hat sich entschieden gegen das Stereotyp des »verrückten« Künstlers gewehrt. Louis Sass stellt den Zusammenhang zwischen Manie und Kreativität ebenfalls in Frage und behauptet aber andererseits, dass die Schizophrenie zu einer noch fundamentaleren Form der Kreativität führe (Martin 2009, 201). Dem widersprechen allerdings alle vorhandenen historischen, biografischen und wissenschaftlichen Zeugnisse. (Jamison 1993, 299)
Künstlerische Arbeiten, die von einer milden oder sogar einer psychotischen Manie inspiriert worden sind, werden oft überarbeitet und editiert, wenn der Künstler sich in einer Depression befindet, oder in eine endgültige Form gebracht, wenn er oder sie völlig ›normal‹ ist. (Jamison 1993, 6) Jamison (1993, 154) erinnert daran, dass z. B. Byron, der auch manisch-depressiv war, die meiste Zeit seines Lebens »klinisch normal« war, wie das für die manisch-depressive Krankheit charakteristisch ist. Diejenigen, die Künstler und Schriftsteller gegen den »Vorwurf« verteidigen, »verrückt« gewesen zu sein, sind meist der Auffassung, dass »verrückt« gleich moralisch oder ästhetisch »schlecht« ist, und dass »Verrücktheit« ein Zustand ohne Veränderungen und ohne Zeiten eines durchaus rationalen Denkvermögens ist (vgl. Jamison 1993, 92).
So wie Rilke seine Elegien und die Sonette an Orpheus wie unter einem »Diktat« empfing, so glaubte auch Celan an den schöpferischen Augenblick, die Atemwende, in der ein Gedicht entstand, die selbst ein Gedicht ist: »Vielleicht ist es kein Zufall, dass Celans Definition von der Dichtung als einer Atemwende an Rilkes Gedicht Atmen, du unsichtbares Gedicht erinnert.« (Lyon 1987, 202; Horn, A. u. P. 2010, 223ff.) Manche Künstler, wie beispielsweise Munch, nehmen sogar die negativen Seiten und das Leiden der Krankheit in Kauf, denn, so meinen sie, eine Heilung würde ihre Kunst zerstören. Allerdings sollte man diesen »Wahnsinn« auch nicht romantisieren (Jamison 1993, 241 u. 257). Die meisten, die an dieser Krankheit leiden, sind nicht besonders kreativ und haben von der Krankheit kaum Vorteile. Niemand argumentiert umgekehrt, dass alle Schriftsteller und Künstler »verrückt« sind, und selbst diejenigen, die an manisch-depressiver Krankheit litten, waren nicht durchweg und die ganze Zeit über krank. Aber es gibt eine Überschneidung zwischen dem künstlerischen Temperament und den Manisch-Depressiven (Jamison 1993, 90f.). Vor allem kann der schöpferische Ausdruck des Leidens ein Mittel sein, den Schmerzen zu entgehen (Jamison 1993, 123). Im Gegensatz zu Schizophrenie oder Alzheimer ist die manisch-depressive Krankheit keine Demenzkrankheit (vgl. Jamison 1993, 96); allerdings kann sich die manisch-depressive Krankheit oder eine zyklische Depression über die Zeit verschlimmern, wenn sie nicht behandelt wird oder wenn sie, wie augenscheinlich bei Celan, nicht adäquat behandelt wird. In diesem Fall kommen dann Manien, Depressionen und gemischte Zustände häufiger vor, sind intensiver oder dauern länger. (Jamison 1993, 155) Außerdem sind unbehandelte manisch-depressive Krankheiten eine schwere menschliche Belastung für Familie und Freunde, und so kam es nicht nur wegen seiner Beziehung zu Ingeborg Bachmann immer wieder vor allem wegen seiner manischen und depressiven Zustände zu einer Ehekrise in seiner Beziehung zu Gisèle (PC/GCL 2, 99ff.). Über alle Ehekrisen hinweg erinnert Celan seine Frau an »Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehn, / das wir gelesen haben« (in Georg Heyms Umbra vitae).[9] Das war vor vielen Jahren, und dazwischen liegen »Die Jahre, die Worte seither«. Aber Celan beschwört die einstige Gemeinsamkeit: »Wir sind es noch immer.« Der leitmotivisch gebrauchte Vers »Wir sind es noch immer« aus Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehen (G125), einem Gedicht des Bandes Die Niemandsrose, steht daher als verbindendes Wort über der gesamten Korrespondenz von Paul Celan und seiner Frau. Tröstend erinnert er sie: »Weißt du, der Raum ist unendlich«, aber wir Menschen sind nur endlich. Deshalb »weißt du, du brauchst nicht zu fliegen«, aber »weißt du, was sich in dein Aug schrieb«, in das Auge einer Künstlerin, die das in ein visuelles Kunstwerk umschafft, das »vertieft uns die Tiefe«. Der »Rundstern« [Judenstern] ist »herum- / gesteuert« und »pflichtet uns bei«. Immer wieder erscheint bei Celan die Tiefe und die Metapher des Grabens, des Hinabtauchens in den anderen. Schon in Edgar Jené und der Traum vom Traume (GW 3, 157) schrieb Celan: »alles sei getan wenn die Vernunft in die Tiefe stiege und das Wasser des dunklen Brunnens an die Oberfläche förderte.« Die magische Bedeutung des Wassers ist nicht nur von der christlichen Taufe bekannt, schon das Alte Testament sah den Geist Gottes über dem Wasser schweben, und in der Kabbala gab es Initiationsriten, in denen das Wasser eine wichtige Rolle spielte. (Scholem 1973, 183)
Ein immer wiederkehrendes Motiv ist auch die Blindheit als Zeichen des Dichters. Der im normalen Sinne »blinde« ist der wirklich »sternklare«, wie es in dem Gedicht Dunkles Aug im September (G33) heißt: »der blinden / Freunde des Himmels sternklare Inbrunst / ruft ihn herauf«. Man könnte den »aufgrund dieser Blindheit folgenden Sprachgebrauch als den modernen, auf das Paradoxon gründenden, und damit der zeitgenössischen Wirklichkeit entsprechenden Sprechweise« verstehen (Jackson 1977, 78). Allerdings weist Jackson (1977, 77f.) darauf hin, dass in Tübingen, Jänner (G133) das traditionelle Bild des Dichters, zu dem auch die Hochschätzung des »blinden Sänger« gehört, durchaus auch negativ gesehen wird.
Orakeldeuter, Seher, Dichter, Feldherrn, Staatsmänner
Schon Demokrit aus Abdera schrieb, kein Dichter sei ohne einen gewissen Wahnsinn zu denken. (Diels 1922, 2/66) Unlernbar und unlehrbar seien gerade die höchsten Leistungen der Orakeldeuter, Seher, Dichter, Feldherrn, Staatsmänner (Natorp 1921, 485; Dilthey 1886). Und Platon sagt im Phaidros:»nach dem Zeugnis der Alten [sei] der Wahnsinn edler als die Besonnenheit« (Platon 1940, 2/434). Denn so argumentiert er: »Nun aber werden uns die größten der Güter durch Wahnsinn zuteil, freilich nur einen Wahnsinn, der durch göttliche Gabe gegeben ist. […] Das aber verdient als Zeugnis bemerkt zu werden, dass auch von den Alten die, die die Namen festgesetzt haben, den Wahnsinn weder für schändlich noch für einen Schimpf hielten. Denn nicht würden sie dann die schönste Kunst, durch welche die Zukunft erkannt wird, gerade mit diesem Namen verflechtend Wahnsagekunst(μανικεν) genannt haben; sondern weil sie etwas Schönes ist, wenn sie durch göttliche Schickung entsteht, haben sie es so beliebt und festgesetzt.« (Platon 1940, 2/433)
Und über die Dichter sagt er: »Wenn aber einer ohne diesen Musenwahnsinn zu den Pforten der Dichtkunst kommt, in der Überzeugung, er könne auch wohl durch Kunst ein guter Dichter werden, der wird teils selber als ein Ungeweihter erachtet, teils wird seine Dichtung als die des Besonnenen von der der Wahnsinnigen verdunkelt.« (Platon 1940, 2/434)
Den Dichter kennzeichnet immer schon »ein ekstatischer, den Menschen über alles Irdische, bloß Menschliche mit einem einzigen gewaltsamen Ruck hinwegreißender Wahn, eine ›Manie‹«. (Natorp 1921, 484f.) Überall verbreitete Erzählungen von Reisen durch Himmel und Hölle sind fast immer als manische Erfahrungen zu verstehen. Auch Aristoteles dachte über die Beziehung von Melancholie, Wahnsinn und Kreativität nach. Und noch zu Ciceros Zeiten hieß dichterische Begeisterung: furor poeticus. Lange Zeit und zum Teil bis heute ist allerdings die Vorstellung von »Wahnsinn« von dem geprägt, was etwa Aristoteles in der Nikomachischen Ethik als Beispiel anführt, wo er von einem Menschen schreibt, »der seine Mutter als Opfer schlachtete und aufaß, oder bei dem anderen, der die Leber seines Mitsklaven verschlang«. (Aristoteles 1909, 150)
Diese Auffassungen über den dichterischen Wahnsinn wirken bis ins 20. Jahrhundert weiter. Robert Burton schrieb im 17. Jahrhundert, dass alle Dichter verrückt sind. Eduard Hartmann (o. J., 1/239ff.) schreibt in der Philosophie des Unbewussten: »In neuerer Zeit hat besonders Shaftesbury auf die grundlegende Bedeutung des Enthusiasmus für die Entstehung alles Wahren, Großen und Schönen mit Nachdruck hingewiesen.« Dort wo »noch Alles mit bewusster Wahl gemacht« wird, »fehlt der göttliche Wahnsinn, der belebende Hauch des Unbewussten, der dem Bewusstsein als höhere unerklärliche Eingebung erscheint«, meint auch Hartmann. Der Dichter muss die Inspiration »als Thatsache erkennen …, ohne je ihr Wie enträthseln zu können: die bewusste Combination lässt sich durch Anstrengung des bewussten Willens, durch Fleiss und Ausdauer und dadurch gewonnene Uebung mit der Zeit erzwingen, die Conception des Genies ist eine willenlose leidende Empfängniss, sie kommt ihm beim angestrengtesten Suchen gerade nicht, sondern ganz unvermuthet wie vom Himmel gefallen«. Besonders die Moderne ist »gerade auf ihrem Haupt- und Königsweg im Kern schizophren« (Nau 2003, 449), wobei »schizophren« in diesem Satz eher metaphorisch als klinisch genau gemeint ist. Das »Verrückte« als Kennzeichen der modernen Kunst spielt schon im Symbolismus eine zentrale Rolle. Rey (1970, 753) macht in diesem Zusammenhang auf die Verwandtschaft zwischen Celans Poetologie und der Kunstauffassung der französischen Symbolisten und ihrer deutschen Nachfolger aufmerksam.[10] Problematisch ist trotzdem der von Cesare Lombroso (auch von Gottfried Benn) postulierte Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn, der sich in der Popularpsychologie bis heute hält. Ganz zu Recht sagt Jaspers über Psychose und Kunstschaffen (31950, 101): »Zunächst gilt abstrakt, dass der Wert eines Geschaffenen allein aus dem Gehalt des geistig Hervorgebrachten zu sehen und zu beurteilen ist: die Kausalität, unter deren Einfluss etwas entsteht, besagt nichts über den Wert des Entstandenen.«
Noch problematischer allerdings ist die in der katholischen Kirche praktizierte Gleichsetzung von »Superbia« (Stolz, Eitelkeit, Hochmut, Arroganz), »Ira« (Zorn, Wut) und »Luxuria« (Wollust, Unkeuschheit), die zu den sieben Hauptlastern oder »Wurzelsünden« oder Todsünden zählten, mit manischen Psychosen, oder die Verurteilung der »Melancolia« als »Acedia« (Faulheit, Trägheit, Trägheit des Herzens). Symptome der Manie und der Depression wurden hier als Wurzelsünde eingestuft. Noch schlimmer ist die Auffassung, die moderne Kunst sei geisteskrank, wie es »die nationalsozialistische Propaganda gegen die ›entartete Kunst‹ tat« (Nau 2003, 450). In der Zeit des Nationalsozialismus trugen prominente deutsche Psychiater außerdem zur »Vernichtung unwerten Lebens« bei. Nicht wenige stießen diese Entwicklung sogar an und brachten sie vorwärts. Manisch-Depressive (»zirkulär Irre«) wurden als »erbkrank« eingestuft, zwangssterilisiert oder – dann mit der Diagnose »Schizophrenie« – in den Vergasungs-Anstalten der »Aktion T4« ermordet. Auch in Teilen der USA wurden Manisch-Depressive zwangssterilisiert (Jamison 1993, 8). Dafür gab es in den USA ein Committee on Heredity and Genetics (Jamison 1993, 214).
Viele Menschen wehren sich gegen eine Diagnose einer Geisteskrankheit – auch Celan hat sich sein Leben lang dagegen gewehrt –, weil dem so Diagnostizierten in unserer Gesellschaft wesentliche Aspekte des Personseins abgesprochen werden und sie nicht als autonome Personen gesehen werden, die ihren Körper, ihre Fähigkeiten und ihren Besitz durch ihren Willen kontrollieren können. Im 18. Jahrhundert wurden die »Verrückten« als wenig mehr als unvernünftige Tiere gesehen, und auch heute noch disqualifiziert eine Diagnose einer Psychose den so Diagnostizierten von vielen Berufen (Martin 2009, 86f.). Es ist verständlich, dass angesichts der massiven Vorurteile, die immer noch in weiten Kreisen der Bevölkerung gegen sogenannte »Geisteskranke« herrschen, die Beschreibung eines Dichters wie Celan als »bipolar« zu durchaus falschen Folgerungen führen kann. Dennoch kann man Celans Werk ohne ein Verständnis seiner Krankheit nicht richtig lesen.
»Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich.« – Die manisch-depressive Krankheit
Man muss sich immer daran erinnern, dass jede Diagnose, selbst wenn sie uns bekannt wäre, immer nur eine Beschreibung eines Menschen unter vielen ist (Martin 2009, 10). Ohne Zweifel enthalten Beschreibungen wie »manisch-depressiv« immer schon kulturelle Voraussetzungen und Annahmen. Vor allem muss man sich davor hüten, die manische Depression als beständig und als ein Ding zu sehen. Es gibt kein Ding Manie oder Depression außerhalb eines bestimmten kulturellen Kontextes. Manische Zustände und die Weise, in der sie erfahren und betrachtet werden, sind nicht ein für allemal festzumachen. Das hängt davon ab, wem das geschieht, in welchem Kontext und in der Gegenwart welcher anderer Menschen. Die Manie ist eine Erfahrung, die wie jede andere menschliche Erfahrung durch ihre geschichtlich spezifische soziale Imagination bestimmt ist. Zu fragen ist z. B., ob das Verhalten von Menschen, bevor die Kategorie »manisch-depressiv« existierte, als Zeugnis dafür genommen werden kann, dass sie »manisch-depressiv« waren. Kann man daher sagen, dass Kleist »manisch-depressiv« war? (Vgl. Horn 2009) Haben Schumann oder van Gogh ihr Leben als »manisch-depressiv« erfahren, oder haben sie ihre Erfahrungen in Kategorien gedeutet, die ihr kulturelles Umfeld ihnen an die Hand gab, z. B. als »melancholia« oder »Wahnsinn«? (Martin 2009, 231)
Die heutige Definition der bipolaren Krankheit stammt erst aus dem Jahr 1974, als man in Amerika versuchte, präzise definierte, symptomatische Beschreibungen psychischer Krankheiten zu erstellen (die DSM Kategorien), auch wenn schon Emil Kraepelin im 19. Jahrhundert von einem »manisch-depressiven Wahnsinn« sprach. Erst 1980 entstand die überarbeitete neue Liste psychischer Krankheiten, die im Wesentlichen heute noch gültig ist (DSM-III). Nicht einmal für einen Psychiater ist eine solche Diagnose immer klar und einfach. Noch ungenauer und unbefriedigender muss jede nachträgliche »Diagnose« aus biografischen Zeugnissen sein.[11] Die tatsächlichen ärztlichen Diagnosen sind, bis auf einige Hinweise in Celans Briefen und denen seiner Frau, nicht bekannt und unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht, und wie treffend sie waren, ist nicht mehr zu beweisen, da die Krankenakten nicht öffentlich zugänglich sind (PC/GCL 2, 29).[12] Was eine Diagnose als manisch-depressiv bedeutet, ist durchaus umstritten und meist nicht mehr als eine kleine Insel der Klarheit in dem Chaos des Lebens des Patienten. Selbst wenn die Diagnose der behandelnden Ärzte zugänglich wäre, wäre sie nicht unbedingt zuverlässig, da die Diagnose und Behandlung von Psychosen sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert haben. Noch in den siebziger Jahren wurden Patienten vor allem in den USA als schizophren diagnostiziert, die nach heutigen europäischen Kriterien eine Depression, Manie, Neurose oder Persönlichkeitsstörung hatten (Nau 2003, 37f.). Jamison (1995, 59) erinnert sich, dass in ihrer klinischen Ausbildung die manisch-depressive Krankheit fast keine Rolle spielte und sie wesentlich psychoanalytisch fundiert war.[13]
Dennoch sind die vorhandenen Zeugnisse (in Briefen z. B.) heranzuziehen, um wenigstens eine annähernde Einsicht zu erhalten. Zum Beispiel berichtet Edith Silbermann: »Paul konnte sehr lustig und ausgelassen sein, aber seine Stimmung schlug jäh um, und dann wurde er entweder grüblerisch, in sich gekehrt oder ironisch, sarkastisch.« (Zit. Böttiger 1996, 27) Manische Menschen, wenn sie in der Hypomanie sind, sind charismatisch, haben eine wundervolle Persönlichkeit, sprudeln über vor Ideen (Martin 2009, 209). In der hypomanischen Phase können sie spontan assoziieren, witzige und brillante Sätze bilden, aber zur selben Zeit konfus denken. Sie können sich gesundheitlich und geistig völlig auf der Höhe fühlen und ihre Fähigkeiten für außerordentlich halten. In der Depression dagegen sind ihre Gedanken wie paralysiert und unbeweglich. Sie machen widersprüchliche Aussagen, können Worte nicht finden, Sätze nicht korrekt formen. (Martin 2009, 293)
Die genaue Form der Psychose Celans kann man aus verschiedenen Hinweisen nur erraten, doch deutet vieles auf eine bipolare Krankheit hin.[14] Trotz der Schwierigkeit, eine Diagnose aus biografischen Material zu erstellen, sind die beschriebenen Symptome doch sehr deutlich: starke Veränderungen in der Stimmung, Energie, Schlafbedürfnis, Denken und Verhalten, versuchter und durchgeführter Selbstmord (70–90% aller Selbstmorde sind mit manisch-depressiver oder depressiver Krankheit assoziiert). (Jamison 1993, 58) Die Entstehung einer bipolaren Störung ist höchstwahrscheinlich multifaktoriell bedingt. Sowohl genetische Faktoren als auch psychosoziale Auslöser dürften eine Rolle spielen, d. h. das Erbgut setzt einen Rahmen für die Erkrankungswahrscheinlichkeit (Prädisposition, Vulnerabilität) und die Umfeldfaktoren beeinflussen Entstehung, Verlauf und Ende der Erkrankung. Eine Depression wird physiologisch durch einen Mangel der Neurotransmitter Noradrenalin und Serotonin begünstigt. Inzwischen gilt eine Störung des gesamten Gleichgewichts verschiedener Transmitter als Ursache depressiver Phasen. Außerdem ist bei Depressiven die Empfindlichkeit und Dichte der Rezeptoren, auf die die Neurotransmitter einwirken, verändert. Eine Manie wird von einer erhöhten Konzentration der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin hervorgerufen. Manische oder depressive Episoden treten häufig, aber nicht ausschließlich nach einem belastenden Lebensereignis auf. Es gibt eine Rückkoppelung zwischen den Erlebnissen und dem Handeln einer Person auf der einen Seite und seiner Genetik, seiner Biochemie und der Symptomatik auf der anderen Seite. Es ist ohne Zweifel so, dass eine Depression (oder auch eine Manie) durch »Ängste« und »Verbitterung« ausgelöst werden kann,[15] dass aber die Psychose andere Ursachen als »psychologische« hat.
Die Bipolare affektive Störung (auch bekannt unter der Bezeichnung »manisch-depressive Erkrankung«) ist eine psychische Störung und gehört zu den Affektstörungen. Es handelt sich um eine ernsthafte Erkrankung des Gehirns, die u. a. wegen des erhöhten Suizidrisikos, der Gewaltbereitschaft und der sozialen Folgen gefährlich werden kann. Die Symptome korrespondieren mit einer Störung des Hirnstoffwechsels, die sich psychisch manifestiert. Die Krankheit hängt nach neueren Einsichten mit molekularen Mechanismen bei den Rezeptoren und Neurotransmittern im Gehirn zusammen (Martin 2009, 25). Sie zeigt sich bei den Betroffenen durch episodische, willentlich nicht kontrollierbare und extreme Auslenkungen des Antriebs, der Aktivität und der Stimmung, die weit außerhalb des Normalniveaus in Richtung Depression oder Manie schwanken. Manisch-depressive oder bipolare Krankheiten umfassen ein weites Spektrum von Stimmungs-Krankheiten oder Temperamenten (Jamison 1993, 13).[16] Manie, obwohl im Allgemeinen freudig erregt, selbstsicher oder grandios, ist oft durchsetzt mit Depression, Panik und äußerster Gereiztheit (Jamison 1993, 28). Eine Zeit lang ist das, was der Patient sagt, noch kohärent, seine Sätze bedeuten etwas, auch wenn vieles davon verrückt klingt. Schließlich wird es völlig inkohärent, ein wildes Durcheinander von Worten. Dabei kommt es oft zu frenetischen, scheinbar ziellosen und gewalttätigen Handlungen. Bizarre, getriebene, paranoide und impulsive Verhaltensweisen sind häufig zu beobachten (Jamison 1993, 30f.).
Die Bipolare Störung wird oft mit Kreativität in Verbindung gebracht, zu den Betroffenen zählen viele erfolgreiche Menschen. Der gesteigerte Antrieb in hypomanen Phasen kann für ungewöhnliche und gewagte Projekte begeistern und Ziele werden oft mit großem Engagement verfolgt. Eine »Romantisierung« der Krankheit ist aber unangebracht, da ihre Folgen oft sehr schwerwiegend sind – vor allem, wenn sie nicht oder nicht richtig behandelt wird. Nur ein geringer Teil aller bipolar Erkrankten wird derzeit korrekt diagnostiziert. Psychotische Symptome, die bei schweren Manien auf deren Höhepunkt vorkommen können, führen oft zur Fehldiagnose einer Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Störung.[17]
Jamison (1993, 107) berichtet, dass manische Patienten dazu neigen, ausgesprochen kombinatorisches Denken zu zeigen. Ihre Sprache ist durch ein Verschmelzen von nicht zueinander passenden Wahrnehmungen, Ideen oder Bildern gekennzeichnet. Die Ideen werden locker miteinander verknüpft, extravagant miteinander verbunden und ausgearbeitet. Sie benutzen vage und entfernt miteinander verwandte Begriffe als Kategorien und Prinzipien. Im Meridian zitiert Celan ein Beispiel eines solchen Denkens aus Büchners Lenz – Lenz, der ebenfalls an manisch-depressiver Krankheit litt: »nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte«. Und Celan fügt dem in derselben Denkweise hinzu: »Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, – wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich.« (M141) Zu Recht sagt daher Buhr (1976, 59), dass derjenige, der nicht auf dem Kopf gehen will, Celans Lyrik »dunkel« finden wird. Buhr (1976, 61) stellt daher die Frage, ob nicht alles, was Celan gesagt hat, »selbstentworfene Dunkelheiten und Verfinsterungen eines selbstentfremdeten Menschen« sei, und die Stelle aus Büchners Erzählung der Ausdruck »eines verwirrten, vielleicht schon krankhaften Seelen- und Geisteszustands eine Menschen sei«, der schließlich »in geistiger Umnachtung zugrunde gegangen ist«.
Wegen der vielen Missverständnisse ist es nötig, über Begriffe wie Wahnsinn, verrückt, manisch usw. nachzudenken. Aber politische Korrektheit ist nicht immer hilfreich. Kay Redfield Jamison (1995, 5), eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der manisch-depressiven Krankheiten und selbst ein Opfer dieser Krankheit, hat nachgewiesen, dass viele unter den Manisch-Depressiven die kreativsten und begabtesten Künstler und Wissenschaftler waren.[18] Sie sagt, die Krankheit ist zwar biologischen Ursprungs, aber man erlebt sie als psychologische Erfahrung. Die Krankheit ist einzigartig in der Hinsicht, dass sie Vorteile und Freude bringt, aber auch beinahe unerträgliches Leiden und nicht selten zum Selbstmord führt. (Jamison 1995, 6) Sie ist äußerst skeptisch, ob jemand, der diese Krankheit nicht selbst gehabt hat, sie jemals verstehen kann. Es ist keine Krankheit, in die man sich leicht einfühlen kann, und viele finden sie erschreckend. (Jamison 1995, 174) Kay Redfield Jamison (1995, 6) sagt (aus eigener Erfahrung), dass das Problem bei der manisch-depressiven Krankheit nicht darin liege, dass es keine Medikamente gäbe, um diese Krankheit zu behandeln, sondern dass Kranke sich oft weigern, diese Medikamente zu nehmen, ja dass viele sich weigern, sich überhaupt behandeln zu lassen.
Die manisch-depressive Krankheit verzerrt die Stimmungen und Gedanken, verursacht schreckliches Verhalten, zerstört die Basis des rationalen Denkens und untergräbt oft den Wunsch und den Willen zu leben. In den depressiven Phasen einer bipolaren affektiven Störung dominiert das Krankheitsbild der Depression mit gedrückter Stimmung und starker Hoffnungslosigkeit. Es fehlt jeder Antrieb, sich aufzuraffen. Die Betroffenen beschreiben sich selbst als freudlos. Sie leiden unter Schlafstörungen, vor allem unter Durchschlafstörungen in der zweiten Nachthälfte. Der Appetit nimmt ab, viele bemerken einen deutlichen Gewichtsverlust. Die Mimik im Gesicht ist starr und ausdruckslos. Depressive sprechen meist leise und die Antworten kommen verzögert. Sie leiden unter fehlendem Selbstbewusstsein und Selbstvorwürfen. Ihre Gedanken kreisen oft zwanghaft um Tod und Selbsttötung. Auch bei Celan gibt es neben Zeiten der Paranoia und Manie immer wieder dunkelste Depressionen, die sich in seinen Gedichten auch niederschlagen: »Hier – das meint hier, wo die Kirschblüte schwärzer sein will als dort.« Ursprünglich als Hiroshimagedicht geplant (Allemann 1987, 15), ist es nun ein Zeugnis auch der Schwärze der Depression. Eine der Erfahrungen des Depressiven ist: »und sie liebten mich nicht und ich liebte sie nicht, denn ich war einer, und wer will Einen lieben, und sie waren viele …« (Gespräch im Gebirg)
In den manischen Perioden ist die Ausrichtung des Krankheitsbildes genau entgegengesetzt. Der Betroffene hat Lebenskraft und das Bedürfnis, etwas zu tun. Die wichtigsten Symptome sind gehobene Stimmung, Aggression, Reizbarkeit (Irritabilität), stark gesteigerter Antrieb und Energie. Das Schlafbedürfnis ist vermindert, die Erkrankten fühlen sich trotzdem frisch. Symptomatisch ist auch ein gesteigerter Rededrang: Die Stimme ist kräftiger und man spricht schneller als sonst. In der Manie zeigen sich oft mangelnde Sensibilität für die Bedürfnisse und Gefühle der unmittelbaren Mitmenschen. Maniker berichten über gesteigerte Sinneswahrnehmungen, seltener auch über Halluzinationen. Franz Wurm berichtet, dass Celan eine allgegenwärtige Empfindlichkeit für Gefahren ringsum gehabt habe (Böttiger 1996, 133). Meist fehlt ihnen in der manischen Phase jede Krankheitseinsicht. Bezeichnend sind ein hemmungsloses und unkritisches Verhalten, gesteigerte Impulsivität und Spontaneität. Dies kann sich z. B. durch einen Kaufrausch bemerkbar machen. Typisch ist dabei eine Selbstüberschätzung, Größenwahn und Leichtsinnigkeit. In der Manie beobachtet man auch oft eine Änderung des Geschmacks: Maniker tragen bunte, schreiende Farben, sehr oft rot. Erhöhtes Selbstbewusstsein und eine niedrige Hemmschwelle sind weiterhin bezeichnend. Jean Bollack berichtet aufgrund einer Notiz seiner Frau von dem folgenden Vorfall: »Eines Abends in der Dordogne, wo die Gestalten und die Erinnerung Hölderlins ihn beschäftigten, sagte er: ›je suis la poésie‹. An jenem Abend war er aufgewühlt (an den übrigen Tagen eher verschlossen und ausweichend).« (Böttiger 1996, 129f.) In der akuten Manie ist ein weitergehender psychotherapeutischer Ansatz, schon aufgrund des Mangels an Einsicht und des erhöhten Selbstwertgefühls der Patienten, nicht möglich. Nach Abklingen der manischen Phase brauchen jedoch die meisten Betroffenen therapeutischen Beistand um mit den Krankheitsfolgen fertig zu werden.
Lithium wird bereits seit der Mitte des 20. Jahrhunderts als Medikament in der Psychiatrie eingesetzt und ist deshalb in der Anwendung sehr gut erforscht. Bei affektiven Störungen wie der Bipolaren Erkrankung oder Depressionen ist die Lithiumtherapie eine der wenigen medikamentösen Behandlungen, für die eine suizidverhütende Wirkung eindeutig nachgewiesen ist.[19] Aus den vorliegenden Berichten geht nicht hervor, dass Celan Lithium erhalten hat, wahrscheinlich, weil das sehr wirksame Medikament damals in Frankreich noch nicht allgemein gebräuchlich war.
Über die Behandlung von Celans Krankheit wissen wir nur wenig. Am 23.12.1963 schickt Gisèle ihm 4 Tabletten Imménoctal (ein Barbiturat, Secobarbital). Am 7.5.1966 berichtet Celan, er habe mit Hilfe von Chloral (Chloralhydrad, zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen), dann mit Imménoctal ein wenig schlafen können aber nicht ausreichend, und dass er nächste Nacht Théralène (Schlafmittel, Sedativ, Alimemazin) bekommen würde. Vom 2.5.1966 bis 8.6.1966 sollte Celan mit der Insulintherapie nach Sakel behandelt werden. (PC/GCL 2, 272) Dr. Sakel war der Erfinder der Insulin-Koma-Therapie für Schizophrenie und andere Psychosen (1927). Er stellte fest, dass ein Insulin-induziertes Koma und Konvulsionen aufgrund eines niedrigen Glukosespiegels den psychischen Status von Psychotikern zum Teil dramatisch verbessern konnten. Bei bis zu 88% seiner Patienten besserte sich der Zustand. Heute wird diese Therapie nicht mehr angewendet. Celan berichtet: »Heute morgen die Spritze, die mich ein wenig matt gemacht hat.« (9.5.1966 PC/GCL 1, 398) Am 22. Mai 1966 berichtet er, er sei erst bei seiner 16. Spritze. (PC/GCL 1, 402). Am 24. Mai 1966 berichtet er: sein Nachbar bekomme die »komatöse Schockbehandlung« (ziemlich schlimm anzusehen), während es bei ihm nur die »feuchte Schockbehandlung« ist. (PC/GCL 1, 404)
Interpretationen ersetzen nie den Text – Psychiatrie und Literaturwissenschaft
Rainer Nägele (1987, 254) macht auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die entstehen, wenn man einen literarischen Text in einen kritisch-wissenschaftlichen »übersetzt«: »die interpretative Übersetzung nimmt meist stillschweigend an, dass sie direkt und eigentlich sagt, was der literarische Text metaphorisch und symbolisch verhüllt. Sie gibt sich selbst den Status des Originals.« »Interpretationen«, vor allem auch psychologische, können daher nur ein Zugang zum Gedicht sein, sie ersetzen aber nie den Text. Im Sinne der Psychoanalyse meint Nägele, dass »jede konkrete Sprache schon Übersetzung« ist. Daher sind »Freuds Traumdeutungen … Übersetzungen in diesem anderen Sinne: Übersetzungen von etwas, das schon Übersetzung ist, weil ›es‹ nie spricht, wo es spricht.« Daraus folgert er: »Poetische Sprache ist an sich dem Original weder näher noch ferner als irgendeine andere Art des Sprechens.« Der Versuch, etwa die »Absicht« oder »Intention« des Dichters zu erfassen, scheitert an der Tatsache, dass man auch Worte ohne »Absicht« sprechen kann, und dass die vom Leser erratene Absicht immer eine Konstruktion des Lesens ist. Als solche wird sie hier auch verstanden. Vor allem, da Celans Sprache von einer Einmaligkeit ist, für die es keine angemessene gesellschaftliche Übereinkunft gibt: Das Gedicht ist »gestaltgewordene Sprache eines Einzelnen« (M144) und »Es spricht immer nur in seiner eigenen, allereigensten Sache«. (M142) Aber Einzigartigkeit ist Einsamkeit und oft Unverständlichkeit, und daher zeigt das Celansche Gedicht »eine starke Neigung zum Verstummen« (M143). Wenn Lesbarkeit in der Wiederholbarkeit der Zeichen besteht, wie Derrida (2008, 80) meint, dann ist das Unwiederholbare der Lyrik eben gerade nicht kommunizierbar. Die Frage ist daher: Wie also kann das Einzigartige, das Unveräußerliche zu einem Anderen sprechen? Und verschärft sich die Unverständlichkeit, wenn der Dichter bipolar ist?
Man kann eine Psychose wie die Bipolare Erkrankung als Krankheit und als Textstruktur verstehen (vgl. Nau 2003, 457). Es soll daher hier nicht in erster Linie um die Hirnphysiologie und Biochemie gehen, die eine Ursache der Psychosen sind (vgl. Häfner 2000), als vielmehr um das, was durch sie bewirkt wird. Wie erfährt ein Patient diese Krankheit, wie schildert er sein subjektives Erleben, welche Folgen hat das für seine Dichtung?[20] Inzwischen gibt es eine Reihe von Studien über »psychotische« Dichter, die versuchen, den jeweils neuesten Stand der Psychiatrie einzuarbeiten. Dazu gehört auch die Dissertation von Anne-Christin Nau (2003; vgl. Horn 2003), die sich umfangreiche Gedanken darüber macht, wie z. B. »Schizophrenie« (oft eine falsch diagnostizierte manisch-depressive Psychose) als Interpretationsansatz in der Literaturwissenschaft fruchtbar gemacht werden kann. Sie ist sich auch durchaus der Schwierigkeiten bewusst, die sich bei einem Versuch ergeben, eine Psychose gewissermaßen aus literarischen Texten und historischen Zeugnissen zu diagnostizieren. Psychosen sind immer in relativ ›offener‹ Weise zu verstehen und nicht als Etikettierung von Autoren zu verwenden. Zu Recht unterscheidet die Autorin daher zwischen Schizophrenie als Krankheit und als Textfigur (Nau 2003, 457).
Neben genetischen spielen unterschiedliche Faktoren aus dem psychosozialen Umfeld eine große Rolle, z. B. die Lebensgeschichte, traumatische Ereignisse wie bei Celan der Holocaust oder später die Goll-Affäre. Die moderne Forschung hat eine Häufung von »life-events« vor psychotischen Ausbrüchen festgestellt. (Nau 2003, 102ff.) Ciompi (1992, 275) sieht eine Psychose als krisenhafte Störung der Informationsverarbeitung im Sinne der Überforderung eines von vornherein mehr oder weniger labilen affektiv-kognitiven Bezugssystems empfindlicher oder verletzlicher Menschen. Obwohl das eher eine Wirkung der Psychose als die Ursache ist, ist diese Auffassung für die Analyse von Gedichten durchaus produktiv. Unter anderem geht es um folgende Erscheinungen: Bei der Lockerung des Denkzusammenhangs geht die Logik der Gedanken verloren. Das Denken wird sprunghaft, wild, unlogisch, von Assoziationen und dem Klang der Wörter geleitet. Es kommt zu einem Zerfall der Sprache, der Betroffene ist oft nicht fähig, Gefühle des Glücks, des Vergnügens und der Befriedigung zu empfinden. Es kommt einerseits zu einem wilden Gedankendrängen, andererseits zu einem vollständigen Gedankenentzug. Oft kommt es auch zu wahnhaften Zuständen, zu systematisierten oder unzusammenhängenden Wahnideen, zu Verfolgungswahn, Größenwahn und Beziehungswahn. Alles, was geschieht, kann dann eine Beziehung zu dem Patienten haben. Sie beginnen ängstlich zu forschen, was die anderen wohl über sie denken (Nau 2003, 29ff.), was andere über sie reden, sie neigen dazu, alles Gerede und Getuschel auf sich beziehen.[21] Alles, was uns im Normalzustand relativ unberührt ließe und uns objektiv geringfügig erschiene, wird zum Zeichen, zum Omen. Die Welt verwandelt sich in eine rätselhafte Welt, hinter allem verbirgt sich ein Geheimnis. (Duerr 1985, 190) Dabei werden auch die Ich-Identität und Grenzen des Ichs aufgelöst. Wahnbildungen können als Abwehr gegen die schreckliche Angst vor psychischer Desintegration und Kontrollverlust verstanden werden. (Mentzos 1991, 11) Es ist spekuliert worden, dass das Leiden ein Anstoß zur Kreativität ist (Nau 2003, 462) und »dass das Gedicht aus solcher Hinfälligkeit seine Identität gewinnt: Identität angesichts der durchgängigen ›Ungültigkeitssprechung‹ der Zeichen, aus denen es sich fügt«. (Jackson 1977, 78) Es kommt zu Störungen der Ich-Konsistenz und der Ich-Grenzen. Gerade deshalb besteht der Patient darauf: »Ich bin, der ich bin«. »Ich-Grenzstörung bedeutet für manche Menschen aber auch eine Bereicherung der Möglichkeiten des (afferenten) Vernehmens (Sensibilität), feines ›Gespür‹ für die Atmosphäre, Gedanken-Lesen, telepathisch-hellseherische, intuitive Begabung, prophetische Zukunftsschau …« (Scharfetter 1986, 50; Nau 2003, 56).
Die Kreativitätsschübe erfolgen vorwiegend in der hypomanen Phase. Durch moderne Behandlungsmethoden kann die Kreativität meist erhalten bleiben, sodass sie als positiver Aspekt dieser schlimmen und zerstörerischen Krankheit wirken kann. Manisch-depressive[22] Menschen sind in ihrem manisch anmutenden Arbeiten zu Werken fähig, die Menschen ohne manische Erfahrung oftmals für unmöglich halten. Visionen zu verwirklichen setzt in diesem Sinn allgemein einen manischen Antrieb voraus. Nach einer Untersuchung von Kay Redfield Jamison von 1993 beträgt die Häufigkeit bipolarer Erkrankungen bei kreativen Persönlichkeiten das 10-fache der Häufigkeit bei der Allgemeinbevölkerung. Mehr als ein Drittel aller zwischen 1705 und 1805 geborenen englischen und irischen Dichter litten gemäß Jamison an bipolaren Erkrankungen, mehr als die Hälfte an Stimmungsstörungen. (Jamison 1993 u. 1997)
Ganz verborgen blieben Celans psychische Probleme nicht. In seiner Kritik zu Celans Atemwende – »Die Welt, in der nur einer lebt« – schreibt R. Hartung (1967): »So machen nicht wenige Gedichte oder Verse dieses Bandes den Eindruck, als sei alle Energie des Autors aus der Welt zurückgezogen und ganz dem eigenen Inneren zugewendet: Situation einer tiefen Krise, in der man am Allgemeinen und dessen Vernunft kaum mehr partizipiert; Dokumente einer gefährlichen Isolation, in der es nicht nur einsame Siege gibt, sondern in der auch der Wahn gedeiht, den kein freier Blick auf die Welt mehr korrigiert – als hätte sich der Dichter jenseits der Menschenwelt im Weglosen verstiegen.«
In einem ganz privaten Idiom – »Psychose« als Sprachstruktur und Thema in den Texten Paul Celans
»Wenn die Wörter verschwunden sind, bleibt die Grammatik zurück,
und das heißt eine Maschine. Doch was sie bedeutet,
weiß niemand. Eine fremde Sprache.«
(Lars Gustafsson, Die Maschinen, München 1967)
Soziologische, psychoanalytische, literaturtheoretische und andere Methoden sind wegen ihres Reduktionismus kritisiert worden, weil sie die Sprache der Literatur in eine vorgegebene außerliterarische Terminologie übersetzen. (Kudszus 1978, 19) Während z. B. nach Nau (2003, 462) psychopathografische biografische Betrachtungen und eine Einbeziehung des Autors bei der Analyse von Literatur und Kreativität zu vermeiden sind, vertrete ich die Auffassung, dass zu einem Verständnis der Dichtung Celans eine solche Ausblendung seiner Lebenswirklichkeit nicht möglich ist. Böttiger (1996, 159) sagt zu Recht: »Diese biografische Prägung unterscheidet die Dichtung im Sinne Celans von bloßer Artistik«. Dichtung ist, wie Celan gesagt hat, das Einmalige der Sprache. Was immer wieder übersehen wird, ist, dass ich zunächst einmal die Wörter verstehen muss, wenn ich ein Gedicht lese, und das Verständnis der Wörter ist nur möglich innerhalb eines realen Zusammenhangs. Wenn Celan von »Tracht« spricht, dann muss ich wissen, dass es sich bei ihm nicht um Folklore, sondern um Mineralogie handelt, und erst dann kann ich das Wort in seinem Gedichtzusammenhang erschließen.[23] Wenn er von Landwehrkanal spricht und »die Frau / mußte schwimmen, die Sau«, dann verstehe ich das Gedicht nur, wenn ich weiß, dass der Landwehrkanal in Berlin ist und dass die »Sau« die antisemitische und anti-kommunistische Beschimpfung von Rosa Luxemburg durch ihre Mörder ist, die am 15. Januar 1919 aufs Grausamste ermordet und in diesen Kanal geworfen wurde. Gadamer (1973, 128) meint, man muss nichts Privates und Ephemeres wissen. Doch Celans Gedichte sind tief in diesem Privaten verwurzelt und ohne eine solche Kenntnis oft nicht verständlich, und es bleibt dann bei unverbindlichen Assoziationen des Interpreten. Daher muss ich in seinem Wortgebrauch auch immer seine psychischen Erfahrungen mitdenken.
Dabei teile ich nicht ganz die Hoffnung George Steiners,[24] dass wir unmittelbar auf die wesentlichen Bedeutungen zugreifen könnten, wenn uns die notwendige biografische Matrix und das Codebuch der persönlichen und literaturhistorischen Anspielungen zugänglich wäre (so notwendig solche Anmerkungen auch sind). Steiner fand aber, dass die Erklärungen derjenigen, die Zugang zu solchen biografischen Fakten hatten, ungemein an Schlüssigkeit gewannen. Viele Dunkelheiten lassen sich immerhin auf diese Weise auflösen.[25] Es ist sicherlich nicht zu kurz gedacht, wenn man Celans gesteigertes Interesse an medizinischem und psychologischem Fachvokabular in seinen Gedichten etwa aus der Zeit der Fadensonnen auch auf seinen Krankheitszustand bezieht; diesen Bezug auszuklammern, hieße die »Vielstelligkeit des Ausdrucks« zu missachten, die für Celans Dichtung konstitutiv ist (H104). Auch Kudszus (1978, 21) fragt, ob man sich der Dichtung ohne eine biografische Argumentation nähern sollte, meint aber, die paradoxen Strukturen der modernen Literatur würden durch eine Analyse, wie sie etwa bei Bateson, Jackson, Haley und Weakland in Toward a Theory of Schizophrenia dargestellt wird, durchaus gewinnen.
Manche der Auffassungen Celans über Dichtung und Kunst lassen sich sowohl als in seiner ihm ganz eigenen Ästhetik verankert lesen, als auch mit seiner Krankheit in Verbindung bringen. Obwohl Celan davon spricht, dass das Gedicht »dialogisch« ist, existiert für ihn »das Andere« nicht. Das Andere muss »durch das oft verzweifelte Gespräch des Gedichtes erst entdeckt, freigesetzt, konstituiert werden, weil es an sich doch nicht existiert. … Aber Celan ist es doch nicht gelungen … einen unbedingten Glauben an das ›Andere‹ aufzubringen. Die Sprache des Gedichts wäre das einzige Mittel, dieses ›Andere‹ zu konstituieren, aber seine Sprachskepsis war zu groß, als dass er die Sprachkunst als die höchste metaphysische Tätigkeit hätte akzeptieren können.« (Lyon 1987, 212)
Hans-Peter Duerr (1985, 180) verweist auf die pyrrhonischen Skeptiker, die in der Unruhe des Geistes eine ständige Belästigung des Friedens ihrer Seele sehen und glauben, dass sie diesem Denken nur dadurch Einhalt gebieten können, dass sie es in ein unlösbares Dilemma, in die Absurdität, ins Paradoxon und vor allem in die Unentscheidbarkeit führen. Aber er meint auch: »Doch die Auflösung des philosophischen, des intellektuellen Zweifels hilft dem Schizophrenen im Gegensatz zum Philosophen nicht allzu viel. Denn der Schizophrene weiß ja oft alles, und nicht selten besser und klarer als der Psychiater.« (183) Duerr (1985, 190) berichtet auch über die Spracherfahrung einer Schizophrenen: »Wenn sie etwa ein Gefäß anschaute, das auf dem Tisch stand, … dann war da kein Gefäß mehr, das dazu dient, mit Wasser oder Milch gefüllt zu werden … Nein! Sie hatten ihren Namen, ihre Funktion, ihre Bedeutung verloren … Ich versuchte, ihrem Zugriff dadurch zu entgehen, dass ich ihren Namen aussprach. Ich sagte: ›Stuhl‹, ›Krug‹, ›Tisch‹ – ›Das ist ein Stuhl‹, doch das Wort war wie abgezogen, jeder Bedeutung entleert, es hatte den Gegenstand verlassen, sich von ihm losgelöst.«[26]
Einige Kritiker glauben daher, dass Celans Dichtung in einem ganz privaten Idiom geschrieben ist, das schließlich im Schweigen enden muss; es sei nicht nur völlig von jedweden Referenten und von allen möglichen Konnotationen abgeschnitten, die die Wörter im Laufe der Geschichte angesammelt haben (vgl. Colin 1987, 157), sondern es bewege sich auch in einem selbstwidersprüchlichen Diskurs. In Sprich auch du (G85) heißt es: »Sprich – / Doch scheide das Nein nicht vom Ja.« Wo das Ja vom Nein nicht mehr geschieden werden kann, kann man eigentlich nur noch paradox oder gar nicht mehr sprechen. Das Paradox verweist auf die Unzulänglichkeit eines naiven Diskurses, der auf dem Prinzip der Identität begründet ist. (Jackson 1987, 220) Kudszus (1978, 19) erinnert an Folgendes: »In der Literatur zu Paul Celan wird immer wieder auf die enigmatischen Qualitäten hingewiesen, die ein Kennzeichen der modernen Literatur sind. Man verweist auf die scheinbar unausschöpfliche Vieldeutigkeit und Negativität.« Celan versuche in einer rätselhaften und verschlüsselten Welt einen Sinn zu finden und fragt sich immer wieder: was meinen die Worte der anderen, welche Botschaft enthalten sie? An bestimmten Stellen verliert er die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, weil die Botschaften der Umwelt unverständlich oder widersprüchlich sind; es handelt sich um eine Welt, die der Kafkas ganz ähnlich ist.
Für Celan ist die metonymisch-assoziative Beziehung fundamental: »die Hand kann die von ihr erzeugte Dichtung bedeuten, die Wimper den Zustand von Schlaf und Traum.« (Böschenstein-Schäfer 1987, 233) So heißt es z. B.: »Stimmen vom Nesselweg her: / Komm auf den Händen zu, uns. / Wer mit der Lampe allein ist, / hat nur die Hand, draus zu lesen.« Die Hand verweist aber auch auf die »Handlung« und die »Behandlung« und im »speeding« der manischen Phase auf die Unmöglichkeit, die Hand und den Körper still zu halten (Martin 2009, 104). Außerdem hält die Hand des Dichters die Feder oder den Stylus und steht daher für seinen unnachahmlichen Stil.
Aber diese Assoziationen sind nicht immer leicht nachzuvollziehen. Beda Allemann (1987, 6 u. 13) beschreibt das Dilemma von Celans Lesern wie folgt: man könne dem Wortlaut nach Alles und zugleich beinahe Nichts verstehen. Es ist – wie jede poetische Sprache – eine Sprache, die wir ohne die Hilfe des Kontexts durch eine Realsituation zu verstehen suchen, und darüber hinaus eine Sprache der Verfremdung innerhalb des poetischen Idioms. Diese Sprache, die gleichzeitig aus Trümmern besteht und doch Poesie ist, wurde oft das »dunkle Gedicht« genannt, »so benannt, nicht nur weil es sich dem Verständnis des Lesers widersetzt, sondern vor allem, weil es die Dunkelheit der Geschichte im Gedächtnis behält«. (Witte 1987, 73) Im Bezug auf die »Fremdheit« notiert sich Celan ein Wort von Valery: »Toute vue de choses qui n’est pas étrange est fausse«. (PC/GCL 2, 287) Er zitiert im Meridian auch ein Motto aus Šestovs Le Pouvoir des Clefs: »Qu’on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession.« (Pascal) (M141)
Eines der vielen Probleme ist es, dass »viele der Wortbildungen, die hier vorkommen, in der Sprache gar nicht existieren«. (Gadamer 1987, 60) Der Gebrauch der Worte »folgt nicht festgewordenen Regeln, nach denen die Ausdrücke in einer Sprache verwendet werden, und ebenso wenig folgt ihre Fügung den Regeln der Zusammensetzung von Worten oder gar Satzgliedern, die wir Syntax nennen. […] Das bedeutet, dass hier etwas Stärkeres wirksam wird als die vorbestimmten Regeln der Sprachkonvention.« Gadamer (1987, 61–70) behauptet: »Im Gegensatz zu gewohnten älteren Formen der Poesie, die von Glätte und Glanz des Rhetorischen viel enthalten, reichen hier wohl die Dissonanzen bis in die kompositorischen Elemente hinein und lösen noch Worteinheiten auf. In ein und demselben Wort ›klingt es auseinander‹.« Daraus folgert er über die Sprache Celans: »Sie kennt kaum noch Metapher, sie ist in sich selbst Metapher«.
Nägele (1987, 253) formuliert Celans Dilemma so: »Wer schreibt, redet zu niemandem wie der Stein, er kaut nur die Wörter, bis die expatriierte Bedeutung hervortritt.« Im Gespräch im Gebirg heißt es an einer Stelle: »Er [der Stein] redet nicht, er spricht, Geschwisterkind, der redet zu niemand, der spricht, weil niemand ihn hört, niemand und Niemand.« Sprechen ist also eine Handlung, die sich an niemand wendet. Aber auch an den »Niemand« wie in dem Gedicht Psalm (G132). Gedichte schreiben ist daher: »Mit den Sackgassen sprechen / vom Gegenüber, / von seiner / expatriierten / Bedeutung –: // dieses / Brot kauen, mit / Schreibzähnen.« (G324) In einem Interview mit Harry Neumann von der Welt vom 27.1.1958 sagt Paul Celan: »Gedichte sind nicht Kultur – sie führen ein unterirdisches, subversives Dasein.« (PC/GCL 2, 104)
Die Sprachstruktur seiner Lyrik und die Themen, die seine Lyrik anspricht, machen den Versuch, die Psychose Celans zu verstehen, zwingend notwendig, wenn man nicht bei abstrakten Verallgemeinerungen bleiben will. Wenn man wie Nau (2003, 465) von der Psychose als einer »Zeichenfeldstörung« spricht, kommt man nicht umhin, die Ursache und Auswirkung dieser »Störung« konkret zu analysieren. Zwar ist es durchaus richtig, dass Lyrik überhaupt ein »sekundäres semiotisches System« ist, das von normalsprachlichen Texten mehr oder weniger stark abweicht; Formen wie Buchstabenzauber oder Klangzauber, Assonanz, Alliteration, Paronomasie, Reim (Nau 2003, 464) sind Eigenschaften lyrischer Texte, die wenig mit Kommunikation und Information zu tun haben. Allerdings weicht Celans Sprache – vor allem in den späteren Gedichten, die an die Grenze menschlichen Sprechens gehen und mit Begriffen wie »Wortaufschüttung« und »Wortzersplitterung« (Neumann 1968, 27) zu fassen sind – auch von dem ab, was man bisher als lyrische Sprache bezeichnete. Wenn man Dichtersprache im Gegensatz zur Mitteilungssprache versteht, dann muss man immer noch die Sprache eines einzelnen Dichters (Neumann 1968, 8) als von dem »sekundären semiotischen System« der Lyrik abweichend begreifen. Und die Sprache des Manischen zeigt eine unglaubliche Geschwindigkeit der Verwandlungen (Canetti 1980, 347), die nicht immer leicht nachzuvollziehen ist.
Celan hatte keine Scheu, von der Wahrheit zu sprechen. In einem Brief an Petre Solomon (1982, 23) vom 2. August 1965 sagte er: »Je mène, depuis longtemps, un combat, celui de la poésie solidaire de la vérité.« [Ich führe seit langem einen Kampf, den Kampf um eine Dichtung, die solidarisch ist mit der Wahrheit.] »Wahrheit« ist ein im jüdischen Denken zentraler Begriff, allerdings ist in diesem Denken »Gott allein die Wahrheit«. Wahrheit ist das Sigel Gottes. (Scholem 1973, 233) Celan aber nimmt die Wahrheit für den Menschen in Anspruch. Die Wahrheit ist nach Celan etwas, das in mühseliger Arbeit aus einer steinharten Wand herausgeschlagen werden muss, wie der Bildhauer die Figur mit dem Meisel aus dem Marmor herausschlägt. In dem Gedicht Aus Fäusten (G196) heißt es »Aus Fäusten, … erblüht dir ein neues Gehirn«, und diese Fäuste sind »weiß« – vom Steinstaub? – »von der aus der Wortwand / freigehämmerten Wahrheit«.[27] Aus den Fäusten, aus der Arbeit dieser Fäuste, erblüht dem Dichter dann »ein neues Gehirn«, eine neue Art die Welt zu sehen und zu verstehen, aber auch eines, das sein zerstörtes Gehirn ersetzen kann.
In dieser Arbeit geht es vor allem darum, die »Psychose« als eine Sprachstruktur und als ein Thema in den Texten Paul Celans zu analysieren. Eine »Psychose« lässt sich allerdings an den Texten Paul Celans nicht zweifelsfrei festmachen. Einerseits sehen z. B. sprachliche Strukturen Schizophrener oder Bipolarer oberflächlich vetrachtet im hohen Maße anderen poetischen Sprachstrukturen ähnlich, andererseits darf man nicht vergessen, dass akute oder chronische Psychosen, wenn sie nicht geheilt werden können, kreative Gestaltung fast ganz unmöglich machen.[28] Viele Kritiker versuchen daher diese Sprache im Bereich des »Mystischen« zu verstehen: »Mit Fadensonnen beginnt der Versuch die eigene Sprache einem Bereich zu öffnen, der sich jeglicher Diskursivierung – nicht-poetischer und poetischer – entzieht. Der Ort oder Bereich ›jenseits der Menschen‹ erinnert daher nicht zufällig an Plotins Bestimmung eines ›Jenseits des Seins‹ oder an Wittgensteins Begrenzung des Sagbaren, das ausschließlich der Erfahrbarkeit mystischer Offenbarung unterliegt« (H103). Genauer versteht man diesen nicht-diskursiven Sprachgebrauch, wenn man ihn sowohl als den ›entnachteten‹ wie auch den ›außerhimmlischen‹ Ort, den ›meerigen Lichtsumpf‹ sieht. (H103) Wobei ›entnachtet‹ nicht als ›umnachtet‹ zu lesen wäre, sondern als Überwindung der Umnachtung.
Als psychotisch kann man Sprachstrukturen lesen, die in sich widersprüchlich und unvereinbar sind: und vieles, was zunächst unverständlich, ungereimt, ungeheuerlich, widersinnig, unberechenbar erscheint. Zu den Sprachstrukturen, die in dieser Weise gekennzeichnet sind, gehören Paradox und Oxymoron, aber auch schwer verständliche, abwegige, unlogische und kontradiktorische Aussagen, paralogische Kombinationen, Sprachzerfall, Sprachskepsis, Sprachverweigerung und Sprachunfähigkeit. In … rauscht der Brunnen (G138) spricht Celan davon, dass seine »ver- / krüppelnden Worte«, gerade seine »geraden« sind.[29] Es lassen sich in Celans Dichtung gelegentlich Glossolalien, sinnloses und automatisches Reden, Paranomasien, unsemantische Lautkonglomerate und Neoglossien feststellen. Allerdings tragen gerade diese zum literarischen und künstlerischen Charakter der Gedichte bei. Typisch ist auch das Herauslösen von Worten aus ihrem gewöhnlichen Bedeutungskontext zu neuen, unerwarteten Sinnverbindungen (Nau 2003, 116). So beginnt z. B. das Gedicht Hafen (G188) mit dem Oxymoron »Wundgeheilt«, spricht von einem »Wahndock«, von »Schwarzfluch«, einem »Abgrundvers« und einer unverständlichen »Eiskummerfeder«. Ebenso paradox ist die ständige Kopplung des Lebens mit dem Tod: »Beim Tode! Lebendig!«[30] (Buck 2002, 21) In den sechziger Jahren wurde Celan der Vorwurf gemacht, er werde immer unverständlicher (Böttiger 1996, 137).
In seiner Büchner-Rede Der Meridian spricht Paul Celan vom Weg und der Richtung der Kunst: »Und Dichtung? Dichtung, die doch den Weg der Kunst zu gehen hat? Dann wäre hier ja wirklich der Weg zu Medusenhaupt und Automat gegeben!« (M139) »Es ist der Weg, den die Dichtung zu gehen hat, auch wenn und eben weil er sie vor das Medusenhaupt und das Absurde führt.« (Allemann 1970, 194) Die Dunkelheit ist die »der Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – vielleicht selbst entworfenen – Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit«. (M141) Celan ist sich durchaus bewusst: »das sind alte und älteste Unheimlichkeiten« (M138). An die Grenzen gehen, kann auch ein Verstummen bedeuten: »es ist ein furchtbares Verstummen, es verschlägt ihm – und auch uns – den Atem und das Wort«. In diesem Sinn sagt er über die Dichtung: »das kann eine Atemwende bedeuten«. (M141)
Jackson (1977, 80) zeigt, wie die besondere Entschiedenheit des Celanschen Sprechens erst durch die Unentschiedenheit zwischen Ja und Nein gewonnen wird: das Nichts und das Absolute, beide aber immer zugleich, d. h. in der Absurdität ihrer Gleichzeitigkeit. Und diese Absurdität schließt zugleich auch die Absurdität alles Ästhetischen und also auch die der Dichtung ein (vgl. Neumann 1968, 41).
Welch ein Spiel!
»Welch ein Spiel!«, schrieb Celan 1954 in einem Brief über die Dichtung: »So ephemer, so königlich auch«. Aber so »ephemer« und auch »königlich« es sein mochte, es ist etwas Gespanntes, Zwiespältiges um dieses Spiel (Felstiner 2000, 113). Jackson (1987, 219) erinnert daran, dass Celan in den Jahren nach dem Krieg in Bukarest mit Wörtern und Namen spielte und so die Unterordnung unter und die ontologische Feierlichkeit der Sprache in Frage stellte (vgl. Böttiger 1996, 55). Schon in Bukarest gab es in Celans Kreis eine Neigung zu Wort- und Sprachspielereien. Celan nannte es später cette belle Saison des calembours. »Aber heftiges Kalauern verrät mehr als nur die Lust an Worten. … Das Wortspiel, als ein Hinwegsehen über die wörtliche Bedeutung, ist auch ein Hinwegsehen über die hartnäckige Faktizität der Dinge« (Felstiner 2000, 74). Wer in einer bipolaren Welt lebt, der neigt dazu, die Tatsächlichkeit des Traumas zu negieren (nicht nur zu verdrängen). »Die Strophen aus dem Schlussgedicht des Bandes Atemwende, Einmal (G214): ›Eins und Unendlich, / vernichtet, / ichten. // Licht war. Rettung‹ zeigen, dass eine solche spekulative Auflösung der Wörter, die Zerlegung in ihr Silbenmaterial, durchaus ihre Berechtigung haben kann.« (Wögerbauer 2002, 126) Denn hier lösen sich nicht nur die Worte auf, sondern auch der Sinn und das Ich. Hans-Peter Duerr (1985, 191) zitiert die »entichte«[31] Erfahrung einer Frau während einer Zen-Meditation: »Ich bin tot! Es gibt nichts mehr, was sich noch Ich nennen könnte. Es gab niemals ein Ich.« Es ist aber auch bekannt, dass Bipolare durchaus in der Lage sind, ironische, sarkastische und scharfe Kommentare zu ihrer eigenen Krankheit abzugeben und sich über die Perzeption ihrer Krankheit durch andere lustig zu machen und sie zu karikieren (Martin 2009, 59). Es gibt eine Reihe polemisch-sarkastischer Gedichte von Celan, die das belegen.[32] »Manie« kann durchaus auch eine Performanz, ein Spiel sein (ohne dass dadurch das Erschreckende und die Realität des Wahnsinns irgendwie verkleinert werden). Das zeigt, dass es durchaus nicht so ist, dass Menschen, die als »wahnsinnig« oder »manisch-depressiv« beschrieben werden, sich nie selbst darstellen können, sondern dass sie ihren eigenen Stil der Selbstdarstellung entwickeln, der allerdings Außenstehenden oft unverständlich erscheinen muss.
Gegen die Auffassung von Celan als Sprachspieler argumentiert Rey (1970, 751): »Dichten ist für Celan keineswegs ein unverbindliches Spiel mit Worten, sondern vielmehr ein existenzieller, ja ein religiöser Akt. Eben dieser Glaube an die religiöse Funktion der Kunst verbindet Celan mit dem französischen Symbolismus und darüber hinaus mit der deutschen Romantik. Nicht umsonst hat man auf die Zusammenhänge mit Novalis, Hölderlin, Jean Paul hingewiesen.« Das ist insofern richtig, als Bipolare tatsächlich dazu neigen, sich in die Sprache als quasi-religiösen Zufluchtsort zu begeben, die Welt als durch und durch magisch zu sehen, in der alles nur wegen der geheimen Namen lebt, die der Welt innewohnen (Scholem 1973, 228). Außerdem sieht Rey auch »Beziehungen zu modernen Autoren …, die im Schatten des Symbolismus stehen, wie Rilke und Benn«. Auch Celan stellte sich wie Heidegger (2003, 2) immer wieder die Frage: »Wo und wie gibt es die Kunst? Die Kunst ist nur noch ein Wort, dem nichts Wirkliches mehr entspricht.« Celan selbst war sich durchaus der Tatsache bewusst, dass seine Dichtung nur möglich war, weil er dem Holocaust entronnen war und sich daher immer auf den Holocaust bezog. Celan benutzt die Sprache auch als Abwehrzauber gegen die antisemitische Gefahr, die er immer noch als durchaus real und gefährdend erfährt. Celan verweist aber auch auf Adornos Dictum, dass keiner Kunst die Spur von Affirmation fehle (Böttiger 1996, 103): »Welches der Worte du sprichst«, hatte Celan geschrieben, »du dankst / dem Verderben« (Welchen der Steine du hebst (G82)).
Auch Felstiner (2000, 224) spricht von der »Schicksalhaftigkeit des Deutschen« und meint, das »brachte Celan dazu, diese Sprache zu verrenken, zu versetzen, zu verstören und zu zerstören. Seine Gedichte in dem Band Die Niemandsrose (1963) zeugen von einem Jakobs-Kampf mit dem deutschen Lexikon.« Celan selbst war sich bewusst: »Die Lebensumstände, das Leben im fremden Sprachbereich haben es mit sich gebracht, daß ich mit meiner Sprache viel bewußter umgehe als früher – und doch: das Wie und Warum jenes qualitativen Wechsels, den das Wort erfährt, um zum Wort im Gedicht zu werden, weiß ich auch heute nicht näher zu bestimmen. Dichtung, sagt Paul Valery irgendwo, sei Sprache in statu nascendi, freiwerdende Sprache.« (Brief an Hans Bender 18.11.1954; Felstiner 2000, 113)