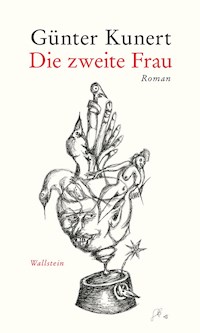Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Günter Kunert ist ein Chronist der besonderen Art. Er übermittelt uns erstaunliche Nachrichten aus Osmosistan und Dahlak; so heißen zwei obskure Länder, zwischen denen seltsame Schiffsladungen mit (zumeist wenig brauchbaren) Bügelmaschinen unterwegs sind, und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sind ebenso Erfindungen des Autors wie zahllose Sprichwörter und Lebensweisheiten, die gleichwohl immer wieder bekannten Persönlichkeiten oder Schriftstellern untergeschoben werden. Man erkennt noch die Herkunft, aber sie sind nicht selten ins Überraschende und Gegenläufige, Surreale gewendet, denn "nach Adam Ries gibt es auch für Mathematiker eine Verführung, zu beweisen, dass zweimal zwei fünf ist". Meldungen aus der Ferne und Beobachtungen in der Nähe werden in Kunerts Fantasie verwandelt und ironisch, satirisch, grotesk verzerrt und voller Spaß und Unernst dargeboten. 1964 hat der Autor diese Aufzeichnungen begonnen, nicht zuletzt, um sich auf diese Weise einen "Emergency Exit" aus beengten Verhältnissen zu schaffen und ihnen eine komische und irreale Seite abzugewinnen. Entstanden ist eine Sammlung von Einfällen, kurzen Betrachtungen, Späßen, verzerrten Perspektiven, mikroskopischen Durchblicken, Momentaufnahmen, Spott und Hohn.Man liest und staunt. Tatsächlich: Günter Kunert ist der bedeutendste literarische Essayist unter den deutschen Literaten der Gegenwart. Sensibel, aber nie sentimental. Lakonisch aus Genauigkeit. Und was selten ist: Tapfer vor dem Freund.Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Erika – ohne die die besagten »Sprichwörter« kaum das Zwielicht der Buchwelt erlebt hätten – in Dankbarkeit.
Günter Kunert
Die Geburt der Sprichwörter
WALLSTEIN VERLAG
Mit dem Anfang beginnen: das schreibt sich leicht hin. Aber wo fängt der Anfang an? Untersucht man das einfachste Unternehmen, wo hebt es an, wo hört es auf, verwandelt es sich und verliert seine Einfachheit wie gottbehüte der Schmetterling den Flügelstaub oder der Mensch seine Naivität im Lauf seiner Erfahrungen. Jeder scheinbare Anfang hat einen speziellen Anfang für sich, der wiederum eine Ursache besitzt, die auch an einem Punkt einsetzt, der ebenfalls nicht mittels Autogenese erschien, sondern seinerseits irgendwann von irgendwas eingeleitet wurde: man merkt, es ist schwer anzufangen. Zu enden ist leichter, selbstverständlicher: der Schluss ergibt sich von allein, hat keinen eigenen Schluss im Gefolge, muss nicht in sich noch einmal aufhören, sondern endet, indem er endet.
Im Jahre 1964, kein historisch Pointiertes, begann ich Notizen zu machen; absichtslos, Einfälle aufzuschreiben: Ideen, Definitionen und Formulierungen zwecks späterer Auswertung; Arbeitsnotate, Bruchstücke von Gedichten, nicht mal Torsi, sondern das, was dem Torso fehlt: ein abgebrochener Fingerzeig, eine zersplitterte Geste, lauter Rudimente, die sich zu keinem Ganzen zusammenfügen wollten, oder aus denen kein ganzer Leib mehr erwuchs. Im Einzelnen glaubhaft brauchbare Teile, die doch zu nichts nütze gewesen sind. Oder doch: zur Entlastung des bedenklichen Augenblicks, des unruhigen, verselbstständigten Denkens, das sich nach außen manifestieren muss, um zur Ruhe zu kommen. »Die besten Leser sind die Ungeborenen«, lese ich beim Durchblättern, und wer das für einen Witz hält, stimmt mich traurig: das Paradoxon enthält das Destillat der Wahrheit, mehr als Wahrheit also, eine Überwahrheit, die viel zu wahr ist, um dem Leser, der schon zu lange geboren ist, eingängig zu sein. Ich sollte ihn beschimpfen, lasse es lieber, da ich, wenn nicht auf sein Wohlwollen, so doch auf sein Geld angewiesen bin. Ihm, der von dem Gehalt oder Verdienst seines Lebens ein kaum sichtbares Minimum für Kunst, für Literatur ausgibt (Wieviel Bücher kaufst Du im Jahr, Rindvieh?), seien diese Körner, Samen, wer weiß, vergiftet, mag sein, ungenießbar, ganz sicher, hingestreut. So schwer ist es eben, mit irgendeinem Anfang anzufangen. Man gibt das Datum an, die Tageszeit, die zufällig Nacht ist, und zitiert sich selbst mit der ersten Zeile der Notizen, denen von nun an ungezählte, ich jedenfalls zähle sie nicht, folgen werden: Jede verschlafene Stunde ist nicht mehr zu erwecken.
Oft dachte ich, wenn ich das Interesse des Lesers, deines vielleicht, an »historischen Romanen« sah: die flüchten in die Vergangenheit. Bis ich merkte, dass es auch eine Flucht in die Zukunft gibt, zu deren Hilfe die moralischen Bücher benutzt werden; denn: das gesättigte moralische Empfinden ist ein utopisches. Wo bleibt das Gesetz gegen Fluchthilfe aus der Gegenwart?
Notiert die Idee zu einem großen Zyklus sogenannter »Amtsgedichte«. Die Titel stehen da und heißen »Fragebogen«, »Antrag«, »Vorladung«, »Verordnung«, »Benachrichtigung«, »Ablehnung«, und als letztes: »Urteil«. Nie ist ein Gedicht zu einem dieser Titel entstanden; ich vermute: aus lauter Erschrecken vor der unsäglichen Schwärze und vernichtenden Leere jeder einzelnen Überschrift, deren Summation mir schon wie ein drohender Vers vorkam, wie er manchmal in Stein über dem Tor eines alten Gerichtgebäudes geschlagen steht.
Für gewöhnlich wohne ich in Ambivalencia.
Gedichte von tiefer Oberflächlichkeit; kein Widerspruch in sich, eine exakte Bezeichnung für z. B. bechersche Gedichte, die an ihrer Äußerlichkeit kranken, während sich in ihrem Innern, aber ganz undeutlich, eine heftige Bewegung vollzieht.
Eine Stadt, von der nicht mehr heil geblieben ist als ihr Name: das möchte ich aktualisieren: von der nichts mehr blieb als dieser. Er darf im Übrigen erraten werden.
Es wird berichtet von der Ehrfurcht des Tums: große Schwierigkeiten ergaben sich, als das Tum eingeführt wurde. Ich ersehe aus den Notizen einen langwierigen Ausrottungsfeldzug gegen Antitümler; versehentlich wurden auch größere Mengen Mittümler beseitigt; apokryphe Texte sprechen sogar vom Tumbau, indes die kanonisierten von der Ausbreitung des Tumtums künden. Zehn Millionen Tote? Ich kann die Schriftzüge nicht entziffern, Tum sei Dank.
Sich selbst ins Gesicht zu treten, ist ein Kunststück, das man nur nach langjährigem Studium der Philosophie fertigbringt. Dafür darf man dann aber auch damit öffentlich auftreten.
Ich merke, den bisherigen Notizen fehlt es an gebührendem Ernst: dem des sog. Lebens. So gebe ich daher die Notiz wieder, geschrieben nach einem Besuch bei Brecht, wie üblich ganz früh, er unglaublich munter, ich weniger glaublich; fragend nach einem mich wesentlich betreffenden Lyriker, Edgar Lee Masters nämlich, hör ich, er, Brecht, ihm den gleichen Vorzug gebend, habe versucht, jenen amerikanischen Klassiker während seines, Brechts, Aufenthalts in Amerika zu treffen, was ihm jedoch misslungen. Masters habe in New York im Armenhaus gelebt, krank und mittellos, und auf Brechts Einladung zu einem Treff sei seine Antwort gewesen: Schicken Sie mir das Geld und ich komme. Brecht, selbst der Dollars bar, hatte zu seinem, zu Masters’, auch zu meinem Bedauern auf die Begegnung verzichten müssen: wie gern hätte ich davon erfahren, falls geschehen wäre, was mir damals als die besondere Konstellation zweier Planeten hätte vorkommen müssen: »schicksalswendend«. Und warum reden wir immer noch so selten vom Geld?
Die meisten Leute wissen nicht, wie sterblich sie sind. (aus dem Buch »Sohar«)
Einer hat mir aus dem Fenster zugewinkt. Obwohl wertneutral, es bleibt offen, ob drohend, ob einladend, lese ich diesen Satz mit dem angenehmen Gefühl des soeben freundlich Eingeladenen, nachdem ich ihn vor langer Zeit notierte. Das Empfinden für den Wink aus dem Fenster hat sich nicht geändert: habe ich mich nicht geändert? Sogar die Straße, obwohl schemenhaft, ist mir bewusst als Hintergrund des Fensters, aus dem sich eine Männergestalt herausneigt und ganz leicht mit der Hand, die Innenfläche zu sich gekehrt, zwei, drei Mal mich zum Heraufkommen auffordert, so dass niemand sonst auf der Straße es sieht; es ist eine alte Berliner Straße, die Gitschiner Straße möglicherweise, in deren Mitte hoch droben auf rostender Eisenkonstruktion die U-Bahn fährt: erste Strecke in Berlin überhaupt, oder es handelt sich um eine der Seitenstraßen der Prenzlauer Allee; die ungewisse Ahnung von Sonnenschein ist dabei. Einer hat mir zugewinkt. Und ich? Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Über das Schicksal großer Reiche. Sie alle haben eins. Ihre Hinterlassenschaft: Ruinen, wenigstens die. Bei der Bestandsaufnahme solchen Erbes kommt öfter die Todesursache des Erblassers ans Licht. Die Mayas sind lange weg. Kein Krieg hat sie gefällt. Keine Seuche. Keine Naturkatastrophe. Sie starben einfach aus durch falsche Bearbeitung des Bodens, der, von der Monokultur des Maisanbaus ausgelaugt, nichts mehr an notwendiger Nahrung hergab. Und während wir, archäologisch fasziniert, die Ergebnisse der empirischen Forschung der Kulturseite unserer Zeitung beim Anstehen nach Obst entnehmen, entgeht uns, dass die Nachrichten über die Gegenwart von großen Reichen viel weniger präzise sind.
Ben Turpin, dieser beängstigend schielende Stummfilmstar der Slapstick-Comedies: wie der stolpert, weil er sich selbst ein Bein stellt; wie er in die Grube fällt, die er soeben zu undurchsichtigen Zwecken persönlich ausgehoben hat – was dem da geschieht, ist jeweils Rettung vor Schlimmerem. Das Stolpern wird zu einer besonderen Gabe, das rechtzeitige Hinfallen zum Geniestreich: Dialektik wird praktiziert, und zwar eine auf die verheißene Utopie gerichtete: Ständig schlägt die Katastrophe in ihr Gegenteil um und hebt alle menschheitliche Erfahrung auf: solange der Stummfilm läuft. Daher vielleicht das Fasziniertsein vieler Intellektueller von dieser banalen Muse, die triumphierend siegt (im Fallen).
Tumult des Fleisches. Aufruhr des Fleisches. Abnutzung der Haut durch Zeit. Versagen des Tastsinns durch Nichtgebrauch der Finger. Völlige Erblindung des Leibes. Auf der Zunge ein Geschmack von Zunge. Kotzen einwärts. Ein schwächliches Marschieren der ganzen Gewalt. Sie geht ab: eine tote Frucht vom Baum der Verkenntnis.
Empörend wie die ungerechte Verteilung des Reichtums ist gleichermaßen die ungerechte Verteilung der Armut.
Dann bot sich an die Rekonstruktion von Kunstwerken aus dem Gedächtnis nach der großen umfassenden Zerstörung; Angaben von Galeriebesuchern, Kunsthändlern, Ethnologen, Kunstgeschichtlern zum Zwecke des Nachmalens und Nachmodellierens. (Ähnlich wie aus der Menge von Tatzeugen einzelne Züge des Mörders unter dem Bleistift des Polizeizeichners zu seinem Porträt werden; übrigens beängstigend amateurhafte Konterfeis). So umringt eine Gruppe den überlebenden Maler; Hinweise, Ausrufe: Links stand das Peloton, links, die Gesichter verzerrt, die Gewehre erhoben, rechts die zu Erschießenden, einer hat die Arme hochgeworfen, etwa so, sehen Sie doch her, so etwa, und geschrien, ja, und es war Nacht, Spanien, ganz dunkel, Goya.
Und keiner Nachprüfung zugänglich entstünde ein Bild der Erschießung von Aufständischen vor Madrid, und stünde unbezweifelt dafür: die Summation kleiner Realitätsverschiebungen, minimaler Fehlblicke, dauernde winzige Brechungen, welche die ganze Oberfläche (das Produkt der Innenfläche) verändern, wandeln, wobei doch Ähnlichkeit sich erhält, so etwa vollzieht sich Geschichtsschreibung, und wir dürfen dabei nicht vergessen: diese Art Abbild bildet die Grundlage für Geschichtsvollstrecker.
Wie man sich erinnert, so schläft man. (Das große Traumbuch, Vorwort, Seite 59)
Wenn ihr einen siegreichen Helden für einen ganz kleinen Roman benötigt, bitte: es ist der Schwamm. Zuerst wohnt er im Keller, natürlich, er kommt von unten, ein Unterprivilegierter, ein Untengehaltener, der zu den einen gehört, die bekanntlich im Dunkeln sind. Aber bald, da die im Lichte des Hauses zerstritten, ihre Kompetenzen unklar und überhaupt ihre Selbstsüchte groß sind, kriecht er nach oben. Es geht aufwärts mit ihm. Revolutionär missachtet er bürgerliche Konventionen: er klopft nicht an, sondern ist plötzlich drin. Unbescheiden beschränkt er sich nicht auf die Küche, breitet sich sogleich über die Wohnzimmerwände aus und löst insgeheim die Tapete vom Putz, der Inwohner letzte Illusion, die plötzlich zu Boden lappt. Sein Triumph ist vollkommen. Kompromisse duldet er keine: Anstriche durchbricht er kämpferisch. Eine Koalition, etwa mit dem faulen und langweiligen Zahn der Zeit, lehnt er ab. So siegt er, und sein Sieg ist so total und umfassend, da das Haus unbewohnbar wird, wie nur der Sieg eines wirklichen Helden sein kann.
Den Leuten die Haut abziehen, damit sie feinfühliger werden.
Ein Friedhofsbaedecker: der fehlte. Ich habe viele Friedhöfe gesehen, nicht etwa von unten, sondern als lebender Besucher: berühmte und unbekannte, triste und märchenhafte, bunte und farblose, und es läge mir, der derart mit der Vergangenheit auf Du und Du steht, eigentlich ob, einen Reiseführer über Friedhöfe zu verfassen. Der berühmteste ist wohl der alte Prager jüdische Friedhof, zu vielen gezeigt, in der Saison von schwindendem Zauber, dafür bietet der neue jüdische Friedhof in Nusle, wo Franz Kafka im Familiengrab mit Vater und Mutter zu liegen gezwungen ward, vielerlei Entdeckungsmöglichkeiten. Er ist weitläufig, verliert sich einfach ins Grüne und außerdem in einen christlichen Friedhof, aber seine wahre Sehenswürdigkeit sind die Namen auf den Steinen: Die Ostjuden, die bis ins 19. Jahrhundert ihre hebräischen Namen tragen durften, mussten sich zwangsweise später von den Behörden benennen lassen; die Bürokratie verlieh den Juden jene, die wir hier finden: Grynspan, Katzenellenbogen, Veilchenblüth und so weiter und so fort. Merkwürdig, nachdem sie und ihre Nachfahren von der europäischen Erde fast getilgt sind, verloren diese Namen alle Komik: sie sind wieder magisch geworden. Ein Granitblock mit dem Namen Arje Feigenbaum, der dem Stein widerspricht, ohne jedoch den Quader beeinflussen zu können, ruft eigentümliche Empfindungen hervor. Als sei in den Namen ein Nachblühen, ganz schwach und kaum zu merken. Empfehlen könnte ich auch die Friedhöfe Kalabriens, die Mauern mit ihren Fächern, darein man die metallverpackten Toten schiebt, eine Marmortafel davor, ein Foto drauf, darunter der klangvolle Name, und ein Lämpchen für Allerseelen; so ähnliche Grabmauern erheben sich auch auf dem alten Friedhof in New Orleans, nahe dem French Quarter, Haupteingang von der Basin Street; und der ärmste Platz liegt unter dem sehr hohen Himmel von Sky City, in Acoma, dem Indianer-Reservat in Neu-Mexiko: eine ebene Fläche aus Lehm vor der Pueblokirche, zerbrochene Holzkreuze, ausgeblichene Farben, und Hunde laufen zwischen den unbehügelten Gräbern umher, wie wir, und sie suchen gar nicht erst, was wir immer noch auf einem dieser Plätze für menschliche Reste anzutreffen erwarten. Nichts Metaphysisches. Vielleicht einen Sinn-Zusammenhang, eine Glaubensstütze für unseren Glauben an Kontinuität, eine Bestätigung unserer geliebten Teleologie. Irgendetwas.
Die überdimensionale Hochachtung vor jemand schließt die (unbewusste) Verachtung der eigenen Person ein.
Vorgriff auf eine spätere Seite; Vorblättern, wie der Neugierige im Kriminalroman: Wer wars? Dr. Verschwindowsky und seine internationale Sippschaft: Heinrich Abmurks, Franz Foltera, Bloodminster Killingworth.
Bei Weizsäcker eine Definition entdeckt, die, nicht auf Lyrik gemünzt, diese glänzend definiert: »Viel eher wird man vermuten dürfen, dass es zum Wesen des richtig gebrauchten spekulativen Begriffs gehört, nicht eindeutig zu sein.«
Wie emigriert muss man sein, um »volkstümlich« zu werden?
Konvergenz: jede Terminologie hat primär nicht Definitionsaufgabe, sondern Gruppensolidaritätscharakter (was fürn gutes deutsches Bandwürmchen!) Sie hat nur den Zweck, zu signalisieren, wer »in« ist und wer »out«. Wer funktionale Termini in den Mund nimmt, besudelt sich oder andere. Wie schön ist es, Dreck anzufassen.
In öffentlichen Auseinandersetzungen des »Geisteslebens« geht es nie um Machtfragen: die werden woanders entschieden. Zwischen Sturmgeschütz und Panzer haben keine Diskussionen Platz. Aber es geht um Fragen der moralischen Legitimität oder Illegimität der Macht.
Statt auf Veränderung solltet ihr auf Besserung bedacht sein.
Die zweite Geschichte handelt von einem anderen Mann, er hat, ich bin dessen sicher, bessere Nerven, vielleicht auch nur mangelhaftere Erfahrungen, eine nivelliertere Biographie: er jedenfalls macht eine Erbschaft, die aus einem Bauwerk besteht, und dieses Bauwerk, und das ist der Seltenheitswert der Hinterlassenschaft, ist eine reguläre Brücke. Über einen regulären Fluss. So balanciert er ungestraft auf dem Geländer, einmal hin, einmal her. Jede zweite Strebe streicht er gelb, jede dritte lila. In einem Klubsessel nimmt er mitten auf seinem Besitztum Platz, man weicht ihm rechts und links aus; Hustenanfälle, verursacht durch Abgase, stellen sich ein; der Sitzplatz wird aufgegeben. Andere Unternehmungen wollen dem Brückenerben nicht einfallen. Einige Male besucht er noch sein Eigentum, dann bleibt er weg. Die Farben blättern ab, der ehemalige Rost erscheint ungebrochen, indessen wir unsern Mann vorm Traualtar sehen: in seinem Alter eine etwas lächerliche Affäre: sie, die Braut, zeigt sich verschämt und rotbäckig, sie murmelt ihr Ja, wird künftig aber lauter sein: ein Kind wird erwartet, hoffentlich ein Junge, man muss einen männlichen Erben haben, vor allen Dingen für die Brücke, denn was geschähe mit ihr, könnte man sie nicht seinem eigenen Fleisch und Blut weitergeben? Solche Sorgen, und wer kann sich schon eine Vorstellung davon machen?
Politiker können nur dem Maß ihres Unwissens entsprechend handeln.
Gar nichts voraussetzen. Ausbeutung wird nur als Ausbeutung erkannt, sobald das Bewusstsein des Ausgebeutetseins hinzukommt; bis dahin herrscht vom Himmel zur Erde gespiegelte Hierarchie, soziale Ordnung, freies Spiel der Kräfte; uns erscheint heute bereits die Rolle einer Hausangestellten als eine Erniedrigung. Der Vorgang des Bedienens und Bedientwerdens erweckt physischen Widerwillen. Sklave und Sklavenhalter redivivus. Das wurde nicht immer so »empfunden«, es war das »Normale«, das Selbstverständliche, daran zu rütteln die Gefahr mit sich brachte, das Weltgebäude würde einstürzen. Und es wurde ja auch erst daran gerüttelt, als andere Säulen, andere soziale Beziehungen entstanden waren. Morsches allein reißt man ab. Das historische Bewusstsein zündet immer spät. Was es sich als überlebt bewusstmacht, ist schon objektiv von der Tagesordnung abgesetzt. Unser Unbehagen, mit dem wir den verschmutzten und sich anstrengenden Arbeiter seinen Eisenhammer mühsam schwingen sehen, die auf dem Baugerüst werkenden Gestalten oder die als solche unkenntlichen Frauen im Schlamm der Kartoffelfelder, all jene, deren Anblick uns noch außerhalb der Werkhallen zugänglich ist und die noch ihren Körper einsetzen, kündigt an, dass sie schon allesamt anachronistisch geworden sind, ohne es zu wissen.
Warum können wir uns nur im Zorn zur Wahrheit gegenüber unserem Nächsten aufraffen?
Kultur: ist Körper, ist Verkauf, ist Beute, ist Garten, ist Vorsilbe und Nachsilbe höchst deutscher Banalität.
(24. 2. 73)
Große Ereignisse lassen ihre Schatten zurück.
Dieses Institut für Ästhetik: ob man darüber lachen oder weinen soll, ist wohl eher den daran Beteiligten als den Unbeteiligten überlassen: Beschäftigung mit Kunst von Amts wegen: das ist aus ganzem Herzen preußisch. Immerhin besser, als gäbe es ein Institut für Fragen der Lebenskunst. Was käme da wohl an Dekreten zutage. So kann noch ganz privatim über die Lebenskunst gesprochen werden, über Lebenskünstler, die es auch immer noch gibt, vermutlich mehr denn je, da ja in der Beschränkung sich erst der Meister zeigt, und dieser fördernde Umstand grundsätzlicher »Natur« ist. Aber solche Überlegungen werden uferlos.
Weil wir grade über Kunst reden: Die höchste aller Künste gehört zu dem, was einfach ist, aber schwer zu machen, nämlich: ihre Förderung. Künstler und ihre Ausbeuter, ihre Ausschlächter, ihre Neider, Unterdrücker, ja: Liquidatoren trifft man allerorten, und wer da sagt, er sei einem begegnet, der ganz selbstlos und nur um der Kunst willen die Kunst fördere, persönliche wie allgemeine Interessen dabei außerhalb des Interessenbereichs haltend, dem wollen wir Lügnertum bescheinigen. Es sei denn, ihm sei ein Gespenst erschienen.
In der Zeitung stand: Wer andere entflammen will, muss selbst glühen. Das ist die Weisheit der Pyromanen.
Einteilung der Menschen in »gute« und /oder »schlechte« vollstreckt die Optik des selbstgläubigen Nichtdenkers. Eine andere wäre eine in »Differenzierte« und »Reduzierte«, die aber unter Reduzierten sich niemals durchsetzen wird: also nicht unter der Mehrheit, unter die man geraten kann wie unter einen Lastwagen, um sich danach als ebensolcher Krüppel wie alle anderen wiederzufinden; solch Wiederfinden ist jedoch keine Selbstentdeckung mehr.
Sobald aus dem Recht auf den Verzehr von Leberwurst die Pflicht zum Verzehren von Leberwurst wird, vergeht einem der Appetit.
Oft fragt man sich, was bedeutet dem Einzelnen die Geschichte. Sie bedeutet für viele und zwar, wie ich fürchte, für die Ausübenden, einen Anschauungsunterricht, dass Böstum Zinsen trägt und Verbrechen sich auszahlt, vorausgesetzt es wird in einem größeren Maßstab vollzogen, nach dem es nicht mehr so genannt wird. Geschichte als Beispiel ist unmoralisch. Sie dient – und das nicht nur als verordneter Lehrstoff, sondern sogar dem Individuum, der sich ihr freiwillig und ungezwungen nähert – als ein Mittel zur Domestizierung des Individuums: da sieht man doch, dass im Laufe ganz reizender Epochen sich das Unterkleid ändert, die Frisur, die Art der Fortbewegung und niemals der Glaube, damit bessere sich bereits alles, große Veränderungen träten ein, sobald aus Tempo Hundert Tempo Tausend würde; es bedürfe nur eines kleinen, eigentlich ganz leicht und einfach vollziehbaren Schrittes, eines allerletzten Sprunges, um das gelobte Land zu betreten; oder doch: ein gelobtes Land. Aber wie kommt man aus diesem wieder heraus? In ein nächstes? Wozu? »Ja, wollen Sie denn, dass alles beim Alten bleibt?« Ich will es eben nicht, aber es bleibt immerzu dabei, dass es dabei bleibt. Ich glaube ans Weitergekommensein, falls ich morgen früh in der Zeitung die Sensationsmitteilung lese: »Heute wurde niemand liquidiert. Damit ist die Geschichte der Menschheit beendet.«
Die Geschichte (und ihre wechselnde Interpretation) stößt auf unterschiedliche Interessen und Interessenlagen, aber für die armen Leute, deren Anzahl erstaunlicherweise trotz allem Fortschritt nicht abnimmt, gibt es nur eine Geschichte: die ihres Lebens. Und sie sind immer bereit, diese zu erzählen. Und sie ist wahrer als Mommsens Mätzchen, Rankes Redereien: das Allgemeine zeigt sich im Allgemeinen im Allgemeinen nicht, nur im Besonderen, aber da tut es auch gleich weh.
Frage, wie es mir geht: Ein bisschen, ein wenig, fast gar nicht. Es geht mit mir und ich gehe mit. Wir beide stützen uns aufeinander, gegeneinander, können aber nicht auf uns bauen, sondern torkeln Betrunkenen gleich, zerren uns vorwärts, halten uns zurück und auf: ich und der Geist der Zeit, der nicht allein als Wort einem Gespenst synonym ist.
Eine verwandelte Mücke zertrampelt uns alles Porzellan.