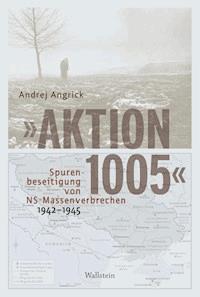50,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wer sich mit der Geistesgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt, stößt immer wieder auf seinen Namen. Ob als Autor literarischer Texte oder von Kinderbüchern, ob als Wissenschaftler und Institutsgründer, als Initiator von Projekten wie der Wehrmachtsausstellung oder als Mäzen – überall setzt Jan Philipp Reemtsma Zeichen, die unübersehbar sind. Entsprechend viel gibt es über ihn zu sagen, von ihm zu kommentieren und für weitere Überlegungen und Analysen nutzbar zu machen. Über 50 Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichsten Disziplinen setzen sich mit den Themen auseinander, die den vielfältig interessierten Reemtsma beschäftigen. Dabei geht jeder Beiträger von einem Zitat Reemtsmas aus und entwickelt seine Gedanken in direktem Bezug auf den Jubliar. So zieht sich dessen Wirken wie ein roter Faden durch diese Festschrift. Aufsätze über Literatur und Literaturwissenschaft finden sich darin, wie auch über Zivilisationstheorie, Soziologie, Rechtstheorie und Gewaltforschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Susanne Fischer, Gerd Hankel, Wolfgang Knöbl (Hg.)
Die Gegenwart der Gewalt und die Macht der Aufklärung
Festschrift für Jan Philipp Reemtsma
Band 1 zu Klampen Verlag
Eine AnekdoteEinmal soll Jan Philipp Reemtsma am damals berühmten Tandem-Rennen »Rund um den Dümmer« teilgenommen haben. Mit Tandem, aber ohne Partner sei er erschienen und habe überdies darauf bestanden, hinten zu sitzen. Erstaunlicherweise wurde er zum Rennen zugelassen und belegte Platz 9 von 35 Teilnehmern; dass er während der gesamten 20 Runden gelesen habe, muss allerdings dem Reich der Legende (Johann Scheerer) zugewiesen werden. Platz 1 belegte, wie jedes Jahr, das Ehepaar A. und A. Schmidt. N. Heidelbach 2022
Die Herausgeberin und die Herausgeber dankenAnn Kathrin Scheerer und Johann Scheererfür die großzügige finanzielle Unterstützung,ohne die diese Festschrift nicht möglich gewesen wäre.
© 2022 zu Klampen Verlag, Springe
Redaktion: Andrea Böltken, Berlin
Gestaltung und Satz: Friedrich Forssman
Einbandgraphiken: Cornelia Feyll
Karte auf S. 263: Peter Palm, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Bindung: Schaumann, Darmstadt
ISBN Printausgabe 978-3-86674-839-2
ISBNE-Book-PDF 978-3-98737-352-7
ISBNE-Book-EPUB 978-3-98737-353-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Band 1
Nikolaus HeidelbachZeichnung
Vorwort
Die Macht der Aufklärung
Carsten Brosda »Dass Naphta mitdiskutierte, gab Settembrini recht« Über den Gedanken der Aufklärung im Gespräch
Ute Daniel Vorgeschichten und Gegenwarten Einige Beobachtungen zu ihrer wechselseitigen Ausgestaltung
Eva-Maria Engelen Autonomie und Kritik
Jürgen Habermas »Urteilt, auf dass Ihr beurteilt werden könnt«
Tina Hartmann Reaktionäre oder progressive Aufklärung? Christian Fürchtegott Gellert, Sophie La Roche und Christoph Martin Wieland zu postkolonialer Aufklärungskritik
Joachim Kersten Ein Dichter als junger Mann
Ulrike Lorenz Ein »souveräner Prolet«: Otto Dix
Reinhard Merkel Zauberberg and beyond:Aufklärung und Gewalt
Iris Radisch Kopf hoch Wie verständigt sich eine zerrissene und fragmentierte Gesellschaft über gute und schlechte Literatur?
Sebastian Scheerer Die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen – an einem aktuellen Beispiel
Alfons Söllner Erinnerung an die Exilforschung
Die Gegenwart der Gewalt
Andrej Angrick Einige Photos aus der Mitte des letzten Jahrhunderts Unfertige Überlegungen zur Kiew-Serie des Propagandakompanie-Photographen Johannes Hähle
Gerd Hankel Über den Weg in einen Völkermord und die Lehren daraus Ein Lehrstück über den Variantenreichtum des Menschenrechtsdiskurses
Karsten Linne Ein problematischer Namengeber: Klaus-Joachim Zülch
Klaus Manger »HEUTE«, »HIER« und »JETZT« Allgegenwärtige Gewalt in Paul Celans Dichtung
Regina Mühlhäuser Körper, Sexualität, Gewalt Anmerkungen zum Verständnis sexueller Gewalt gegen Frauen und Männer
Hans-Peter Nowitzki »Das Settembrinihafte der Aufklärung« Wieland und die Gewalt
Bernd Rauschenbach »Wafen, herre, wafen!«
Thomas Schmid Lauter lose Enden Der Völkermord der Deutschen an den Herero verweist nicht auf den Holocaust
Nikola Tietze Europäische Freizügigkeit und soziale Sicherheit Auf-, Um- und Abbau rechtlicher Brücken europäischer Gewaltabstinenz
Vorwort
Diese Festschrift ist die zweite zu Ehren von Jan Philipp Reemtsma. Warum eine zweite Festschrift? Weil er sie verdient, lautet die einfache Antwort. Wer sich in der Geistesgeschichte der Bundesrepublik Deutschland nur ein wenig auskennt, stößt immer wieder auf seinen Namen. Ob als Autor literarischer Texte oder von Kinderbüchern, ob als Wissenschaftler und Institutsgründer, als Initiator von Projekten wie der Wehrmachtsausstellung oder als Mäzen – überall hat Jan Philipp Reemtsma Zeichen gesetzt, die unübersehbar geblieben sind. Entsprechend viel gibt es über ihn zu sagen, von ihm zu kommentieren und für weitere Überlegungen und Analysen nutzbar zu machen.
Festschriften sind bekanntlich ein riskantes und schwieriges Genre. Riskant, weil man ja so genau nicht weiß, ob der Geehrte sich darüber auch wirklich freut oder ob ihm die ganze Angelegenheit nicht eher als peinlich erscheinen wird, weil seinem Urteil nach einfach zu viel Aufhebens gemacht wird. Ein solches Risiko ist aber auch gar nicht zu vermeiden, es war der Herausgeberin und den beiden Herausgebern von Anfang an bewusst, und wir sind es dann auch eingegangen – mal sehen, was Jan Philipp Reemtsma dazu sagen wird!
Das Genre ist eben auch ein schwieriges, weil man hier von Anfang an mit einer ganzen Reihe von Organisationsproblemen zu kämpfen hat – angefangen mit der Frage, wen man für einen Beitrag anfragt, wer seine Zusage einhalten kann und ob man auch wirklich niemanden übersehen und damit unabsichtlich Kränkung verursacht hat. Aber all dies berührt noch nicht einmal das vielleicht entscheidende Problem, nämlich, ob aus den verschiedenen Beiträgen überhaupt ein einigermaßen kohärentes Ganzes entstehen kann. Je mehr Beiträgerinnen und Beiträger den Jubilar feiern wollen, desto weiter könnte hier eine Lösung in die Ferne rücken.
Wie Sie, verehrter Jan Philipp Reemtsma, und Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser, feststellen können, sind die eben angesprochenen Fragen und Probleme in der vorliegenden Festschrift allesamt nicht aufgetreten. Fast alle, die wir anfragten, haben schnell zugesagt, so dass die Liste der Autorinnen und Autoren – aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen, aus Theater und Literatur, Weggefährtinnen und -gefährten – immer länger wurde, was schließlich dazu führen sollte, dass wir schon früh auf eine zweibändige Ausgabe zusteuerten. Dies änderte sich auch später nicht mehr, weil die Texte wie angekündigt eintrafen, was uns in Zeiten einer stets arbeitsüberlasteten scientific community und deren Umfeld (und in Zeiten von Corona!) besonders freute. Und Kohärenz haben wir von Anfang an herzustellen versucht, indem wir den potenziellen Beiträgerinnen und Beiträgern – durchaus ungewöhnliche – Vorschläge machten: Sie sollten nicht irgendetwas zu Reemtsmas Œuvre schreiben, das von der Gewaltsoziologie über die Literaturwissenschaft bis hin zu zeitdiagnostischen Beiträgen reicht. Vielmehr baten wir sie, über Zitate, die uns einerseits bemerkenswert (und diskussionswürdig), andererseits für Reemtsmas Werk und Arbeitsweise einigermaßen charakteristisch erschienen, zu reflektieren, die Gedanken des Jubilars weiterzuführen, zu kritisieren, zu modifizieren oder einzuschränken. Sie finden diese Reemtsma-Zitate gegebenenfalls als Motti zu Beginn der Beiträge oder in diesen selbst.
Außerdem wählten wir Abbildungen aus, die für bestimmte Momente in der Gewaltgeschichte stehen und sich unter Rückgriff auf das vom Jubilar entwickelte theoretische Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse anbieten. Diese etwa:
Oder diese:
Schließlich formulierten wir konkrete Themenvorschläge, die sich auf das weite und von Jan Philipp Reemtsma bereits abgesteckte Feld von Vertrauen und Gewalt beziehen, beispielsweise zu Reemtsmas Diagnose des Schweigens der Soziologie zum Problem der Gewalt, zu seinem Plädoyer für eine triadische Konzeption der Gewalt oder der Unterscheidung zwischen lozierender, raptiver und autotelischer Gewalt.
Wer über ein anderes Thema schreiben wollte, das ihr oder ihm mit Blick auf den Jubilar wichtiger war, konnte dies natürlich gerne tun. So erhielten wir Beiträge über Inspiration und Vertrauen, über einen problematischen Namengeber, über Exilforschung und das koloniale Erbe Deutschlands sowie – aus der Feder von Jürgen Habermas – eine erstmals für die deutsche Leserschaft ausgearbeitete Aufzeichnung über diachrone Gerechtigkeit. Früh musste uns leider Albrecht Schöne, emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Göttingen, absagen. Er hätte sich gerne an der Festschrift beteiligt, doch sein hohes Alter und Gesundheitszustand hinderten ihn daran. Zu seinem großen Bedauern war es auch Hans Magnus Enzensberger aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, wie beabsichtigt ein Gedicht zur Festschrift beizusteuern. Und Joachim Latacz, bis 2002 Ordinarius für Griechische Philologie an der Universität Basel, konnte ebenfalls krankheitsbedingt seine komprimierte Neu-Interpretation der Ilias am Beispiel der Darstellung ihres Haupt-›Helden‹ Achilleus durch Homer nicht beenden. Alle drei gratulieren dem Jubilar herzlich.
An dieser Stelle noch ein Wort zu Literatur und Literaturwissenschaft, wie wir sie mit der Person Jan Philipp Reemtsma verbinden. Bei der Bedeutung, die beides für ihn hat, wird es nicht verwundern, dass dieses Wort doch ein längeres sein muss:
»Wie redet man über Literatur? – wie man möchte, was soll’s? Denkbar dennoch, daß man es gar nicht täte. Nicht aus irgendeinem Grund, sondern weil es eben Brauch wäre, es nicht zu tun.«1 Diese Sätze, die Reemtsmas Schriften zur Literatur eröffnen, sind dem soziologischen Blick des Jubilars geschuldet, denn der Literaturwissenschaftler würde es natürlich nicht für denkbar halten, dass man nicht über Literatur spricht. Wir folgen hier Reemtsmas Phantasie nicht weiter, die das gesellschaftliche Verstummen angesichts fiktionaler Texte ausmalt – sie entwirft beispielsweise »Das Schweigen eines Dummkopfs bei der Lektüre des ›Tristram Shandy‹« als Stoff für einen neuen Roman von Laurence Sterne –, sondern fragen, wie denn Jan Philipp Reemtsma über Literatur redet und schreibt.
Neben der systematischen, theoriebasierten Befragung der kompletten Wissenschaft – »Was heißt: einen literarischen Text interpretieren?«2 – ist hier vor allem die Kreativität zu nennen, die scheinbar Unvereinbares in einem fruchtbaren Betrachtungs- und Argumentationsraum zusammenbringt. Wer sich Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür mit der ähnlich gelagerten Problemkonstellation des Rambo-Films »First Blood« erschließt, muss zwar mit Gegenwind aus der Zunft rechnen, aber er erhält die Chance, einen originellen Blick auf den Gegenstand zu gewinnen, der anderes zutage fördert, als es der jeweils gerade herrschenden Wissenschaftskonvention – Reemtsma spricht von »Moden« – gelingen könnte. Der Reflex gegen literaturwissenschaftliche »Moden« und ihre komplexen und gelegentlich überzogenen Begrifflichkeiten und das Beharren darauf, dass man anders, aber nicht weniger fundiert, und vielleicht anders besser über Literatur reden kann, lässt sich zwar durchaus als konservativer Reflex gegen die Kulturwissenschaften lesen. Fruchtbarer ist es, darin eine Herausforderung zum wissenschaftlichen Mut zu sehen, die Konventionen allenfalls als Angebot zu betrachten und der eigenen Lektüre, den eigenwilligen Fragen des lesenden Individuums zu vertrauen. Das kann dann auch die nur auf den ersten Blick altmodische Frage nach dem Helden und seiner Rolle in unserer Kultur sein.3
Der schreibende Leser Jan Philipp Reemtsma hat über viele Autoren aus einem breiten Spektrum publiziert: Walter Benjamin, Felix Dahn, Robert Gernhardt, Walter Kempowski, Stephen King, Heinrich von Kleist, Karl Kraus, Gotthold Ephraim Lessing und William Shakespeare, um nur einige zu nennen. Schwerpunkte in seinem Werk bilden die Auseinandersetzung mit Arno Schmidt und Christoph Martin Wieland; der eine ein singulärer Autor des zwanzigsten Jahrhunderts, der sich seine literarischen Verbündeten ausschließlich in der Vergangenheit suchte, der andere einer dieser Verbündeten, der als aufklärerischer Prinzenerzieher nach Weimar zog und die Weimarer Klassik begründete. Gemeinsam haben beide, dass ihre literarische und intellektuelle Bedeutung im literaturwissenschaftlichen und feuilletonistischen Gespräch nicht ausreichend gewürdigt wurde, bis Reemtsma sich auf vielerlei Weise eingemischt hat.
Denn das tut er auch als Vorleser: Mit Joachim Kersten und Bernd Rauschenbach bereiste er die Theater und Buchhandlungen der Republik, um Arno Schmidt den Lesern und Leserinnen ans Herz zu legen. Gut vorgetragen entpuppt sich dessen vermeintlich schwierige Prosa plötzlich als ungeheuer zugänglich, witzig und lebensnah. Reemtsma hat neben einem großen Teil des schmidtschen Œuvres auch Wielands wichtigsten Roman Aristipp auf CD eingelesen.
Als Stifter hat er vieles erst möglich gemacht: Nun können Interessierte das Wieland-Gut Oßmannstedt ebenso besichtigen wie das Arno-Schmidt-Haus in Bargfeld. Literaturausstellungen zum Werk Schmidts und Peter Rühmkorfs im Schiller-Nationalmuseum und der Berliner Akademie der Künste eröffneten neue Wege, sich die Texte und Themen der Autoren zu erschließen.
Dank seines Engagements kann man nun die Werke Arno Schmidts in einer Bargfelder Ausgabe lesen, die 2010 mit der Edition von Zettel’s Traum abgeschlossen wurde. Weitere Editionen sind weit fortgeschritten: Die Oßmannstedter Ausgabe der Werke Christoph Martin Wielands, die kritische Ausgabe der Werke Walter Benjamins, die Edition der ergiebigen Tagebücher des Hamburger Juristen und Politikers Ferdinand Beneke, einer Fundgrube zur Alltagsgeschichte des Bürgertums zwischen Französischer Revolution und Vormärz. 2022 erscheint der erste Band der Oevelgönner Ausgabe von Peter Rühmkorfs Werken.
Das alles sorgt ebenso wie Reemtsmas literaturwissenschaftliche Tätigkeit dafür, dass man dem klugen Leser Jan Philipp Reemtsma folgen kann. Walter Benjamin, Ferdinand Beneke, Paul Celan, Dante, Theodor Fontane, Thomas Mann, Peter Rühmkorf, Arno Schmidt und Christoph Martin Wieland – sie werden auch in dieser Festschrift beleuchtet.
Wir haben die vorliegenden zwei Bände der Festschrift in vier Teile gegliedert, wobei die Muster und Themen, die sich bei der Lektüre der eingegangenen Beiträge herauskristallisierten, titelgebend wurden. Nicht wenige Texte gruppierten sich um das Aufklärungsverständnis von Jan Philipp Reemtsma. Gefragt wird darin nach der »Macht der Aufklärung«, etwa danach, welche Rolle die Humanwissenschaften bei der Aufklärung von Vergangenheit und Gegenwart spielen, oder danach, was (aufklärerische) Kritik heißen kann, aktuelle Probleme der Meinungsfreiheit eingeschlossen.
Zahlreiche andere Beiträge konzentrierten sich auf Reemtsmas Stellung in der aktuellen Gewaltforschung. Wie stellt sich die »Gegenwart der Gewalt« dar? Grundsatzfragen der Gewaltanalyse werden hier ebenso berührt wie diesbezügliche zeitdiagnostische Überlegungen Reemtsmas. Wie die von Reemtsma immer wieder thematisierte »Kommunikation der Gewalt« aussieht und aussehen kann, loten Autorinnen und Autoren aus Soziologie, Geschichts- und Rechtswissenschaft, aus Literaturwissenschaft und Literatur»produktion« aus – entsprechend Reemtsmas Einsicht, wonach es nicht den Sozialwissenschaften allein überlassen bleiben darf, über Gewalt nachzudenken.
Beiträge zum »Eigensinn des Individuums« schließen die beiden Bände ab. Ein Thema, das nicht nur auf einen Schwerpunkt von Reemtsmas Forschungen verweist, sondern auch auf ihn selbst – auf seine Rolle als einflussreicher Stifter und auf seine wissenschaftliche Karriere, die ohne Übertreibung als höchst eigensinnig bezeichnet werden kann, da er sich disziplinär nie festliegen ließ, sich wohl auch nie festlegen wollte, sondern gerade auf ganz ungewöhnliche Weise zwischen den Disziplinen sein fruchtbarstes Arbeitsfeld fand. Und so ist es auch hier: Das Schreiben von Biographie wird ebenso thematisiert wie der von Individuen einzufordernde und ihnen zu zeigende Respekt, die Schwierigkeit, das »Ich« zu fassen, ebenso wie die (fremde) Aneignung individueller schöpferischer Tätigkeit.
So vielfältig die Teile sind, stellen sie doch nur einen Ausschnitt aus Reemtsmas Schaffen dar. Aber einen, von dem wir denken, dass er ins Zentrum von Reemtsmas Denken führt. Die Kreativität, mit der alle Mitwirkenden die Aufgabe angepackt haben, freut uns umso mehr, als sie unsere Ausgangsüberlegung zu Beginn des Festschrift-Unterfangens bestätigt: dass Reemtsmas Schriften zum produktiven Weiterarbeiten und -denken einladen. Und wenn die Leserinnen und Leser diese Einladung annehmen würden, dann wären wir zufrieden – und Jan Philipp Reemtsma sicherlich auch, dem wir und alle Beiträgerinnen und Beiträger herzlich zum siebzigsten Geburtstag gratulieren.
Zum Schluss noch ein Dank, der ebenfalls von Herzen kommt. Andrea Böltken hat das Lektorat besorgt. Ihre sorgfältige und zugleich einfühlsame Hand hat sich einmal mehr als Gewinn für ein Buch erwiesen. Friedrich Forssman, der die Festschrift gestaltet hat, sowie Dietrich zu Klampen, der sie verlegt, haben uns zahlreiche wertvolle Hinweise gegeben und dafür gesorgt, dass am Ende aller Arbeiten zwei schöne Bände stehen. Angelika Sagner von der Hamburger Edition und Svenja Kunze vom Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung haben die mit den vielen Abbildungen verbundenen Klärungen in die Hand genommen. Nach Kräften unterstützt hat uns auch Martina Winkel, Sekretärin der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Mit dem Gelingen des Festschrift-Projekts ist aber insbesondere Matthias Kamm, der Büroleiter des Stiftungsvorstands, verbunden. Als schon seit vielen Jahren enger Mitarbeiter von Jan Philipp Reemtsma hat er uns während der gesamten Entstehungszeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Susanne Fischer Gerd Hankel Wolfgang Knöbl
1 Jan Philipp Reemtsma, »Wie redet man über Literatur?«, in: ders., Schriften zur Literatur, Bd. I, München 2015, S. 7–21 (Zitat S. 7).
2 Ders., Was heißt: einen literarischen Text interpretieren? Voraussetzungen und Implikationen des Redens über Literatur, München 2016.
3 Ders., Helden und andere Probleme. Essays, Göttingen 2020.
Die Macht der Aufklärung
Carsten Brosda»Dass Naphta mitdiskutierte, gab Settembrini recht«Über den Gedanken der Aufklärung im Gespräch
»Das Settembrinihafte der Aufklärung hat vielen missfallen, hatte aber einen guten Grund, der allen Sozialwissenschaften zugrunde liegt: Wer theoretisiert, schlägt nicht zu; eine Gesellschaft, die Leute dafür abstellt, über sie nachzudenken, gibt sich der Vorstellung hin, sie befinde sich in Zeiten, in denen das Denken helfe. Dass Naphta mitdiskutierte, gab Settembrini recht.« Jan Philipp Reemtsma1
Mit dieser verhalten zuversichtlichen Beobachtung leitet Jan Philipp Reemtsma das Fazit seiner groß angelegten Betrachtung über Vertrauen und Gewalt in der Moderne ein. Die literarische Allusion ist präzise gewählt: Thomas Mann verhandelt in seinem Roman Der Zauberberg schließlich auch die Möglichkeiten der Aufklärung und des Gesprächs im Schlagschatten des aufziehenden Ersten Weltkrieges. Reemtsma führt im Anschluss Beispiele aus Literatur und Geschichte an, in denen vor allem der physisch Unterlegene immer weiterredet, in der verzweifelten Hoffnung, dass Kommunikation letzten Endes doch befriedende Wirkung haben, das Zuschlagen verhindert werden könne. Wer auf der Fortsetzung des Gesprächs beharre, vermeide so vielleicht doch, dass das Recht des Stärkeren nur physisch interpretiert werde. Und sei es nur, weil alle anderweitig so beschäftigt sind, dass sie von der Absicht zuzuschlagen abgelenkt werden.
Die Hip-Hopper der Antilopen Gang machten sich erst vor wenigen Jahren in ihrem Song »Pizza« milde über diese Hoffnung lustig, indem sie sie aufs universelle Essen verlagerten und rappten: »Hauptsache, Käse; die Welt ist eine Scheibe / Wer grade Pizza isst, tut keinem Menschen was zuleide.« Genauso funktioniert in den von Reemtsma zitierten Beispielen auch die verbale Nutzung. Solange noch gesprochen wird, wird nicht geschossen. Selbst dann, wenn viele dieser Gesprächsversuche letztlich bloß einen Aufschub erwirken. Und auch, wenn in sicherlich nicht wenigen Situationen gerade das fortgesetzte Reden so sehr missfällt, dass es selbst zum Trigger der Gewalt werden kann, weil das sprachlose Gegenüber keinen anderen Ausweg mehr sieht, die Tiraden zu beenden.
Aber der Kern des lakonischen Verweises auf die Gespräche am Zauberberg liegt meines Erachtens tiefer, als es die Anekdoten und Beobachtungen solcherart strategischer Kommunikation vermuten lassen. Auf den Diskurs- und Streitspaziergängen durchs Gebirge geht es schließlich nicht bloß darum, wie früher auf dem Schulhof als minder bemuskelter Junge mit einer großen Klappe und tollkühnen Sprüchen den Ausweg aus einer drohenden Gewaltlage zu suchen. Hier bahnt sich Grundsätzlicheres an, das sich in alltagsweltlichen Gesprächen ebenso wiederfinden lässt wie in den von Reemtsma angesprochenen Diskussionen über sozialwissenschaftliche Theoriebildung. Durch die Gespräche seiner Protagonisten scheint Mann auch im Zauberberg zu versuchen, die Vernunftansprüche der Aufklärung quasi performativ durch ihre verbale Anwendung selbst zu begründen.
Die Dispute zwischen Settembrini und Naphta und ihr Nachhall bei Hans Castorp lassen sich nämlich durchaus als Manifestation des menschlichen Glaubens an die Kraft der Kommunikation lesen. Die Kontrahenten versuchen, ihre Konflikte eben nicht über das Faustrecht, sondern durch geistige Auseinandersetzung beizulegen. Und schon lange bevor er sich verbal mit Naphta duelliert, lässt der pädagogisch ambitionierte Settembrini kaum etwas unversucht, um die praktische Ingenieursintelligenz Castorps um einen aufgeklärten Humanismus zu erweitern. Der Umstand, dass in dem Roman so viel und so weit ausgreifend geredet wird, gerinnt so zum Beleg, dass dieser kraftzehrenden Tätigkeit von »unserer redseligen Spezies«2 (Jürgen Habermas) ein Sinn zugeschrieben wird. Kommunikation dient eben nicht nur dem Austausch von Informationen und Meinungen, sondern schafft gleichermaßen im Akt des Sprechens und im nicht minder bedeutenden Akt des Zuhörens die Grundlage einer sozialen Beziehung. Deren Potenzialen soll im Folgenden nachgegangen werden.
Die soziale Bindungskraft des Sprechens
»Dass Naphta mitdiskutierte, gab Settembrini recht«, schreibt Reemtsma. Nicht im Gehalt der getätigten Aussagen, die meist auf erbitterten Widerspruch stoßen, sehr wohl aber in der Unterstellung, dass Kommunikation gelingen könne. Wer spricht und diskutiert, geht davon aus, dass der Gesprächspartner daran interessiert ist, Gründe zu wägen, Geltungsansprüche zu hinterfragen und den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zu akzeptieren. Die Diskutanten unterstellen einander – und sei es auch kontrafaktisch –, dass Verständigung möglich sein kann. Das gilt nicht nur im sozialwissenschaftlichen Seminar, sondern entfaltet beinahe überall im Alltag Wirkung. Der abschließende Hinweis in Vertrauen und Gewalt stößt daher die Tür zu einem Verständnis der modernen Gesellschaft als zumindest nach Gewaltfreiheit strebender Kommunikationsgemeinschaft sperrangelweit auf.
Dies geschieht nicht im normativen Kammerton der Moralphilosophie, sondern ist gekleidet ins Gewand einer sozialwissenschaftlichen Theorie der Gesellschaft und ist damit weniger von ontologischen Unterstellungen als vielmehr von empirischen Beobachtungen geprägt. Reemtsma verweist implizit auf jene Überlegungen zur Integration einer modernen Gesellschaft durch das kommunikative Handeln ihrer Bürgerinnen und Bürger, für die er bereits 2001 Jürgen Habermas anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gewürdigt hat.3 Die beiden Großdenker der Bundesrepublik Deutschland sind sicherlich keine unmittelbaren wissenschaftlichen Gefährten, teilen aber ein sehr feines Pathos der Nüchternheit4 und ein nicht minder reflektiertes Understatement. Durch beider Skepsis schimmert ein anthropologischer Optimismus hindurch, der im besten Sinne aufklärerisch zu nennen ist – sowohl im Hinblick auf seine gesellschaftstheoretischen als auch auf seine wissenschaftspraktischen Implikationen.
Dass Reemtsma die habermassche Kommunikationszuversicht dabei durchaus distanziert betrachtet, mag eine Passage aus einer Rede über Gewalt als Lebensform demonstrieren, in der er mit Witz verdeutlicht, warum das Beharren auf Begründungen in der Alltagskommunikation durchaus zügig an seine Grenzen stoßen kann. Dort heißt es: »Jemand trinkt sehr gerne nach Torffeuerrauch schmeckenden Maltwhisky. Warum in aller Welt tut er das? Na, er schmeckt ihm eben. Wenn er diesen Geschmack nicht schätzte – er tät’s nicht. Ja, aber das Zeug schmeckt doch abscheulich – wie Moorleiche! Und auch noch Schnaps! Ja, Du magst das nicht, er schon. Aber warum? Wann ist das eine sinnvolle Frage? Zum Beispiel dann, wenn er sich, nachdem er ein Glas getrunken hat, stets erbricht, weil er eigentlich keinen Alkohol verträgt, und immer sagt: ›Eigentlich trinke ich viel lieber Gin Tonic, aber den vertrage ich auch nicht‹. Das wäre ein guter Anlass zu fragen, was hier eigentlich los ist. Nur sind die Probleme, vor die man gestellt ist, selten dieser Art.«5 Ganz offensichtlich gibt es Bereiche des Menschlichen, die sprachlich kaum zureichend zu erfassen sind, weil sie eben nicht primär auf rationalen Begründungen beruhen. Geschmacksurteile, ästhetisch-expressive Wertungen oder emotionale Zustände gehören regelhaft dazu. Und damit so mancher Wesenskern unserer modernen humanen Existenz.
Von dieser Beobachtung wäre es nicht mehr weit bis zu der Feststellung, dass jeder Versuch, die menschliche Vernunft im Gespräch über die guten Gründe für eine Aussage zu verorten, nur eitler Intellektualismus sein könne, der die Bedingungen der universitären Seminarkommunikation mit den rauen Umständen des lebensweltlichen Alltags verwechsele, in denen man eben akzeptieren müsse, wenn jemand schrecklich schmeckendes Zeug säuft. Aber wer zugleich – und sei es noch so spöttisch – auf das »Settembrinihafte der Aufklärung« verweist, der verortet den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit dann eben letztlich doch in einer sprachlichen Äußerung im sozialen Zusammenhang, mithin im Gespräch oder im sogenannten kommunikativen Handeln, in dem es um Verständigung geht und damit um weit mehr als bloß um das Äußern einer Erkenntnis oder einer Information. »Wenn einem keiner sagt, was man tun soll, woher soll man’s wissen?«, fragt Reemtsma in seinem instruktiven Porträt der Zeit Lessings in Hamburg, in dem er dessen geschliffen maßlose Polemiken als streitbare Versuche der Wahrheitsfindung in aufklärerischem Interesse zu deuten vermag.6 Schließlich betone schon Lessing selbst, dass es des Streits – mithin eines kommunikativen Austausches über die Sache oder ihre Moral – bedürfe, um der Wahrheit zumindest ein Stück näher zu kommen.7
Und tatsächlich: Wer sich auf die von der US-amerikanischen pragmatischen Sprachphilosophie inspirierte und dennoch knochentrocken sozialwissenschaftliche Rekonstruktion der Kommunikationsbedingungen moderner Gesellschaften bei Habermas einlässt, der kann heute nach wie vor eine belastbare Grundlage für ein bei aller Leidenschaft eben doch vernünftiges und aufgeklärtes gesellschaftliches Miteinander entdecken. Dieses Fundament ist schmal und brüchig, besteht es doch lediglich aus den wechselseitigen Erwartungen, die Sprecherinnen und Sprecher im sozialen Kontext aneinander haben. Ihr kommunikatives Handeln hat mehrere, potenziell verwobene Dimensionen, die Habermas in Anlehnung an die sprechakttheoretischen Überlegungen von Austin und Searle rekonstruiert: Wenn zwei Personen miteinander sprechen, dann wird etwas ausgesagt (lokutionärer Akt), dann wird mit der Aussage eine Handlung im sozialen Kontext vollzogen (illokutionärer Akt) und dann wird durch die Aussage etwas in der Welt bzw. beim Zuhörer bewirkt (perlokutionärer Akt).8
Insbesondere die in etwas sperriger Terminologie als illokutionäre Akte bezeichneten sozialen Kontextualisierungen sind für die Fortsetzung eines Gesprächs von entscheidender Bedeutung. Sie machen aus der Äußerung eine soziale Handlung und schaffen damit einen Zusammenhang, der über die bloße Informationsvermittlung des Sprechens hinausgeht. Wer mit jemandem spricht, setzt sich unmittelbar auch zum Gegenüber in Beziehung. »Mit der illokutionären Kraft seiner Äußerung kann ein Sprecher einen Hörer motivieren, sein Sprechaktgebot anzunehmen und damit eine rational motivierte Bindung einzugehen.«9 Das passiert offensichtlich zwischen Settembrini und Naphta und ist gleichsam die Voraussetzung dafür, vor dem Hintergrund einer oft nicht realisierten, gleichwohl aber gemeinsam unterstellten idealen Sprechsituation eine soziale Grundlage des Gesprächs zu schaffen. Diese ist wiederum Voraussetzung dafür, auch in den Inhalten nach Gemeinsamkeiten und Übereinkünften, nach Einverständnis und Verständigung zu suchen – oder eben nach den Aspekten, in denen man sich respektvoll darauf verständigt, unterschiedlicher Ansicht zu sein. In diesen Überlegungen werden die Konturen eines Verständnisses von Vernunft sichtbar, das weit über jede zweckrationale Verengung hinausgeht und Aspekte des Sozialen und Kulturellen explizit einbezieht, weil sie für den notwendigen kommunikativen Austausch zwingende Bedingungen sind.
»Die ideale Sprechsituation ist weder ein empirisches Phänomen noch ein bloßes Konstrukt, sondern eine in Diskursen unvermeidlich reziprok vorgenommene Unterstellung«, schreibt Habermas. Und er führt weiter aus: »Diese Unterstellung kann, sie muß nicht kontrafaktisch sein; aber auch wenn sie kontrafaktisch gemacht wird, ist sie eine im Kommunikationsvorgang operativ wirksame Fiktion. Ich spreche daher lieber von einer Antizipation, von einem Vorgriff auf eine ideale Sprechsituation. Dieser Vorgriff allein ist Gewähr dafür, daß wir mit einem faktisch erzielten Konsens den Anspruch eines vernünftigen Konsenses verbinden dürfen; zugleich ist er ein kritischer Maßstab, an dem jeder faktischer Konsensus auch in Frage gestellt und daraufhin überprüft werden kann, ob er ein hinreichender Indikator für einen begründeten Konsens ist.«10
Oft ist im Anschluss an diese Überlegungen aufgeregt diskutiert worden, wie wahrscheinlich das Erreichen eines solchen Konsenses eigentlich ist. Das ist meistens eine gezielt ablenkende Scheindiskussion, denn schon Habermas selbst geht zumindest mit Blick auf das gesellschaftliche Zeitgespräch von der Fortsetzung des Dissenses aus. Schließlich ist er die Grundlage aller weiteren Kommunikationsnotwendigkeiten, solange eine Übereinkunft über die Regeln des Gesprächs grundsätzlich möglich ist. Die Option der Verständigung zwischen kommunikativ handelnden Interaktionspartnern ist in Form illokutionärer Bindungskräfte bereits tief in sprachliche Strukturen eingelassen. Sie ermöglichen die Gewähr dafür, dass die erhobenen Geltungsansprüche auf Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Aussage gegebenenfalls durch rationale Begründungen eingelöst werden können, die einer Kritik des Hörers standzuhalten vermögen. Der illokutionäre Bindungseffekt erwächst also nicht aus der Gültigkeit des Gesagten, sondern aus dem »Koordinierungseffekt der Gewähr« dafür, dass erhobene Geltungsansprüche eingelöst werden können.11 Wer ernsthaft spricht und streitet, lässt sich in der Regel auf die Spielregeln der Aufklärung ein – oder muss sich mindestens an ihnen messen lassen. Die Chance, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen, steigt in diesen Fällen.
Die Verflüchtigung der Wahrheit
Diese aufklärungsoptimistischen Überlegungen waren schon kühn, als Habermas vor mehr als einem halben Jahrhundert versuchte, mit ihnen aus der Sackgasse herauszumanövrieren, in die Adorno und Horkheimers kulturkritische Analysen die kritische Theorie hineingefahren hatten.12 Ideen wie die kontrafaktische Unterstellung der Verständigungsorientierung, die Herrschaftsfreiheit sozialer Diskurse oder die aufklärerische Wirkung öffentlicher Kommunikation zogen schon damals viel Kritik auf sich. Oft beruhte diese Kritik auf dem allzu bereitwillig herbeigeführten Missverständnis, dass es sich bei den Überlegungen zu einer kommunikativ gewendeten Gesellschaftstheorie gleichsam um moralische Appelle handele und nicht um die Rekonstruktion jener regulativen Ideale, deren oftmals dramatische Kontrafaktizität überhaupt erst jene normative Erwartungsspannung empirisch entfalten konnte, die fortgesetzte Zuversicht in das Gelingen gesellschaftlicher Aufklärung zu rechtfertigen vermochte.
Der zwanglose Zwang des besseren Arguments lässt sich dann zwar immer noch gewaltsam durchbrechen – aber immerhin muss allen Beteiligten bewusst sein, dass hier Gewalt angewendet wird, weil die sprachlichen Möglichkeiten erschöpft und keine guten Gründe mehr zu finden sind. Mit Reemtsma, der Gewalt trotz aller Ächtung in der Moderne auch als kommunikatives Mittel betrachtet und die Nähe des Streits zur Gewalt explizit betont, ist die physische Gewaltanwendung in solchen Situationen zunächst als eine Veränderung des Kommunikationsmodus zu interpretieren,13 während Habermas in ihr einen Ausdruck des ultimativen Abbruchs der Kommunikation sieht. In Habermas’ Denken kommt Gewalt als ein Modus des Austausches zwischen Individuen schon konzeptionell nicht vor.
In den Überlegungen der Theorie des kommunikativen Handelns, die Kommunikation als einen verbalisierten sozialen Austausch betrachtet, wird der Maßstab der Kritik an davon abweichenden Verhaltensund Handlungsweisen gleichsam in die sprachliche Kommunikation und ihre pragmatischen Grundprinzipien hineingelegt. Jede Notwendigkeit eines metaphysischen oder transzendentalen Bezugs entfällt ebenso wie jede Möglichkeit, die Kommunikation unter Aufrechterhaltung ihres sozialen Sinns in einen anderen, nicht rationalen, sondern physischen Modus zu verlagern. Auch eine letzte Begründung der erhobenen Geltungsansprüche ist nicht mehr notwendig (und auch nicht mehr möglich), es reicht die universalpragmatisch ernüchterte Plausibilität der Annahme, dass sich niemand die Strapazen des Gesprächs aufladen würde, ohne zu unterstellen, dass es einen Sinn haben könnte. Die Fortsetzung des Gesprächs gibt somit dem Aufklärungsoptimisten recht.
Heute zögert man zweimal, bevor man sich derart zuversichtlichen Rekonstruktionen des gesellschaftlichen Gesprächs nähert. Voller Emphase wird zwar selbst in den USA immer noch die Relevanz der conversation of democracy beschworen und damit John Deweys lange Zeit prägender Blick auf öffentliche Kommunikation in der Demokratie aktualisiert.14 Zugleich aber steckt allen Beobachtern die Erfahrung in den Knochen, dass in den letzten Jahren in vielen modernen Demokratien das Prinzip der Postfaktizität zu völlig neuen Blüten getrieben wurde. Und zwar durchaus im Anschluss an jene postmodernen und poststrukturalistischen Überlegungen, mit denen sich die Rationalisten Habermas und Reemtsma wiederholt kritisch beschäftigt haben. Die Plausibilität der – auf einem intuitiven Verständnis für die illokutionären Aspekte des Sprechens beruhenden – Annahme, dass auch der Gesprächspartner recht haben könne, ist jedenfalls in vielen öffentlichen Kommunikationskontexten schwer erschüttert.
Die ehemalige Literaturkritikerin der New York Times Michiko Kakutani hat die Verflüchtigung öffentlicher Wahrheitsansprüche eindringlich in ihrem Buch Der Tod der Wahrheit analysiert, in dem sie sich mit der besonderen Situation in den USA während der Präsidentschaft Donald Trumps auseinandersetzt – und in dem sie eine erstaunliche Umkehrung der Wirkung postmoderner Erzählperspektiven im politischen Gespräch beschreibt.15 Zunächst zeichnet sie nach, wie befreiend die Ideen der Postmoderne seit den sechziger Jahren auf Kunst und Kultur gewirkt haben, weil sie ehemals eherne, vermeintlich objektive und in Stein gemeißelte Wahrheitsansprüche verflüssigten, indem sie sichtbar machten, dass es unterschiedliche Erzählungen, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Biographien gibt, die zu unterschiedlichen Zugriffen auf Wirklichkeit führen können.
Insbesondere in der Kunst ist diese Verflüssigung der Perspektiven auf das, was uns eigentlich ausmacht, zunächst als ein großer Gewinn gewertet worden. Festgefügte Traditionen und Machtansprüche landen so auf dem Stapel des Gestrigen. Beinahe alles kann infrage gestellt, diskutiert und verhandelt werden. »Der Mut der Erkenntnis und des Ausdrucks, das ist die Literatur, es ist die Humanität …«, lässt Mann seinen Settembrini sagen.16 In dem Moment aber, in dem dieses Verflüssigen in Gesellschaft und dann noch weiter in Politik hineindringt und sich mit Narzissmus und Beliebigkeit verbindet, besteht die Gefahr, dass sich Zusammenhänge auflösen und sich damit die Möglichkeit verflüchtigt, im Gespräch aus individuellen Wahrnehmungen wieder eine gemeinsam unterstellte Lebenswelt zu vereinbaren. Wir gestehen dann zwar jedem Einzelnen zu, einen eigenen Zugriff auf die Wirklichkeit zu haben, sind aber nicht mehr in der Lage, die Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven in einer kohärenten Form so zusammenzubringen, dass wir als Gesellschaft noch handlungsfähig sind. In diesem Moment egalisiert sich der Anspruch der Überprüfbarkeit der erhobenen Geltungsansprüche durch den Hinweis, dass ja jeder das Recht habe, frei seine Meinung zu äußern. Kontrafaktisch ist dann nicht mehr nur die Unterstellung der Verständigungsbereitschaft und des Koordinierungseffekts der Prüfbarkeit von Geltungsansprüchen, sondern plötzlich schon der erhobene Geltungsanspruch der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, ja manchmal sogar der Richtigkeit. Sprache wird zu einem Spiel ohne Regeln, ohne freiheitliche Verantwortung für das Gesagte, ohne Interesse an wechselseitiger sozialer Bindungskraft. Entscheidend ist allein das Interesse an Wirkung, nicht durch klassisches rhetorisches Überwältigungssprechen, sondern durch gleichsam von allen Bezügen losgelöste Behauptungen, die eine Projektionsfläche für die Wahrheitsannahmen und -wünsche der Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen.
Aufgrund solcher Strategien, die sich von der Wahrheitsorientierung abwenden und zugleich journalistische und politische Diskursinstitutionen delegitimieren, können zunehmend »kommunikative Inhalte nicht mehr in der Währung kritisierbarer Geltungsansprüche ausgetauscht werden«, schreibt Habermas in einer aktuellen Betrachtung. »Nicht die Häufung von Fake News« ist dann »für eine verbreitete Deformation der Wahrnehmung der politischen Öffentlichkeit signifikant, sondern der Umstand, dass aus der Perspektive der Beteiligten Fake News gar nicht mehr als solche identifiziert werden können«.17 Das liegt nicht in erster Linie an einem wie auch immer gearteten dramatischen kommunikativen Kompetenzverlust der Sprechenden, sondern vor allem an den Wirkweisen der Systeme digital-algorithmischer Kommunikationsvermittlung. Diese stellen wie die klassischen Massenmedien einen professionellen Modus der Informationsauswahl und -vermittlung dar. Allerdings beruht die Auswahl nicht auf der allgemeinen Relevanz der vermittelten Information, sondern auf der datengetrieben ausrechenbaren individuellen Passung. An die Stelle intersubjektiver Nachvollziehbarkeit tritt subjektives Gefallen. Dadurch gehen Wertmaßstäbe ebenso verloren wie soziale Bezüge, die sonst durch kommunikative Klärung überhaupt erst entstehen.
In den Begrifflichkeiten der Theorie des kommunikativen Handelns gesprochen, gewinnen hier die perlokutionären Aspekte des Sprechaktes, also die strategisch wirkungsorientierten Bestandteile des im sozialen Kontext Gesprochenen, erheblich an Bedeutung. In solchen Äußerungen, in denen der illokutionäre Effekt hinter Machtbeziehungen zurücktritt und in denen perlokutionäre Effekte überwiegen, hat der Hörer aufgrund der den genuinen Sprechakt erweiternden Faktoren (gemeint ist vor allem ein externes Sanktionspotenzial, welches das Fehlen rationaler Motivation kompensiert) nicht die Möglichkeit, das Sprechaktangebot selbstbestimmt auf der Basis einer rationalen Prüfung der erhobenen Geltungsansprüche zu bewerten.18 Diese Wirkung ist gerade dann besonders groß, wenn diese strategischen Aspekte gut verschleiert hinter allgemeinen Überlegungen unsichtbar werden.
Selbst eine aufklärerische Methode wie das postmoderne Erzählen, die ja eigentlich die Kontingenz eines jeden Wahrheitsanspruchs relativieren soll, verkehrt sich in solchen Momenten ganz offensichtlich in ihr Gegenteil, wenn sie in die falschen Hände gerät. Die Freiheit der individuellen Behauptung steigt dann zwar ins Unermessliche, zugleich aber gelingt es offensichtlich immer seltener, aus der Vielheit dieser Stimmen die Vernunft einer modernen Gesellschaft herauszuhören. Wenn dann noch eine narzisstische Lust an der Polemik hinzukommt, die sich nicht auf die streitbare Klärung der Sache, sondern auf ein personalisiertes Kräftemessen fokussiert, richtet sich das Sprechen zunehmend gegen die Ideen der Aufklärung, die einst seinen sozialen Wert begründet haben.
Grundsätzlicher gesprochen: Freiheit ohne sozialen Kontext frisst augenscheinlich nur allzu oft die Bedingungen auf, die sie überhaupt gewährleisten können. Die Befreiung des Einzelnen durch das Anerkenntnis seiner individuellen Perspektive und Narration markiert zwar zunächst einen emanzipatorischen Fortschritt. Wenn sie aber mit Machtkalkül strategisch missbraucht wird, kann sie auch zum Verlust eines gemeinsamen Weltverständnisses führen. Die unterschiedlichen Konstruktionen der Wirklichkeit werden dann ratlos, gleichgültig oder aggressiv nebeneinander vertreten. Es ist jedenfalls zu vermuten, dass es Settembrini eher nicht in den Sinn gekommen wäre, fortgesetzt einfach etwas zu behaupten, um Naphta aus dem Konzept zu bringen, dass er wohl kaum seine Wahrheitsansprüche nach Belieben einem strategischen Gesprächsziel angepasst hätte. Möglicherweise wäre das Gespräch dann sofort beendet worden. Oder das letztlich dann doch physische Duell, dessen Regeln sich beide Protagonisten im Roman entziehen, hätte schon weitaus früher stattfinden müssen.
Wie wir aber heute damit umgehen, dass die Wahrheit und die ihr zugrunde liegende Faktizität nicht bloß hinterfragt werden können, sondern dass sie ganz generell zur disponiblen Masse geworden sind, markiert eine Weggabelung in der weiteren Entwicklung der Aufklärung. Denn natürlich bleibt es ein immenser Freiheitsgewinn, dass die Wahrheit nicht mehr festgefügt ist, sondern zum Tanzen gebracht werden kann. Dass jede Bürgerin und jeder Bürger die je eigene Sicht der Dinge öffentlich äußern und verbreiten kann, ohne Vermittlungsinstanzen, Filter und Bevormundung, ist ein alter Traum jeglichen Bemühens um Demokratisierung. Zugleich aber zerbricht etwas, wenn wir uns nicht auch darum bemühen, weiterhin das Gemeinsame, das Wahre zu bestimmen – mit Blick auf die conditio humana genauso wie mit Blick auf die Werte und Regeln unseres Zusammenlebens.
Unter den aktuellen Bedingungen des gesellschaftlichen Diskurses ist das nicht nur in den USA und ihrer dortigen tief gespaltenen politischen Öffentlichkeit schwieriger geworden.19 Die Gründe dafür werden in vielen Büchern und Artikeln immer wieder diskutiert. Manches Mal geschieht dies in einem apodiktischen Tonfall, der sehr an die Fundamentalkritik von Adorno und Horkheimer an der medialen Kulturindustrie moderner Massendemokratien erinnert.20 Habermas wiederum reagiert auf diese unerbittlich düsteren Zerfallsszenarien im Strukturwandel der Öffentlichkeit, indem er die widersprüchlichen Charakteristika demokratischer Öffentlichkeit zwischen freiem Räsonnement und neuerlicher Vermachtung durch demonstrative Machtdarstellung in medialer Vermittlung herausarbeitet und damit eher Spannungsverhältnisse und bis heute offenstehende Optionen betont.21 Er konzediert in einer jüngsten Aktualisierung, dass der »egalitäre und unregulierte Charakter der Beziehungen zwischen den Beteiligten und die gleichmäßige Autorisierung der Nutzer zu eigenen spontanen Beiträgen« Potenziale auf digitalen Plattformen darstellen, die durchaus den ursprünglichen Überlegungen zu einer aufklärerischen Öffentlichkeit zu entsprechen scheinen. Aber er schreibt weitergehend auch: »Dieses große emanzipatorische Versprechen wird heute von den wüsten Geräuschen in fragmentierten, in sich selbst kreisenden Echoräumen übertönt.«22 Bleibt also die Frage, ob Naphta heute überhaupt noch hören könnte, was Settembrini zu sagen beabsichtigt.
Trotz alledem: das gesellschaftliche Gespräch
Die aktuelle Kritik an den modernen digitalen Kommunikationsverhältnissen läuft im Kern darauf hinaus, dass Settembrini gar nicht mehr performativ recht behalten kann mit seinem Aufklärungsoptimismus, weil er und Naphta sich in den digitalen Weiten gar nicht mehr finden würden. Wer die literarischen Dystopien der Digitalmoderne zur Hand nimmt, findet als einen wiederkehrenden Topos stets die Vereinzelung des Menschen in einer Welt, die soziale Bezüge und ihre eigene Wiederverzauberung nur technisch kalkuliert vorgaukelt. Ein als ›echt‹ empfundenes Miteinander, also eben jene Empathie im Sinne einer »Einsicht in die Umstände, die auch uns in Situationen bringen können, in denen wir uns nie zu finden hofften«,23 die für Reemtsma Voraussetzung der Aufklärung ist, lässt sich in diesen literarischen Betrachtungen meist nur außerhalb der technischen Systeme finden.24
Und auch die sozialwissenschaftliche Analyse betont heutzutage, dass das Zueinanderkommen von Naphta und Settembrini durch die technisch zweckrationale Zurüstung ihrer kommunikativen Umstände mindestens deutlich erschwert wird. Jeder ist in seiner eigenen Blase zwar potenziell unendlich vernetzt und global erreichbar, faktisch aber eben doch von seinesgleichen umgeben, und das uniforme Echo zunehmend gefestigt in individueller Welt- und singulärer Selbstwahrnehmung. Die Sphäre, in der das Aushalten von Differenz und Uneindeutigkeit zur Kompetenz des Lebens und Teilhabens in einer aufgeklärten Gesellschaft hätte werden können, der öffentliche Raum des gesellschaftlichen Gesprächs, scheint längst in einzelne Parzellen zerfallen. Alle Maßstäbe scheinen verloren. Und die Arenen, in denen aus kultureller Differenz durch das gemeinsame Sprechen soziale Solidarität hätte wachsen können, scheinen kaum noch erreichbar.
Selbst jene Diskursräume, in denen die Wissenschaftlichkeit einer Aussage, mithin die empirisch und methodisch gestützte Validität und Reliabilität ihrer Geltungsansprüche, einen besonderen Wert erfahren sollte, nehmen manche heutzutage nur noch als Blase neben weiteren wahr und nivellieren sie so trotz ihrer hochgradigen Ausdifferenzierung beinahe unterschiedslos. In der öffentlichen Kommunikation vor allem während der Corona-Pandemie ist nochmals verschärft deutlich geworden, in welchem Maße ein vulgarisierendes Verständnis von Meinungsfreiheit ein wissenschaftliches Forschungsergebnis gleichrangig zu einer Äußerung neben den Facebook-Posts ehemaliger Fernsehköche schrumpfen lässt. Wenn aber alles bloße Meinung ist, dann kommen einer Gesellschaft die Maßstäbe der Verständigung genauso abhanden, wie wenn einzelne Sprecherpositionen aufgrund von Status und Reputation als unangreifbar begriffen werden.
Neben rationale Bezüge treten dann plötzlich ganz andere, zum Teil widerstreitende Kriterien. Aus einer sozialwissenschaftlichen Beobachterposition heraus wird deutlich, dass derartige, nicht diskursive Aspekte die Spielräume rationaler Verständigung einengen oder gar vollständig überlagern, weil der Wille zum vernünftigen Austausch nicht mehr wechselseitig unterstellt wird. Hier finden die Diskursmöglichkeiten in modernen Gesellschaften ihre Grenze. Hier führen zu viel Toleranz und Verständnis paradoxerweise zur Einengung ihrer eigenen Möglichkeiten. Natürlich sind Affekte und Emotionen immer auch Teil der öffentlichen Kommunikation, oft treiben sie sie maßgeblich an. Aber es wird problematisch, wenn sie keinen Zugang zu anderen Ebenen des Austausches mehr gewähren.
Beispiele dafür finden sich in letzter Zeit zuhauf. So hat Reemtsma erste Demonstrierende gegen die Corona-Maßnahmen schon im Mai 2020 in einem Interview mit der tageszeitung als narzisstisch Übersteuerte beschrieben, die in einer Affektgemeinschaft zusammenkämen. Es seien die »konstitutionell Labilen«, sagte er, die ihre eigene Verunsicherung in den zunächst krude wirkenden Gemeinschaften bei Anti-Corona-Demos zu verstecken oder zu kompensieren versuchen. Wer sich seiner eigenen Situation grundsätzlich nicht sicher sei, der reagiere auf die Unsicherheiten einer unüberschaubaren und dynamischen Situation nicht selten mit ungesteuerter Empörung. Diese »Bewegung« müsse man aushalten: »Wir überschätzen das Politische immer, weil wir meinen, über Politik gut miteinander reden zu können. Wir können über Affekte reden, aber mit rein affektiv Gesteuerten nicht. Das möchten wir aber zuweilen tun, und dann vergessen wir, was wir sehen, und reden uns ein, es gehe um Politik.«25
Es wäre naiv zu glauben, in solchen Situationen müsse man sich nur ganz besonders darum bemühen, vernünftig zu sprechen, dann würde alles wieder gut. Das Beispiel verweist, ähnlich wie die Single-Malt-Anekdote, vielmehr auf die Grenzen diskursiver Möglichkeiten, die immer dann erreicht sind, wenn sich eben nicht alle Beteiligten am Diskurs wechselseitig Verständigungsbereitschaft unterstellen, sondern den sozialen Sprechzusammenhang durch Misstrauen und Empörung zum Kollaps bringen. Die alte Weisheit stimmt: It takes two to tango. Wenn jemand nämlich trotz aller naheliegenden Vorbehalte auch beim krudesten Querdenker noch versuchen würde, Verständigungsbereitschaft zu unterstellen und den Austausch fortzusetzen, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ihm aus verschwörungsideologischen Erwägungen heraus abgesprochen würde, an der Wahrheit interessiert zu sein. Eine Verständigung oder auch nur ein Einverständnis ohne Akzeptanz der Gründe wäre dann trotzdem kaum möglich.
Der Gedanke einer gesellschaftlichen Selbstaufklärung im Gespräch der Vielen braucht aber das gemeinsame Verständnis der notwendigen Vernunftmaßstäbe des Gesprächs, die dann auch erbitterten Streit, gravierende Divergenzen in der Sache und spitz formulierte, ja gar verletzende Polemiken ermöglichen und aushaltbar machen. Ohne die Rekonstruktion jener Bedingungen der Vernunft des Zwischenmenschlichen, die seit der Aufklärung immer weiter ausbuchstabiert werden, kann es nicht gelingen. Die Verflüssigung der kulturellen Traditionsbestände unserer Gesellschaften, die offensichtliche Möglichkeit, alles und jedes infrage stellen zu können und begründen zu müssen, findet eine natürliche Grenze in jenen praktischen Unterstellungen – oder »Imaginationen«, wie Reemtsma an einer Stelle schreibt – die uns überhaupt sozial handlungsfähig machen. »Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wer wir gemeinsam sind, und erwarten, dass diese Vorstellung von den meisten geteilt wird, weshalb wir annehmen, dass, wenn etwas in der Interaktion oder mit den Institutionen nicht erwartungsgemäß funktioniert, es ein gemeinsames Anliegen ist, das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen.«26
An solch einem Punkt sind wir aktuell. Die Kommunikationskrise tritt vielfach zutage und verlangt die Bereitschaft, sich mit gemeinsamen Anliegen zu beschäftigen. Das Hindernis dabei sind gar nicht unbedingt jene oft diskutierten vermeintlichen ›Spaltungen‹ unserer Gesellschaft, die vielfach weder empirisch noch konzeptionell tatsächlich auf einer Kluft im Kern unseres sozialen Miteinanders beruhen. Vielmehr gilt es, vernünftig mit einer zunehmenden Fragmentierung zwischen vielen verschiedenen Positionen umzugehen. Ihr wäre vor allem mit einer Solidarität der Vielfalt zu begegnen, die allerdings im gesellschaftlichen Gespräch die Akzeptanz jener grundlegenden Kommunikationsregeln bräuchte, deren illokutionäre Bindungskräfte derzeit zunehmend brüchig erscheinen.
Wer nämlich unterschiedslos und bezuglos Meinungen nebeneinanderreiht, der stärkt nicht die Freiheit, sondern der beraubt sich der diskursiven und damit auch der demokratisch deliberativen Möglichkeit, zu einer Vorstellung von Gemeinsinn überhaupt noch vorzudringen. Allzu oft wird dann in öffentlichen Auseinandersetzungen die Idee der Freiheit nur noch individualistisch verkürzt begriffen und nicht zugleich als ein Wert verstanden, der seinen Sinn erst in Gemeinschaft entfalten kann, weil er nur durch die Vorstellung von etwas Gemeinsamem überhaupt gesichert wird. »Eine liberale politische Kultur«, schreibt Habermas zu Recht, »ist kein Wurzelgrund für libertäre Einstellungen; sie verlangt eine, wenn auch in kleiner Münze ausgezahlte Gemeinwohlorientierung«.27
Natürlich hat jede Bürgerin und jeder Bürger einen verfassungsrechtlich verbrieften Anspruch auf Freiheit, genauer gesagt, auf spezifisch benannte Freiheitsrechte, unter denen die Meinungsfreiheit einen hohen Rang einnimmt. Die politische Debatte über diese Rechte kreist aber schon seit Längerem nicht mehr nur darum, dass der Staat sie durch zurückhaltende Nutzung seines Gewaltmonopols sichern müsse, sondern zugleich auch darum, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen zur Inanspruchnahme dieser Freiheiten gewährleistet sein müssen. Es reicht schließlich nicht aus, jemandem nur ein Recht zu garantieren, mit dem dieser dann aufgrund fehlender Rahmenbedingungen gar nichts anfangen kann.
Auch mit Blick auf die Voraussetzungen und Ressourcen des Freiheitsgebrauchs gibt es daher eine politische und gesellschaftliche Verpflichtung, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten. Auch diese muss nicht appellierend eingeklagt werden, sondern kann sozialwissenschaftlich rekonstruiert werden. Dass daraus wirksame Annahmen entwickelt werden können, setzt voraus, dass Freiheiten nicht bloß als etwas außergesellschaftlich quasi Naturzuständiges proklamiert werden, sondern dass zumindest anerkannt wird, dass ihre Realisierung von gesellschaftlichen Übereinkünften abhängt, sie also auch sozial verstanden werden müssen. Die Freiheit manifestiert sich nicht von selbst, sondern wird in ihrem konkreten Gehalt vereinbart und gelebt. Das geschieht in jenen unzähligen Gesprächen, die eine moderne digitale Öffentlichkeit ausmachen, entweder implizit durch Inanspruchnahme kommunikativer Freiheiten oder explizit durch diskursive Klärung allgemeiner Spiel- und Zugangsregeln.
Diese prozeduralen Übereinkünfte sind Voraussetzung dafür, dass Geltungsansprüche der Wahrheit, Richtigkeit oder Wahrhaftigkeit diskutiert und so soziale Interaktionen koordiniert werden können. George Orwell hat es in 1984 treffend beschrieben: »Freiheit bedeutet die Freiheit, zu sagen, daß zwei und zwei vier ist. Gilt dies, ergibt sich alles übrige von selbst.«28 Die Wahrheit muss heutzutage zwar immer wieder neu bestimmt werden. Das aber macht sie keineswegs beliebig, sondern bindet sie erst recht an gute Gründe, an bessere Argumente und an die belegbare Faktizität der Welt. Es braucht die allgemeine Akzeptanz, dass die Freiheit der Meinung durch kritische Fragen und Widerspruch nicht nur nicht eingeschränkt wird, sondern dass sich ihr innerster Gehalt erst in jenen Momenten zeigt, in denen solche diskursive Kritik formuliert und dann entlang der unterstellten allgemeinen Kommunikationsannahmen deliberativ behandelt wird. Die Freiheit, dieses Gespräch gemeinsam führen zu können, realisiert sich dann, wenn sie wechselseitig anerkannt wird und wenn sie gesellschaftlich den Raum – durchaus auch den konkreten und physischen Raum – hat, der entsteht, wenn sich Menschen treffen und ins Gespräch miteinander kommen. Dass das gelingt, beruht auf den der Sprache immanenten sozialen Regeln und Bezügen. Oder mit Habermas übersetzt auf die gesellschaftliche Ebene: »Bei der in der Öffentlichkeit entfesselten Kakophonie der gegensätzlichen Meinungen wird allein eines vorausgesetzt – der alle übrigen Auseinandersetzungen legitimierende Konsens über die Grundsätze der gemeinsamen Verfassung.«29
Diese Vorstellung des Allgemeinen im gesellschaftlichen Gespräch zu rekonstruieren ist die vielleicht vordringlichste Aufgabe unserer Zeit. Sie bedarf eines Bewusstseins für die sozialen Bezüge sprachlicher Kommunikation. Sie bedarf der Bereitschaft derjenigen, deren Handeln maßgeblich auf Kommunikation beruht, diese sozialen Bezüge transparent zu machen. Und sie bedarf Sprecherinnen und Sprecher, die sich daran machen, einmal mehr die sozialen Rahmenbedingungen unserer aufklärerischen Gespräche nüchtern zu rekonstruieren, um die Maßstäbe ausweisen zu können, anhand deren wir den Grad der Aufgeklärtheit unseres Miteinanders ablesen können.
Zum Schluss seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Friedenspreises zitiert Reemtsma aus einem Aufsatz von Jürgen Habermas über Arnold Gehlen: »Humanität ist die Kühnheit, die uns am Ende übrigbleibt, nachdem wir eingesehen haben, daß den Gefährdungen einer universalen Zerbrechlichkeit allein das gefahrvolle Mittel zerbrechlicher Kommunikation selbst widerstehen kann.«30 Diese Humanität ist es auch, die bei aller demonstrativ skeptischen Zurückhaltung aus vielen Überlegungen Jan Philipp Reemtsmas funkelt, wenn er sich mit historischer Verantwortung, mit literarischen Gratwanderungen, mit dem Boxstil Muhammad Alis oder mit gesellschaftlichen Abgründen auseinandersetzt. Immer wieder stößt man als sein Leser auf einen Autor, der nicht davon ablassen will, sich und uns, mithin die menschliche Spezies in all ihrer sozialen und kulturellen Vielfalt, als vernunftbegabt zu verstehen. Aber man begegnet auch einem Denker, der keine Lust darauf hat, das Vernünftige voller Pathos und mit all seiner immensen rhetorischen Kraft einzufordern. Zu keiner Sekunde zweifelt man, dass er das könnte. Aber der kühle Analytiker Reemtsma weiß nur allzu gut um die Beschränktheit dieses verzweifelten Stilmittels. Und er misstraut ihm zu Recht zutiefst.
Wer Reemtsma aufmerksam liest, der versteht schnell, dass es trotz aller aktuellen Probleme auch jetzt und in Zukunft nicht darum geht, immer dramatischer an die Settembrinis und Naphtas unserer Zeit zu appellieren, dass sie bitte vernünftig miteinander umgehen und verständigungsorientiert miteinander sprechen mögen. Wie sollte man sie auch mit solchen Appellen wirkungsvoll erreichen? Die Fortsetzung des aufklärerischen Gesprächs entscheidet sich weiterhin in der gesellschaftlichen Praxis. Schließlich hat Settembrini im Zauberberg empirisch recht mit seiner Annahme, dass das Sprechen etwas bringen kann – nicht bloß, weil er normativ gut begründet, sondern weil Naphta letztlich praktisch ins Gespräch einsteigt. Wer den Gedanken der Aufklärung im Gespräch stärken will, der muss ihn aus dem alltäglichen Sprechen unserer Zeit heraus erneut rekonstruieren und so aufzeigen, welche Bedingungen es braucht, damit die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Verständigung zwischen den Sprechenden trotz aller stets bleibenden Zweifel unterstellt werden können. Damit es plausibel bleibt, dem »Mut der Erkenntnis und des Ausdrucks« (Thomas Mann) Ausdruck zu verleihen. Der Maßstab unserer Vernunft liegt weiterhin zwischen uns und ist nur sprechend zu ermessen.
1 Ders., Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburg 2008, S. 538.
2 Jürgen Habermas, »Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit«, in: Martin Seeliger / Sebastian Sevignani (Hg.), Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit [= Leviathan 49 (2021), Sonderbd. 37], Baden-Baden 2021, S. 470–500 (Zitat S. 486).
3 Vgl. Jan Philipp Reemtsma, »Laudatio«, in: Jürgen Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt a. M. 2001, S. 35–57.
4 Vgl. Theodor Geiger, Demokratie ohne Dogma. Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit, München 1963.
5 Jan Philipp Reemtsma, »Gewalt als attraktive Lebensform betrachtet«, in: Gewalt als Lebensform. Zwei Reden, Stuttgart 2016, S. 7–28 (S. 14f.).
6 Ders., Lessing in Hamburg. 1766–1770, München 2007, S. 50.
7 Vgl. ebenda, S. 92.
8 Vgl. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns [1981], Frankfurt a. M. 1995, Bd. 1, S. 388ff. Die Ausführungen zur Gesellschaftstheorie von Habermas stammen zum Teil aus Carsten Brosda, Diskursiver Journalismus. Journalistisches Handeln zwischen kommunikativer Vernunft und mediensystemischem Zwang, Wiesbaden 2008.
9 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1, S. 376 (Hervorhebung im Original).
10 Ders., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns [1984], Frankfurt a. M. 1995, S. 180.
11 Ebenda, S. 406.
12 Vgl. Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente [1944], Frankfurt a. M. 1988.
13 Vgl. Reemtsma, Gewalt als Lebensform.
14 Vgl. John Dewey, Die Öffentlichkeit und ihre Probleme, Bodenheim 1996.
15 Vgl. Michiko Kakutani, Der Tod der Wahrheit. Gedanken zur Kultur der Lüge, Stuttgart 2019. Die folgenden Überlegungen stammen in Teilen aus Carsten Brosda, Die Kunst der Demokratie. Die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft, Hamburg 2020, S. 50ff.
16 Thomas Mann, Der Zauberberg [1922], Frankfurt a. M. / Hamburg 1967, S. 619.
17 Habermas, »Überlegungen und Hypothesen«, S. 497f. (Hervorhebungen im Original).
18 Vgl. ders., Theorie des kommunikativen Handelns, S. 394.
19 Vgl. Ezra Klein, Der tiefe Graben. Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika, Hamburg 2021.
20 Vgl. Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung.
21 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchung zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, mit einem Vorwort zur Neuaufl., Frankfurt a. M. 1990.
22 Ders., »Überlegungen und Hypothesen«, S. 488.
23 Reemtsma, Lessing in Hamburg, S. 59.
24 Vgl. z. B. prominent Dave Eggers, Der Circle, Köln 2015.
25 Siehe »Impfangst als Weltverschwörung«, Interview mit Jan Philipp Reemtsma, in: taz (online) vom 20.5.2020 (https://tinyurl.com/23mjb5a8) [eingesehen am 3.2.2022].
26 Reemtsma, Gewalt als Lebensform, S. 35.
27 Habermas, »Überlegungen und Hypothesen«, S. 481.
28 George Orwell, 1984, Berlin 1984, S. 101.
29 Habermas, »Überlegungen und Hypothesen«, S. 478.
30 Ders., Philosophisch-politische Profile [1981], Frankfurt a. M. 1998, S. 119.
Ute DanielVorgeschichten und GegenwartenEinige Beobachtungen zu ihrer wechselseitigen Ausgestaltung
»Heldengeschichten sind Geschichten, in denen sich Gesellschaften ihre Vergangenheiten ausmalen. Es sind … fiktive Geschichten, in denen man sich Zeiten ausmalt, in denen es noch hoch herging.« Jan Philipp Reemtsma1
Fiktive Geschichten auszumalen weist die Geschichtsschreibung strikt von sich. Am Beginn ihrer Verwissenschaftlichung steht das Diktum Leopold von Rankes, die Geschichtsschreibung habe zu zeigen, wie es gewesen ist, ohne etwas hinzuzuerfinden.2 Das Fiktivitätsverbot diente Ranke zur Abgrenzung gegenüber dem erfolgreichsten Geschichtenschreiber seiner Zeit, Walter Scott.3 Auch dieser arbeitete mit historischen Quellen und machte in seinen Büchern allerhand Fußnoten. Ihren kommerziellen Erfolg verdankten seine historischen Romane aber wohl weniger diesen Strukturanalogien zur akademischen Geschichtsschreibung als den erfundenen Personen und Dialogen, die das Dargestellte vergegenwärtigen.
Die Ansprüche an die geschichtswissenschaftliche Methodik sind seit Rankes Zeit enorm gewachsen. Neben die Quellenkritik traten Forderungen nach ›Objektivität‹ – einem Ideal, das im neunzehnten Jahrhundert seinen Siegeszug antrat –, nach der Klärung zentraler Begriffe, der Formulierung des erkenntnisleitenden Interesses, nach methodischer Raffinesse, expliziten Thesen und Theorieverwendung. Die Modi der Gegenstandskonstruktion – national / transnational / global, race- und gender-Sensitivität, um nur einige zu nennen – sind seither ebenso explizit zu machen und zu begründen wie Fokussierungen des Dargestellten und Auslassungen.
Aber dennoch: Rankes Fiktivitätsverbot hat seinen Stachel nicht verloren. Nicht, weil sich etwa relotiushafte Tendenzen unter den Historikern und Historikerinnen zeigten – Dialoge oder Zeitzeugen zu erfinden bleibt tatsächlich den historischen Romanen vorbehalten. Auch nicht, weil sich die geschichtswissenschaftliche Zunft regelmäßig über Angemessenheit und Korrektheit historischer Interpretationen streitet. Das ist nur das normale wissenschaftliche Geschäft, das darin besteht, Stärken und Schwächen von Vorgehens- und Darstellungsweisen und ihren Resultaten im Schlagabtausch hervorzukehren. Sondern deswegen, weil eine systemrelevante, nämlich unvermeidliche Einflugschneise für Fiktives darin besteht, »eine rückblickende Entwicklungsfolge zusammenzustellen und zu konstituieren«, wie Paul Ricœur in den fünfziger Jahren die Aufgabe der Geschichtsschreibung beschrieb.4 Heute würde das wohl niemand mehr so ungeschützt sagen. Aber gemeint ist letztlich ziemlich das Gleiche, wenn es heißt, Historikerinnen und Historiker nähmen ihre Fragen aus ihrer jeweiligen Gegenwart. Es gehört nun einmal zum Kerngeschäft der historischen Zunft, ihrer jeweiligen Gegenwart eine Vorgeschichte zu verschaffen.
Was daran nenne ich fiktiv? Nicht, dass etwas hinzugefügt wird, sondern dass ganz im Gegenteil selegiert, gewichtet und weggelassen wird. Noch einmal in den Worten Ricœurs: »Es ist die Gewichtsverteilung, die Kontinuität schafft, indem sie alles Zusätzliche weglässt: Das Erlebte ist verworren und mit Unwichtigem durchsetzt; der Bericht hingegen ist verbunden und signifikant in seiner Kontinuität.«5 Der Bericht, die historische Darstellung, gestaltet, bildet, fingiert in zweierlei Richtung: Mit Blick auf die jeweilige rückblickende Gegenwart wird Kontinuität hergestellt. Mit Blick auf die dargestellte Vergangenheit-als-Vorgeschichte wird Verworrenes und für die Kontinuitätskonstruktion Unwichtiges gelöscht.
Diese Erkenntnis ist auf einer allgemeinen Ebene nicht wirklich neu. Theodor Lessing hat in Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, aufgewühlt durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, wohl die ausdrucksstärkste Klage über die kontinuitätsstiftende Aneignung der Vergangenheit formuliert:
Nun aber wird Geschichte bekanntlich nur von Überlebenden geschrieben. Die Toten sind stumm. Und für den, der zuletzt übrig bleibt, ist eben alles, was vor ihm dagewesen ist, immer sinnvoll gewesen, insofern er es auf seine Existenzform bezieht und beziehen muss, d. h. sich selbst und sein Sinnsystem eben nur aus der gesamten Vorgeschichte seiner Art begreifen kann … Somit ist Geschichte die egozentrische Selbstbezüglichkeit des Geistes, der aus Geschichte herausgeboren, zuletzt Geschichte als Vorstufe seiner eigenen Gegenwart begreift … Wenn nur er und seine Ideale übrig bleiben, so vermeint er die Vorwelt als Stufe zu ihm hin geheiligt und begründet.6
Der aktuelle Problemstatus dieser Erkenntnis ist hoch genug, um Eingang in die methodologischen Unterweisungen geschichtswissenschaftlicher Proseminare zu finden. Jedoch nicht hoch genug, um von der Gewöhnung an diese Erkenntnis, ihrer stillschweigenden ›Einpreisung‹ in die geschichtswissenschaftliche Praxis, dazu überzugehen, sie zum Ausgangspunkt des Weiterdenkens zu machen. Es ist ein bisschen wie in dem animierten Kurzfilm »Das Unkraut«, der Kinogängerinnen der frühen sechziger Jahre als Vorfilm begegnen konnte.7 In einer expandierenden Stadtlandschaft expandiert ungeplant auch ein Kraut. »Da ist ein Kraut, das soll weg«, wird von Passanten und der Behörde festgestellt. Und noch einmal festgestellt. Und immer wieder festgestellt. Gegenmaßnahmen bleiben unzureichend oder ganz aus, niemand will zuständig sein, man gewöhnt sich an die Wucherungen. Die Stadtlandschaft verwandelt sich in eine Dschungelruine.
Letzteres droht der historischen Forschung nicht. Aber das Unkraut ist nicht die schlechteste Metapher für das Wuchern unreflektierter Wechselwirkungen zwischen Gegenwartsbezug und Gegenstandskonstitution (ein unverfänglicherer Ausdruck für Gegenstandsfingierung) oder, anders formuliert, zwischen dem Bedürfnis jeder Gegenwart nach Vorgeschichte und dem Bedürfnis, diese Vorgeschichte zu verstehen. Fingierende Anteile durchwuchern beide Pole bzw. Blickrichtungen dieser Wechselwirkungen. Der Blick zurück ›erkennt‹ Vorgeschichte daran, dass sie sich mit der Gegenwart des Zurückblickenden verbinden lässt. Vergangenheit-als-Vorgeschichte muss also gleichsam auf ›uns‹, auf die Zukunft hin, die ›wir‹ darstellen, ausgerichtet sein. Das Bedürfnis, diese Vorgeschichte nicht nur zu haben, sondern auch zu verstehen, ist jedoch kaum zu befriedigen, wenn die Selektionswirkungen des Anachronismen generierenden Rückblicks zu stark sind.
Am Beispiel der deutschen Novemberrevolution von 1918/19 lässt sich besonders gut aufzeigen, welche Chancen auf Erkenntnis und Verständnis vergeben werden, wenn die historischen Menschen zu stark aus ihrer Gegenwart und deren Zukunftsträchtigkeit heraus verstanden werden und zu wenig aus ihrer eigenen Vergangenheit, aus der sie selbst ihre Situationsdeutungen und Handlungsanweisungen bezogen haben. Rückblickend erscheint es als selbstverständliche Feststellung, dass das revolutionäre und gegenrevolutionäre Geschehen zwischen dem Ende der Kampfhandlungen an den Fronten und dem Entweichen des Kaisers in die Niederlande im November 1918 einerseits und der Unterzeichnung des Versailler Vertrags sowie der Begründung der Weimarer Republik im Sommer 1919 andererseits am Ende von etwas stand – nämlich am Ende des Kriegs und des Deutschen Kaiserreichs – und gleichzeitig am Anfang von etwas Anderem, nämlich der Weimarer Republik. Für die Damaligen war das jedoch keineswegs selbstverständlich: Für sie war nicht nur unklar, wofür ihre Gegenwart den Anfang darstellen würde, sondern auch, was sie beendete. War der Krieg tatsächlich zu Ende? Das war damals keineswegs ausgemacht. Und war mit Wilhelm II. auch die Monarchie abhandengekommen? Wer konnte das schon sagen?
Nun ist die offene Zukunft jeder historischen Gegenwart eigen. Als abstrakte Aussage formuliert, gehört diese fundamentale Einsicht zum methodologischen Selbstverständnis aller historisch arbeitenden Disziplinen. Was aber folgt daraus für die historische Darstellung? Wird darin erörtert, wo und wie die zeitgenössischen Situationsdeutungen rückblickende Einordnungen konterkarieren (und umgekehrt)? Und werden daraus Schlüsse gezogen für die erklärende Einordnung historischer Gegenwarten in diachrone Verlaufsgeschichten? Das sind keine rhetorischen Fragen, denn immer wieder einmal geschieht beides tatsächlich. Klaus Latzel etwa hat herausgearbeitet, wie unterschiedlich sich das revolutionäre Geschehen darstellt, je nachdem ob man die Überblicksund Gesamtdarstellungen zur Hand nimmt, die es als Vorgeschichte der Weimarer Republik beschreiben, oder ob man das Geschehen vor Ort in den deutschen Staaten betrachtet: Die Darstellungen der Revolution als Vorgeschichte heben die politisch-ideologischen Auseinandersetzungen hervor, aus denen das zukünftige Staatswesen erklärbar wird, also die zentralen Streitfragen wie Sozialisierung der Schlüsselindustrien, Durchsetzungsfähigkeit der Reichsregierung oder den Grundkonflikt Räteherrschaft versus Parlamentarisierung. Latzels alltags- und erfahrungsnahe Darstellung der Revolutionen – im Plural –, die sich in den verschiedenen deutschen Einzelstaaten vollzogen, entwirft demgegenüber ein Bild, in dem sichtbar wird, womit die Arbeiter- und Soldatenräte, die sonst als Kontrahenten im Streit um die zukünftige Gestaltung von Staat und Gesellschaft figurieren, die ganze Zeit tatsächlich beschäftigt waren: mit der Bewirtschaftung von Kartoffeln, Bestandsmeldungen von Vorräten an Alkoholika, dem Fettgehalt von Käse und Quark, der Gebührenordnung für Hebammen oder der Versorgung demobilisierter Soldaten mit Strumpfwerk.8 Damit gestalteten sie jede Menge Gegenwart und Zukunft für damalige Menschen, aber eher keine Vorgeschichte für ihre Nachgeschichte.
Besonders störend wirken sich allerdings die Interferenzen zwischen dem Gegenwartsinteresse an einer Vorvergangenheit, die die zurückblickende Gegenwart verständlich machen kann, und der Chance, diese reklamierte Vergangenheit ihrerseits zu verstehen und zu erklären, dort aus, wo es um handlungsleitende Motive und Situationsdeutungen früherer Menschen geht. Die Frage danach zu stellen, warum Menschen handeln, wie sie es tun oder getan haben, ist eine zentrale Aufgabe der Humanwissenschaften. Wer sie stellt, nimmt jedoch eine eigentümliche Stellung ein. Jan Philipp Reemtsma hat diese Stellung der Fragensteller einmal so beschrieben:
Ich möchte … fragen, warum wir so fragen. Warum meinen wir, die Soziologie, die Psychologie und in gewissem Sinne die Historiographie könnten uns etwas »erklären«, soll heißen: uns sagen, was dahintersteckt, in Wirklichkeit passiert, die wahren Gründe, Motive, was auch immer sind? – Lassen Sie uns banal miteinander werden. Wenn einer irgend etwas tut, nehmen wir an, dass er das tut, weil er es tun will. Wir fragen ihn manchmal, warum er das tut/tun will – und dann fragen wir nach Gründen, oft nach Legitimationen. Wir fragen, wie er, was er tut, begründen und legitimieren kann. Das tun wir, weil es uns betrifft und wir uns möglicherweise mit seinem Tun befassen wollen, mit ihm, der das tut. Wir sondieren das Terrain, auf dem wir uns befinden. Wenn jemand uns anrempelt und wir sagen: »Was fällt Ihnen ein?« und er sagt »Ich hab’s eilig!«, nehmen wir es entweder hin, oder wir sagen: »Das ist noch lange kein Grund!« Eine Reaktion à la »Ja, das sagen Sie so, aber warum tun Sie’s wirklich?« würde uns als Sonderlinge ausweisen.9
Als Sonderlinge weisen sich Historiker und Historikerinnen, indem sie diese Frage stellen, tatsächlich nur »in gewissem Sinne« aus: Sie begegnen den Protagonisten ihrer Forschungen selten in Alltagssituationen, die es ihnen erlauben, im unmittelbaren Dialog den absonderlichen Schwenk von den Diskursregeln des Alltags in diejenigen der Forschung zu vollziehen. Doch die Diskursregeln der historischen Forschung beinhalten diesen Schwenk gewissermaßen selbst, beruhen geradezu auf ihm. Denn sie verlangen, dass diejenigen Gründe und Motive, die die historischen Protagonisten selbst angeben, ernst genommen werden müssen (das sogenannte Vetorecht der Quellen), aber nicht zu ernst. Soll heißen, geschichtswissenschaftliche Beschreibungen und Erklärungen können durch überlieferte Selbstaussagen von Zeitgenossen falsifiziert, aber nicht legitimiert werden. Wenn also beispielsweise politische und militärische Akteure im Verlauf der Novemberrevolution überall bolschewistische Umtriebe sahen, ist ernst zu nehmen, dass sie das so sahen. Nicht legitim wäre es demgegenüber, aus diesen Quellenaussagen auf die Existenz ubiquitärer bolschewistischer Umtriebe zu schließen.