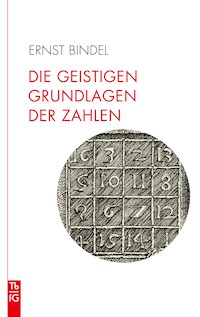
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Tb fG
- Sprache: Deutsch
Von der Weisheit der Zahlen Anhand zahlreicher kulturhistorischer Dokumente stellt Ernst Bindel die Entwicklung des Zahlenverständnisses vom Altertum bis zur Neuzeit dar. Anschaulich entwickelt er die verschiedenen Qualitäten der Zahlen aus geometrischen Konstruktionen und mathematischen Verhältnissen heraus. So stellt sich die Zahlenwelt als eine sinnvoll strukturierte Ganzheit dar. Ein Klassiker der Zahlenbetrachtung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERNST BINDEL 1890–1974) studierte Mathematik, Physik und Chemie in Göttingen, Berlin und Halle. Von 1924 bis 1963 war er Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Ernst Bindel ist der Verfasser mehrerer Bücher, u.a. Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten, Die Kegelschnitte, Logarithmen für jedermann und Die ägyptischen Pyramiden und Pythagoras.
ERNST BINDEL
DIE GEISTIGEN GRUNDLAGEN DER ZAHLEN
Die Zahl im Spiegel der Kulturen. Elemente einer spirituellen Geometrie und Arithmetik
Inhalt
Vorwort zur Ausgabe von 1958
Das Buch vom Menschen und die ersten zehn Zahlen
Quantitative und qualitative Zahlenbehandlung
Die Stellung des Altertums zur Zahl Fünf
Fünf als die Zahl des schöpferischen Individuums
Der Fünfstern als Symbol
Die Zahl Fünf im Tierkreis
Die Zahl Zehn und die stetige Teilung
Abschließendes über die Zahlen Zehn und Fünf
Die ersten sieben Zahlen in ihrem Verhältnis zur Raumeswelt
Raum und Zeit innerhalb der Zahlenwelt
Zwölf als Summe von Fünf und Sieben
Die Zahlen Sechs und Sieben im Pflanzenwerden
Die Zahlen Sechs und Sieben im Aufbau der Rechnungsarten
Die Zahl Sieben und der Mensch
Das septimale Zahlensystem und die Zahlen 666 und 1000 der Apokalypse
Sieben in der alten Zahlenweisheit
Die Zahl Sieben in der Rosenkreuzerströmung
Siebzehn als Vereinigung von Zehn und Sieben
Zahl und Sprache
Zeugnisse der Seherin von Prevorst über Zahl und Sprache
Kabbala und Gematria
Gematria der apokalyptischen Zahl 666
Die Sonderstellung der drei ersten Zahlen
Das vierte Blatt im Buch des Menschen
Die Zahl Vier und der Mensch. Der rechte Winkel
Erden- und Weltentwicklung im Licht der Vierheit
Von der Vier zur Neun. Vom Figurenwerk der Neunzahl
Die Neunheit in der Symbolik
Vom Figurenwerk der Achtzahl. Die Achtheit in der Symbolik
Das periodische System der Elemente als Schöpfungsurkunde
Zahlengesetze in der Stoffeswelt und in der Erdenentwicklung
Schlusswort
Vorwort zur Ausgabe von 1958
Vor nunmehr 25 Jahren, im Juni 1933, begann ich meine allmonatlich erscheinenden Rundschreiben über «Die geistigen Grundlagen der Zahlen» zu veröffentlichen, ein Jahr nach dem Erscheinen meines Buches über «Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit». Sie gingen im bescheidenen Gewand einer Vervielfältigung an einen wenige Hundert zählenden Kreis von Beziehern hinaus. Ihre Folge schloss nach 22 Lieferungen im Januar 1935 ab, so dass ihr Inhalt für nachträgliche Interessenten, die sich in ziemlicher Anzahl einstellten, verschlossen blieb. Die politischen Verhältnisse, welche alle literarischen Veröffentlichungen mehr und mehr unter eine bedrückende Aufsicht stellten, verboten eine zweite Auflage. Nach 1945 wäre zu ihr die Möglichkeit vorhanden gewesen. Sie wurde nicht genutzt, weil ich mich nun einem anderen, wenn auch verwandten Fragenkomplex zuwendete, dessen Behandlung sich in den Jahren 1950 bis 1953 in der Veröffentlichung meines dreibändigen Werkes über Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten niederschlug. Erst nach weiteren fünf Jahren war es mir aufgrund einer Zusage des Verlages Freies Geistesleben möglich, an ein Wiedererscheinen meiner nun schon weit zurückliegenden Arbeit zu denken. Der lange Zwischenzeitraum seit ihrem ersten Erscheinen hat es mit sich gebracht, dass ich ihr eine neue Form geben musste; auch die gediegenere Art der Veröffentlichung als Buch nötigte dazu. So wurden von mir die einstigen Rundschreiben gründlich überarbeitet. Vieles wurde als für einen nun hoffentlich größeren Leserkreis nicht tauglich gestrichen, einiges neu eingefügt und dem Ganzen stilistisch eine geprägtere Form gegeben. Jedoch ist im großen der damalige Charakter erhalten geblieben. Die Entscheidung darüber, was einem unvorbereiteten Leserkreis zu sagen möglich ist und was nicht, war mir nicht immer leicht. Schwierigere mathematische Gedankengänge schieden von vornherein aus, um die leichte Verständlichkeit für den Leser nicht zu beeinträchtigen. Ich hoffe, mit dem, was ich beibehalten zu können geglaubt habe, das Richtige getroffen zu haben, auch wenn mancher Leser da und dort anderer Meinung sein mag. Vor langen Zitaten bin ich nicht zurückgeschreckt, wenn in diesen das, was deutlich werden soll, am besten gesagt ist und durch eine Wiedergabe mit eigenen Worten keineswegs gewinnen würde. Dass mir dabei Rudolf Steiners Wort besonders schwer wog, wird man bald bemerken. In der vorliegenden Arbeit musste ich auch mit solchen Lesern rechnen, die meine anderen Buchveröffentlichungen über das Reich der Zahlen nicht kennen, so die schon erwähnte über die Zahlengrundlagen der Musik und besonders das Buch über die ägyptischen Pyramiden (Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit), das sogar den Untertitel trägt «Zugleich eine allgemeinverständliche Einführung in die Symbolik von Zahlen und Figuren» und daher vieles von dem vorwegnimmt, was jetzt ausführlicher behandelt wird. Mich auf das, was dort noch nicht gesagt ist, zu beschränken hätte die vorliegende Arbeit zu einem Torso werden lassen, so dass diese in Bezug auf den Untertitel des Pyramidenbuches sich wie ein notwendiger Ausbau ansehen lässt.
Ernst Bindel
1. Kapitel
Das Buch vom Menschen und die ersten zehn Zahlen
Für die Aufeinanderfolge verschiedener miteinander verbundener Tatbestände findet man als Sinnbild oft das Bild des Buches mit seinen aufeinanderfolgenden Blättern. So spricht man vom Buch des Lebens, das anfänglich leer sei und in welches das Schicksal seine Eintragungen mache, oder vom Buch der Welt, das aufgeschlagen vor uns liege und in welchem lesen zu lernen unsere Aufgabe sei. In der Apokalypse des Johannes wird mehrfach und bedeutsam das Symbol des Buches verwendet; dort wird es jedes mal von einem Engelwesen gehandhabt. Das erste dieser geistigen Bücher wird als siebenfach versiegelt geschildert; die Entsiegelung wird alsdann durch die Symbolgestalt des Lamms vorgenommen. Hier gewahren wir bereits die Verknüpfung des Buchsymbols mit der Zahlenwelt.
Weniger bekannt dürfte die Verwendung des Buchsymbols in der Form des «Buches vom Menschen» sein. Sie findet sich u. a. bei Louis Claude de Saint Martin, jenem französischen Weisen, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebte (1743 bis 1803), in seinem Erstlingswerk Des erreurs et de la vérité, das 1775 herauskam und ins Deutsche durch Matthias Claudius, den Herausgeber des Wandsbeker Boten, übersetzt wurde. Die Übersetzung wurde 1782 unter dem Titel Irrtümer und Wahrheit veröffentlicht; ihr sind die im folgenden angeführten Zitate entnommen. St. Martin kleidet in das Bild des «Buches vom Menschen» den Weg des Menschenwesens durch die unendliche Zeit. Auf einen paradiesischen Urzustand des Menschen folgte sein Abstieg in die Welt des Leidens durch einen schuldvollen Verzicht auf die ihm verliehenen Hoheitsrechte. Seitdem lebt er in der Hoffnung auf eine Wiedereinsetzung in seine ursprünglichen Rechte. Dieser Weg wird von St. Martin zunächst ohne das Gleichnis des Buches vom Menschen sogleich auf den ersten Seiten seines Werkes geschildert. Da auf diese wichtige Schilderung mehrfach zurückgegriffen wird, sei es gestattet, auf sie ausführlich hier einzugehen.
«Es ist kein Ursprung, der den seinen übertreffe; denn der Mensch ist älter als jedes andere Wesen der Natur; er existierte vor der Entstehung auch des allergeringsten Keims, und doch ist er erst nach ihnen auf die Welt gekommen. Was ihn aber weit über alle diese Wesen erhob, ist das: sie mussten von einem Vater und einer Mutter entstehen, und der Mensch hatte keine Mutter.»
Alsdann wird der Aufenthaltsort des Menschen, den die Bibel als den Garten des Paradieses beschreibt, als ein Wald geschildert, der aus sieben Bäumen bestand, deren jeder sechzehn Wurzeln und vierhundertneunzig Zweige gehabt habe. Die Früchte der Bäume hätten sich ohne Unterlass erneuert und dem Menschen die vortrefflichste Nahrung gewährt.
«Hier an diesem lieblichen Orte, der Heimat menschlicher Glückseligkeit und dem Thron seiner Herrlichkeit, würde er ewig glücklich (…) gewesen sein (…). Er genoss einen Frieden und eine Seligkeit, die den heutigen Menschen gar nicht können begreiflich gemacht werden.»
Ein furchtbares Vergehen, das näher zu beschreiben unterlassen wird, machte diesem Aufenthalt ein Ende. Der Mensch ward schmählich aller seiner Rechte beraubt und in die Region der Väter und Mütter hinabgeworfen, wo er seitdem lebt und den Gram und die Demütigung hat, unter allen den übrigen Wesen der Natur verkannt und wie eines von ihnen geachtet zu werden. Es sei nicht möglich, einen Zustand mit Gedanken zu fassen, der trauriger und bejammernswerter wäre als der unglückliche Zustand des Menschen in dem Augenblick seines Falles.
«Indes wollte ihn sein Vater, als er ihn so strafte, nicht aller Hoffnung berauben (…); er ließ sich seine Reue und seine Scham rühren und versprach ihm, dass er durch seine Mühungen seinen ersten Zustand wieder erlangen könnte (…). Es müssen uns auch die Rettungsmittel, die dem Menschen nach seiner Vergehung übrig geblieben sind, nicht wunder nehmen; es war die Hand eines Vaters, der ihn strafte, und es war auch eines Vaters Zärtlichkeit, die über ihn wachte, selbst da noch, als seine Gerechtigkeit ihn von seiner Gegenwart entfernte. Denn der Ort, von wo der Mensch ausgegangen ist, ist mit so vieler Weisheit angelegt, dass der Mensch, wenn er wieder zurückgeht, wo er hergekommen ist, durch eben die Wege, die ihn verführt haben, unfehlbar wieder gelangt zu dem mittelsten Punkt des Waldes, in dem er allein den Genuss einiger Kraft und einiger Ruhe haben kann.
In der Tat, er ist auf Abwege geraten, indem er von Vier zu Neun ging, und er wird sich immer nicht wiederfinden können, als wenn er von Neun zu Vier geht. Übrigens hätte er unrecht, wenn er sich über diese Unterwerfung beklagen wollte; so und nicht anders ist das Gesetz, das allen den Wesen, welche die Region der Väter und Mütter bewohnen, auferlegt ist; und weil der Mensch sich freiwillig da hinab begeben hat, so ist’s natürlich, dass er die ganze Mühseligkeit dieses Gesetzes fühle. Allerdings! Fürchterlich ist dies Gesetz, aber es ist nichts in Vergleichung mit dem Gesetz der Zahl sechsundfünfzig, das schrecklich ist und entsetzlich denen, die sich ihm bloßstellen; denn sie können nicht zu vierundsechzig gelangen, als nachdem sie es in seiner ganzen Strenge ausgehalten haben.
Das ist die allegorische Geschichte von dem, was der Mensch in seinem Ursprunge war, und von dem, was er durch seine Abweichung von seinem ersten Gesetz geworden ist. Ich habe durch dies Gemälde gesucht, ihn zu der Quelle all seines Unglücks zu führen und ihm, freilich dunkel und versteckt, die Mittel, wie dem könne abgeholfen werden, anzuzeigen.»
Wieder ist in die ganze Schilderung die Zahl in geheimnisvoller Weise hineinverwoben, zuweilen in einer unserem Verständnis so fernliegenden Form, dass man versucht ist, das Ganze für eine Scharlatanerie zu halten. Jedoch ein langes Umgehen mit jenen von St. Martin verwendeten Zahlengeheimnissen vermag zu der Überzeugung zu führen, dass in ihnen doch Weisheit verborgen ist. Es ist hiermit nicht anders als mit jenem Zahlengeheimnis, das der Apokalyptiker gelegentlich der Schilderung des «zweihörnigen Tieres» im 13. Kapitel in Gestalt der Zahl 666 ausspricht und zu dem er den ausdrücklichen Zusatz macht: Hier spricht die Weisheit selbst.
Erst in der Mitte des Werkes, gegen Ende des ersten Bandes, erscheint bei St. Martin das Bild des Buches vom Menschen. Wieder sei es gestattet, die Martin’sche Darstellung selbst anzuführen. Er spricht von einer Reihe von Vorteilen, in deren Besitz der Mensch sei, und fährt dann fort:
«Diese unaussprechlichen Vorteile hafteten an dem Besitz und dem Verständnis eines überköstlichen Buches, das zu den Geschenken gehörte, die der Mensch mit seinem Dasein erhalten hatte. Obgleich dieses Buch nur zehn Blätter enthielt, so fasste es doch in sich alle Einsichten und alle Erkenntnisse von dem, was gewesen ist, von dem, was ist, und von dem, was sein wird; und das Vermögen des Menschen war damals so ausgedehnt, dass er auf allen zehn Blättern des Buches zugleich lesen und es mit einem Blick umfassen konnte.
Bei seinem Fall ist zwar das nämliche Buch ihm geblieben, er ist aber des Vermögens beraubt worden, so leicht darin lesen zu können, und er kann nicht mehr alle dessen Blätter kennen lernen, als eins nach dem andern. Und doch wird er nimmermehr in seine Rechte gänzlich hergestellt werden, bis er sie alle studiert hat; denn obgleich ein jedes von diesen zehn Blättern eine besondere und ihm eigentümliche Kenntnis enthält, so hängen sie doch so untereinander zusammen, dass es unmöglich ist, eins davon vollkommen inne zu haben, wenn man es nicht dahin gebracht hat, sie alle zu kennen; und wiewohl ich gesagt habe, der Mensch könne sie nicht mehr lesen als eins nach dem andern, so würde doch jedwedem seiner Schritte die Sicherheit fehlen, wenn er sie nicht alle im ganzen durchlaufen wäre und hauptsächlich das vierte, das allen übrigen zum Vereinigungs-Punkt dient.
Dies ist eine Wahrheit, welche die Menschen wenig in Acht genommen haben, und doch wäre es ihnen unendlich nötig, sie zu beherzigen und zu erkennen; denn sie werden alle mit dem Buch in der Hand geboren; und wenn das Studium und das Verständnis dieses Buches gerade der Beruf ist, den sie zu erfüllen haben, so kann man urteilen, wie wichtig es für sie sei, dabei keinen Fehltritt zu begehen.»
Nun kommt er auf den Inhalt der einzelnen zehn Blätter zu sprechen. Da bei der Besprechung der einzelnen Zahlen meist die Martin’sche Charakteristik in Form dieser Blätter des zehnblättrigen Buches herangezogen werden wird, genügt es hier, zunächst als Probe nur den Inhalt einiger Blätter anzuführen:
4. Blatt: von allem, was tätig ist; von dem Prinzipio aller Sprachen, so derer, die zeitlich als die außer der Zeit sind; von der Religion und dem Gottesdienst des Menschen; und hier findet sich die Zahl der immateriellen Wesen, die denken.
5. Blatt: von der Abgötterei und von der Fäulung.
8. Blatt: von der zeitlichen Zahl desjenigen, der die einzige Stütze, die einzige Kraft und die einzige Hoffnung des Menschen ist, das ist, von dem reellen und physischen Wesen, das zwei Namen und vier Zahlen hat, insoweit als es zugleich tätig und verständig ist und seine Aktion über die vier Welten ausdehnt …
10. Blatt: das zehnte endlich war der Weg und das Komplement der neun vorhergehenden. Es war ohne Zweifel das Allerwesentlichste und eigentlich das Blatt, ohne das alle die vorhergehenden nicht würden gekannt sein; denn wenn man sie alle zehn in Zirkumferenz ordnet, so findet sich die meiste Verwandtschaft zwischen ihm und dem ersten, aus dem alles ausfließt; und wenn man von seiner Wichtigkeit urteilen will, so wisse man, dass der Urheber der Dinge eben durch dies zehnte Blatt unüberwindlich sei, weil es seine Wagenburg ist rund um ihn her, die kein Wesen überschreiten kann.
Wie aus der ganzen Schilderung hervorgeht, ist dieses Buchsymbol vorzugsweise mit der Zahl zehn verbunden, während das der Apokalypse vorzugsweise auf der Zahl sieben ruht.
Die weitere Betrachtung wird zeigen, dass man es bei alledem nicht etwa mit einer bloßen Phantasie von St. Martin allein zu tun hat, sondern dass hier altes Weisheitsgut der Menschheit vorliegt. Auch Rudolf Steiner sprach einmal von einem zehnblättrigen Buch in einem Vortrag, den er am 3. April 1905 in Berlin hielt. Davon existiert nur eine fragmentarische Nachschrift. Dennoch gestattet sie einen Einblick in die Art und Weise, wie er sich über dieses merkwürdige Thema ausgelassen hat. Es heißt da zunächst über das Buch überhaupt:
«Dieses zehnblättrige Buch ist etwas Wirkliches, Reales. Das Denken des Geheimwissenschaftlers ist ein anderes als dasjenige, was die Menschen ihr Denken im Alltag nennen. Das Denken des Geheimwissenschaftlers bekommt durch Intuition einen Begriff, auf einmal, innerlich. Er ist nicht angewiesen auf äußere Erfahrungen und Wahrnehmungen – es ist wie eine Erleuchtung; auf einmal ist sie da, und zwar deshalb, weil er die höheren Wirklichkeiten überschaut – er schaut die geistigen Urbilder der Dinge, wie ein Maler z. B. schaut, innerlich in sich hat das Urbild seines Wirkens. Es gibt von allen Dingen Urbilder, die auf dem höheren Plane leben, und diese schaut der Geheimwissenschaftler. Das Lesen in den geistigen Urbildern nennt man im Okkultismus das Lesen des ‹zehnblättrigen Buches›.»
In einer Frühzeit sei die Menschheit zum Lesen dieses Buches allgemein befähigt gewesen, nämlich vor ihrem Fall, ehe der Mensch in die «Region der Väter und Mütter» hinabstieg, bis zur Mitte der sogenannten lemurischen Zeit, als unsere Menschheit noch nicht mit einem physischen Leib umkleidet war. Damals gab es auch noch keine Trennung der Menschen in zwei verschiedene Geschlechter. Heute seien nur noch die Eingeweihten zum Lesen jenes Buches befähigt. Dieses Lesen von Seiten der Eingeweihten wird dann folgendermaßen beschrieben:
«Was in der geistigen Welt vor sich geht, entdeckt man nicht nach und nach in Einzelheiten, sondern vor dem geistigen Auge des Forschenden liegen alle Dinge klar. Dieser Dinge sind zehn; das ist das zehnblättrige Buch.»
Nun folgt auch bei Rudolf Steiner eine Schilderung der einzelnen Blätter; ihr Lesen besteht eigentlich nur in einem lebendigen Erfassen der ersten zehn Zahlen. So heißt es in Bezug auf das erste Blatt:
«Man erlebt innerlich Entstehen und Vergehen. Beispiel: wenn man eine Blume anschaut, sie ist entstanden, sie vergeht, sie hinterlässt einen Keim, der auch verfault. Ein ganz kleines Keimchen nur bleibt. Die ganze neue Pflanze ist in ihm enthalten. Die Pflanze wechselt ab zwischen großer Ausdehnung und einer Wesenheit, die in ein Nichts zusammengedrängt ist, ins Punktuelle. Dieses Ausdehnen – in einen Punkt Zusammendrängen kann man in der ganzen Natur verfolgen. Es ist beim Menschen so, es ist im ganzen Sonnensystem so. Da sprechen wir von Manvantara – Ausdehnen und von Pralaya – in einen Punkt Zusammenschrumpfen.
Diesen Zustand des In-einen-Punkt-zusammengedrängt-Seins, in dem das ganze reiche Leben zusammengedrängt ist und aus dem alles hervorquillt, muss man in sich zum Erleben bringen. Man versetzt sich in einen Zustand des Anschauens – innerlich – des Punktuellen; in diesen muss sich der Geheimschüler versetzen. Er muss innerlich erleben einen Punkt, der alles enthält und aus dem alles hervorquillt, der nichts und alles ist, der die Einheit von Sein und Kraft enthält. Es gehört zu den Geheimnissen, sich hineinzuversetzen in einen solchen Zustand, dass man erleben kann, wie aus dem Nichts das All entspringt; das ist das Lesen des ersten Blattes.»
Durch die obigen Worte werden wir auf die Urideen, die Schöpferkräfte der geistigen Welt verwiesen. Es war der «göttliche» Platon – so nennt ihn Schopenhauer –, welcher diese Ideen zuerst in philosophischer Reflexion betrachtete und die Ideenlehre in seinen Dialogen niederlegte. In ihnen findet sich jedoch kaum etwas von jenem durch Rudolf Steiner angedeuteten Zusammenhang zwischen Ideen und Zahlen. Dennoch kann gerade Platon als ein Zeuge für diesen Zusammenhang herangezogen werden. Man muss nur hinzunehmen, dass er seiner Ideenlehre im Alter eine Vertiefung zuteil werden ließ, welche nicht mehr in seine Dialoge eingegangen ist. In Form intimer mündlicher Belehrung brachte er diese Vertiefung vor seine Schüler. Sie bestand darin, dass er auf einer neuen Stufe seiner Einsicht die Ideen mit den Zahlen schlechthin gleichsetzte. Aus dem bloßen Eidos, der bloßen Idee, wurde der Arithmos eidetikos, die Ideenzahl. Allerdings ist nichts davon erwähnt, dass es sich gerade um zehn solcher Ideen, um zehn solcher Ideenzahlen dabei gehandelt hätte.
Die Lehre von gerade zehn zahlenartigen Ideen fand dafür in der sich gleichzeitig abspielenden hebräischen Kultur ihre Ausbildung. In der althebräischen Geheimlehre, welche den Namen Kabbala trug, wurde von jenen zehn schöpferischen Ideen als von den zehn heiligen Sephiroth gesprochen. Es wurde dort sogar auch eine bestimmte Anordnung in Form eines Schemas gegeben, das der Baum der Sephiroth genannt wurde und das Aussehen der Figur 1 hatte (S. 17). Den hebräischen Namen der Sephiroth sind in Klammern diejenigen lateinischen Namen beigefügt, in welche man sie zu übersetzen pflegte. Man zog dann noch zwischen den einzelnen Sephiroth bestimmte Verbindungslinien, die man Kanäle nannte, insgesamt 22 an der Zahl, welche man mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets parallelisierte, so dass dieser Baum der Sephiroth zu Zweigen die Buchstaben des hebräischen Alphabets hatte.
Die Totalität der zehn Sephiroth bezog man auf das ewige Wesen des Menschen selber. Jener höhere oder «idealische» Mensch, wie ihn Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen nennt, war nach der hebräischen Lehre also auf eine Totalität von zehn Ideen veranlagt. Man nannte ihn dort den «Adam Cadmoni», den «Menschen aus dem Osten» oder auch den «Menschen der Vorzeit», d. h. eben den Menschen vor seinem Fall.
Figur 1
Figur 2
1.Substanz, Sein, Wesen (ousia)
So klingt die hebräische Weisheit mit der griechisch-platonischen bedeutsam zusammen. Auch Platons großer Schüler Aristoteles folgte ähnlichen Wegen. Von ihm stammt eine Lehre, welche eine merkwürdige Verwandtschaft mit der Sephirothlehre zeigt: die von den zehn Denkprinzipien oder den zehn Kategorien. Bedeutsamerweise holt Aristoteles sie aus den Wortarten der Sprache heraus. Seine Ausführungen sind wegen ihrer Flüchtigkeit schwer verständlich; auch lassen sich die Namen für die zehn Grundbegriffe z. T. schwer ins Deutsche übersetzen. Aristoteles selber gibt für die Kategorien keine besondere Anordnung, sondern zählt sie nur lose auf:
«Von den ohne Verbindung gesprochenen Worten bezeichnen die einzelnen entweder eine Substanz oder eine Größe oder eine Beschaffenheit oder eine Beziehung oder einen Ort oder eine Zeit oder einen Zustand oder eine Lage oder ein Tun oder ein Leiden.» (4. Kapitel der «Kategorien».)
Alsdann behandelt er nur vier von ihnen ausführlich, und zwar in folgender Reihenfolge: Substanz, Größe, Beziehung, Beschaffenheit, indem er sie nach ihrem sachlichen Inhalt und nach ihrer Wortbedeutung untersucht; die übrigen sechs werden von ihm nur gestreift. Diese Kategorienlehre wird heute als ein Denkerzeugnis des jüngeren Aristoteles angesehen, ja, von manchen in Bezug auf ihre Echtheit sogar bezweifelt. Der spätere, ältere Aristoteles hat dann Platons Lehre von den Ideenzahlen, die er einst als Schüler von Platon selber mündlich empfangen hatte, aufs heftigste bekämpft. Dennoch leuchtet in dem Zusammenhange der zehn Kategorien etwas auf, was an die Zehnheit der schöpferischen Ideen heranführt; denn es lassen sich die zehn Kategorien in derselben Weise wie die zehn Sephiroth sinnvoll anordnen (siehe Figur 2, S. 17).
Das hebräische Wort sephiroth ist die Mehrzahl des Wortes sephira. Als solches ist es weniger unbekannt, als man beim bloßen Hören vielleicht meint. Es besteht aus den fünf Buchstaben samekh, phe, iod, resch und he und bedeutet ursprünglich soviel wie Licht, Glanz. Erst in zweiter Linie nimmt es die Bedeutung von Zahl an; die zehn Sephiroth sind weiter nichts als die ersten zehn Zahlen. Bedeutsam ist die Verwandtschaft des Wortes sephira mit dem hebräischen Wort sepher, das soviel wie Buch bedeutet; einige Forscher weisen auch auf die Verwandtschaft mit dem griechischen Wort sphaira (Sphäre) hin. Durch das Wort sephira wurde somit der Lichtursprung, der Sphärenursprung der Zahlen betont. Es machte dann bei der Weitergabe des hebräischen Kulturgutes an die anderen Völker eine mannigfache Wandlung durch. Zunächst ging es ins Arabische als sifr über, von da ins Lateinische als zephirum, von dort ins Italienische als cifra, woraus schließlich unser deutsches Lehnwort Ziffer wurde. Im Französischen bezeichnet das entsprechende Wort chiffre noch heute eine Art Geheimschrift, einen Geheimschlüssel. Also deuten auch wir noch durch unser Wort für die ersten Zahlen mit einem eigenen Zahlzeichen, durch das Wort Ziffer, ohne uns dessen bewusst zu sein, auf einen Lichtursprung, eine Lichtheimat der Zahlen hin.
Desgleichen besitzen wir gerade zehn solcher Ziffern, solcher Zahlsymbole, aus denen dann alle anderen Zahlen komponiert werden, und somit haben wir in unseren zehn Ziffern und in dem darauf gegründeten Dezimalsystem der Zahlen den Abglanz ältester Weisheitslehren vorliegen. Unsere zehn Ziffern stellen eigentlich zehn Urprinzipien dar, die der Welt schaffend zugrunde liegen, und unser gesamtes Rechnen ist nichts weiter als ein Umgang mit jenen zehn Urwesen, wie unser gesamtes Denken nach Aristoteles ein Umgang mit zehn Kategorien ist.
Wenn die zehn heiligen Sephiroth auf den höheren Menschen im Menschen, auf den idealischen Menschen bezogen wurden, sind dann nicht auch unsere ersten zehn Zahlen von tiefgehender Bedeutung für das Menschenwesen? Ältere Zeiten haben an dieser Beziehung der Zahl zum Menschen nie gezweifelt. Der Umgang mit den Zahlen wurde von jeher als eine spezifisch menschliche Angelegenheit betrachtet. So sagt der arabische Arzt und Philosoph Avicenna um das Jahr 1000 n. Chr.: «Bruta non numerant.» (Tiere zählen nicht.) Dies ist und bleibt richtig trotz aller Einwände, die man ab und zu dagegen zu machen beliebt, trotz der da und dort auftretenden sogenannten rechnenden Pferde etc. Selbst die intelligentesten Tiere sind ohne eine Spur von Zählfähigkeit. Hier klafft deutlich ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen Mensch und Tier; nur der Mensch zählt und rechnet.
Somit wäre in den ersten zehn Zahlen bereits unsere ganze Menschlichkeit beschlossen. Das war auch die Meinung der Weisen älterer Zeiten, wenn sie die Zahlen betrachteten. Über die den ersten zehn Zahlen entsprechenden zehn Urprinzipien sollte der Mensch nicht hinausstreben. Sonst überschritte er den ihm von der geistigen Welt abgesteckten Bezirk und käme in einen furchtbaren Bereich schwarzmagischer Kräfte und Gewalten hinein. Wie drückt z. B. St. Martin diesen Tatbestand aus? Er fasst die Totalität der ersten zehn Zahlen in eine einzige Zahl zusammen, indem er die Summe bildet:
Man nannte diese Art Addition eine Addition im Sinne der göttlichen Weisheit. Somit bezeichnete die Zahl 55 die Grenze der Menschlichkeit; wieder erscheint im Bilde dieser Zahl die Zehn, und zwar in Gestalt zweier nebeneinanderstehenden Fünfen. Eine Überschreitung dieses Menschlichkeitsbezirkes liegt dann in dem Übergang zur Zahl 56 vor, von der es bei St. Martin heißt, «dass ihr Gesetz schrecklich sei und entsetzlich denen, die sich ihm bloßstellen».
Unsere Aufgabe muss darin bestehen, irgendwie einzusehen, dass die ersten zehn Zahlen eine so bedeutsame Totalität bilden, dass sich mit ihnen gleichsam ein Ring für den Menschen schließt. Es wird damit – es sei vorweg gesagt – ein recht schwieriges Problem angeschnitten, und es kann sich nur um den Versuch handeln, an die Beantwortung der gestellten Frage allmählich heranzukommen. Aber bevor daran gegangen wird, muss man sich darüber klar werden, warum es dann zu einer solchen Verkennung des wahren Wesens der Zahlen, zu einer solchen Entfernung von der uns überlieferten alten Zahlenweisheit gekommen ist. Denn heute schalten wir zwar ebenfalls ganz ausgiebig mit den ersten zehn Zahlen in Gestalt der zehn Ziffern, aber ein Bezug derselben auf unser Menschenwesen ist uns dabei nicht mehr bewusst. Wir gehen zwar viel mit den Zahlen um, haben auch mit dem Ergebnis einer geradezu großartigen Zahlentheorie viel Nachdenken auf die Zahlen verwendet, dabei aber eine über das Bloß-Logische hinausgehende Beziehung der Zahlen zu uns selbst nicht mehr zu finden vermocht, obwohl der Umgang mit ihnen ein spezifisch menschlicher Vorgang ist.
Wenn es schon wahr ist, dass der Umgang mit der Zahl eine eigentlich menschliche Angelegenheit ist, muss auch die Art des Umgangs ein getreues Abbild der Art unseres Menschentums sein. Man möchte das bekannte Fichte-Wort «Sage mir, was für eine Philosophie du hast, und ich will dir sagen, was für ein Mensch du bist» verwandeln in das Wort: «Sage mir, wie du mit der Zahl umgehst, und ich will dir sagen, was für ein Mensch du bist!»
Die Zahl folgt wirklich dem Menschen wie sein Schatten, sie begleitet ihn durch die Höhen und die Niederungen des Menschseins hindurch. Wie die eigentliche Heimat des Menschen in den Höhen zu suchen ist, so auch der Urstand der Zahl. Selbst bei seinem Abstieg in die Tiefe ist dem Menschen der Aufblick zur Höhe noch geblieben, so dass der Grieche ihn einen Anthropos, einen zur Höhe Hinaufblickenden nannte. Auch in dem Wort, das den Umgang mit der Zahl in unserer deutschen Sprache bezeichnet, im Worte «rechnen», findet sich noch der Aufblick zur Höhe, steht es doch in einem geistig-lautlichen Zusammenhang mit den Worten recht, rechtschaffen, Rechenschaft, Gerechtigkeit, Gericht, richtig; der etymologische Ursprung ist ein anderer, da das Rechnen ein Rechenen, ein Umgang mit dem Rechen, ein Zusammenharken von Zahlen bedeutet. Aber auch das Rechnen hat sich seinem Ursprung entfremdet; der Mensch ist, wie Richard Wagner in seiner Schrift «Erkenne dich selbst» vom Jahre 1880 sagt, zu einem «rechnenden Raubtier» im Gegensatz zum reißenden Raubtier geworden.
Entgegen der Zuordnung der Zahlen zum Moralischen des Menschenwesens herrscht heute die Anschauung, dass die Zahl und das Rechnen eine Art neutrales Gebiet bilden. Das Rechnen sei eine rein intellektuelle Angelegenheit des Menschen, jenseits von Gut und Böse. So wurde es nicht immer angesehen. Erst mit Aristoteles kam eine solche Denkweise auf; er sagt in seiner Metaphysik: «Hier wird nichts in der Weise bewiesen, dass man aufzeigte, es sei etwas das Bessere oder das Schlechtere (…). In den anderen Gebieten, auch beim gemeinen Handwerk, wie bei dem des Zimmermanns oder Schusters, da wird alles unter den Gesichtspunkt des Besseren oder Schlechteren gestellt. Die mathematischen Wissenschaften aber handeln mit keinem Wort vom Guten oder Schlechten.»
Die Haltung des Aristoteles ist nur aus seinem Gegensatz zu seinem Lehrer Platon verständlich, dessen Zahlbegriff durch einen anderen zu ersetzen er als eine der wichtigsten Aufgaben ansah.
Platons Haltung gegenüber der Zahl wurde schon gestreift, als die Weiterbildung seiner Ideenlehre zur Ideenzahlenlehre behandelt wurde. In Form einer Vorlesung entwickelte er sie vor seinem engsten Schülerkreis und gab ihr den Titel Über das Gute. Durch eine Verknüpfung der Zahl mit der Idee wollte er die Welt des Guten fundieren. So richtete Platon bezüglich der Zahlen seinen Blick ganz hoch hinauf, er verhimmelte sie im wahren Sinn des Wortes.
Dem späteren Aristoteles wurde dieses Verhimmeln gründlich zuwider. Ihm erschien es notwendig, dass die Menschen sich mit der Zahl zur Erde hinunterfanden. Darum auch sein Kampf gegen die platonischen Ideenzahlen, darum sein Herausnehmen der Zahl aus der Welt des Guten, sein Neutralisieren der Zahl. Durch Aristoteles ist der Zahlbegriff bewusst veräußerlicht und der Keim zu dem heute gängigen Zahlbegriff gelegt worden.
Wirklich ausgebildet und praktiziert wurde jedoch dieser Zahlbegriff erst durch das Römertum. Wohl kann man noch bei Aristoteles davon sprechen, dass die Zahl ihrer bisherigen moralischen Sphäre entrückt und von ihm in ein neutrales Gebiet versetzt worden sei. Aber sie vermochte sich in der Hand des Menschen nicht lange in dieser Neutralität zu halten. Der Mensch hat es als moralisches Wesen schwer, Neutralität zu bewahren; ihm geraten seine Gedankenschöpfungen entweder zum Guten oder zum Schlimmen. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass die Behandlung der Zahl durch das spätere Römertum sie alles andere als neutral bleiben ließ. Zur Zeit der Cäsaren verband sie sich aufs engste mit dem Geldwesen. Auch dem Römer war die Zahl einstmals ein hohes verehrungswürdiges Wesen. Das zeigt allein schon der sprachliche Zusammenhang des lateinischen Wortes für Zahl, numerus, mit dem Worte numen, durch das die Gottheit bezeichnet wurde. Zu diesen beiden verwandten Worten gesellte sich als ein drittes das Wort nummus, Münze. Für den Römer wurde der Umgang mit der Zahl vorzugsweise zu einem solchen mit der Münze, dem Gelde. Auch in unserer deutschen Sprache hat sich der Zusammenhang zwischen Zahl und Münze niedergeschlagen, indem auch wir das Hantieren mit der Münze als die Tätigkeit des Zahlens bezeichnen. Die römischen Cäsaren haben bei dieser Entwicklung eine besondere Rolle gespielt. Wie Rudolf Steiner in seinen Vorträgen Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha (gehalten in Berlin 1917, GA 175) ausgeführt hat, erzwangen sich die Cäsaren die Einweihung in die Mysteriengeheimnisse, ohne vorher den vorgeschriebenen Läuterungsweg durchschritten zu haben; sie rissen das Amt des pontifex maximus, des Oberpriesters, an sich und erhoben Anspruch auf göttliche Verehrung ihrer Person. Die Folge war eine Dämonisierung der Mysterienkulte. In diesen Niedergang wurde auch das Geldwesen und mit ihm das Zahlenwesen hineingezogen; so trugen die Münzen fortan das Bild des Cäsargottes. Die drei Wesenheiten, welche durch die Worte numen, numerus und nummus bezeichnet wurden, wurden miteinander in eine niedere Sphäre heruntergedrückt. Statt des Kultus der Gottheit kam ein Mammonskultus auf. Was bisher zum Segen gewirkt hatte, verwandelte sich in sein Gegenteil, wurde zum Fluch. Dieser Kultus ist trotz des sich ausbreitenden Christentums Kulturantlitz der Neuzeit geblieben und nötigte Richard Wagner zu seinem harten Wort vom «rechnenden Raubtier». Gerade dem Christentum seiner Zeit hielt er dasselbe entgegen: «Ein Christentum, welches sich der Rohheit und Gewalt aller herrschenden Mächte der Welt anbequemte, dürfte, vom reißenden Raubtiere dem rechnenden Raubtiere zugewendet, durch Klugheit und List vor seinem Feinde übel bestehen, weshalb wir denn von der Unterstützung unserer kirchlichen wie staatlichen Autoritäten für jetzt kein besonderes Heil erwarten möchten.»
Wenige Zeilen vorher nennt er jenen Feind des Christentums, vor dem es durch Klugheit und List übel bestehen möchte, den gespenstigen Weltbeherrscher; er hat ihn in seinem Ring des Nibelungen als Alberich verkörpert: «Der verhängnisvolle Ring des Nibelungen, als Börsenportefeuille, dürfte das schreckliche Bild des gespenstigen Weltbeherrschers zur Vollendung bringen.»
2. Kapitel
Quantitative und qualitative Zahlenbehandlung
Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass alles davon abhängt, wie man mit den Zahlen umgeht. Bei dem Begriff «Umgang mit den Zahlen» ist nicht an irgend etwas Verschwommenes gedacht, sondern etwas ganz Bestimmtes gemeint. Denn das Umgehen mit den Zahlen ist nichts weiter als dasjenige, was wir als das Rechnen zu bezeichnen pflegen, und die Arten des Umgangs mit der Zahl sind somit die verschiedenen Rechnungsarten. Unter ihnen existieren vier, welche allgemein bekannt sind und auch allgemein verwendet werden, die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division. Ein besonderes Kapitel wird später den geistigen Aufbau aller vorhandenen Rechnungsarten behandeln. An dieser Stelle mögen uns zunächst nur die genannten vier «Grundrechnungsarten» beschäftigen. Statt ihre Aufzählung mit der Addition zu beginnen, hätte an erster Stelle auch die Division stehen können, so dass die Vierheit gelautet hätte: Division, Multiplikation, Subtraktion und Addition. Welche Rechnungsart die erste Stelle einnimmt, ist nicht gleichgültig. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass heute der größte Wert auf die Addition gelegt wird, und zwar in dem Sinne, dass in ihr ein zusammensetzendes, synthetisches Verfahren des menschlichen Geistes am besten zur Geltung kommt. Daher ist heutzutage auf der Addition alles andere aufgebaut; die Subtraktion erscheint als eine bloße Rückwendung der Addition, die Multiplikation als eine fortgesetzte Addition gleicher Summanden und die Division als eine Rückwendung der Multiplikation bzw. als eine fortgesetzte Subtraktion gleicher Subtrahenden. Die zivilisatorische Bedingtheit dieser Anordnung wird von Rudolf Steiner folgendermaßen gekennzeichnet:
«Wir sind ja im Verlaufe der Zivilisation allmählich dazu gekommen, das Arbeiten mit Zahlen in einer gewissen synthetischen Weise zu behandeln. Wir haben eine Einheit, eine zweite Einheit, eine dritte Einheit, und wir bemühen uns, im Abzählen, im additiven Elemente das eine zu dem anderen hinzuzufügen, so dass dann das eine neben dem anderen liegt, indem wir zählen. (…) In dieser Weise hat sich wiederum nicht das Elementar-Menschliche zum Zählen hin entwickelt.» (GA 303, Vortrag vom 31.12.1921.)
Mit diesen Worten ist zugleich ausgedrückt, dass es nicht immer so war, wie es heute ist, dass also die Addition nicht immer die Vormachtstellung besessen hat. Wie hat sich denn das «Elementar-Menschliche» zum Zählen hin entwickelt?
«Das Zählen ging allerdings aus von der Einheit; die Zwei war aber nicht ein äußerliches Wiederholen der Einheit, sondern sie lag in der Einheit darinnen. Die Eins gibt die Zwei, und die Zwei ist in der Eins drinnen. Die Eins geteilt, gibt die Drei, und die Drei ist in der Eins darinnen. Fing man an zu schreiben, ins Moderne umgesetzt: eins, so kam man aus der Einheit nicht heraus, indem man zur Zwei kam. Es war ein innerlich organisches Bilden, indem man zur Zwei kam, und die Zwei war in der Einheit darinnen, ebenso die Drei und so weiter. Die Einheit umfasste alles, und die Zahlen waren organische Gliederungen der Einheit.» (Ebd.)
In der «elementar-menschlichen» Zahlbildung war also nicht ein additives Verfahren der Ausgangspunkt, sondern ein Teilen, ein Gliedern der Einheit und damit ein divisives Verfahren. Statt des Anhäufens von Einzelheiten handelte es sich um das Gliedern der Einheit.
Man kann sich beide Zahlbehandlungen gemäß Rudolf Steiner durch folgende Darstellung anschaulich machen:
Figur 3
Beide Auffassungen der Zahl scheinen zueinander in einem Gegensatz zu stehen, die eine scheint die andere auszuschließen. Wie es sich damit verhält, soll nachher untersucht werden. Zunächst von dieser Frage ganz absehend, kann man sagen, dass es eine Einseitigkeit der letzten Vergangenheit war und auch noch der Gegenwart ist, nur die additive Zahlbetrachtung gelten zu lassen. Sie erhielt dadurch Vorrang, dass sie sich zum Begreifen und Handhaben alles Mechanischen empfiehlt. Da, wo ein Ganzes durch Zusammensetzen von Teilen entsteht, in der Welt des Maschinellen – wobei dieser Begriff sehr weit gezogen werden muss –, bot sie sich wie von selbst an. Mit dem Aufkommen der mechanischen Betrachtungsweise und besonders des Maschinenwesens schob sich auch die synthetische Behandlung der Zahlen in den Vordergrund. Hingegen genügt sie nicht mehr für das Begreifen der Welt des Lebendigen, der organischen Welt; aus einer Zelle werden ja zwei stets durch Teilung und nicht durch Aneinanderreihung. Auch im Leben draußen ist es so, wenn es in ihm noch lebendig zugeht. Zuerst sieht man eine grüne Wiese als Einheit, und dann erst entdeckt man nach und nach die einzelnen Pflanzen. Zuerst sieht man den Wald als Ganzes, und beim Näherkommen gewahrt man nach und nach die einzelnen Bäume. Nur dann, wenn man von den Einzelheiten aus zum Ganzen kommen möchte, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man könnte sagen, dass die gliedernde Betrachtung der Zahl überall da am Platze ist, wo das Ganze mehr bedeutet als die Summe seiner Teile und wo man also vom Ganzen ausgehen muss, um die Teile zu begreifen.
Die Verschiedenartigkeit der beiden Zahlenauffassungen offenbart sich auch in der Rolle, welche in beiden die Einheit spielt. In der heute herrschenden Auffassung spricht man von mehreren Einheiten, die aneinandergefügt werden. Aber darf man eigentlich überhaupt so sprechen? Darf man von dem Worte Einheit, wenn man es recht bedenkt, überhaupt die Mehrzahl bilden? Sind nicht «mehrere Einheiten» logisch ein Widersinn? Allenfalls darf hier doch nur von mehreren Einzelheiten gesprochen werden. Die Einheit kann dabei nur dasjenige sein, was als die Summe der Einzelheiten herauskommt. Aber diese Summe ist nur ein dürftiges Abbild der Einheit, eine zusammengestückte Einheit. Dagegen wird in der anderen Zahlenauffassung die Würde der Einheit mehr gewahrt. Da gibt es immer nur die eine Einheit, dieselbe Einheit, aber in mannigfacher Gliederung. Diese Gliederung der einen Einheit sind die Zahlen 2, 3, 4, 5 usw. Je höher hinauf es in der Zahlenreihe geht, desto reicher, desto reichhaltiger wird die Einheit. Aber alle sind und bleiben sie die Einheit: «Hen kai pan!» (Eines ist alles!) Nach der heute herrschenden Zahlenauffassung unterscheiden sich die verschiedenen Zahlen voneinander nur durch die Anzahl von Einheiten, besser Einzelheiten, welche in jeder zu einem Ganzen zusammengeschlossen sind. Man frage doch einmal unbefangen sich selber, als welches Wesen z. B. die Zahl 5 in der eigenen Vorstellung lebt, und man wird sich zunächst nichts anderes zu antworten wissen, als dass 5 eben die Summe 1 + 1 + 1 + 1 + 1 sei. Dass man bei dieser Erklärung die 5 eigentlich schon vorausgesetzt hat, wird einem wenig bewusst. Der Begriff Fünf ist eben bereits vor seiner scheinbaren Erklärung im menschlichen Bewusstsein existent, er lebt dort als ein Eigenwesen, als ein Ganzes, und nur eine mechanische Betrachtungsweise wähnt, ihn durch die Aufzählung 1 + 1 + 1 + 1 + 1 erschöpfend erklärt zu haben.
Mit dem dürftigen Begriff der Zahl als bloßer Anzahl verbindet sich dann die Vorstellung von der Größe einer jeden Zahl, indem die Einzelheiten, welche eine Zahl komponieren, alle von gleicher Größe gedacht werden. Zu der Frage des «Wie viel» tritt so bei jeder Zahl diejenige des «Wie groß». Demgemäß unterscheiden sich für unser heutiges Bewusstsein die verschiedenen Zahlen voneinander durch ihre Größe; man drückt dies ja durch folgende Schreibweise aus: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 …
Der Begriff der Größe, der Quantität gelangt so in der Zahlenwelt zu ungeahnter Bedeutung, zu einer Bedeutung, welche gar nicht in der Sache selbst liegt. In der anderen, der gliedernden Zahlenbehandlung, ist er demgegenüber von geringerer Wichtigkeit. Dort sind alle die verschiedenen Zahlen gleich groß, wenn man hier überhaupt den Begriff der Größe, der Quantität anwenden will; alle sind sie die Einheit. Die Zahlen 5 und 3 sind beides Ganzheiten, sind beide die Einheit. Das Größenhafte offenbart sich dann weniger in ihnen selber als in ihren Teilen, ihren Gliedern. Sie selber unterscheiden sich jetzt voneinander durch ihre Art; 3 ist eine bestimmte Art der Einheit, 5 eine andere Art derselben Einheit. So werden die verschiedenen Zahlen zu verschiedenen Arten einer und derselben Einheit, an Stelle einer quantitativen Zahlenauffassung tritt eine mehr qualitative.
Somit lassen sich die beiden Zahlenbetrachtungen auch als quantitativ und qualitativ kennzeichnen. Es ist wichtig, dass man mit den beiden Worten auch die richtigen Begriffe verbindet. Die quantitative Betrachtungsart kennzeichnet sich dadurch, dass sie nur dieses Merkmal hat und eine qualitative Betrachtungsart desselben Gegenstandes ausschließt bzw. verhindert. Hingegen haftet der qualitativen Betrachtungsart diese Einseitigkeit nicht an; sie enthält auch das Quantitative ungezwungen in sich, wie ja die Quantität auch eine Qualität neben anderen Qualitäten ist. Ein Fortschreiten von der quantitativen Zahlenbetrachtung zur qualitativen ist nicht der Übergang zu einem Gegensätzlichen, sondern zu einem Reicheren, Höheren. Wir sind in Wahrheit mit der quantitativen Zahlenauffassung verarmt, indem wir die Erfassung des Lebendigen, die Lebendigkeit eingebüßt haben und nur noch in der Lage sind, das Zusammengesetzte zu begreifen. Auf diese Situation deutet St. Martin in seinem Werk Über die Zahlen mit den Worten hin:
«In den Zahlen werden die Wesen durch die Qualitäten und nicht durch die Quantitäten geschaffen, weil die Qualitäten einen Charakter haben und die Quantitäten keinen. 2 mal 2 Pferde sind wohl 4 Pferde, aber 4 Pferde sind nicht ein Wesen, während in der wahren Ordnung die Zahl 4 ein mit Leben begabtes Wesen ankündigt, welches Eigenschaften hat, die sein Dasein bilden. Ebenso ist es mit allen beliebigen Zahlen.»
Die mit der qualitativen Zahlenauffassung verbundene Bereicherung macht sich auch noch auf eine andere Weise geltend. Man braucht zu diesem Zwecke nur das Bild zu betrachten, welches die Gliederung der Einheit nach den verschiedenen Zahlen darbietet (Figur 3). Es veranschaulicht zugleich auch die Vorgänge, welche sich beim Tönenlassen einer Saite abspielen. Die als Ganzes angestrichene Saite liefert einen Ton, den Grundton oder die Prim, der ungegliederten Einheit entsprechend. Aber auch die Einheit in Gestalt der Zwei schwingt als sogenannter erster Oberton mit, ebenso die Einheit in Gestalt der Drei als zweiter Oberton, die Einheit in Gestalt der Vier als dritter Oberton usw. Erst der Grundton samt den mitklingenden Obertönen ergibt den ganzen wirklich erklingenden Ton. Grundton und Obertöne sind in Wahrheit alle «eines», die Einheit in ihrer vielgestaltigen Gliederung jubelt auf. So erweist sich die gliedernde Zahlbetrachtung nicht bloß als die lebendigere, sondern auch als diejenige, welche mit dem Künstlerischen, in diesem Falle mit dem Musikalischen, eine Verbindung eingeht. Vermöge dieser musikalischen Bedeutung der Zahlen erhält auch der vorhin aufgestellte Begriff der Qualität einer Zahl einen konkreten Inhalt: So qualitativ verschieden, wie der Grundton von seinen Obertönen ist, sind auch die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, … voneinander. Die qualitative Zahlbetrachtung erhebt sich hier zu einem Begreifen des tönenden Wunders der Einheit.
Aber noch eine weitere Stufe hinauf wirkt sich der Umgang mit der Zahl aus. Die heute übliche Umgangsart erschöpft sich ja in der Tätigkeit des Anhäufens von Einzelheiten. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass sich mit dieser Tätigkeit auch eine ganz bestimmte Seelenhaltung des Tätigen verbinden muss, welche als die Seelenhaltung des Erraffens, des besinnungslosen Anhäufens bezeichnet werden muss, da ja der Blick auf das Ganze verlorengegangen ist. Einen grandiosen künstlerisch-musikalischen Ausdruck hat Richard Wagner diesem Drang nach fortwährender Vergrößerung, Vermehrung in seinem Rheingold gegeben, indem er dort den «gespenstigen Weltbeherrscher», den Nibelungen Alberich, seinen Hort aufhäufen lässt und diese Tätigkeit durch ein musikalisches Thema begleitet, das sich von unten heraufwälzt und in einem dämonischen Aufschrei ausklingt. Die quantitative Betrachtungsweise der Zahlen veranlagt keimhaft die Tendenz zur Egoität bzw. pflegt eine bereits vorhandene. Bis in scheinbar nebensächliche Einzelheiten lässt sich diese Wirkung nachweisen. Man betrachte z. B. das heutige Geld. Die einzelnen Münzsorten treten nicht als Gliederungen einer Einheit, sondern als Anhäufungen einer Einzelheit vor Augen. Auf einem Geldstück, das heute die Aufschrift «50 Pfennig» trägt, hätte noch vor wenigen Jahrhunderten «2 eine Mark» gestanden. Vor mir liegen zwei alte Münzen, die eine aus dem Jahre 1764 mit der Aufprägung «24 einen Thaler», die andere aus dem Jahre 1777 mit der Prägung «6 einen Reichsthaler». Man sieht, es wurde damals noch Wert darauf gelegt, die verschiedenartige Gliederung der Einheit, in diesem Falle eines Talers, auszudrücken, weil der Blick auf das Ganze im Menschen als Kraft noch wirksam war. Das Ganze war hier in allen Verrichtungen noch der Ausgangspunkt, es bewährte sich noch als der Regulator auch in den sozialen Beziehungen der Menschen zueinander.
Wer sich zu einer Handhabung der Zahlen erzieht, welche dieselben ebenfalls als Gliederungen und Teile eines und desselben Ganzen erscheinen lässt, regt in sich selber eine soziale Grundempfindung an. Die ins Moralisch-Ethische gehende Wirkung der Zahl geht besonders den Lehrer und Erzieher an. Welche Behandlung er der Zahl zuteil werden lässt, ist für die ganze Entwicklung des Kindes nicht gleichgültig. Die Methode, welche die einzelnen Zahlen nur durch Aneinanderreihen von «Einsen» entstehen lässt, ist für das Kind in den ersten Schuljahren völlig unangebracht, da es in dieser Zeit noch ganz und gar auf das Erlebnis von Totalitäten angelegt ist. Es weiß sich selber noch als ein Glied in einem Ganzen und geht auch überall noch in Gemeinschaften auf, in der Gemeinschaft der Familie und in derjenigen der Klasse. Dieser eingewurzelte Gemeinschaftssinn kann nur dann gepflegt werden, wenn dem Kinde die Zahlen nun auch als gegliederte Ganzheiten nahegebracht werden. Statt dessen setzt man es vor ein Rechenbrett, das eigens zu dem Zweck erfunden zu sein scheint, ein inneres Verhältnis zur Zahl beim Kinde nicht aufkommen zu lassen. So lernt das Kind die Zahlen ausschließlich durch Zusammenfügung von Einzelheiten kennen, und der Erwachsene, der einmal aus dem Kinde wird, weiß es dann nicht besser. Er kennt von Kindheit auf die Zahlen als bloße Anzahlen gleichartiger oder ungleichartiger Gegenstände, durch deren Abzählung die betreffende Zahl entsteht; die 6 erschöpft ihm ihr Wesen darin, eins mehr als die 5 zu sein, die 5 darin, eins mehr als die 4 zu sein usw.
Allein man braucht gar nicht einmal das Ethos der beiden Zahlenauffassungen zur Beurteilung ihres Wertes heranzuziehen, es genügt schon das, was jede für die Zahlen selber leistet. Von einer Zahl bloß zu wissen, dass sie um eins größer als die ihr vorhergehende ist, lässt alle Zahlen gleich, eine wie die andere, aussehen. In der Nacht dieser Zahlbetrachtung erscheinen sie alle grau. Dagegen enthüllt sich der besondere Charakter einer Zahl erst dadurch, dass man weiß, wie sie sonst noch mit ihren Vorgängerinnen durch ihre Gliederung zusammenhängt. So zeigt z. B. das Bild der Einheit im Gewand der Sechs, dass es in sich auch das Bild der Einheit im Gewand der Zwei sowie dasjenige im Gewand der Drei enthält:
Figur 4
Dagegen zeigt das Bild der Einheit im Gewand der Fünf, dass es gleichsam für sich dasteht und keinem der vorhergehenden Zahlen ähnelt; nur das Bild der ungegliederten Einheit, aus dem alle anderen erst hervorgehen, ist darin enthalten:
Figur 5
Weil das so ist, nennt man Fünf eine «erste» Zahl, eine «Primzahl», wogegen Sechs aus dem oben angegebenen Grund eine «zusammengesetzte» Zahl genannt wird. Die letzte Bezeichnung ist allerdings nicht gerade besonders glücklich, weil sie den geschilderten Sachverhalt schlecht beschreibt. Denn zusammengesetzt im üblichen Sinn ist jede Zahl, auch die Primzahl Fünf, die ja entweder aus fünf Einzelheiten oder aus drei und zwei Einzelheiten usw. besteht.
So kommt man schnell und ganz natürlich durch die gliedernde Zahlbetrachtung zu dem Unterschied der Primzahlen und der zusammengesetzten Zahlen, der durch die anhäufende Zahlbetrachtung zwar auch entwickelt werden kann, aber doch nur mühsam und verzwungen. Zu welcher Art von Zahlen eine Zahl gehört, macht sie überhaupt erst interessant und reizvoll, sie bekommt dadurch erst ihr bestimmtes Gesicht.
Damit soll die additive Zusammensetzung einer Zahl aus Einzelheiten nicht etwa als ganz belanglos hingestellt werden. Ein Ganzes in Teile zu zerlegen und aus Teilen ein Ganzes zusammenzusetzen sind zwei Verfahrensarten des menschlichen Geistes, die bloß nicht gleichrangig nebeneinander stehen, wie zu zeigen versucht wurde. In der Welt der Artefakten, zu denen in erster Linie die Maschinen gehören, wird nun einmal aus Teilen ein Ganzes zusammengesetzt.
Im gesamten Altertum wurden die Zahlen durchgängig als sinnvolle Gliederungen der einen Einheit genommen. Hand in Hand damit ging ein wahrhaftiger Kultus der Einheit, die als der Mutterschoß aller Zahlen galt und als solcher allen Zahlen übergeordnet wurde; ja, man sprach es geradezu aus, dass die Einheit, weil sie höher als alle Zahlen stehe, selber nicht mehr Zahl sei. Die heutige Zahlbetrachtung und gar die heutige Behandlung der Einheit wäre im Altertum geradezu als Barbarei erschienen. Infolge dieser Einstellung wurde das Altertum der Schöpfer einer großartigen Zahlenweisheit, von der man sich heute kaum noch einen Begriff zu machen vermag. Das meiste davon ist uns verlorengegangen, und was von ihr übriggeblieben ist, ist der Verständnislosigkeit anheim gefallen. Nur in den die alte Weisheit pflegenden okkulten Strömungen der verschiedensten Art hat sich auch jene Zahlenweisheit noch verhältnismäßig lange erhalten. Einen Vertreter einer solchen Strömung haben wir ja bereits in St. Martin kennengelernt. Ein anderer wichtiger Vertreter, der am Ausgang des Mittelalters bzw. am Beginn der Neuzeit lebte, war Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 bis 1535). Gerade er, der noch in die alte Zeit zurückblickte und schon in die neue Zeit vorausschaute, stellte die beiden möglichen Arten der Zahlenbetrachtung scharf nebeneinander. In einem Kapitel seiner Schrift Die Cabbala, das die Überschrift trägt «Von den Zahlen, ihrer Macht und ihren Kräften», weist er zunächst auf die «Kraft» der Zahlen hin: «Dass aber von allem zur Mathematik Gehörigen die Zahlen als das reinst Formelle ebenso auch das Tatkräftigste seien, indem sie Kraft und Wirkung sowohl auf das Gute als auf das Böse besitzen, darüber stimmen nicht nur die heidnischen, sondern auch die hebräischen und christlichen Theologen überein.»
Alsdann grenzt er diese Zahlen, die er anderswo auch Vernunftzahlen nennt, gegen die sogenannten Wortzahlen oder Handelszahlen ab: «Unter Zahlen verstehen sie (die heidnischen sowie die hebräischen und christlichen Theologen) aber bloß die reinen formalen Zahlen, nicht die materiellen, geschriebenen oder gesprochenen Zahlen der Handelswelt, mit welchen Pythagoräer, Akademiker und der heilige Augustin nichts zu schaffen haben wollten.»
Heute wird der von Agrippa aufgestellte Unterschied zwischen den Zahlen nicht mehr gemacht. Der Materialismus und Intellektualismus der Zeit hat auch hier seine Wirkung getan. Es geht dem heutigen Menschen kaum ein, dass die Zahlen weit mehr enthalten sollen, als ihm von ihnen oberflächlich bewusst ist, dass sie nicht bloß Hilfsmittel zur Abzählung und Abmessung sinnlich wahrnehmbarer Gegenstände darstellen, sondern darüber hinaus auch ein Ausdruck schaffender und ordnender Geistwesen seien, jener Geistwesen, welche der alte Hebräer die zehn heiligen Sephiroth nannte. Erst langsam muss sich unser Bewusstsein an diese Möglichkeit herantasten. Selbst die besten Geister, sofern sie nicht Okkultisten waren, hatten es in dieser Hinsicht schwer. Am allerschwersten haben es jedoch diejenigen, welche heute als die berufenen Vertreter der Wissenschaft von den Zahlen gelten, die Mathematiker selber. Was sagt ein moderner Mathematiker über das Wesen der Zahl? Bezeichnend ist, was Felix Klein in seinem Buche Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus geschrieben hat: «Was zunächst den Zahlbegriff angeht, so ist seine Wurzel äußerst schwer zu entdecken. Am glücklichsten fühlt man sich vielleicht noch, wenn man sich entschließt, von diesen allerschwierigsten Dingen ganz die Hand zu lassen. (…) Eine sehr verbreitete Auffassung ist die, dass der Zahlbegriff eng mit dem Zeitbegriff, mit dem zeitlichen Nacheinander zusammenhängt. Unter den Philosophen sei Kant, unter den Mathematikern Hamilton als ihr Vertreter genannt. Andere wieder meinen, dass die Zahl mehr mit der Raumesanschauung zu tun habe; sie führen den Zahlbegriff auf die gleichzeitige Anschauung verschiedener nebeneinander befindlicher Gegenstände zurück. Eine dritte Richtung endlich sieht in den Zahlenvorstellungen die Äußerungen einer besonderen Fähigkeit des Geistes, die unabhängig neben oder gar über der Anschauung von Raum und Zeit steht. Ich glaube, dass diese Auffassung gut gekennzeichnet wird, wenn man mit Minkowski (…) auf die Zahlen das Faustzitat anwendet: Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit, um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit!»
Wir sehen, es bleibt hier nur noch bei der bloßen Aufzählung von verschiedenen Meinungen über die Zahlen, wobei allerdings deren letzte eine große Hochschätzung der Zahl, eine Ahnung ihres umfassenden Wesens verrät.





























