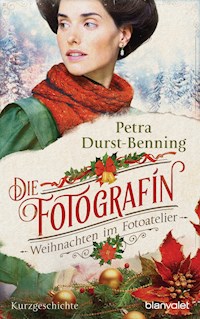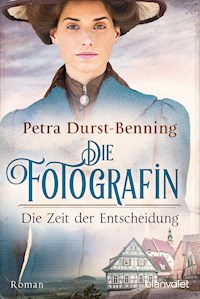9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lauscha, ein kleines Glasbläserdorf im Thüringer Wald im Jahr 1890: Der Glasbläser Joost Steinmann stirbt, und die drei Töchter Johanna, Marie und Ruth stehen völlig mittellos da. Als ein amerikanischer Geschäftsmann auf die schönen gläsernen Christbaumkugeln aus Lauscha aufmerksam wird, gibt er eine Großbestellung in Auftrag. Die couragierte Marie wittert ihre Chance und bricht mit allen Regeln: Sie wagt es, als erste Frau kunstvolle Christbaumkugeln zu kreieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Lauscha, ein kleines Glasbläserdorf im Thüringer Wald im Jahre 1890: Als der verwitwete Glasbläser Joost Steinmann stirbt, stehen seine drei jungen Töchter Johanna, Marie und Ruth völlig mittellos da. Wie in den anderen Häusern des Ortes werden auch in ihrem Haus Glaswaren nach alter Tradition hergestellt: Die Männer blasen das Glas, während die Frauen fürs Verzieren zuständig sind.
Als eines Tages der berühmte amerikanische Geschäftsmann Woolworth auf seiner Einkaufstour durch Europa auf den Lauschaer Christbaumschmuck aufmerksam wird und eine Großbestellung aufgibt, fasst sich Marie ein Herz: Die couragierte und geschäftstüchtige Frau bricht mit allen Regeln und nimmt in der elterlichen Werkstatt den Platz des Vaters ein. Aus ihren Händen entstehen die schönsten Christbaumkugeln, die in Lauscha je produziert wurden, und auch Mister Woolworth ist fasziniert von der jungen Frau und ihrer Kunst …
Die Autorin
Petra Durst-Benning, 1965 in Baden-Württemberg geboren, lebt mit ihrem Mann südlich von Stuttgart. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen historischer Romane, allein ihre große Glasbläser-Saga – zu der Die Glasbläserin den Auftakt bildet – begeisterte Hunderttausende Leser.
Mehr Informationen über die Autorin finden Sie unter
www.durst-benning.de
Von Petra Durst-Benning sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Glasbläserin · Die Amerikanerin · Das gläserne Paradies ·
Die Samenhändlerin · Floras Traum (Das Blumenorakel) ·
Die Zuckerbäckerin · Die Zarentochter · Die russische Herzogin ·
Solange die Welt noch schläft · Die Champagnerkönigin · Bella Clara ·
Die Silberdistel · Die Liebe des Kartographen · Die Salzbaronin ·
Antonias Wille · Winterwind · Mein Findelhund
Petra Durst-Benning
Die Glasbläserin
Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Neuausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Juni 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011
© 2002 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
© 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München / Ullstein
Berlin
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: living4media / © Christine Bauer
Satz und e-book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
eBook ISBN 978-3-8437-0029-0
E R S T E S B U C H
HERBST 1890
AUFBRUCH
»In ein farbiges Glas zu sehen … das Auge wird erfreut,
das Herz ausgedehnt, das Gemüt erheitert;
eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.«
(Johann Wolfgang von Goethe)
1
Schon zweimal war Ruth an diesem Morgen oben gewesen, um Johanna zu wecken. Jedes Mal hatte sie ein Brummen zur Antwort bekommen, das sie zu der Annahme verleitete, ihre Schwester würde tatsächlich aufstehen. Warum falle ich nur jeden Tag erneut darauf rein, fragte sich Ruth ärgerlich, als sie die schmalen Stufen, die Küche und Werkstatt mit der oberen Etage des Hauses verband, zum dritten Mal emporstieg. Der Geruch von ausgelassenem Speck begleitete sie. An der Dachluke stellte sie sich auf Zehenspitzen und warf einen Blick nach unten hinters Haus, wo sie Marie singen hörte. Eine Spinne hatte quer über die Luke ein Netz gespannt. Ohne das feinziselierte Kunstwerk auch nur eines Blickes zu würdigen, wischte Ruth es mit der Hand weg. Marie war nirgendwo zu sehen, genauso wenig wie Vater. Ruth verzog den Mund. Bis einer von den beiden merken würde, dass es in der Küche verbrannt roch, würden die Kartoffelscheiben und Speckstreifen nur noch ein Klumpen Holzkohle sein!
Die Tür zu der Kammer, in der sie und ihre beiden Schwestern schliefen, hatte sie beim letzten Versuch, Johanna zu wecken, offen gelassen. So konnte sie schon vom Treppenabsatz aus erkennen, dass Johanna immer noch nicht auf den Beinen war. Ohne ein Wort trat Ruth ans Bett, packte die Leinendecke an einem Zipfel und zerrte sie unter Johannas Armen hervor.
»Wie kannst du dich bei dieser Hitze so zudecken!« Kopfschüttelnd schaute sie auf ihre Schwester hinab, die endlich wach zu werden schien. Ruth ging zum Fenster und stieß beide Läden auf. Sofort drang die grelle Septembersonne ins Zimmer und tauchte alles in staubiges Licht.
Wie ein rheumatisches Weib schob Johanna ihre Beine aus dem Bett, und mehr als ein gequältes Stöhnen brachte sie dabei nicht heraus.
Ein scharfer Blick noch, und Ruth hastete die Treppe wieder hinunter, um das Frühstück zu retten. Während sie die Kartoffelscheiben und den Speck von der Pfanne löste und noch ein bisschen Öl nachgoss, dankte sie ihrem Herrgott dafür, eine Frühaufsteherin zu sein.
Von Kindesbeinen an hatte Johanna morgens nicht aufstehen wollen. Wie oft waren die Geschwister wegen ihr zu spät in die Dorfschule gekommen! Es war nicht so, dass Johanna einfach nur ungern aufstand – sie litt allmorgendlich und war vor zehn Uhr selten ein ganzer Mensch. »Es ist, als ob ich am Abend davor eine halbe Flasche Schnaps getrunken hätte«, hatte Johanna die Taubheit in ihrem Kopf einmal zu erklären versucht. Dabei hatten weder sie noch Ruth jemals eine halbe Flasche Schnaps getrunken und wussten demnach auch nicht genau, wie man sich danach fühlte. Jeder nahm Rücksicht auf Johannas morgendliche Schläfrigkeit und die Aufgaben im Haus waren unter den drei Schwestern so verteilt, dass Johanna morgens nichts zu schaffen hatte. Manchmal fragte sich Ruth jedoch, ob sie ihr damit überhaupt einen Gefallen taten. Sie seufzte. Wenn Mutter noch lebte … die würde wahrscheinlich nicht so viel Aufhebens machen! Anna Steinmann war in vielen Fragen unnachgiebiger gewesen als ihr Mann. Ruth erschrak, als sie feststellte, dass sie Mühe hatte, sich das Gesicht ihrer Mutter für einen Moment vor Augen zu rufen. Zehn Jahre waren eine lange Zeit.
Das Wasser, das sie für den Morgenkaffee aufgesetzt hatte, begann dicke Blasen zu werfen und riss Ruth aus ihren Erinnerungen. Hastig zog sie den Kessel zur Seite. Sie mochte es nicht, wenn die kalt angesetzten Zichorienwurzeln zu brodeln begannen – zu schnell wurde das Getränk bitter. Besser war es, das Ganze nur leicht sieden zu lassen. Überhaupt war Ruth bei diesem Thema eigen: Der Kaffee, den sich die meisten im Dorf aus getrockneten und gemahlenen Runkelrüben brauten, konnte ihr gestohlen bleiben. Lieber würde sie Wasser trinken als dieses Gesöff! Am liebsten trank sie natürlich echten Bohnenkaffee, den es für ihren Geschmack allerdings viel zu selten gab. An jedem Freitag, wenn Johanna nach Sonneberg ging, um die Glaswaren zu verkaufen, die sie im Laufe der vergangenen Woche hergestellt hatten, brachte sie ein kleines Tütchen echten Bohnenkaffee mit. Obwohl es Joost Steinmann selbst nicht wichtig war, welche Art von Kaffee auf den Tisch kam, solange er dunkel und heiß war, gönnte er seinen Töchtern den kleinen Luxus. Und so war es ihnen schon vor langer Zeit zum Ritual geworden, Johannas Rückkehr aus Sonneberg mit Kaffee, süßem Brot und frisch eingelegtem Hering, den sie ebenfalls aus der Stadt mitbrachte, zu feiern.
Es waren diese kleinen Gewohnheiten, die sich herumsprachen und Joost Steinmann den Ruf einbrachten, eine »Weiberwirtschaft« zu haben. Dabei war es keineswegs so, dass Joosts Töchter Narrenfreiheit besaßen: In den eigenen vier Wänden hatten sie zwar tatsächlich mehr Freiheiten als andere Mädchen in ihrem Alter. Wenn es jedoch darum ging, seine drei Töchter vor vermeintlichem Übel zu bewahren, konnte Joost schlimmer als eine Glucke sein. Zum Singen in den Gesangsverein gehen? Unmöglich – wo doch auf dem Nachhauseweg böse Buben lauern konnten. Allein zu einer Sonnwendfeier? Diese Frage konnten sie sich sparen. Als ein paar Mädchen im Dorf einige Jahre zuvor eine Spinnstube gründeten, hatte er seine Töchter nicht einmal an deren harmlosen Zusammenkünften teilnehmen lassen. »Am Ende brecht ihr euch noch auf dem Nachhauseweg ein Bein!«, hatte er seine Ablehnung begründet und hinzugefügt: »Besser, ihr bleibt zu Hause und übt euch im Lesen und Schreiben.« Als ob Bücher ein Ersatz für fröhliches Geplänkel waren! Ruth schluckte. Ab November würde es wieder soweit sein: Während sich die anderen Mädchen an zwei Abenden in der Woche zum Spinnen trafen, würden sie und ihre Schwestern zu Hause hocken. Wenn nach der Spinnstube auf den Straßen die Schneebälle flogen und die Mädchen lachend und kreischend und von den Burschen verfolgt durch die Straßen rannten, würden Johanna, Marie und sie längst im Bett liegen.
Es war kein Wunder, dass es sich unter den jungen Burschen im Dorf längst herumgesprochen hatte, dass Joost es nicht schätzte, wenn seinen Mädchen der Hof gemacht wurde. Unter seinem missbilligenden Blick wurde es den meisten so unwohl, dass sie kein zweites Mal kamen, um eine der drei zu einem Spaziergang abzuholen.
Ruth ging zum Tisch und kramte in der Schublade nach dem kleinen Spiegel, den sie dort deponiert hatte. Wenn sie ihn weit genug von sich weg hielt, konnte sie – wenn auch nur klein – ihr ganzes Gesicht darin betrachten. Sie war eine Schönheit, das wusste sie. Ihre Schwestern und sie hatten die gleichmäßigen, wohlgeformten Züge ihrer Mutter geerbt, und diese war eine außergewöhnlich schöne Frau gewesen.
Entmutigt ließ Ruth den Spiegel sinken. Und wenn sie noch so zufrieden war mit dem, was sie im Spiegel sah – was nutzte es ihr? Würde jemals ein Mann ihre Lippen küssen? Würde ihr je einer sagen, dass ihre Augen glänzten wie dunkelster Bernstein? Oder dass ihre Haut so rein war wie ein Frühlingsmorgen? Wenn es nach Joost ginge, würde sie als alte Jungfer versauern!
Der einzige Mann, der regelmäßig bei ihnen ein und aus ging, war ihr Nachbar Peter Maienbaum. Seit dessen Eltern vor einigen Jahren kurz hintereinander gestorben waren, betrachtete Joost ihn als eine Art Sohn, keinesfalls jedoch als potentiellen Schürzenjäger. Ha!, von wegen! Ruth war sich ziemlich sicher, dass Peter schon seit längerem ein Auge auf Johanna geworfen hatte. So, wie er sie immer anstarrte! Doch außer ihr schien das niemandem aufzufallen, und Johanna schon gar nicht! Ruth seufzte tief auf. Wenn sie ein Mann so anschauen würde – sie würde es gewiss wahrnehmen!
»Johanna läuft wieder einmal durch die Gegend wie ein Hund ohne Schwanz! Aber kaum ist sie wach, kann sie uns für den Rest des Tages gar nicht genug herumkommandieren! Es ist doch immer dasselbe.« Graziös rutschte Marie auf die Eckbank. Sie war so schlank, dass sie dazu den Tisch nicht das kleinste Stück nach vorn schieben musste, bemerkte Ruth neidisch. Dabei waren alle drei Schwestern schlank, keine von ihnen so unförmig wie manches Weib im Dorf, mit hängenden Brüsten und schwammigen Rundungen überall. Jede von ihnen konnte dem lieben Gott für ausgeglichene Proportionen danken, für glatte, gesunde Haut und für kastanienfarbene Haare, die seidig glänzten, ohne dass sie mehr dafür tun mussten, als sie täglich mit hundert Strichen zu bürsten. Doch bei Marie war alles kleiner, feiner, zerbrechlicher – wie bei einer wertvollen Miniatur.
»Immerhin ist sie schon unten. Ich hab schon befürchtet, dass ich nochmals die Treppe hinauf muss«, antwortete Ruth trocken.
Nach dem Tod ihrer Mutter hatten sie es sich angewöhnt, sich im angrenzenden Schuppen, in dem sie auch die Wäsche machten, zu waschen. Auch Joost selbst ging zur Morgentoilette nach draußen, statt sich einfach in der Küche zu waschen. So konnte jeder seinen persönlichen Raum wahren, was den Mädchen so wichtig war wie Joost selbst.
»Wo bleibt eigentlich Vater?«
»Ich weiß nicht. Bei ihm ist’s gestern Abend später geworden als sonst. Er ist so laut die Treppe hochgepoltert, dass ich davon aufgewacht bin. Danach konnte ich ewig nicht mehr einschlafen!« Marie zog eine Grimasse. »Er wird doch nicht einen Rausch ausschlafen?«
Ruth zuckte mit den Schultern. »So viel trinkt er nun auch nicht«, sagte sie in einem leicht entschuldigenden Ton. Dabei hatte sie keinen Grund, Joosts Wirtshausbesuche verteidigen zu müssen. Er ging zwar jeden Abend für ein paar Stunden in den Schwarzen Adler, aber im Gegensatz zu anderen Männern aus dem Dorf trank er dabei selten einen über den Durst.
Die Kartoffelscheiben hatten inzwischen eine kräftige braune Kruste bekommen. Ruth pickte sich mit den Fingern eine davon heraus und steckte sie hastig in den Mund. Heiß! Dann schenkte sie Marie und sich einen Becher Kaffee ein. Der würzige Duft passte zu dem sonnigen Morgen. Pflaumenkuchentage nannte sie die sonnenbeglückten Tage, die nicht mehr zum Sommer, aber auch noch nicht zum Herbst gehörten. Das Konzert der Vögel, die es sich den Sommer über in dem großen Birnenbaum vor dem Küchenfenster bequem gemacht hatten, fehlte um diese Jahreszeit. Nur hin und wieder war ein Amselzirpen oder das grelle Pfeifen einer Lerche zu hören. Und bald würden die Herbstnebel auch dieses ersticken. Ruth inhalierte schnell den Kaffeeduft. Sie hasste die kalte Jahreszeit.
»Es dauert nicht mehr lange, dann müssen wir morgens wieder Licht machen«, sagte Marie, als habe sie dieselben Gedanken gehabt.
Dass die eine aussprach, was der anderen durch den Kopf ging, kam bei den Schwestern öfter vor.
Ja, sie hatten sich nach Anna Steinmanns Tod arrangiert – was das Zusammenleben und auch was die Arbeit anging. Natürlich fehlten immer irgendwo ein Paar Hände zum Anpacken. Aber mochten die anderen Glasbläser im Dorf lästern oder gutmütig spotten – die Steinmannsche Weiberwirtschaft gehörte nicht zu den schlechtesten Betrieben. Die Apotheker- und Reagenzgläser, die sie herstellten, waren erster Güte. Dass die Steinmanns die Produkte von Anfang bis Ende fertig machen konnten und keinen Arbeitsgang – weder das Schleifen der Stöpsel noch das Beschriften oder das Verpacken der Gläser – aus dem Haus geben mussten, war dabei von großem Vorteil. Wie die anderen Glasbläser verkauften auch sie ihre gesamten Waren an einen Verleger im nahe gelegenen Sonneberg. Friedhelm Strobel, dessen Verlagshaus beste Kontakte weltweit pflegte, betonte immer wieder, dass er durchaus bereit wäre, mehr Steinmann-Gläser aufzukaufen. Doch mit nur einem Glasbläser im Haus war es ihnen unmöglich, eine höhere Stückzahl herzustellen. Ein patenter Schwiegersohn wäre da eine große Hilfe, bekam Joost von seinen Wirtshauskameraden immer wieder zu hören. Doch er winkte nur ab. »Meine Mädchen müssen nicht heiraten – und des Geldes wegen schon gar nicht!«, war eine seiner beliebten Redensarten, die er mit nicht wenig Stolz in der Stimme zum Besten gab.
Mit einem Seufzer stellte Ruth ihren Becher ab und ging zum Herd. Mühelos hob sie die schwere gusseiserne Pfanne und stellte die Morgenmahlzeit auf dem Tisch ab. »Jetzt reicht’s! Ich geh’ nachschauen, wo …« Sie brach ab. Johanna war im Türrahmen erschienen. Noch blasser als sonst am Morgen, die Augen weit aufgerissen, als habe sie im Gang den Teufel getroffen, hielt sie sich eine Hand vor den Mund, schien einen nicht enden wollenden Schrei zu unterdrücken.
»Johanna! Um Gottes willen! Was ist los?«, rief Marie.
Ruth verspürte einen Klumpen in ihrem Hals, der vor einem Augenblick noch nicht da gewesen war. Zwei eiskalte Hände quetschten ihr Herz zusammen, und sie wusste in diesem Moment, dass etwas Furchtbares passiert war. Sie brachte keinen Ton heraus.
»Der Vater …« Auf Johannas Stirn hatte sich eine Falte gebildet, die vom Haaransatz bis zur Nase reichte. »Er liegt oben im Bett. Er rührt sich nimmer.«
2
Wann immer Johanna später an diesen Morgen zurückdachte, fiel ihr das Märchen von Dornröschen, der verwunschenen Prinzessin, ein. Reglos, mit halb geschlossenem Mund, hatte Marie dagesessen. Und Ruth war zwischen Tisch und Eckbank eingeklemmt gewesen, halb sitzend und halb stehend. Auch sie selbst war unfähig gewesen, einen Schritt von dem Türrahmen fort zu machen. Wie versteinert waren sie, als würde ihre Reglosigkeit sie davor bewahren, sich mit der Ungeheuerlichkeit des Augenblicks auseinander zu setzen.
Es war Marie gewesen, die sich als Erste rührte. Sie rannte die Treppe hoch, in die Kammer der Eltern, an Joosts Bett. Ihr Schrei zerschnitt die Stille im Haus und ließ die wenigen Vögel draußen verstummen.
Johannas und Ruths Blicke trafen sich über der Pfanne. Dann hasteten sie nach oben.
Die hölzernen Stufen, in der Mitte von vielen Fußtritten hell gewetzt, verschwammen vor Johannas Augen zu schmalen, gelblichen Streifen. Sie spürte, wie sich etwas Salziges in ihren Mundwinkeln fing und merkte erst da, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie konnte sie genauso wenig kontrollieren wie die Gedanken, die ihr zuflatterten, ohne dass sie nach ihnen gerufen hätte.
Der Vater war tot.
Musste man den Arzt aus Sonneberg rufen? Nein, kein Arzt mehr.
Ein Pfarrer. Ja. Sie musste den Pfarrer holen.
Die Werkstatt musste aufgeräumt werden.
Waschen. Tote mussten gewaschen werden. Und aufgebahrt.
Ein Schluchzen kroch aus ihrer Kehle, so heiß und brennend, dass es weh tat. Sie wollte die Gedanken abstellen, die alles so wirklich machten.
Marie hatte Joosts Hände über seiner Brust gefaltet. Gott sei Dank waren seine Augen schon geschlossen gewesen, als Johanna ihn gefunden hatte! Hätte eine von ihnen seine Augen schließen müssen …, sie wollte nicht daran denken.
Joost war noch keine fünfzig Jahre alt gewesen. Und gesund. Außer seinem Kreuz hatte ihm nie etwas zu schaffen gemacht.
»Er sieht so friedlich aus«, flüsterte Marie. Sie strich Joosts Decke glatt. Sein Leib wirkte darunter auf einmal viel kleiner als im Leben.
Auf Zehenspitzen, als wollte sie nicht stören, schlich Ruth zur gegenüberliegenden Bettseite. Sie beugte sich über ihren Vater und schaute in sein Gesicht. Keine Spur eines Todeskampfes.
»Vielleicht schläft er nur tiefer als sonst?« Zaghaft berührte sie seine Stirn. Keine von ihnen war es gewohnt, den Vater anzufassen. Die Haut des Toten war nicht so eisig kalt, wie es immer hieß, stellte sie überrascht fest. Auch nicht feucht oder pergamentartig. Doch die darunter liegenden Knochen fühlten sich unbeweglich an und blockierten Ruths streichelnde Finger.
Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Ruth begann zu weinen. Auch Marie weinte und Johanna schluckte heftig.
»Aber warum? Ich versteh das nicht!« Der Kloß in ihrem Hals drückte gegen die zu engen Wände. »Wie kann Vater im Schlaf sterben, einfach so? Das kann doch gar nicht sein!«, rief sie fast trotzig.
Doch nichts konnte Joosts Tod rückgängig machen. Mitten im Schlaf hatte sein Herz aufgehört zu schlagen. Eine Erklärung dafür gab es nicht. Peter Maienbaum, den Johanna aus dem Nachbarhaus holte, war genauso schockiert wie Joosts Töchter. Nein, Joost sei am Vorabend nicht anders gewesen als sonst. Krank schon gar nicht, sondern heiter. Wie alle anderen hatte er über die Witze vom Stinnes-Maul gelacht.
»Der hat diesen Namen nicht umsonst. Mit seinen Sprüchen kann der ein ganzes Wirtshaus unterhalten«, sagte Peter geistesabwesend.
Johanna winkte ab. Was interessierte sie der Stinnes-Maul.
»Wir müssen den Vater aufbahren.« Ihre betont sachliche Stimme hätte eher zu einem alltäglichen Ritual gepasst.
Erschrocken schauten Ruth und Marie zu ihr hinüber.
»Am besten räumen wir unten in der Werkstatt unsere Arbeitstische zur Seite, und dann holen wir Vater und sein Bett herunter.«
»Aber warum willst du das tun? Wir können Vater doch auch hier … aufbahren«, sagte Ruth, der es schon vor dem Wort grauste. Marie sah von einer zur anderen.
Johanna schüttelte den Kopf. »Nein, das muss ordentlich gemacht werden. Das hätte der Vater gewollt. Wenn die Leute kommen …« Der Rest ging in einem Schluchzen unter. Sie wandte sich ab.
Hilflos schauten Ruth und Marie auf die bebenden Schultern ihrer Schwester. Keine hatte ein Quentchen Trost übrig, zu schwer drückte sie die eigene Last. Dass Johanna, die sonst so gern den Ton angab, genauso hilflos war wie sie, machte die Situation noch bedrohlicher – falls das überhaupt möglich war.
Peter räusperte sich. »Ich gehe jetzt und hol ein paar Männer. Dann beginnen wir mit …«
Warum findet plötzlich keiner mehr die passenden Worte, schoss es Johanna durch den Kopf, während sie mit beiden Händen über ihre Augen wischte. Nur langsam ebbte ihr Weinen ab.
Peter rüttelte sie sanft am Arm. »Es wäre vielleicht ganz gut, wenn jemand hinuntergeht und Kaffee kocht. Für die Leute und so …«
Kurze Zeit später kam er mit drei Männern zurück. Mit zerknüllten Hüten in den Händen standen die Nachbarn da, sprachen ihr Mitleid aus und waren froh, etwas zu tun zu haben, was sie der bedrückenden Gesellschaft entkommen ließ. Unter Peters Anleitung machten sie sich an die Umbettung, wobei sie den Toten erst auf den Boden hievten, dann das Bett abbauten und unter verschluckten Flüchen die schmale Treppe hinunter bugsierten. Das Aufbauen in der Mitte der Werkstatt verlief problemlos, auch der Tote ließ sich widerstandslos nach unten bringen. Die vier Männer atmeten erleichtert auf.
Die Frauen der Nachbarn hatten, kaum dass sie von Joosts Ableben hörten, ihre eigene Arbeit ebenfalls zur Seite gelegt. Wenig später erschienen auch sie im Totenhaus. Die eine brachte eine Schüssel mit Kartoffelbrei, die andere einen Topf mit Gemüsesuppe, die nächste Brot, das sie mit Schmalz beschmiert und mit Salz bestreut hatte. Die hölzernen Bodendielen kamen nicht mehr zur Ruhe und knarrten unentwegt, während die Frauen nach Streichhölzern suchten, um Kerzen anzuzünden, den Männern Becher mit Kaffee brachten und einen scheuen Blick auf den Toten warfen.
Die Witwe Grün, die zwei Häuser weiter wohnte, wusch zusammen mit Ruth den Toten und kleidete ihn neu an, während Johanna und Marie das Bett mit frischem Leinen bezogen.
Irgendjemand benachrichtigte den Pfarrer. Die Frauen waren gerade mit dem Herrichten des Toten fertig, als der Gottesmann zur Tür hereinkam, im Schlepptau zwei Ministranten, die Weihrauch schwenkten.
Wie betäubt stellte sich Johanna mit den anderen in einem weiten Kreis um Joosts Bett auf, während der Pfarrer seine Fürbitte hielt. Das kann alles nicht wahr sein, schoss es ihr durch den Kopf.
Den ganzen Tag über kamen Leute vorbei, um ihr Beileid auszudrücken oder eine Zeitlang die Totenwache mit den Mädchen zu teilen. Keiner blieb lange, zu Hause wartete auf jeden die Arbeit. Die Erleichterung, nicht selbst von einem so plötzlichen familiären Unglück betroffen zu sein, stand jedem ins Gesicht geschrieben. Mancher trug sie ganz offen vor sich her, andere versuchten, sie zu verbergen. Johanna konnte den Leuten nicht verübeln, dass sie so fühlten. Als letzten Winter die schlimme Grippe durch Lauscha gegangen war und der Säbel Hannes – fast zehn Jahre jünger als ihr Vater – und noch zwei ältere Leute aus dem Unterdorf daran starben, war auch ihr Gedanke gewesen: Gott sei Dank keiner von uns! Wenn sie von ihren Besuchen in Sonneberg zurückkam und an dem Haus vorbeiging, über dessen verwaister Eingangstür der messingfarbene Säbel blitzte, musste sie immer noch jedes Mal an den Hannes denken. Noch nicht einmal zum Heiraten war er gekommen, so jung hatte er sterben müssen.
Trotzdem: Das Schulterklopfen, der gemurmelte Trost, der klamme Druck einer Hand – im Laufe des Nachmittags begannen die Beileidbezeugungen Johanna zu kratzen wie ein Büschel Brennnesseln. Sie glaubte, in den salbungsvollen Blicken mehr zu lesen als reines Mitgefühl. So etwas wie … Erwartung. Erregtheit.
Drei junge Frauen ohne männlichen Schutz.
Warteten die Leute darauf, dass eine von ihnen zusammenbrach? Oder dass ein weiteres Unglück über ihr Haus hereinbrach? Johanna schalt sich für ihre ungnädigen Gedanken. Die Leute meinten es doch nur gut.
3
Es war nach sieben, als der letzte endlich ging. Peter Maienbaum war der Einzige, der ihnen anbot, die Totenwache in der Nacht mit ihnen zu teilen. Johanna zögerte kurz, lehnte dann aber ab. Das war etwas, das sie allein machen mussten.
Keiner der drei Frauen war es nach Essen zumute, und so deckte Ruth die gebrachten Speisen mit Leinentüchern zu und stellte sie weg. Sprichwörtlich todmüde setzten sie sich an den Küchentisch.
Johanna stand noch einmal auf und öffnete die Tür. »Die Luft ist zum Schneiden dick.«
»Das kommt vom Weihrauch.« Maries Augen waren gerötet.
»Nicht nur. Die vielen Leute …« Johanna war zu müde, um zu erklären, dass sie das Gefühl hatte, ihr Zuhause sei durch die vielen Besucher irgendwie besudelt worden. Die fremden Gerüche gehörten nicht hierher. Die unsichtbaren Stapfen, welche die Füße der Besucher auf dem Holzboden hinterlassen hatten, ebenfalls nicht.
»Vielleicht ist’s auch … der Vater?« Ruth schaute hinüber in die Werkstatt.
»Ruth!« Marie schrak zusammen. Ängstlich schaute sie Johanna an.
»Das weiß doch jeder, dass Tote zu riechen beginnen, wenn sie …«
»Jetzt langt’s!«, unterbrach Johanna sie barsch. Ihnen stand eine ganze Nacht der Totenwache bevor. Ruths dumme Reden fehlten da gerade noch. Sie ging zum Schrank und holte die restlichen Kerzen heraus. Licht war gut. Licht konnte nicht schaden. »Da drüben liegt kein Toter, sondern der Vater.«
Ruth öffnete den Mund, schluckte ihre Bemerkung dann aber herunter. In der Gegenwart eines Toten stritt man schließlich nicht.
Nur zögerlich ließ das Kneifen um Johannas Mund herum nach. Ihre Augen stierten nicht mehr starr nach vorn wie die einer Puppe, sondern wurden wieder beweglicher. Auch ihre Arme, die sie den ganzen Tag über unwillkürlich verkrampft hatte, wurden langsam locker. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und hatte zum ersten Mal an diesem Tag nicht das Gefühl, etwas tun oder sagen zu müssen.
Einer von ihnen war nicht mehr da.
Je länger sie schwiegen, desto mehr fehlte er ihnen. Sein lautes Poltern, wenn das Abendessen nicht fertig war oder wenn Ruth zu wenig Wurststücke in die Kartoffelsuppe geschnipselt hatte. Seine ausgreifenden Bewegungen, wenn er Brot schnitt oder ein Stück vom gerauchten Schinken absäbelte.
Johanna war die Erste, die das Schweigen brach. »Vater hat immer so vor Kraft gestrotzt …« Sie presste die Lippen aufeinander.
Ruth nickte. »Nicht so ein halber Hering wie der Bayern-Hans oder der Friedmar Grau. Aber auch kein Fettwanst wie Wilhelm Heimer.«
»Wenn Vater in den Raum kam, hat man gar nicht hingucken müssen. Das hat man irgendwie gespürt.« Marie sprach aus, was Johanna hatte ausdrücken wollen. »Vor dem hatten alle irgendwie Respekt.« Sie schmunzelte. »Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit den zwei Hähnen?«
Johanna lachte traurig. »Die Viecher hat der Vater für mich beim Marzen-Paul gekauft. Er hoffte, ich würde eher wach, wenn zwei Hähne krähen statt nur einer. Und dann hat der Marzen-Paul stockbesoffen angeklopft und gemeint, er hätte dem Vater die falschen Viecher mitgegeben, nämlich seine prämierten Zuchthähne, und er wolle sie zurück.«
»Vater hat sich nur vor ihm aufgebaut und schon ist der Marzen ganz klein geworden.«
»Und genutzt haben die Hähne letztlich auch nicht.«
Sie lachten kurz auf und schwiegen dann wieder.
»Wer wird nun auf uns aufpassen?«, fragte Marie.
Johanna warf ihr einen Blick zu. Nicht diese Frage. Nicht heute nacht. Und morgen auch noch nicht.
»Prinzessin hat er dich als kleines Kind immer genannt, weißt du noch?« Marie war immer seine Kleine geblieben.
»Die Prinzessin und ihr Luftschloss in der Seifenblase. Irgendwann würde er ein Märchen für mich erfinden, hat er gemeint. Aber so weit ist’s nicht gekommen.« Maries Augen wurden wieder feucht.
»Dafür hat er dir immer Seifenwasser für deine Seifenblasen zubereitet!«, sagte Ruth. »Diese schrecklichen Seifenblasen.« Sie formte mit ihren Händen eine Kugel in der Luft. »Phhh! Alles zerplatzt und zurück bleibt ein nasser Fleck. Dass du dich dafür so begeistern konntest, habe ich schon als Kind nicht verstehen können.«
»Aber Vater hat’s verstanden. Er hat genauso gern wie ich in die Regenbogenfarben geguckt.« Marie schaute auf. »Im Himmel sieht er sicher viele bunte Regenbogen. Das wird ihm gefallen« – sie schluchzte auf –, »und bei der Mutter ist er auch.«
Ihr Weinen steckte die anderen an, und sie hielten ihre Trauer nicht zurück.
Lange Zeit später wischte Ruth sich eine verschwitzte Haarsträhne aus der Stirn und verzog schniefend ihr Gesicht.
»Ich muss gerade an den Frankreich-Auftrag von Friedhelm Strobel denken, für den wir gerade einmal zwei Wochen Zeit hatten. Vor fünf Jahren war das, im Jahr 1885.«
»Du meine Güte!« Johanna schlug die Hände zusammen. Durch den Windhauch begann das Kerzenlicht zu flackern. »Der Auftrag für diese französische Parfümfabrik!« Und auf Maries unsichere Miene hin fuhr sie fort: »Erinnerst du dich nicht mehr? Fünftausend Flakons haben die verlangt. Und auf jedem sollte stehen: Eau de Paris.« Sie lächelte.
Marie schnippte mit den Fingern. »Stimmt! Der Vater hat’s uns extra noch vorgeschrieben. Nur haben wir seine Klaue nicht richtig lesen können, und ehe er sich versah, waren tausend Fläschchen mit Roi de Paris beschriftet.«
»Der König von Paris.« Ruth schüttelte den Kopf. »Jeder andere hätte seine Arbeitsmädchen grün und blau geschlagen, und was tut unser Vater? Fängt an zu lachen und hört nicht mehr auf.« Sie warf einen wehen Blick hinüber in die Werkstatt. Ja, da drüben lag nicht irgendein Toter, sondern ihr lieber, guter Vater.
»Aber ich hatte nichts zu lachen, als ich Strobel das erklären musste«, sagte Johanna säuerlich. »Ich war erst zum dritten Mal allein in Sonneberg zum Verkaufen und mir meiner Sache sowieso noch nicht sicher! Mit meinen sechzehn Jahren bin ich ganz schön ins Stottern gekommen, und ich hätte nie geglaubt, dass er uns die Flakons abnehmen wird.«
»Aber irgendwie hast du’s hingekriegt.« Noch heute war Anerkennung in Maries Stimme zu hören. »Ein paar Wochen später hat Strobel dir noch einen zweiten Auftrag übergeben, den wir ausschließlich mit Roi de Paris beschriften sollten!«
»Ha! Wahrscheinlich hat er die Dinger zum doppelten Preis an die Franzmänner verkauft und so getan, als ob der Name seine eigene Erfindung gewesen sei!« Ruth zog die Nase hoch. »Wie habe ich mich damals nach so einem französisches Parfüm gesehnt! Sogar geträumt habe ich davon. Einmal bin ich morgens aufgewacht und glaubte wirklich, einen Duft nach Maiglöckchen und Flieder in der Nase zu haben.« Sie seufzte.
»Wenn es nach Vater gegangen wäre, hättest du sogar ein Fläschchen davon bekommen«, entgegnete Johanna. »Ich habe mich damals bei Strobel in seinem Namen erkundigen müssen, ob es möglich wäre, ein solches Parfüm aufzutreiben. Nicht, dass ich damit einverstanden gewesen wäre! Was braucht ein Mädchen von vierzehn Jahren Parfüm, habe ich mich gefragt. Aber Vater hat dir deine Extrawünsche ja erfüllt, wo es nur ging.«
Ruth sah aus, als ob sie etwas erwidern wollte, doch dann schluckte sie eine Antwort hinunter.
Eine Zeitlang blieb jede mit ihren Gedanken allein. Es gab so viele Geschichten.
Nachdem Ruths Kopf schon zweimal nach vorn auf ihre Brust gekippt war, machte Johanna den Vorschlag, die Totenwache abwechselnd zu übernehmen, so dass Ruth und Marie schlafen gehen könnten. Beide verneinten. Doch bald darauf sackte erst Ruths und dann Maries Kopf auf die Tischplatte. Johanna seufzte. Im Bett hätten die beiden es bequemer gehabt.
Sie stand auf, leise, ohne ihren Stuhl zu rücken. Auch sie war müde. Sie nahm eine der Kerzen und ging hinüber in die Werkstatt. Ihr Blick verharrte an Vaters Bolg, an seiner Werkbank. Die neue Gasleitung, welche erst seit kurzem ihr Haus mit der vor etlichen Jahren gegründeten Gasanstalt verband, glänzte silbern und stach zwischen den anderen, abgegriffenen Werkzeugen wie ein Fremdkörper hervor. Johanna kämpfte gegen den Schmerz in ihrer Brust an. Wie viel Überzeugungskraft hatte es sie gekostet, Joost dazu zu bringen, sich den Anschluss legen zu lassen! Ihr Vater hatte sich nicht gern Veränderungen gestellt. Wenn’s nach ihm gegangen wäre, hätte er bis zu seinem Lebensende mit der Öllampe weiter gearbeitet.
Warum jetzt schon? wollte sie schreien, in die Nacht, nach oben in den Himmel. Ihre Lider brannten heiß. Sie atmete tief durch.
Als er dann mit dem »neumodischen Kram« so gut zurechtkam, war Joost stolz gewesen wie eine Sau mit achtzehn Ferkeln! Die heißere Flamme ermöglichte es ihm, noch dünnwandigere Flakons und Gläser zu blasen als zuvor. Von da an war kein Abend vergangen, an dem er nicht versucht hätte, die wenigen Glasbläser an seinem Stammtisch, die noch keinen Anschluss ans Gaswerk hatten, von dessen Vorzügen zu überzeugen.
Ihr Vater. Er würde ihr so fehlen. Schon jetzt fühlte sich ihr Herz an wie eine große, klaffende Wunde.
Als ihre Mutter starb, war sie elf Jahre alt gewesen, Ruth neun und Marie sieben. Ein ganzes Jahr lang hatten sie nachts nur schlafen können, wenn Joost eine Lampe in ihrer Kammer brennen ließ. Jeden Abend – anstelle eines Gebetes sozusagen – hatte er ihnen erzählt, wie schön es droben im Himmel für die Mutter sei. Die Mädchen waren trotzdem jede Nacht abwechselnd aufgestanden, um nach dem Vater zu sehen. Ihre größte Angst war gewesen, dass auch er sie verlassen könnte. Dank seines Feingefühls und seiner Geduld hatte diese Angst allmählich nachgelassen. Nun wollte die Furcht von damals sie wieder mit Haut und Haaren verschlingen, doch Johanna hielt dagegen. Liebevoll schaute sie auf das nur vom Licht ihrer Kerze beleuchtete Gesicht ihres Vaters. Die Jahre, in denen Joost sie stark gemacht hatte, sollten nicht umsonst gewesen sein.
Joost Steinmann, der »Büchsenmacher«. Einmal hatte einer seiner Stammtischbrüder es gewagt, ihn so zu nennen, weil er nur drei Töchter und keinen Sohn zustande gebracht hatte. Der Mann war mit einem blauen Auge nach Hause gegangen, aus dem er eine Woche lang nicht hatte sehen können. »Was brauche ich Söhne?«, hatte Joost immer wieder gesagt. »Ich hab doch meine Steinmänner!« So hatte er Ruth, Marie und sie genannt. Johanna schluckte.
Sie schaute ihn an und strich ihm über die Wange. »Ich weiß noch nicht, wie’s weitergehen wird«, flüsterte sie leise. »Aber eines versprech ich dir!« Ihre Hand brannte auf seiner kalten Haut, und es fiel ihr nicht leicht, sie dort liegen zu lassen. »Wir werden dir keine Schande machen. Wenn du vom Himmel auf uns hinabguckst, dann sollst du stolz auf uns sein!«
Als der Morgen kam, hatte Johanna alle Tränen geweint. Während sich Ruth und Marie zu dem Toten ans Bett setzten, legte sie sich für ein paar Stunden schlafen. Doch schon am späten Vormittag wachte sie wieder auf. Es gab vor Joosts Beerdigung noch viel zu tun.
4
»Das war’s!« Ruth warf den Lumpen, mit dem sie den nassen Hauseingang aufgewischt hatte, zu dem Stapel Geschirr, der sich im Waschtrog türmte. Mit einem Plumps ließ sie sich neben Marie und Johanna auf der Küchenbank nieder.
Es war später Nachmittag. Um diese Zeit saßen sie normalerweise über ihre Tische gebeugt. Doch heute hatte um zwei Uhr die Beerdigung stattgefunden. Trotz strömenden Regens waren so viele Trauergäste zum Friedhof gekommen, dass Johanna befürchtet hatte, die für den Leichenschmaus hergerichteten Brote und Hefekuchen würden nie und nimmer ausreichen. Doch die meisten hatten sich nach der Zeremonie am Grab verabschiedet – die Arbeit wartete. Nur die Nachbarn aus den umliegenden Häusern waren mitgekommen, um über einer Tasse Kaffee oder zwei Joost in Ehren zu halten. Die Haken im Hauseingang hätten unter der Last der regenschweren Mäntel fast nachgegeben. Bald hatte alles nach nassem Filz gerochen, und auf dem Boden bildeten sich breite Wasserlachen. In der Küche hatten Ruth und die Witwe Grün nicht schnell genug frisches Wasser für Kaffee aufsetzen können. Beerdigungen machten durstig, das wusste jeder. Als die Platten mit dem Gebäck und den Schinkenbroten geleert waren und die Luft verbraucht und abgestanden roch, hatte sich einer nach dem anderen verabschiedet. Peter Maienbaum war als Letzter gegangen. Mit der Klinke in der Hand hatte er einen letzten Blick in die verwaiste Werkstatt geworfen – auch er hatte Mühe, Joosts plötzlichen Tod zu akzeptieren.
»Auf einmal ist’s so still hier drinnen.« Marie schaute sich um, als könnte sie nicht glauben, dass alles vorbei war.
Johanna nickte. Keiner mehr da, der noch Kaffee nachgeschenkt haben wollte. Oder der sie mitleidsvoll anguckte.
»Das mit der Glasrose vom Schweizer war eine schöne Idee«, sagte Marie unvermittelt.
Die beiden andern nickten.
Der Glasbläser Karl »Der Schweizer« Flein, so genannt wegen seines jahrelangen Aufenthalts in den Schweizer Bergen, hatte statt einer echten Blume eine mundgeblasene ins Grab gelegt. Doch wie die echten Blüten war Johanna auch die kristallene Schönheit fehl am Platze vorgekommen.
»Und Wilhelm Heimers Rede war auch anrührend,« bemerkte Johanna.
»Stimmt«, pflichtete Ruth ihr bei. »Als er sagte, dass er sich mit Vater immer besonders verbunden gefühlt hat, weil sie beide so jung Witwer geworden seien, hatte ich einen richtigen Kloß im Hals.«
»Mich hat gewundert, dass Heimer überhaupt gekommen ist. Wo er die Flamme doch so ungern ausgehen lässt.« Johanna verzog den Mund. Wenn des Nachts ringsum die Lichter verloschen, flimmerten weiter oben auf dem Berg im Heimerschen Haus noch lange die Gaslampen. Viele im Dorf hielten Wilhelms Heimers Fleiß für übertrieben, andere waren einfach nur neidisch auf seine vielen Aufträge, die er nur ausführen konnte, weil alle seine drei Söhne gute und fleißige Glasbläser waren.
»Dass es ausgerechnet heute hat regnen müssen«, beklagte sich Ruth.
»Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn die Sonne geschienen hätte«, erwiderte Marie. »Unter die Erde zu kommen, wenn der Himmel blaugewaschen ist und die Sonne strahlt … Nein, da ist es doch besser, wenn auch der Himmel weint.«
Dann wusste keine mehr etwas zu sagen. Vaters Tod, die Beerdigung, das Wetter, das sich nach den vielen Wochen Sonnenschein nun gewandelt hatte, die Rede des Pfarrers, der sich fortwährend versprochen hatte, so dass manche angenommen hatten, er hätte zuviel vom Altarwein getrunken – jede Kleinigkeit war beim Leichenschmaus durchgekaut worden. Nun war es genug.
Johanna starrte auf das schmutzige Geschirr. Das Feuer im Ofen war noch an. Sie könnte Wasser heiß machen und die Teller waschen. Bevor eine der beiden anderen auf diesen Gedanken kommen konnte, sprang sie auf. Marie nahm ihr eilfertig die tropfnassen Teile aus der Hand, trocknete sie ab und stapelte sie auf dem Tisch. Als alles sauber war, schleppten Marie und Ruth den Zuber mit Spülwasser nach draußen und kippten ihn aus. Johanna begann, den Glasschrank, in dem das Geschirr aufbewahrt wurde, auszuräumen. »Der gehört schon lange einmal gründlich geputzt«, gab sie auf die fragenden Blicke der beiden anderen zur Antwort. Ruth holte ihr Stopfzeug heraus und Marie das Kleid, das sie vor ein paar Tagen zu nähen begonnen hatte. Doch kaum lagen die Handarbeiten vor ihnen auf dem Tisch, ließen sie die Hände wieder in den Schoß sinken.
Als sie schließlich nach oben gingen, war es draußen noch nicht ganz dunkel. Keine von ihnen wagte, einen Blick in die verwaiste Werkstatt zu werfen.
*
Als Ruth am nächsten Morgen aufwachte, regnete es immer noch. Sie zündete die Gaslampe über dem Küchentisch an und ging wie jeden Morgen zum Vorratsschrank, um die am Vorabend gekochten Kartoffeln herauszunehmen, zu schälen und in Scheiben zu schneiden. Den Porzellanknauf in der Hand, hielt sie inne.
Es waren keine Kartoffeln da.
Kein Morgen wie jeder andere.
Mit brennenden Augen floh sie aus der Küche in den Schuppen. Hin und her ging ihr Arm, sie pumpte so heftig Wasser in die Schüssel, dass der Schwengel zu scheppern begann. Wasser lief über den blau emaillierten Rand der Schüssel, doch Ruth merkte es nicht. Erst als es über ihre Füße schwappte, ließ sie ihren Arm sinken. Ein lautes Heulen füllte die klamme Luft.
Als sie in die Küche kam, saßen Johanna und Marie schon am Tisch. Eine von beiden hatte Brot aus dem Schrank genommen, dazu ein Stück Butter und den Honigtopf. Schweigend kauten sie ihre Brote. Der süße Honig rann unbemerkt ihre Kehlen hinab, denn die Frage, die keine von ihnen auszusprechen wagte, lag ihnen allzu bitter auf der Zunge: »Wie soll es weitergehen?«
Das Regenwetter der nächsten Tage passte gut zu dem Dornröschenschlaf, in den das Haus fiel. Jede der Schwestern verkroch sich in einen Winkel des Hauses und hoffte, es würde bald wieder Zeit sein, ins Bett zu gehen. Hin und wieder schaute Peter vorbei, blieb jedoch nie lange. Im Gegensatz zu den Mädchen wartete auf ihn Arbeit. Und obwohl er sich ein wenig dafür schämte, war er jedes Mal froh, der bedrückenden Stimmung im Steinmann-Haus wieder entfliehen zu können.
Wieder einmal hatten sie eine Mahlzeit schweigend verbracht, als Johanna plötzlich aufschaute und sich räusperte. »Es wird am besten sein, wenn wir nachher erst einmal Vaters Sachen wegräumen.«
Ruth kräuselte die Stirn. »Ich weiß nicht …, sollen wir damit nicht noch warten?«
»Ob wir die Sachen heute wegräumen oder in ein paar Tagen …« Johannas Blick war zögerlich, als würde sie sich gern von ihrem Vorschlag abbringen lassen.
Johanna lag ebenso wenig an der unseligen Aufgabe wie ihr selbst, erkannte Ruth. Ganz gleich, wann sie sich dazu durchringen würden, es würde ihnen immer schwer fallen. Außerdem wusste sie nicht, wie lange sie es noch in der lähmenden Stille des Hauses aushalten würde. Da war es besser, eine unangenehme Aufgabe zu haben als gar keine.
»Du hast recht, es wird Zeit, dass wir ein bisschen Ordnung machen!«
*
Während Ruth und Johanna oben Hemden zusammenlegten, Jacken glatt strichen und Leinentücher darum banden, klopfte es immer wieder an der Tür. Auch eine Woche nach Joosts Tod brachten die Nachbarn noch Essen vorbei. Gerade war ein Töpfchen mit Suppe abgegeben worden. Neugierig hatte die Nachbarin über Maries Schulter gelinst. Wie kamen die drei Waisen zurecht? Drei junge Frauen allein …, wo gab es das schon? Am liebsten wäre das Weib hereingekommen, das hatte Marie wohl gemerkt. Aber nachdem sie sich für das Essen bedankt hatte, hatte sie einfach hastig die Tür hinter sich zugezogen.
Als Marie die Suppe abstellen wollte, verrutschte der Deckel ein wenig. Säuerlicher Geruch stieg ihr in die Nase. Marie schauerte. Womöglich war die Brühe verdorben? Sie überlegte kurz, ob sie den Topf gleich hinterm Haus ausleeren sollte, beschloss dann aber, ihn erst einmal zur Seite zu stellen. Sollten doch Ruth oder Johanna entscheiden, was damit zu tun war. Um den Topf aus dem Weg zu haben, balancierte sie ihn durch die Küche und stellte ihn in der Werkstatt auf einen der verwaisten Arbeitstische.
Sie wollte schon wieder hinausgehen, als sie doch noch stehen blieb.
Wie still es hier war!
Marie zog einen Schemel näher und setzte sich.
Keine Geister. Und doch lag in der Stille etwas Gespenstisches. Tag für Tag, ein Leben lang hatte das Singen der Bunsenbrennerflamme ihren Alltag begleitet. »Wenn die Flamme singen soll, muss man kräftig ins Feuer blasen«, hatte Vater immer gesagt. Marie spürte, wie ihr Hals eng wurde. Liebevoll strich sie über die alte Öllampe, die verwaist neben dem neuen Gasanschluss lag. Nie mehr würde seine Flamme singen.
Aus dem oberen Stockwerk hörte sie ein Rumpeln. Ordnung schaffen, hatte Ruth es genannt – dabei sprachen sie über Vaters Leben!
Als sie gefragt hatte, was sie in der Zwischenzeit tun konnte, während ihre Schwestern oben aufräumten, war ihr der panische Blick, den die beiden ausgetauscht hatten, nicht entgangen. Was tun? Diese Frage hing seit Vaters Tod ständig so groß und mächtig im Raum, dass Marie fast danach greifen konnte. Nein, sie wusste auch nicht, wie es weitergehen sollte mit ihnen. Aber dass Ruth und Johanna sie in irgendwelche Überlegungen gar nicht erst mit einbezogen, verletzte sie. Nur weil sie die Jüngste war, wurde sie nie richtig ernst genommen. Das war bei Vater so gewesen, und bei Ruth und Johanna war es nicht anders. Aber daran ließ sich wohl nichts ändern! Seufzend stand sie auf und ging wieder in die Küche.
Gegen Mittag kam die Witwe Grün vorbei und brachte ein Blech Apfelkuchen. Der Duft von Zimt und Anis zog durchs Treppenhaus und vertrieb den Geruch nach alter Männerkleidung. Während die schweren Krauteintöpfe der anderen Nachbarn ihnen oftmals im Hals stecken blieben, verzehrten die drei jungen Frauen den Kuchen mit gesundem Appetit.
»Wir müssen uns unbedingt bei der Witwe Grün noch mal für alles bedanken«, stellte Johanna fest, während sie den Kuchen in Stücke schnitt.
»Das stimmt«, pflichtete ihr Ruth bei. »Wie die mir geholfen hat, den Vater zu waschen – das hätte nicht jede gemacht.«
»Dass sie überhaupt ihre Hilfe angeboten hat, sieht ihr gar nicht ähnlich. Wo sie doch sonst immer für sich bleibt …«
»Seltsam ist das schon … Obwohl sie nur zwei Häuser weiter wohnt, bekommt man sie fast nie zu Gesicht!«, wunderte sich Marie.
In Lauscha wusste eigentlich jeder über jeden Bescheid, was nicht nur daran lag, dass es sich um ein kleines Dorf handelte und fast alle demselben Brotverdienst nachgingen. Es war vor allem die dörfliche Enge, die Geheimnisse voreinander fast unmöglich machte: Wie Perlen an einer Schnur reihten sich fast alle Häuser links und rechts entlang der Hauptstraße auf, die in steilen Windungen den Berg hoch führte. Seitenstraßen gab es nur wenige – die steilen Waldhänge hatten über Jahrhunderte hinweg erfolgreich verhindert, dass sich noch mehr Thüringer hier ansiedelten.
»Wann willst du die Witwe Grün sehen, wo sie doch den ganzen Tag oben beim Heimer arbeitet«, erwiderte Ruth. »Sie hat wahrscheinlich einfach keine Zeit zum Tratschen.«
Johanna schüttelte den Kopf. »Griseldis ist schon immer für sich geblieben, auch, als ihr Mann Josef noch lebte. Ich glaube, er hat es nicht gern gesehen, dass sie mit den Nachbarn sprach. Das war vielleicht ein alter Suffkopf!«
»Was ist eigentlich aus ihrem Sohn geworden? Magnus hieß der, oder?«, fragte Ruth zwischen zwei Kuchenbissen.
»Keine Ahnung. Der ist irgendwann einfach verschwunden. Warum und wieso weiß eigentlich keiner so genau. Aber ich war ja zu diesem Zeitpunkt auch erst dreizehn Jahre alt und …«, Johanna brach ab, als es an der Tür klopfte.
»Nicht noch mehr Essen«, stöhnte Ruth.
Doch es war Peter, der Johanna bat, mit ihm nach draußen zu kommen. Marie und Ruth schauten sich vielsagend an.
5
»Und? Alles in Ordnung?« Peter zog die Tür hinter ihnen zu.
Johanna zuckte mit den Schultern.
»Tut mir Leid, dass ich mich in den letzten zwei Tagen nur so selten habe blicken lassen, aber bei mir haben sich die Leute die Klinke in die Hand gegeben.«
Peter Maienbaum stellte künstliche Menschenaugen aus Glas her. Seine Kunden kamen teilweise von sehr weit. Wenn jemand nach einem Unfall ein künstliches Auge brauchte, war Eile angesagt. Je länger damit gewartet wurde, desto größer wurde die Gefahr, dass sich die Augenhöhle mit dem Fremdkörper darin entzündete oder zu eitern begann. Wurde das Glasauge jedoch baldmöglichst eingesetzt, war die Chance groß, dass sich die Muskeln daran gewöhnten und sich das Auge im besten Fall sogar bewegen ließ.
»Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Du hast dich schließlich mehr um uns gekümmert als jeder andere«, winkte Johanna ab.
»Das ist der nächste Punkt« – verlegen trat Peter von einem Bein aufs andere. »Es ist so …, ich würde ja gern das Werkzeug eures Vaters kaufen und seine ganzen Rohlinge noch dazu …, aber ich kann das Zeug einfach nicht gebrauchen!«
Johanna versuchte ein Lächeln. »Das weiß ich doch auch, dass du Rohlinge aus der Farbglashütte brauchst und nicht unsere farblosen und braunen.« Sie legte ihre Hand auf seine Schulter. »Mach dir keine Sorgen um uns. Unkraut vergeht nicht.« Sie schubste ihn leicht. »He, wer tröstet hier wen?«, versuchte sie es mit Galgenhumor. »Wir verhungern schon nicht – du müsstest mal die vielen Töpfe sehen, die uns die Leute vorbeigebracht haben. Als ob wir zehn Junge wären statt nur drei.«
Sein Blick blieb skeptisch. »Essen ist das eine. Aber ihr braucht doch auch Geld. Und Arbeit. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie’s bei euch weitergehen soll!«
Johanna seufzte. »Das wissen wir auch noch nicht. Wir sind gerade dabei, Vaters Sachen aufzuräumen. Irgendwo wird sich schon ein Notgroschen finden, der uns erst mal weiterhilft.« Bisher war allerdings noch nichts Derartiges aufgetaucht, und sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wo sie noch fündig werden sollten.
»In eurer Werkstatt stehen doch noch einige Kartons mit fertigen Waren – soll ich die für dich nach Sonneberg bringen?«
»Nein, das mach ich schon selbst«, erwiderte Johanna hastig. »Ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich für einen Tag raus komme. Außerdem: Friedhelm Strobel würde nicht schlecht gucken, wenn auf einmal du ankämst! Und wenn’s morgen Hunde und Katzen regnet – ich geh nach Sonneberg und verkaufe den Rest.« Sie seufzte. »Eigentlich hätte ich ja schon letzten Freitag gehen sollen. Aber so kurz nach Vaters Tod …«
»Der Strobel soll dir ja nicht dumm kommen, sonst kriegt er’s mit mir zu tun! Sag ihm das! Und auch sonst …« – er hob ihr Kinn an – »wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kommst du zu mir. Versprichst du mir das?« Sein Blick ließ Johanna nicht wegschlüpfen.
Sie wand sich aus seinem Arm. Etwas in ihrem Inneren hielt sie davon ab, dieses an sich harmlose Versprechen zu geben. »Wir werden es schon irgendwie richten«, erwiderte sie stattdessen vage. Sie wollte nicht, dass Peter sich zu sehr für sie verantwortlich fühlte. Sie drückte noch kurz seinen Arm, nickte ihm zu und verschwand dann im Haus. Einen Augenblick lang spielte sie mit dem Gedanken, die Treppe hoch zu schleichen und sich einfach ins Bett zu legen. Das viele Reden und die zuversichtliche Miene, die sie dabei aufsetzen musste, kostete so viel Kraft – warum merkten die anderen das bloß nicht? Doch dann gab sie sich einen Ruck – sie konnte ihre Schwestern schließlich nicht allein lassen.
»Und – was hat Peter gewollt?«, platzte Ruth heraus, noch bevor Johanna die Tür hinter sich zugezogen hatte.
Johanna spürte plötzlich ein seltsames Flattern in ihrem Bauch. So hatte sie an besagtem Montag auch im Türrahmen gestanden. Bevor die Traurigkeit sich erneut wie ein schwarzes Tuch um sie legen konnte, gab sie sich einen Ruck. Sie mussten miteinander reden, daran führte kein Weg vorbei.
»Peter würde uns gern Vaters Werkzeug abkaufen und die Rohlinge noch dazu, aber leider kann er das alles nicht gebrauchen.«
»Vielleicht kauft uns einer der anderen Glasbläser die Rohlinge ab?«, fragte Marie.
Ruth seufzte. »Ich weiß nicht …, die Sachen so einfach aus dem Haus zu geben, das wird mir schwer fallen. Das macht alles erst so richtig endgültig.«
»Aber das ist es doch auch!«, schrie Marie leise auf. »Ohne Vater ist’s aus und vorbei mit unserer Glasbläserei.« Sie presste ihre Hand vor den Mund. »Was um alles in der Welt soll denn jetzt aus uns werden?«
Johanna hatte darauf keine Antwort. Seit Vaters Tod dachte sie über nichts anderes mehr nach als darüber, wie es weitergehen sollte. Die Zuversicht, die sie Peter gegenüber an den Tag gelegt hatte, war so hohl wie die Glasperlen, mit deren Herstellung sich das halbe Dorf den Lebensunterhalt verdiente.
Ohne Glasbläser war ihre Lebensgrundlage zerstört. Ohne Glasbläser gab es nichts zu schleifen, zu bemalen oder einzupacken. All ihre Fertigkeiten waren für die Katz.
»Morgen geh ich nach Sonneberg und verkaufe, was an fertiger Ware noch da ist. Viel werden die wenigen Gläser nicht bringen, aber die paar Groschen verschaffen uns wenigstens eine Atempause. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Leute uns ewig Essen vorbeibringen.« Johanna schaute Ruth an, die nicht ganz bei der Sache zu sein schien, und beschloss, noch deutlicher zu werden. Schlechte Nachrichten wurden nicht leichter verdaulich, indem man sie stückweise verabreichte. »Ich hab jede Ritze in Vaters Kammer durchgesucht, aber es scheint, als hätte er nichts für schlechte Zeiten zurückgelegt.« Sie hob die Schultern. »Der Anschluss ans Gaswerk hat wohl alle Ersparnisse aufgefressen.« Sie biss sich auf die Lippen. Es fiel ihr selbst schwer, das zu glauben.
»Vielleicht geben die von der Gasanstalt uns das Geld wieder zurück, wenn wir ihnen sagen, dass wir den Anschluss nicht mehr brauchen?«, fragte Marie leise.
Ruth runzelte die Stirn. Typisch Marie! »Das glaubst du doch selbst nicht! Hast du vergessen, dass die Arbeiter drei Tage graben mussten, bis die Leitung von der Gasanstalt zu unserem Haus gelegt war? Dafür war das Geld. Da können wir doch jetzt nicht einfach kommen und es wieder zurück verlangen. Oder?« Ein kleiner Hoffnungsschimmer flackerte dennoch in dem Blick, den sie Johanna zuwarf.
Doch die schüttelte nur den Kopf. »Auf so etwas lassen die sich gewiss nicht ein! Nein, nein, wir müssen mit dem Geld, das ich vom Friedhelm Strobel bekomme, so lange über die Runden kommen, bis … sich etwas ergibt.«
Der Hoffnungsschimmer in Ruths Blick erlosch. »Ach, wenn uns nur einer helfen würde! Wenn wir einen hätten, der sich an Vaters Bolg setzen würde …«
»Wer sollte das tun?« Johanna lachte bitter auf. »Die anderen Glasbläser müssen doch auch alle schauen, dass sie mit ihrer Arbeit fertig werden. Und außerdem: Wie sollten wir den Mann bezahlen?«
Marie sah aus, als wollte sie etwas sagen, traute sich aber nicht, aus Angst, erneut einen Rüffel zu bekommen.
»Wir müssen darauf hoffen, dass wir irgendwo als Arbeitsmädchen unterkommen. So wie die Witwe Grün«, sagte Johanna. Der Widerwillen in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Arbeitsmädchen waren noch schlechter gestellt als Mägde, das wusste jeder. Da ihr Lohn nur wenige Pfennige pro Arbeitsstunde betrug, mussten sie täglich zehn oder mehr Stunden arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Skeptisches Schweigen. Die Betriebe im Dorf, die fremde Leute beschäftigten, waren rar gesät. Bisher hatte ihnen keiner Arbeit angeboten.
»Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wieder einen Glasbläser ins Haus zu bekommen …« Ruth grinste. »Vielleicht sollten wir allmählich ans Heiraten denken! Das wäre in unserer Situation doch weiß Gott nicht die dümmste Idee, oder?« Sie setzte sich aufrecht hin, als wollte sie im nächsten Moment zu Papier und Griffel greifen, um in Frage kommende Kandidaten zu notieren.
Johanna und Marie schauten sie entgeistert an, nicht sicher, ob sie von ihr auf den Arm genommen wurden.
»Und wo willst du so schnell drei Ehemänner herzaubern?«, fragte Marie.
Ruth schien die Ironie in Maries Stimme nicht wahrzunehmen. Sie verzog den Mund und antwortete ernsthaft: »Das ist in der Tat ein Problem. Vater hat ja immer alle vertrieben. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, sind alle Burschen in unserem Alter im Dorf weggeschnappt, und wir versauern als alte Jungfern. Die anderen Mädchen sind alle längst verlobt!« Ihre Stimme bekam einen leicht panischen Unterton.
Johanna glaubte, nicht richtig zu hören. »Was redest du für Unsinn?«
»Das ist kein Unsinn, sondern die Wahrheit«, verteidigte sich Ruth. »Von den Männern, die inzwischen vergeben sind, hätte mir auch der eine oder andere gefallen können. Da waren einige patente Glasbläser dabei. Aber Vater hat uns ja nicht einmal zum Hüttenplatz gehen lassen, wie also hätte sich je einer für uns interessieren können? Wahrscheinlich haben die uns längst alle abgeschrieben!«
Der Hüttenplatz war der Ort, wo sich die Jungen des Dorfes nach getaner Arbeit trafen. Während drinnen die Feuer der Schmelzöfen große Flammen schlugen, saßen draußen die Mädchen auf der hüfthohen Mauer und kicherten. Vor ihnen rempelten sich die Burschen gegenseitig an, klopften Sprüche oder rauchten Zigaretten, die ihnen oftmals das Wasser in die Augen trieben. Interessierte, verliebte oder auch abweisende Blicke wurden getauscht, manchmal kokett, manchmal forsch oder einfach nur plump, je nachdem, wie viel Raffinesse der Einzelne in seine Werbung zu legen vermochte.
Johanna hatte es nie etwas ausgemacht, an diesen Abenden nicht dabei gewesen zu sein, ganz im Gegenteil: Sie empfand schon die Blicke der jungen Männer, die hinter Ruth, Marie und ihr hersahen, wenn sie durchs Dorf gingen, als störend. Und Ruth hatte immer behauptet, sie würde lieber auf einen polnischen oder russischen Prinzen warten, als sich mit einem der ungelenken Jünglinge vom Hüttenplatz abzugeben. Genau daran erinnerte Johanna sie nun.
»Vielleicht waren das die Hirngespinste eines jungen Mädchens, nicht mehr«, wischte Ruth ihre Träume weg. »Ich möchte endlich einmal etwas erleben. Glaubst du, es macht mir Spaß, tagtäglich nur für die Hausarbeit zuständig zu sein? Ich möchte mich auch einmal hübsch machen, so wie andere Weiber das tun. Und dann in die Singstunde gehen oder in den Theaterverein, wo sie dauernd schöne Kostüme tragen dürfen! Oder einfach nur auf eines der Feste. Vielleicht würde ich dabei sogar meinen Prinzen treffen! Wenn wir allerdings weiter wie Einsiedler leben, wird das gewiss nicht geschehen!«
Entgeistert starrte Johanna ihre Schwester an. Sie hatte auf einmal das Gefühl, viel zu wenig darüber zu wissen, was in Ruth vorging.
»Aber wir können doch jetzt nicht losziehen und uns so mir nichts dir nichts einen zum Heiraten suchen!« Maries skeptische Feststellung durchschnitt die Stille, die sich gerade breitmachen wollte. »Mir würde da keiner einfallen!«
Johanna seufzte. Manchmal ging ihr Maries naive Art wirklich gegen den Strich.
»Mir schon, allerdings nicht für mich …«, sagte Ruth lachend. »Welcher Nachbar kommt täglich herüber und will eine von uns allein sprechen?«
Marie kicherte.
Johanna verdrehte die Augen. Dass Ruth zwischen ihr und dem Nachbarn mehr vermutete als Freundschaft, war ein alter Hut. Für sie war Peter jedoch wie ein großer Bruder. Mit ihm konnte sie reden, wie ihr der Schnabel gewachsen war. »Peter ist ein guter Freund. Von uns allen!«, erwiderte sie, obwohl sie nicht die geringste Lust auf dieses Gespräch verspürte.
»Vielleicht für dich. Ich glaube jedoch, dass er das mit anderen Augen sieht …« Ruth hob die Augenbrauen und schaute geheimnisvoll drein. »Mit Glasaugen!«, platzte sie kichernd heraus.
»Du bist gemein!«, fuhr Marie sie an. »Ich finde Peter sehr nett! Aber andererseits: Wie kann man jemanden heiraten, der Maienbaum heißt?« Auch sie kicherte, wenn auch weniger boshaft als Ruth.
»Ach, ihr seid doch dumme Hühner!« Johanna stand auf und begann, die Kuchenteller in die Spüle zu tragen. »Von mir aus kannst du dir einen zum Heiraten suchen«, sagte sie zu Ruth. »Wenn ich mir allerdings ansehe, wie’s bei den meisten im Dorf daheim aussieht, dann erscheint mir das nicht wie das Paradies auf Erden! Da ist das Brot knapp, und ob eine verheiratet ist oder nicht, macht gar keinen Unterschied. Aber bitte …« Sie zuckte die Schultern. »Wenn du schon dabei bist, such dir am besten einen Mann mit Bruder, dann ist Marie auch gleich versorgt. Ich für meine Fälle geh jedenfalls morgen erst einmal nach Sonneberg!«
6
Draußen war es noch dunkel, als Johanna von Ruth wachgerüttelt wurde. Einen Augenblick lang wusste Johanna nicht, ob sie träumte oder nicht, doch dann erinnerte sie sich wieder an die vor ihr liegende Aufgabe. Während Ruth im Nachtkleid die Treppe hinunterging, zog sich Johanna an. Ihre Sachen hatte sie schon am Vorabend aus dem Schrank geholt und zurechtgelegt. Widerwillig betrachtete sie die Jacke aus dichtgewebtem Wollstoff – vorbei war die warme Jahreszeit, wo eine dünne Strickweste gereicht hatte.
In der Waschküche fuhr sie sich mit einem nassen Lappen übers Gesicht, kämmte ihre Haare aus, die sich in der kurzen Zeit schon am rauen Jackenkragen festgehakt hatten, und band sie zu einem Zopf zusammen. Diesen legte sie wie einen Kranz um ihren Kopf und steckte das Ende mit mehreren Nadeln fest. Darüber band sie ein Tuch, dessen Enden sie ebenfalls miteinander verknotete, so dass nirgendwo ein Zipfel abstand. Mit dem Korb auf dem Rücken, dessen Ladung Gläserkartons hoch über ihren Kopf hinausragte, würden andere Frisuren sie nur stören. Einen langen Augenblick starrte sie auf ihr Spiegelbild und sah nur riesengroße Augen. Es erstaunte sie jedes Mal, wie sich ein Gesicht veränderte, wenn man die Haare wegnahm. Auf einmal wirkte auch ihr Mund viel größer. Prüfend öffnete sie die Lippen, doch es war nicht der Spiegel, der ihr Bild verzerrte. Ihre Oberlippe wölbte sich tatsächlich in einem weiten Bogen, und ihre Unterlippe war nicht weniger sinnlich. Fast sah es so aus, als würde sie ihrem Spiegelbild einen Kuss zuwerfen! Johanna runzelte die Stirn. Dem Vater war es nie ganz wohl dabei gewesen, sie allein nach Sonneberg zu schicken. Daher hatte er von Anfang an darauf bestanden, dass sie sich so unauffällig wie möglich dafür herrichtete. Johanna fragte sich nicht zum ersten Mal, ob sie durch ihre Aufmachung womöglich das Gegenteil von dem erreichte, was sie eigentlich wollte. Doch dann streckte sie ihrem Spiegelbild die Zunge heraus und ging ins Haus zurück.
Ruth hatte bereits die Kartons, in denen jeweils vier Gläser abgepackt waren, sorgfältig auf dem hölzernen Gestell festgezurrt, das an Johannas Lieferkorb befestigt wurde. Gemeinsam trugen sie alles vor die Haustür. Kein Nebel, stellte Johanna erleichtert fest, als sie die schmale Straße hinabblickte. Mit eingespielten Handgriffen schulterte sie den Korb und band sich den Tragegurt um den Bauch. Dann hob Ruth das Gestell darauf und verschnürte es an vier Stellen. Sie hielt Johanna am Arm fest. »Wenn du in Sonneberg bist, dann hör dich um. Vielleicht erfährst du von jemandem, der Arbeit für uns hat. Vielleicht weiß ja auch Strobel einen Glasbläser, der uns nehmen würde.«
Johanna nickte. Das hölzerne Gestell drückte sich schon jetzt unangenehm in ihren unteren Rücken. Sie machte sich auf den Weg.
»Und versuch, dem Geizhals einen besseren Preis abzuringen. Wir brauchen jeden Pfennig!«, rief Ruth ihr nach.
Als ob sie das selbst nicht am besten wüsste! Johanna verzog den Mund. Gute Ratschläge geben, das konnte Ruth. Aber selbst traute sie sich das Verkaufen nicht zu. »Dieser Strobel ist mir unheimlich. Den möchte ich nicht öfter treffen«, hatte sie gemeint, als sie letztes Jahr Johanna einmal begleitet hatte. Auch Johanna war der Mann nicht sonderlich sympathisch, aber was ließ sich daran ändern? Sie seufzte und marschierte dann munter geradeaus.
Es war kurz nach halb sieben.