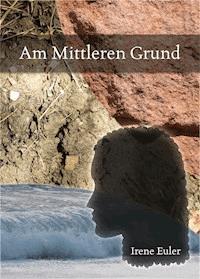Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Erdree ist fassungslos, als sie zum Linländer Heer gerufen wird. Auch der Bogenschütze Wiralin traut seinem verbliebenen Auge nicht – wie soll diese elende Glasbrecherin im Kampf gegen die Ronn helfen? Ihre kreischende Stimme ist unerträglich, und sie wird schon auf der Reise zum Heer todkrank. Aber die Generalin Ulante hat einen Plan, und niemand kann sich ihren Befehlen entziehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Glasbrecherin
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Weitere Bücher von Irene Euler
Irene Euler: Der Zorant – Leseprobe
I
Ulante starrte ins Nichts. Wann immer sie eine Karte von Linland vor sich liegen hatte, endete ihr Blick im Nichts – dort, wo die schwarzen Tintenstriche mit dem Glynwald abbrachen. Dort, wo nur noch pergamentfarbene Leere herrschte. Dort, wo vor fünf Jahren Siedler versucht hatten, neuen Boden zu kolonisieren. Dort, wo plötzlich die Ronn aufgetaucht waren, diese seltsam menschenähnlichen Wesen. Mit drei Fingern statt vier, die dafür von zwei Daumen eingerahmt wurden. Mit merkwürdig leichtem, beinahe flauschigem Haar und kurzen, stumpfen Nasen. Mit Augen, deren Schnitt so rund war, dass man das Weiße nicht zu sehen vermochte. Es wären Kinderaugen gewesen, hätte nicht unverbrüchlicher Stolz aus ihnen gesprochen. Derselbe Stolz hielt die schmalen, länglichen Schädel der Ronn betont aufrecht auf ihren strammen Hälsen. Seit vier Jahren kämpfte Ulante in jedem Frühjahr, in jedem Sommer und in jedem Herbst gegen die Ronn, dort am Rande des Nichts. Zwei Jahre lang als Oberstes Schwert, zwei Jahre lang als Generalin. Und sie war keinen einzigen Schritt weiter gekommen. Es war dem Heer unter ihrer Führung nicht gelungen, das unbekannte Hügelland hinter dem Glynwald zu erobern. Es war ihm nicht einmal gelungen, die Ausläufer des Waldes frei von Ronn zu halten. Seit vier Jahren ging es um mehr als nur um neues Land für die Kolonisten. Es ging darum, Linlands Grenze gegen die Ronn zu sichern. Dafür musste Ulante die Ronn vernichten, oder zumindest weit zurückschlagen. Noch in diesem Jahr, das gerade erst begonnen hatte. Einen weiteren Winter auf Glynwerk würde sie nicht ertragen. Auf dieser düsteren Festung über einem Bergpass tief im Glynwald fühlte sie sich jeden Tag mehr wie eine Gefangene. Andere Aufgaben warteten auf sie. Solange sie hier im Nordosten festsaß, konnte die Westprovinz nicht für Linland zurückerobert werden. Sie hungerte danach, ihr Heer gegen die Westprovinz zu führen – gegen diese elenden Verräter, die glaubten, ihren Landstrich nach hundertsiebzig Jahren einfach wieder von Linland trennen zu können. Das würde ein wahrer Kampf sein: Linländer gegen abtrünnige Linländer, alle mit vier Fingern und einem Daumen an den Händen, mit schwerem, glänzendem Haar auf den Köpfen, mit stämmigen Leibern, mit kräftigen Nasen, mit rundlichen Schädeln und mit Augen, die ihre Blickrichtung verrieten. Kämpfer gegen Kämpfer auf offenem Feld – anders als gegen die verschlagenen, feigen Ronn, die sich nie einer richtigen Schlacht stellten. Ungestüm schob Ulante die Karte von sich und warf ihr dunkelbraunes Haar über die Schultern zurück. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Sie brauchte eine wirksame Waffe gegen die Ronn. Oder ein Wunder.
Es pochte an die Tür.
„Ja, herein!“
Ulantes forsche Aufforderung brachte Oredion über die Schwelle der Generalskanzlei. Lautlos schnaubte Ulante durch die Nase. Ein Wunder sah anders aus als der Oberarzt ihres Heers. Oredion war eine durch und durch mittelmäßige Erscheinung: Nicht unbedingt hager, aber auch nicht stämmig, nicht groß, aber auch nicht klein. Mittelbraunes Haar fiel über mittelbraune Augen und umrahmte Gesichtszüge, denen jede Entschlossenheit fehlte, sich zu Schönheit zu erheben oder der Hässlichkeit anheimzufallen. Ulante verzieh Oredion dies alles nur wegen seiner Hände. Seine Hände waren überaus edel geformt und verfielen in beredte Gesten, wenn er sprach. Als Soldat hätte Oredion die Generalin mit seiner Vorsicht und Bedächtigkeit zur Weißglut getrieben. An einem Arzt schätzte Ulante diese Eigenschaften zumindest manchmal. Sie blickte Oredion stumm entgegen. In die Generalskanzlei kam nur, wer etwas zu sagen hatte. Ulante verzichtete schon lange darauf, die Eintretenden zum Sprechen aufzufordern.
„Ich bin möglicherweise auf etwas Bedeutendes gestoßen...“ Oredions nachdenklicher Ton fand ein Echo in einem leichten Stirnrunzeln.
Ulante seufzte gereizt. Möglichkeiten interessierten sie nicht. Tatsachen waren das Einzige, was zählte. Unwillig beäugte sie das kleine Silbertablett, das Oredion in seinen perfekten Händen trug. Auf dem Tablett lag ein ellenlanger, fadendünner, durchsichtiger Strang. An einem Ende schimmerte er rötlich, als ob er nicht mit aller Sorgfalt gesäubert worden sei. Gesäubert wovon? In der Generalin stieg nicht einmal ein Verdacht auf, was der Arzt ihr zeigen wollte.
„Sag mir, was ich sehe, Oredion,“ fuhr Ulante ihn an. „Du solltest inzwischen wissen, dass ich keine Zeit für Rätsel habe!“
Oredion neigte zur Entschuldigung den Kopf. „Verzeiht mir – ich bin wohl noch zu sehr von meinem Fund gefangen. Ihr gabt mir den Auftrag, einen Ronn genau zu untersuchen. Ich sollte die besonderen Schwächen unseres Gegners herausfinden...“
II
Bekümmert rubbelte Algon sein Knie. Das Rheuma quälte ihn wieder einmal so sehr, dass er schwer auf seinen Holzstuhl niedergeplumpst war. Dabei hatte der raue Stoff seines Unterhemds auch noch den Ausschlag auf seinem Rücken aufgerissen. Algon seufzte. Bestimmt würde er in der Nacht kein Auge zumachen. Nun, er war an Juckreiz, an Schlaflosigkeit und an Schmerzen gewöhnt. Die kommende Nacht würde nicht schlimmer werden als viele andere während seiner sechsundvierzig Jahre in Mooresruh. Ganz anders standen die Dinge für einen seiner Schützlinge. Ihr standen Tage und Nächte voll nie gekanntem Grauen bevor. Allein der Gedanke daran raubte dem Ältesten der Glasbrecher den Atem. Mühsam und mit pfeifenden Geräuschen schnappte Algon nach Luft. Noch bevor er sich gefasst hatte, tauchte Erdree im Türrahmen auf. Obwohl er sie selbst herbeigerufen hatte, setzte Algons Herzschlag für einen Moment aus. Röchelnd winkte er Erdree heran und deutete auf einen Stuhl zu seiner Rechten. So gut es mit tränenden Augen ging, nahm er ihren Anblick ein letztes Mal in sich auf. Er bewunderte den Kopf, auf dem sich keine einzige kahle Stelle fand, die Augen, die nicht rot und entzündet waren, die Gesichtshaut, die kaum Narben aufwies, und den Körper unter der losen Kutte, der kein bisschen verkrüppelt war. Für eine Glasbrecherin verfügte Erdree über eine schier unverwüstliche Gesundheit. In Algons Augen war sie immer ein Wunder gewesen – sein ganzer Stolz und die größte Stütze der gebrechlichsten Bewohner von Mooresruh. Erst mit dem heutigen Tag hatte das Wunder sich in einen Alptraum verwandelt. Ausgerechnet diesen Schützling musste Algon einem furchtbaren Schicksal ausliefern.
Endlich legte sich seine Atemnot. Trotzdem sah Algon Erdree weiter schweigend an. Zuletzt musste er sich eingestehen, dass die stumme Verständigung, die sonst den Alltag von Mooresruh beherrschte, heute nicht ausreichen würde.
„Hast du den Besucher gesehen, der heute Morgen gekommen ist?“ Algon erhob seinen Ton nicht über ein Flüstern. Auch für andere Glasbrecher war die Stimme eines Glasbrechers in normaler Lautstärke kaum zu ertragen.
Erdree schüttelte flüchtig den Kopf, deutete aber auf ihr Ohr. Sie hatte den Besucher nicht selbst gesehen, aber von ihm gehört. Natürlich. Der Mann musste ungeheures Aufsehen erregt haben – so großes Aufsehen, dass die Bewohner von Mooresruh sogar darüber sprachen. Die Glasbrecher kannten nur zwei Arten von Besuch: Die Fuhrleute, die alle paar Monate mit verächtlichen Mienen Nahrungsmittel und andere Güter ablieferten. Und trauernde Eltern, die ihre Kinder in Mooresruh zurücklassen mussten, weil jeder Laut der Kleinen unerträglich in den Ohren schmerzte und alles Glas zu Bruch gehen ließ.
Weil der Älteste wieder in Schweigen verfallen war, hob Erdree die Brauen und wandte ihre rechte Handfläche nach oben.
Algon räusperte sich. Er sprach so selten, dass sein Gewisper brüchig und heiser hervorkam: „Der Besucher war ein Bote der Generalin Ulante. Sie verlangt, dass ein Glasbrecher zum Heer entsandt wird.“
Die Fassungslosigkeit, die sich nun über Erdrees Züge ausbreitete, war ebenso groß wie Algons eigene. Erdree wiederholte ihre letzte Geste.
Algon hatte die Frage freilich schon vorweggenommen und setzte im gleichen Moment fort: „Der Bote sagte, dass die Glasbrecher dem Heer genauso verpflichtet wären wie alle anderen Linländer – womöglich noch mehr, weil sie sonst nichts zum Wohl des Landes beitragen. Und nun würde eben einer der Glasbrecher zum Dienst gerufen werden.“
Erdree hob mechanisch die Hände, hielt jedoch inne. Wie Algon zuvor stieß sie an die Grenzen der wortlosen Verständigung. Es führte kein Weg daran vorbei, ebenfalls zu flüstern: „Welchen Dienst soll ein Glasbrecher denn im Heer leisten – wo wir doch nicht einmal dazu fähig sind, wie normale Bürger zu arbeiten?“
Algon hob die Schultern und stöhnte leise, weil der Stoff seines Unterhemds erneut seinen Ausschlag aufrieb. „Dieselbe Frage habe ich dem Boten natürlich auch gestellt. Er antwortete nur, dass die Generalin darüber zu entscheiden hätte.“
Diese vage Auskunft minderte Erdrees Verwirrung keineswegs. An ihrem unstetem Blick konnte Algon erkennen, wie fieberhaft sie darüber nachdachte, was um Lins willen die Generalin von einem Glasbrecher im Heer erwarten könnte. Der Älteste legte Erdree eine Hand auf die Schulter. Sowie ihr Blick zu ihm zurückkehrte, fuhr er sich mahnend mit einem Finger quer über die Stirn. Angespanntes Grübeln schadete der fragilen Gesundheit der Glasbrecher. Deshalb hatte Algon sich selbst und seine Schützlinge stets zur Schicksalsergebenheit angehalten. Alles würde sich weisen, wenn die rechte Zeit gekommen war. Meist kam es schlimm, und dann war es besser, all das Schlechte nicht schon zuvor in Gedanken durchlitten zu haben. Diesmal fiel es Erdree offensichtlich schwer, sich ihrer Unwissenheit zu fügen. Ihr Atem ging immer noch hastig, als sie nach einer Weile die linke Handfläche nach oben wandte. Mit gehobenen Brauen ließ sie ihren rechten Zeigefinger einen Kreis um die Handfläche ziehen.
Algon kopierte die Geste. Zum Abschluss legte er seinen Zeigefinger auf den Ballen unterhalb seines kleinen Fingers – dorthin, wo auf einer Karte von Linland die nordöstlichen Landschaften verzeichnet gewesen wären. „Das Heer steht immer noch im Glynwald,” ergänzte er flüsternd. “Es ist den Soldaten noch nicht gelungen, die Ronn endgültig abzuwehren.“
Erdree senkte den Kopf und schlug die Arme um ihren Körper. Anscheinend ließ allein der Gedanke an den Nordosten sie in dieser kalten Jahreszeit frösteln. Algon vermutete, dass ihre Augen wieder fieberhaft von einer Seite zur anderen flitzten. Diesmal schritt er nicht ein. Er wusste, was als Nächstes kommen würde, und er wünschte, diesen Moment möglichst lange hinauszuzögern – am liebsten für immer. Der Blick, den Erdree zuletzt auf den Ältesten richtete, war starr vor schrecklicher Gewissheit. Voll Widerstreben streckte sie ihren rechten Zeigefinger aus, um ihn schließlich auf die eigene Brust zu richten.
Algon brachte es nicht über sich, zu nicken, aber seine verzweifelte Miene sagte alles. Erdrees Augen schweiften wieder ab, ziellos, als ob sie irgendwo an den Wänden des düsteren Raumes Halt suchen würden.
„Wen könnte ich denn sonst schicken?“ In seinem Kummer verlor der Älteste der Glasbrecher beinahe die Kontrolle über seine Stimme. Einige Silben brachen so laut hervor, dass sie schmerzhaft durch seine Ohren schnitten. „Mir ist befohlen worden, den kräftigsten Bewohner von Mooresruh an die Grenze zu senden. Das bist du. Jeder andere Glasbrecher würde wahrscheinlich nicht einmal die Reise in den Nordosten überstehen. Nur Kurim ist ähnlich kräftig wie du. Und vielleicht noch Islar. Aber sie sind beide zu jung – Kurim wurde gerade erst fünfzehn, und Islar ist noch nicht einmal vierzehn! Ich würde nichts lieber tun, als dich vor den Befehlen der Generalin zu bewahren! Aber ich muss ihr gehorchen! Du musst ihr gehorchen! Sie schützt Linland für alle – auch für uns hilflose Glasbrecher. Wenn sie findet, dass auch wir für Linland eintreten müssen, ist es unsere Pflicht, den verlangten Dienst zu leisten. Es sind schließlich die Linländer Bürger, die uns trotz unserer Nutzlosigkeit am Leben erhalten. Wie könnten wir uns also weigern, wenn wir aufgefordert werden, Linland zu dienen?“
Während Erdree ausdruckslos zu Boden starrte, konnte Algon die Tränen nicht länger zurückhalten. Er griff nach Erdrees Hand, und so saßen die beiden Glasbrecher für eine Weile nebeneinander. Als der Älteste seine Fassung wiedergewonnen hatte, fing Erdree seinen Blick auf. Ihr linker Zeigefinger beschrieb einen Bogen, der den Lauf der Sonne vom östlichen zum westlichen Horizont imitierte.
„Sobald du das Nötigste zusammengepackt hast,“ erwiderte Algon. Sein Flüstern war vom Weinen noch heiserer als zuvor. „Der Bote der Generalin wartet draußen vor dem Tor, bei seinem Wagen. Er hat nicht einmal die Maultiere ausspannen lassen. Er will so schnell wie möglich abreisen.“
Nun flackerte auch auf Erdrees Miene für einen Augenblick Verzweiflung auf. Doch die starre Maske kehrte sofort zurück.
„Es ist wahrscheinlich besser so,“ wisperte Erdree tonlos. „Dann werde ich keine Zeit haben, über irgendetwas nachzudenken.“ Wie Algon vorher fuhr sie sich mit einem Finger quer über die Stirn. Dann sprang sie auf und flüsterte dem Ältesten ein „Leb wohl!“ ins Ohr.
Seine gestammelte Antwort vernahm sie nicht mehr. Zu rasch war sie aus dem Raum gehastet, mit gesenktem Kopf zwischen hochgezogenen Schultern.
Ungeduldig schritt Wiralin neben dem Wagen auf und ab, seinen Blick auf den gefrorenen Straßenschlamm geheftet. Dieser Ort und seine Bewohner riefen den tiefsten Unwillen hervor, den er jemals empfunden hatte – und das wollte nach den vergangenen Monaten etwas heißen! Allein der Name dieses geduckten Vierkanthofs aus schwarzgrauem Stein war ein Witz: Mooresruh! Noch ein Name wie Sumpfloch wäre zu schmeichelhaft gewesen! Sogar jetzt, mitten im Winter, stieg der stechende Geruch des fauligen Wassers in Wiralins Nase. Wahrscheinlich verhinderten die Gärprozesse in den Tümpeln, dass sie ganz zufroren. Wie unerträglich musste dieser Ort erst in der warmen Jahreszeit sein! Sicher schwärzten dann auch noch Insektenschwärme die verpestete Luft. So betrachtet war es klug gewesen, die Behausung fensterlos zu errichten. Auf diese Weise konnten die Insekten und die Sumpfdämpfe leichter draußen gehalten werden – um drinnen mehr Raum für den Mief feuchter Mauern, für den Rauch schlecht ziehender Feuerstellen und für den Gestank der verschiedensten Krankheiten zu lassen. Wiralin schüttelte sich unwillkürlich unter der frischen Erinnerung an das Innere von Mooresruh. Neben der Behausung der Glasbrecher sah selbst das Armenspital der heruntergekommensten Stadt wie ein Hort der Gesundheit aus. Alle Linländer wussten von Kindesbeinen an, dass die Glasbrecher überaus schwach und kränklich waren. Doch nie hätte Wiralin sich diese elenden Kreaturen auszumalen vermocht, die Mooresruh bevölkerten. Obwohl es drinnen beinahe stockdunkel war, sahen die Glasbrecher noch viel widerwärtiger aus als alle Erzählungen glauben ließen. Diese gebeugten, schlurfenden Gestalten mit ihren stieren Blicken aus krätzigen Gesichtern! Er musste dankbar sein, dass er nur einzelnen Glasbrechern begegnet war, und dass der fahle Fackelschein viel verborgen hatte. Das Gespräch mit dem Ältesten war schlimm genug gewesen. Wie alt mochte er sein, um die siebzig? Wiralin hatte Hundertjährige gesehen, die besser aussahen. Eine Zumutung, in diese Triefaugen blicken zu müssen, die über einer laufenden Nase in einem völlig kahlen Schädel saßen! Und diese knotigen Finger, die der Älteste genauso zittrig hielt wie seinen Kopf, während ein grauenvoller Ausschlag seinen Hals hochkroch! Bei Algons Anblick hatte Wiralin bezweifelt, dass die Stimme tatsächlich das Schlimmste an einem Glasbrecher sein sollte. Doch er war rasch eines Besseren belehrt worden. Bei jedem halblauten Wort des Ältesten hatte Wiralin den Reflex unterdrücken müssen, beide Hände über seine Ohren zu legen. Niemand konnte diesen Kreischton ertragen. Und natürlich war dieser Kreischton der wahre Grund dafür, dass Mooresruh keine Fenster hatte. Selbst der Einbau einiger kleiner Fenster wäre eine riesige Dummheit gewesen. Nach jedem Schmerzens- oder Schreckensschrei hätten die Glasscheiben ersetzt werden müssen – wieder und immer wieder. Nur das Flüstern der Glasbrecher blieb frei von dem alles zerschmetternden Kreischton. Aber um das Flüstern des Ältesten verstehen zu können, hatte Wiralin viel näher zu ihm heranrücken müssen als ihm lieb gewesen war. Wenigstens war der Alte gefügig geblieben, obwohl die Botschaft der Generalin ihn sichtlich erschüttert hatte. Wiralin verschränkte die Arme hinter seinem Rücken. Am liebsten wäre er sofort abgereist, ohne auf den kräftigsten Glasbrecher zu warten. Zum ersten Mal konnte er einen Befehl seiner Generalin nicht gutheißen. So brillant Ulante sonst als Feldherrin war – einen Glasbrecher gegen die Ronn einzusetzen war eine Schnapsidee, die nach Verzweiflung roch. Der Schrei eines Glasbrechers würde die Ronn zwar garantiert in Angst und Schrecken versetzen. Aber bei den eigenen Truppen würde ein solcher Schrei dieselben Fluchtgedanken hervorrufen. Was wäre dadurch gewonnen, wenn die Ronn sich entsetzt die Ohren zuhielten, wenn auch die Linländer unter dem unerträglichen Ton keinen Angriff führen könnten? Es würde auch nicht helfen, den Linländer Soldaten die Ohren zuzustopfen. Dann würden sie nämlich die Befehle ihrer Oberen nicht mehr hören. Nur wenn es in einem Dorf zu einem Kampf von Haus zu Haus käme, wäre die Zerstörung aller Fensterscheiben von Vorteil. Doch kein Linländer war jemals in eine Siedlung der Ronn vorgestoßen – nicht einmal einer der Späher. Weshalb sollte Ulante also annehmen, dass ihnen ein solcher Vorstoß während der kommenden Kampfsaison gelingen würde?
„Soll ich die Maultiere nicht doch ausspannen, Herr? Wer weiß, wie lange wir noch auf diesen Glasbrecher warten müssen.“
Wiralin fuhr unter der plötzlichen Frage heftig zusammen. „Mein Nein von vorhin gilt immer noch,“ schnauzte er seinen Wagenführer an. „Wenn ich meine Entscheidung ändere, werde ich es dich wissen lassen!“
Uto hob die Schultern und beäugte Wiralin ebenso verdrossenen wie vorwurfsvoll. Zweifellos dachte er gerade an die Schelte, die er sich vor einigen Tagen eingehandelt hatte, weil er nach Ansicht seines Herren nicht sorgsam genug mit den Maultieren umgegangen war. Unwillig wandte Wiralin sich ab. Für gewöhnlich ließen dumme Fragen seiner Untergebenen ihn völlig kalt. Doch diesmal hatte Uto ihn erschreckt. Weil er von der falschen Seite gekommen war. Unwillkürlich hob Wiralin die rechte Hand zu seinem Gesicht, um die wulstige Narbe zu betasten, die sich senkrecht von seiner Stirn bis über den Backenknochen zog. Sie stammte vom Schwerthieb eines Ronn während des letzten Kampfs im vergangen Jahr. Die erste ernste Verwundung nach vier Jahren im Linländer Heer hatte Wiralin nicht nur grausam entstellt, sondern ihm auch noch sein rechtes Auge geraubt. Oredion war nichts anderes übrig geblieben, als das Augenlid ebenso zuzunähen wie das Fleisch über der Stirn und über dem Backenknochen. Zumindest hatte der Arzt dies behauptet, als Wiralin aus dem Meer von Schmerzen und Betäubungsmitteln aufgetaucht war. Der Oberste Bogen und der beste Bogenschütze des Linländer Heers war nun ein Einäugiger – und damit vielleicht Geschichte. Zumindest ließen die letzten Wochen nichts Gutes ahnen. Erst hatte Ulante das Kommando über die Bogenschützen seiner Stellvertreterin übergeben – vorerst, wie sie sagte. Dann hatte sie ihn nicht mehr zu den Generalstabsitzungen gerufen. Und nun stand er hier vor dem Tor von Mooresruh, um einen dieser elenden, nutzlosen Glasbrecher in den Glynwald zu bringen. Jeder einfache Soldat wäre dazu imstande gewesen. Ulante hatte ihm zwar einzureden versucht, dass sie einen ihrer engsten Vertrauten schicken wollte, aber gerade in diesen Worten lag die schlimmste Degradierung. Einer ihrer engsten Vertrauten?
Wiralin stand kurz davor, vor der Kälte zu kapitulieren und seinen Mantel aus dem Wagen zu holen, als sich endlich das Tor von Mooresruh mit lautem Knarren öffnete. Nun gab es kein Zurück mehr von Ulantes absurdem Befehl. Wenigstens würde er diesen unerträglichen Ort nun hinter sich lassen können. Mit betont gleichgültiger Miene wandte Wiralin sich dem Tor zu, um den kräftigsten der Glasbrecher zu betrachten – und traute seinem Auge nicht. Ihm kam eine erbärmliche Gestalt entgegen. Eine Kutte aus groben Hanffasern schlotterte um einen kleinen, dürren Körper. Nicht einmal die winterliche Unterkleidung vermochte den Eindruck zu wecken, dass Fleisch auf diesen Knochen saß. Die Schultern hingen der Gestalt herab, als ob sie eine Maultierladung Holz auf dem Rücken tragen würde, dabei hatte sie nur einen kleinen Beutel bei sich. Das kinnlange, stumpfe und merkwürdig schlammfarbene Haar umrahmte ein hohlwangiges Gesicht, dessen Schnitt bestenfalls erahnen ließ, dass die Gestalt weiblich war. Der einzige Flecken Farbe kam von einer enormen Fieberblase auf den schmalen Lippen. Die Haut über den hervorstehenden Backenknochen war hingegen so kränklich blass, dass sie beinahe grau wirkte – grau wie die Augen, unter denen tiefe Schatten lagen. Sie blickten ängstlich drein, bis sie sich plötzlich verschlossen. Offenbar stieß die grausige Narbe auf seinem Gesicht die Glasbrecherin ab. Als ob diese jämmerliche Gestalt sich ein Urteil über einen normalen, gesunden Linländer erlauben dürfte! Wiralin kämpfte mit dem Impuls, sie einfach auf der Straße stehen zu lassen. Mit größter Überwindung öffnete er die Wagentür und forderte die Glasbrecherin mit einer Kopfbewegung dazu auf, einzusteigen.
Erdree war bis zum Tor von Mooresruh gelangt, ohne innezuhalten und ohne sich einen Gedanken zu erlauben. Freilich hatte sie Algon erst vor Kurzem Lebewohl gesagt. Danach war nicht mehr für sie zu tun geblieben, als ihre mageren Habseligkeiten in einen Leinensack zu stopfen. Sie besaß nur einige Kleidungsstücke. Alles andere teilten die Bewohner von Mooresruh miteinander. Eigentlich betrachtete Erdree nicht einmal die Wäsche, Hemden und Strümpfe als ihren Besitz. Die Linländer bezahlten mit ihren Steuern alles, womit die Glasbrecher sich am Leben erhielten. Die einzige Ausnahme war der Torf, der als Brennmaterial diente. Den Torf stachen die Glasbrecher selbst im Moor. Streng genommen gehörte eine Glasbrecherin also den Linländern. Deshalb hatte sie keine Wahl, ob sie dem Ruf des Linländer Heers folgen wollte oder nicht – egal, wie undenkbar ein solcher Ruf vor diesem Tag gewesen war. Deshalb hieß es jenen Ort, an dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, zu verlassen. Womöglich für immer. Nur noch dieses Tor stand zwischen ihr und dem Bruch mit ihrem bisherigen Leben, nichts und niemand sonst. Kein Glasbrecher außer Algon wusste, dass sie gerade Mooresruh verließ. Sie hatte sich von niemand anderem verabschiedet. Sie wollte nichts gefragt werden, worauf sie selbst keine Antwort wusste. Und sie wollte schon gar nicht sehen, wie die Augen der anderen Glasbrecher ihre eigenen Ängste spiegelten. Die anderen sollten ihre Ängste für sich behalten. Sie hatte genug mit ihren eigenen zu tun. Seit sie denken konnte, hatte man ihr gesagt, dass ein Glasbrecher das Leben eines normalen Linländers nicht überstehen würde. Die Glasbrecher waren nicht nur mit einer Stimme geschlagen, die unerträglich durch alle Ohren schnitt und alles Glas zerschmetterte. Die Glasbrecher waren außerdem schwach und anfällig für alle Arten von Krankheiten. Die Natur hatte sie dazu verurteilt, ihr Leben leidend zu verbringen – mit Ausschlägen, Fieber und Lungenkrankheiten, häufig verkrüppelt durch Rheuma. Sie starben früh. Selbst das mittlere Erwachsenenalter erreichten die Glasbrecher nur, weil die Großzügigkeit der Linländer es ihnen erlaubte, ihr Leben in Mooresruh in weitgehender Muße zu verbringen. Wusste Generalin Ulante das alles nicht? Oder wusste sie es und forderte trotzdem den Dienst eines Glasbrechers, weil das Wohl Linlands eben wichtiger war als das Leben eines einzelnen Glasbrechers – eines Glasbrechers, der ohne die Wohltätigkeit der Linländer ohnehin nicht mehr am Leben gewesen wäre?
Erdree rief sich zur Ordnung. Genau diese Grübeleien und sinnlosen Fragen hatte sie sich nicht erlauben wollen. Der beste Weg, ihnen einen Riegel vorzuschieben, war durch dieses Tor zu treten. Sie richtete ihre ganze Konzentration auf ihre Hand, hob sie, schloss sie um den Knauf, drehte ihn, und stieß das Tor auf. Wie immer wurde Erdree nach der Düsternis in Mooresruh vom Tageslicht geblendet. Die eckige Form des Wagens und die weicheren Umrisse der Maultiere nahm sie zunächst nur schemenhaft wahr. Dann fing sie die Bewegungen einer Gestalt vor dem Wagen auf. Im ersten Augenblick dachte Erdree, ein weiteres Tier zu sehen. Die Bewegungen erinnerten sie an den geschmeidigen Lauf einer Wildkatze oder an die präzisen, eleganten Wendungen eines Raubvogels. Obwohl sie gleich darauf begriff, dass sie einen Mann vor sich hatte, konnte sie ihren ersten Eindruck nur schwer abschütteln. Während ihres ganzen Lebens hatte Erdree solchen Elan allein an Wildtieren beobachtet. Dieselbe scheue Bewunderung, die sie bei ihren Begegnungen mit den Tieren des Sumpfes empfunden hatte, stieg auch jetzt in ihr auf. Noch während sie näher kam, blieb Erdree im Bild eines Raubvogels gefangen. Als der Mann sich zu ihr umdrehte, trat das scharfe Profil einer Adlernase hervor. Sein rotbraunes, kurzgeschorenes Haar lag glatt wie Federn um seinen Kopf. Sogar das Auge, das sich ihr zuwandte, glänzte in einem dunklen Bernsteinton. Im nächsten Moment fühlte Erdree sich wie zurückgestoßen. Der Blick des Mannes war voller Härte und Kälte, wie die Oberfläche eines zugefrorenen Teichs. Erdree empfand es beinahe als Erleichterung, dass sie nur einen eisigen Spiegel sah. An der Stelle des rechten Auges saß die Narbe einer bösen, aber gut verheilten Wunde. Unwillkürlich zog Erdree die Schultern hoch. Mit gesenktem Kopf folgte sie der stummen Aufforderung des Boten, in den Wagen zu klettern. Es erschien ihr unrecht, ohne ein Wort oder eine Geste der Begrüßung durch die aufgehaltene Tür zu verschwinden. Aber der kalte Blick dieses Mannes hatte sie geradezu betäubt. Nicht einmal ihre Füße wollten sich vom Boden lösen und auf die Trittstufen steigen. Ungeschickt zwängte Erdree sich in das Innere des Wagens. Nur damit sie nicht im Weg wäre, ließ sie sich schnell auf eine der beiden Bänke plumpsen. Sie wusste nicht, ob es ihr freistand, ihren Sitzplatz zu wählen. Gleichzeitig wagte sie es nicht, einen Blick auf den Boten zu werfen, um herauszufinden, ob er ihr ihre Dreistigkeit übel nahm. Angespannt wartete Erdree auf eine Zurechtweisung, doch nur ein kurzer Befehl an den Kutscher ertönte. Auf der gegenüberliegenden Bank nahm der Bote schweigend Platz. Plötzlich wirkte die Kabine noch enger. Ein Ruck ging durch den Wagen, als die Maultiere anzogen. Die Räder begannen über den gefrorenen Schlamm zu knirschen. Erdree erhaschte nur noch einen flüchtigen Blick auf Mooresruh, bevor sich eine leere Sumpflandschaft vor ihren Augen ausbreitete. Ihre Kehle wurde eng, während ein Kälteschauer durch ihren Körper rieselte. So wie sie sich jetzt fühlte, musste sich eine Schnecke fühlen, die gerade aus ihrem Haus gezerrt worden war – nackt und völlig schutzlos.
Zu dem diffusen Entsetzen, das sich bei der Abfahrt in Erdree ausgebreitet hatte, kamen bald weitere Nöte. Ihre Kleidung bot nicht genug Schutz gegen die Kälte, die durch die Ritzen des Wagens drang. Irgendwann begann Erdree, zu zittern – mal mehr, mal weniger heftig. Das stetige Vorüberziehen der Landschaft machte sie schwindlig. Manchmal ertrug sie es nicht länger und schloss ihre Augen. Aber dann nahm sie das Gerüttel des Wagens, ihre Übelkeit und ihre schmerzenden Glieder nur noch deutlicher wahr. Der Bote der Generalin saß völlig unberührt. Seine langen Beine erlaubten es ihm, sich unter Erdrees Bank an der Wagenwand abzustützen. So wurde er weniger durchgerüttelt. Obwohl sein Mantel nur lose um seine Schultern lag, schien er auch die Kälte nicht zu spüren. Wenn er nicht vor sich hindöste, starrte er aus dem Fenster, als ob er völlig allein wäre. Beim Einfall der Dämmerung wurde Erdree nur noch von einem Wunsch beherrscht: Dass die Reise bald enden möge. Allzu gerne hätte sie gefragt, wie lange die Fahrt an diesem Tag noch dauern sollte. Doch ein Flüstern wäre im Gerumpel des Wagens untergegangen, und einen lauteren Ton durfte sie sich wegen der Fensterscheiben nicht erlauben. So war sie dazu verurteilt, schweigend auszuharren. Inzwischen hatten sich noch dumpfe Kopfschmerzen zu allen anderen Übeln gesellt. Aber wenigstens zitterte sie nicht mehr so stark. Wahrscheinlich hatte sie sich an die Kälte gewöhnt. Erst als der Wagen endlich hielt und der Bote ausstieg, erkannte Erdree ihren Irrtum. Sie hatte sich nicht an die Kälte gewöhnt. Sie war inzwischen völlig erstarrt. Es kostete Erdree all ihre Willenskraft, ihre Knie zu strecken und mit tauben Fingern nach dem Rahmen der Wagentür zu tasten. Prompt verfehlte sie beim Aussteigen die Trittstufe und landete auf Händen und Knien im Schotter auf dem Vorplatz einer Herberge. Der Bote blickte nicht einmal von seinem Gespräch mit dem Wagenführer auf. Erdree musste allein wieder auf die Beine kommen. Sie war zu erschöpft, um den Schmerz in ihren aufgeschlagenen Handflächen zu fühlen. Blindlings taumelte sie dem Boten hinterher, der nun den Eingang der Herberge ansteuerte. Auf der Schwelle prallte Erdree gegen eine Wand aus fettigem Dunst und Lärm. Nach einer Schrecksekunde durchbrach sie diese Wand nur wegen der Wärme, die aus der überfüllten Gaststube drang. Der Bote ließ einen abschätzigen Blick über das Durcheinander von Zechern gleiten. Mit sichtlichem Widerwillen wandte er sich der Wirtin zu, die dienstfertig heraneilte. Erdree fürchtete für einen Augenblick, dass er auf der Ferse kehrt machen würde und sie in den Wagen zurückkehren müsste. Der Gedanke an die Maultiere beruhigte sie ein wenig. Die Tiere würden auf jeden Fall eine Rast brauchen. Über den Lärm hinweg konnte Erdree hören, wie der Bote nach einem Zimmer fragte.
Die Wirtin schüttelte den Kopf. „Die Zimmer sind alle belegt. Ich kann nur mehr Strohsäcke hier in der Gaststube als Nachtlager anbieten.“
Die starre Miene des Boten wurde noch missmutiger. „Ich werde zwei Strohsäcke brauchen – ich nehme an, dass mein Kutscher im Stall schlafen kann?“
„Natürlich.“ Die resolute Freundlichkeit der Wirtin blieb ungebrochen.
Der weitere Wortwechsel zwischen dem Boten und der Wirtin ging in plötzlichem Gegröle unter. Als die Wirtin davonhastete, ging der Bote zu einem Tisch, an dem noch zwei Plätze frei waren. Erdree folgte ihm mit einigen Schwierigkeiten. Die Wärme, die langsam in ihre tauben Glieder kroch, hatte das heftige Zittern zurückgebracht. Krampfhaft presste Erdree ihre Kiefer aufeinander, um zumindest ihre Zähne vom Klappern abzuhalten. Je mehr die Kälte wich, desto mehr fühlte sie wieder die Schmerzen in ihren Gliedern und in ihrem Kopf. Mit einer knappen Geste wies der Bote ihr den Platz auf seiner rechten, blinden Seite zu. Schlotternd versank Erdree zwischen ihrem mürrischen Begleiter und einem bulligen Linländer. Obwohl sie sich so klein wie möglich machte, traf der Ellbogen ihres angetrunkenen Sitznachbarn sie immer wieder hart in die Rippen. Bald fürchtete Erdree, entweder vor Zittern, vor Schwäche oder wegen eines weiteren Stoßes von der Bank zu kippen. Gerne hätte sie sich an den Tisch geklammert, doch stattdessen legte sie unwillkürlich die Hände über ihre Ohren. Das Getöse von Stimmen und klapperndem Essgeschirr war unerträglich. In der Gaststube herrschte zwanzigmal mehr Lärm als in den lautesten Momenten von Mooresruh. Nach der anstrengenden Reise drohte jeder neue Eindruck Erdrees Kopf endgültig zu sprengen. Erdree wollte auch noch ihre Augen schließen, als sie den Blick der Wirtin auffing. Die Frau stellte soeben zwei Schüsseln mit Eintopf, einen Krug mit einem schäumenden Getränk und zwei Becher aus dickwandigem Glas auf dem Tisch ab. Dabei musterte sie Erdree befremdet. Verlegen ließ die Glasbrecherin die Hände sinken.
„Braucht Ihr noch etwas?“ wandte die Wirtin sich an Erdree. Ihr schien eingefallen zu sein, dass alle Wünsche bisher allein von dem Boten gekommen waren.
Erdree holte Atem, um nach Wasser zu fragen. Ihre Kehle war völlig ausgedörrt, und sie traute dem fremden schäumenden Getränk nicht. Doch kein Laut kam über ihre Lippen. Wenn sie den Lärm in der Gaststube übertönen wollte, würde sie beinahe schreien müssen. Das durfte sie wegen der Trinkbecher und wegen der Fensterscheiben nicht tun. Also schloss Erdree ihren Mund wieder und hob ihre Hände. Weil ihr auch keine passenden Gesten einfallen wollten, schüttelte sie schließlich verzweifelt den Kopf.
Die Brauen der Wirtin waren stetig höher gestiegen. „Was ist denn mit ihr los?“ fragte sie den Boten, ohne ihre Stimme zu dämpfen. „Ist sie schwachsinnig?“
„Kann ich nicht sagen,“ gab er gleichgültig zurück.
Gedemütigt blickte Erdree in ihre Schüssel. Er hatte sie aus Mooresruh geholt – er musste doch wissen, weshalb sie hier nicht laut sprechen durfte! Oder wollte er sie etwa schützen? Hassten die Linländer die nutzlosen Glasbrecher? Würden die Männer und Frauen in der Gaststube auf sie losgehen, wenn sie wüssten, dass sie eine Glasbrecherin war? Aber hätte der Bote sie dann nicht warnen müssen, bevor sie diese Gaststube betraten? Zum ungezählten Mal an diesem Tag drängte Erdree die schädliche Grübelei zurück. Sie zwang sich, ihre Finger um den Löffelstiel zu schließen, der aus dem Eintopf herausragte. Ihre Hände zitterten immer noch leicht, aber kaum noch vor Kälte. Es gelang Erdree, den Löffel an die Lippen zu führen und ihn in den Mund zu schieben. Doch statt der erhofften Stärkung brachte das Essen eine neue Herausforderung. Der Kohleintopf strotzte von fettem Schweinefleisch und war viel zu deftig für den empfindlichen Magen einer Glasbrecherin. In Mooresruh wurde so gekocht, wie es sich für Kranke gehörte – und wie die Versorgung durch die anderen Linländer es zuließ. Weil die Lieferwagen nur viermal im Jahr in das abgelegene Moor geschickt wurden, erhielten die Glasbrecher vor allem Nahrungsmittel, die lange gelagert werden konnten. Der kümmerliche Gemüsegarten, die fünf Kühe und die zwanzig Hühner von Mooresruh gaben nicht viel her. Also kamen vor allem Getreidebrei, Kartoffeln und Rüben auf den Tisch der Glasbrecher. Nach wenigen Bissen rebellierte Erdrees Magen heftig gegen den Kohleintopf. Ihr blieb nichts anderes übrig, als den Löffel beiseite zu legen. Im nächsten Moment hielt sie es für klüger, den Abort aufzusuchen. Ungeschickt drängte Erdree sich zwischen ihren Sitznachbarn hervor und stürzte aus der Gaststube ins Freie. Draußen konnte sie sich auf ihre feine Nase verlassen, um jenen Verschlag zu finden, den sie suchte. Drinnen würgte es Erdree heftig, aber nur kurz. Dann begann sich ihr Magen zu beruhigen. Als sie den stinkenden Abort verließ, glaubte Erdree, von der anderen Seite des Stalls her Wasserplätschern zu vernehmen. Tatsächlich fand sie einen ausgehöhlten Baumstamm, der Wasser aus einem dünnen Rohr auffing. Es musste Quellwasser sein. Sauberes Wasser. Vorsichtig trank Erdree einige Schlucke aus ihren hohlen Händen. Die eisig kalte Flüssigkeit brachte ihren Magen erneut dazu, sich zusammenzukrampfen. Erdree drängte sich zu tiefen, ruhigen Atemzügen und lauschte dem gleichmäßigen Plätschern des Wassers. Bald setzte ihr die Winterkälte wieder zu. Unschlüssig wandte Erdree sich von dem Brunnen ab. Der Gedanke, wieder in die überfüllte, laute Gaststube zurückzukehren, ließ sie ebenso stark schaudern wie die Kälte. Nach einigen Augenblicken schlüpfte sie in den Stall. Zu ihrer Erleichterung empfing sie nichts als Dunkelheit und Stille. Bis auf das gelegentliche Stampfen und Schnauben eines Pferdes oder eines Maultiers war alles ruhig. Die Pferdeknechte und die Wagenführer schienen alle in der Gaststube zu sein. Es war kalt im Stall, aber nicht so kalt wie draußen. Erschöpft stützte Erdree ihre verschränkten Arme auf eine der Boxentüren und legte ihren Kopf darauf. Aus der Futterkrippe im Inneren der Box stieg ihr angenehmer Heugeruch in die Nase. Ein Pferd beschnupperte sie neugierig, doch sie störte sich nicht daran. Endlich ein Ort ohne Tumult und ohne neue Bilder, die ihr Kopf nicht mehr zu fassen vermochte. Erdree wusste nicht, wie lange sie so gestanden war, als die Stalltür geöffnet wurde. Im Licht der Windlaterne, die vor dem Stall hing, erkannte Erdree die Gestalt des Boten. Sofort wurden das flaue Gefühl in ihrem Magen und das Pochen hinter ihren Schläfen stärker.
„Ich würde dir raten, nicht allein herumzuwandern,“ ertönte seine kühle Stimme. „Außer, unangenehme Begegnungen mit Betrunkenen machen dir nichts aus. Dann möchte ich dich natürlich nicht aufhalten. Ich bin jedenfalls in der Gaststube, Glasbrecherin.“
„Erdree,“ flüsterte sie mechanisch.
Der Bote hatte sich bereits zum Gehen gewandt und blickte über seine Schulter zurück. „Was war das?“
„Erdree,“ wiederholte sie, kaum lauter. „Mein Name ist Erdree.“
Ohne ein weiteres Wort trat der Bote wieder ins Freie. Erdree konnte nicht sagen, ob er mit dem Kopf genickt hatte, oder ob sein Blick aus einem anderen Grund zu Boden geschweift war. Mit einem tiefen Seufzen folgte sie ihm. Der Gedanke an die Gaststube war ihr immer noch verhasst. Aber der Stall schien eben nicht der sichere Zufluchtsort zu sein, für den sie ihn gehalten hatte.
Die Nacht wurde zu einer einzigen Qual. Stundenlang kauerte Erdree in der hintersten Ecke der Gaststube und versuchte vergeblich, sich gegen den Tumult abzuschirmen. Tränen der Verzweiflung standen bereits in ihren Augen, als die Wirtin endlich die Dorfzecher nach Hause schickte. Nun wurden einige Tische beiseite geschoben und Strohsäcke für jene Reisenden ausgerollt, die sich entweder kein Zimmer leisten konnten, oder keines mehr ergattert hatten. Dankbar streckte Erdree sich auf einem der Säcke aus. Doch die Tortur war keineswegs zu Ende. Kopfschmerzen, Übelkeit und lautes Schnarchen hielten den Schlaf fern. Gleichermaßen übermüdet wie ruhelos warf Erdree sich von einer Seite auf die andere. Zuletzt drang auch noch die nächtliche Kälte in die Gaststube vor und ließ die Glasbrecherin wieder zu einem Eisblock erstarren. Die ersten Geräusche aus der Küche hörte Erdree halb erleichtert, halb ungläubig. Sie war nicht sicher, ob sie auch nur eine Stunde geschlafen hatte. Wenig später erhob sich der Bote von seinem Strohsack. Kaum hatte er an einem der Tische im vorderen Teil der Gaststube Platz genommen, erschien auch schon eine junge Magd, um Frühstück zu bringen. Mühsam rappelte Erdree sich auf. Bestimmt würde der Bote sie bald dazu drängen, aufzustehen. Und es machte ohnehin keinen Sinn, noch länger schlaflos auf diesem Strohsack auszuharren. Auf bleiernen Füßen tappte Erdree durch die Gaststube. Allein ihre Augen offen zu halten war schwer. Sie brach mehr auf der Bank am Frühstückstisch zusammen, statt sich hinzusetzen. Das bernsteinfarbene Auge des Boten richtete sich nur flüchtig auf sie. Trotzdem erkannte Erdree die pure Verachtung in seinem Blick. Betreten senkte sie den Kopf. Nicht einmal sie hatte geglaubt, dass sie die traurige Wahrheit über die Glasbrecher so bald und so eindeutig beweisen würde. Wie viele Tage würde sie fern von Mooresruh überstehen? Zwei? Drei? Jedenfalls nicht genug. Linland rief die kräftigste Glasbrecherin in seinen Dienst, und diese Glasbrecherin würde nicht einmal die Reise an jenen Ort überstehen, wo sie ihren Dienst tun sollte. Sie verachtete sich selbst nicht weniger als dieser Bote, der ausgeruht und energisch vor ihr saß. Aus reiner Verlegenheit griff Erdree nach einem Stück Brot und begann, darauf herumzukauen. Sie war bereits über jegliches Hungergefühl hinaus. Von Appetit konnte erst recht keine Rede sein. Im Gegenteil – der Geruch des gebratenen Specks, den die Magd gerade hereinbrachte, ließ das flaue Gefühl in Erdrees Magen wieder aufleben.
„Seid Ihr Wiralin?“ erkundigte die Magd sich bei dem Boten.
Er nickte mürrisch.
„Euer Wagenführer lässt fragen, ob er schon anspannen soll.“
„Ja. Wir werden sofort nach dem Frühstück aufbrechen.“
Der Ton des Boten war genauso harsch wie seine Miene. Erdree zog unwillkürlich die Schultern hoch und rieb sich die Schläfen. Die tiefe Verachtung, die der Bote für sie empfand, färbte anscheinend sogar auf diese freundliche Magd ab.
„In Ordnung, ich werde es Eurem Wagenführer sagen.“
Zu Erdrees Erleichterung blieb die Stimme der jungen Frau fröhlich. Dieselbe Stimme erklang im nächsten Moment direkt neben ihr:
„Habt Ihr Kopfschmerzen? Ich kann Euch gerne einen Kräutertee bringen, der dagegen hilft.“
Erdree hob vorsichtig ihren Blick – war etwa sie gemeint? Tatsächlich sah die Magd sie erwartungsvoll an. Vor Überraschung erschrak Erdree beinahe. Hastig nahm sie sich zusammen und vergewisserte sich, dass es in der Gaststube ruhig genug war, um ihren Mund aufzumachen.
„Ja, ich hätte gerne einen Tee – gegen die Kopfschmerzen. Vielen Dank.“
„Und Ihr seid auch noch so erkältet, dass Ihr nur noch flüstern könnt!“ Voller Mitgefühl schüttelte die Magd den Kopf. „Da wird Euch der Tee gleich doppelt guttun – dem Kopf und dem Hals!“
Der Tee half Erdree mehr als sie erwartet hatte. Er linderte die Kopfschmerzen zwar nicht sofort, aber ihre Augenlider schienen leichter zu werden. Sie fühlte sich wieder imstande, halbwegs aufrecht am Tisch zu sitzen. Nach der zweiten Scheibe Brot griff Erdree zwar mehr aus Entschlossenheit denn aus Appetit, aber ihr Magen rebellierte nicht dagegen. Sogar Butter und Honig nahm er ohne Beschwerden hin. Als der Bote – Wiralin – aufstand und Erdree auffordernd ansah, war ihre Erschöpfung keineswegs verschwunden. Aber zumindest löste die Vorstellung, sich wieder in den Wagen setzen zu müssen, kein blankes Entsetzen mehr aus. Nur leichtes Unbehagen.
Wiralin nahm ein Proviantbündel von der Magd entgegen und beglich die Rechnung für die Übernachtung. Mit einem gemurmelten Abschiedsgruß wandte er sich zur Tür.
„Vergesst Euren Bogen und Euren Köcher nicht!“ Die Magd sah sich alarmiert in der Gaststube um, als müssten die genannten Waffen irgendwo an der Wand lehnen.
Wiralin warf einen stechenden Blick über seine Schulter. „Mädchen, ich würde niemals meinen Bogen und meine Pfeile irgendwo vergessen!“ Im nächsten Moment war er bereits durch die Tür verschwunden.
Verwundert blickte die Magd ihm nach. „Hat er seine Waffen etwa im Wagen gelassen? Ich meine – er ist doch ein Bogenschütze, oder? Er trägt die Uniform eines Bogenschützen – eine gepolsterte Lederweste über einem grünen Hemd und braune Hosen aus Leder! Aber welcher Linländer Soldat würde seine Waffen an einem Ort lassen, wo er sie nicht im Blick hat?“
Erdree hob hilflos die Schultern. Sie hatte keine Waffen gesehen, weder im Wagen noch sonst wo. Ihr war nicht einmal klar gewesen, was Wiralins Uniform bedeutete. Sogar seinen Namen hatte sie gerade erst erfahren.
Zum Glück winkte die Magd sogleich ab. „Ach, ich vergaß, dass Ihr erkältet seid! Schont Eure Stimme, es ist ja nicht so wichtig. Gute Reise wünsche ich Euch!“
Mit einem freundlichen Lächeln eilte die Magd zurück in die Küche. Erdree wäre ihr gerne gefolgt. Stattdessen wappnete sie sich gegen die Kälte und trat durch die Tür.
Voll kaltem Zorn stapfte Wiralin zum Wagen. Offenbar glaubten nun schon die niedrigsten Dienstboten, dass sie sich über ihn lustig machen durften! Zuerst diese scheinheilige Frage der Magd, ob er Wiralin sei! Als ob Uto ihr nicht den Auftrag gegeben hätte, den Einäugigen zu suchen und ihn zu fragen, wann er abfahren wollte! Es fiel diesem Kerl ja wirklich nicht schwer, seinen Herren eindeutig zu beschreiben! Und dann auch noch die Komödie des Mädchens wegen seiner Waffen! Als ob seine Entstellung nicht deutlich genug kundtäte, warum er keinen Bogen und keinen Köcher bei sich trug! Gerne hätte Wiralin seinem Zorn bei seiner Kontrollrunde um den Wagen Luft gemacht. Aber alles war in Ordnung. Sogar die Maultiere waren sorgfältiger gestriegelt worden als sonst.
„Guten Morgen, Herr!“ posaunte Uto vom Kutschbock herunter. „Irgendwelche Befehle für heute? Dort vorne, vom Rand des Dorfes an, führt die Straße eine Strecke bergauf – sollen die Maultiere auf dieser Strecke entlastet werden? Sollen wir zu Fuß gehen?“
Wiralin trat auf die Straße hinaus, um die Steigung zu betrachten. „Das ist nicht so schlimm,“ gab er zurück. „Im Schritt schaffen es die Maultiere mit dir und der Glasbrecherin im Wagen schon. Ich werde nebenher gehen. Mir ist ein kleiner Marsch gerade äußerst willkommen.” Wiralin wollte bereits wieder in Schweigen versinken, als ihm noch etwas einfiel: „Wenn wir irgendwo halten, Uto, hab mir ein Auge auf die Glasbrecherin! Dieses Völkchen, das in Mooresruh wohnt, ist völlig hilflos, und in den Gasthöfen wimmelt es immer von Abschaum.“
„Hilflos?“ Uto lachte. „Ein Glasbrecher braucht nur zu schreien, und alles rennt davon!“
Wiralin fixierte seinen Wagenführer mit einem kalten Blick, bis Uto wieder eine ernste Miene aufsetzte.
„Natürlich kann ein Glasbrecher sich mit einem Schrei verteidigen.” Um nichts in der Welt hätte Wiralin verraten, dass erst Uto ihn auf diesen Gedanken gebracht hatte. „Aber nur dann, wenn er auch genug Mut und Geistesgegenwart hat, um tatsächlich zu schreien. Ich bin nicht sicher, ob einer dieser elenden Glasbrecher so viel Mut und Geistesgegenwart hat. Diese hier“ – er deutete mit dem Kopf auf die Gestalt, die soeben aus dem Verschlag neben dem Stall kam – „hat sie bestimmt nicht. Sie fürchtet sich schon vor völlig harmlosen Leuten und wird starr vor Angst, wenn ihr jemand zu nahe kommt.“
„Sie wird aber auch ziemlich angestarrt wegen ihrer komischen Kleider.“ Uto malte mit seinen Händen die Kontur eines Kartoffelsacks in die Luft. „Wer trägt schon solche Kutten wie die Glasbrecher?“
Wiralin winkte ab. „Das kann ich nicht ändern. Außer, du willst mit ihr die Kleider tauschen.“
Insgeheim war Wiralin zutiefst erleichtert, dass niemand erkannt hatte, was sich hinter dieser jämmerlichen Gestalt verbarg. Mooresruh lag erst eine halbe Tagesreise hinter ihnen. Es hätte ihn keineswegs überrascht, wenn den Dorfbewohnern beim ersten Blick auf die Kutte klar gewesen wäre, wen sie vor sich hatten. Als Oberster Bogen des Linländer Heers musste er zwar keine Fragen beantworten, aber er konnte kein Gerede brauchen. Solange die seltsame Kutte keine Erinnerungen an die Glasbrecher weckte, war es egal, ob sie auffiel oder nicht. Aber er konnte eben nicht sicher sein, dass niemand die Kutte erkennen würde. Genau deshalb sollte die Glasbrecherin sich möglichst von anderen Linländern fernhalten. Und genau deshalb sollte Uto darauf achten, dass sie möglichst wenig mit anderen Linländern in Kontakt kam. Wiralin hatte nicht die geringste Lust dazu, über die Glasbrecherin zu sprechen – oder gar ihre Haut zu retten, wenn es wegen dieser jämmerlichen Gestalt zu Problemen kommen sollte. Freilich könnten seine Sorgen schneller vorbei sein als er geglaubt hatte. Beim Anblick der totenblassen Glasbrecherin zweifelte Wiralin daran, dass sie die Reise nach Glynwerk überstehen würde. Trotzdem konnte er es sich nicht erlauben, sie zu schonen. Welchen Dienst Ulante auch immer für die Glasbrecherin im Sinn hatte – sie konnte ihn nur dann erfüllen, wenn sie das Leben beim Heer durchstand. Diese Reise gehörte bereits zum Leben beim Heer. Und auf alle Fälle galt: Je schneller sie Glynwerk erreichten, desto besser. Ungeduldig signalisierte Wiralin der Glasbrecherin, in den Wagen zu steigen. Kaum war sie drinnen, warf er die Tür zu.
„Und los!“
Wiralin klopfte einem der Maultiere auffordernd auf den Rücken. Die Aussicht auf den Fußmarsch tat ihm gut. Lange Wagenfahrten waren ihm zuwider. Zum hundertsten Mal verwünschte Wiralin das Pech, dass sein Pferd am Abend vor dem Aufbruch nach Mooresruh zu lahmen begonnen hatte.
Der zweite Reisetag verlief wie der erste. Erdree litt unter der Kälte, unter dem Rütteln und unter den vielen Bildern, die unablässig vor ihren Augen vorüberzogen. Wie am Vortag verboten ihr die Fensterscheiben, auch nur die zaghafteste Frage zu stellen. Wiralin saß ihr gegenüber, als ob er völlig allein wäre. Gegen die Strapazen, die auf Erdree einprügelten, schien er völlig unempfindlich zu sein. Die Mittagspause am Straßenrand half Erdree kaum. Draußen war es noch kälter als im Wagen. Die wenigen Bissen, die Erdree von dem Proviant hinunterbrachte, blieben ihr wie Steinbrocken im Magen liegen. Im Lauf des Nachmittags schwoll ihr Hals schmerzhaft zu. Bald darauf wurde sie außerdem von Hustenreiz gequält. Ihre Kopfschmerzen hatten längst wieder mit voller Heftigkeit eingesetzt. Jedes Geräusch schnitt mit glühenden Klingen durch ihren Schädel. Alles verschwamm vor Erdrees Augen. Die Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit vergingen in einem wirren Zustand, in dem Erdree mal die eine, mal die andere Plage am stärksten fühlte. Am Abend, als sie endlich vor einem Gasthaus hielten, gelang es Erdree kaum noch, dem Wagen zu entkommen. Wenn sie eine weitere Nacht in einer stickigen, lauten Gaststube hätte verbringen müssen, wäre sie wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Doch diesmal konnten die Wirtleute Wiralins Wunsch nach einem Zimmer erfüllen. Erdree kroch sofort in eines der Betten und wickelte sich so fest wie möglich in die Decke. Ihr Nachtmahl bestand aus einem Krug heißer Milch. Etwas anderes vermochte sie nicht durch ihren geschwollenen Hals in ihren gereizten Magen zu zwingen. Bald wünschte sie, dass auch noch ihre Ohren zuschwellen würden. Obwohl der Lärm aus der Gaststube nur gedämpft in das Zimmer vordrang, ließ er Erdree nicht zur Ruhe kommen. Wiralin blickte alarmiert auf, als sie plötzlich das Messer an sich riss, das neben dem Abendbrottablett liegen geblieben war. Stirnrunzelnd beobachtete er, wie Erdree die Enden der dünnen Kordel absäbelte, die sie als Gürtel trug. Nachdem sie neue Knoten in die Kordel geschlungen hatte, damit sie sich nicht auflösen würde, stopfte Erdree die abgeschnittenen Enden in ihre Ohren. Auf diese Weise trotzte sie der Nacht in dem muffigen, harten Bett zumindest einige Stunden Schlaf ab.
Nach und nach stumpfte Erdree gegen die einzelnen Elemente ihrer Qual ab. Den dritten und vierten Reisetag verbrachte sie in einer Blase aus diffusem, immer tieferem Unwohlsein, die von Zwängen durchsetzt war. Erdree zwang sich dazu, einige Bissen und Schlucke von dem zu nehmen, was man vor sie auf den Tisch stellte. Sie zwang sich dazu, zum Wagen zu stolpern und sich auf eine Sitzbank zu hieven. Sie zwang sich dazu, dort sitzen zu bleiben. Sie zwang sich dazu, einen Atemzug nach dem anderen zu nehmen. Sie zwang sich dazu, den Husten zu unterdrücken, der in ihrer Brust schmerzte und die Fensterscheiben klirren ließ.
Als Erdree in der Abenddämmerung des vierten Tages von plötzlichem Rufen aufgeschreckt wurde, war sie nicht sicher, ob sie geschlafen hatte, oder ob sie bewusstlos gewesen war. Benommen sah sie zu, wie Wiralin aus dem Wagen sprang und plötzlich das Gleichgewicht verlor. Er wäre wohl gestürzt, wenn er sich nicht am Türrahmen festgehalten hätte.
„Vorsicht, Herr,“ drang Utos Stimme vom Kutschbock her. „Dieser verdammte Eisregen hat die Straße spiegelglatt gemacht. Bei normalem Regen sind solche Pflasterstraßen besser als alle anderen Straßen. Aber bei Eisregen sind sie schlimmer als die schlammigste Landstraße. Ich mache mir Sorgen um die Maultiere. Wenn eines der Tiere stürzt, oder der Wagen ins Rutschen kommt und die Tiere mitreißt, ist es aus. Und bis nach Monstedt sind es noch eineinhalb Stunden – das heißt: Es wären etwa eineinhalb Stunden bis Monstedt, wenn wir ein normales Tempo fahren könnten...“
Ohne den Türrahmen loszulassen, testete Wiralin den Halt seiner Füße auf der Straße. Seine Miene verhärtete sich noch mehr. „Ich verstehe deine Sorge, Uto. Aber wir haben keine Wahl. Der Eisregen hält vielleicht bis morgen Früh an, und wir können nicht auf der Straße übernachten. Fahr so langsam wie möglich. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Straße nach Monstedt ziemlich eben. Also ist die Gefahr, dass der Wagen ins Rutschen gerät und die Maultiere mitreißt, ziemlich gering.“
„Eine Wahl hätten wir,“ ließ Uto sich wieder vernehmen. „Wir stehen hier bei einer Abzweigung zu einem Herrengut. Der Wegweiser sagt... Redanshaim, glaube ich.“
Wiralin riss den Kopf hoch und musterte fieberhaft die Umgebung. Noch im vorigen Augenblick hätte Erdree es für unmöglich gehalten, dass seine Züge sich noch mehr verhärten könnten. Aber jetzt sah es aus, als ob sein Kopf aus Stein gehauen wäre.
„Wir könnten dort Nachtquartier einfordern.“ Die Hoffnung in Utos Stimme war unverkennbar. „Gutsbesitzer sind dazu verpflichtet, in Notfällen Linländer Soldaten zu beherbergen und zu verköstigen. Das Herrengut liegt viel näher als Monstedt, und außerdem ist die Straße dorthin nicht gepflastert. Deshalb ist es auch mit dem Eis nicht so schlimm.“
Ein zweites Mal prüfte Wiralin den Halt seiner Füße auf der Straße. Er versuchte sogar, einige Schritte zu gehen. Wieder musste er sich am Wagen festhalten, um nicht hinzufallen. Bitterkeit meißelte sich in die steinerne Miene. Nur sein Ton blieb unverändert:
„In Ordnung, Uto – fahr zu dem Herrengut. Es wäre unverantwortlich, die Maultiere auf dieser Straße weiterlaufen zu lassen.“
Wiralin kehrte in den Wagen zurück und nahm auf seiner Bank Platz. Obwohl Erdree scheu ihren Blick abwandte, bemerkte sie, wie hölzern seine geschmeidigen Bewegungen plötzlich geworden waren.
Auf der ungepflasterten Straße zu dem Herrengut fanden die Maultiere tatsächlich besseren Tritt. Es dauerte nicht lange, bis Uto den Wagen vor einem herrschaftlichen Gebäude anhielt. Wiralin schlug seinen schwarzen Mantel fester um die Schultern, bevor er ausstieg.
„Klopf an,“ befahl er seinem Wagenführer. „Frag den Hausdiener, ob die Dame des Hauses uns für eine Nacht Quartier gewährt. Nenn nicht nur meinen Rang, sondern auch meinen Namen.“
Überrascht riss Uto die Augen auf. „Kennt man Euch denn hier?“
„Ich komme aus dieser Gegend,“ entgegnete Wiralin scharf. „Jetzt geh schon!“
Vorsichtig, so weit die Enge im Wagen es erlaubte, streckte Erdree ihre steifen Glieder. Durch den Nebel aus Erschöpfung und Schmerzen dämmerte es ihr, dass sie froh sein müsste, einer weiteren Nacht in einem lauten Gasthof zu entgehen. Doch dieses Herrenhaus – beinahe ein kleines Schloss – erfüllte sie mit ängstlichem Respekt. In solch einem Haus lebten gewiss ganz andere Leute als jene, die sie in den Schenken gesehen hatte. Sogar der ungerührte Wiralin war von der Aussicht auf eine Nacht in diesem Herrenhaus aufgestört worden. Sicher widerstrebte es ihm, sich hier mit einer Glasbrecherin zu zeigen. Schon in den Gasthäusern war es ihm unangenehm gewesen. Jeder Blick und jede Geste hatten ihr gezeigt, wie sehr er sie verabscheute. Wie viel schlimmer musste es für ihn sein, wenn die Herren dieses Hauses ihn kannten. Die Glasbrecher waren wirklich eine Schande für Linland! Verzweifelt kratzte Erdree ihre letzten Kräfte zusammen und versuchte, ihr Schwindelgefühl und das leichte Fieber zu ignorieren. Es gelang ihr tatsächlich, ohne Missgeschick aus dem Wagen zu steigen, als Uto meldete, dass die Hausherrin die Gäste hereinbat. Auch die wenigen Schritte zur Eingangstür legte Erdree unfallfrei zurück. Weil der eisige Boden nach langsamen, bedächtigen Schritten verlangte, fiel ihre Schwächlichkeit nicht einmal auf. Jetzt musste sie nur noch ihren Hustenreiz im Zaum halten.
In der Halle blieb Erdree hinter Wiralin stehen, halb von ihm verborgen. Ein makellos gekleideter Diener nahm soeben Wiralins tropfenden Mantel entgegen, als ob es sich um Kronjuwelen handeln würde. Gleich darauf erschien eine Frau neben ihm – ganz offensichtlich die Hausherrin. Sie mochte die Fünfzig bereits überschritten haben, und das Schwarz ihrer Haare war zu tief, um natürlich zu sein. Dennoch pflegte sie keine Reste jugendlicher Schönheit, sondern präsentierte sich als reife Schönheit. Ein Hauch von Schminke betonte die Vorzüge des exquisit geschnittenen Gesichts, statt die Spuren der Jahre mehr schlecht als recht unter einer dicken Schicht zu verbergen. Ihre füllige Figur wurde in schmeichelhafter Weise von einem Kleid umschlossen, das seinen edlen Charakter allein durch die glänzende Seide erhielt. Spitze, Stickereien oder andere Feinheiten hätten die Gestalt der Hausherrin womöglich plump erscheinen lassen. Einzelne kostbare Schmuckstücke rundeten das Bild ab. Erdree war von dem glanzvollen Auftritt so bezaubert, dass es ihr beinahe weh tat, als die Dame zu sprechen begann. Die gezierte Liebenswürdigkeit der Gutsherrin baumelte von einem Turm aus Hochmut herab.
„Willkommen in Redanshaim,“ trillerte sie Wiralin entgegen. „Welch unerwarteter Besuch eines schmerzlich Vermissten!“
Wiralin verbeugte sich, um die dargereichte Hand zu küssen. Beim Aufrichten versuchte er, dem Schein des Kerzenleuchters zu entkommen, den der Diener hielt – vergeblich. Die Hausherrin erwischte Wiralin am Ärmel und zog ihn ins Licht. Mit einem halb vorwurfsvollen, halb triumphierenden Ausdruck studierte sie die Narbe mit dem für immer geschlossenen Augenlid.
„Nun sieh dir das an!“ Sie legte ihre Hand auf Wiralins rechte Wange und brachte ihr Gesicht noch näher an seines. „Du warst so ein schöner Junge – der schönste, den ich je gesehen habe! Aber du musstest unbedingt zum Heer gehen! Und was hat es aus dir gemacht?“
„Den Obersten Bogen von Linland,“ gab er zurück.
Erdree fuhr so überrascht zusammen, dass sogar ihr Hustenreiz für einen Moment aussetzte. Sie hatte nicht geahnt, dass der vermeintliche Bote ein derart hochrangiger Soldat war. Und warum dieser Tonfall – so hohl, fast ohne Würde?
Die Herrin von Redanshaim blieb unbeeindruckt: „Tatsächlich? Das muss wohl vor dieser Verwundung gewesen sein!“
Sie tätschelte flüchtig Wiralins Wange, bevor sie ihre Hand wieder sinken ließ. Als sie sich Erdree zuwandte, fiel die Maske der Wohlerzogenheit für einen Augenblick. Entsetzen blitzte auf. Erdree vermochte sich kaum auszumalen, wie der Anblick einer Glasbrecherin auf diese Dame wirken musste. Um wenigstens ihren Hustenreiz zu dämpfen, hielt Erdree den Atem an.
„Du liebe Güte!” Die Hausherrin strich über ihr aufgestecktes Haar. “Wer mag bloß deine Reisegefährtin sein, Wiralin?“
Wiralin sah sich nicht einmal nach Erdree um. „Das ist eine Glasbrecherin aus Mooresruh. Ich bringe sie auf Befehl von Generalin Ulante nach Glynwerk.“
„Wofür in aller Welt braucht die Generalin eine Glasbrecherin in ihrem Heer?“
Unwillkürlich holte Erdree wieder Luft und beugte sich vor. Zum ersten Mal, seit sie am Tor von Mooresruh vor seinem kalten Auge zurückgeschreckt war, blickte sie direkt in Wiralins Gesicht. Würde sich nun das Geheimnis lüften, nach dem sie nicht zu fragen gewagt hatte?
Wiralins Mundwinkel hoben sich zu einem spöttischen Lächeln. „Das, beste Munia, kann ich nicht einmal dir sagen.“
„Immer diese Geheimnistuerei von euch Soldaten!“ beschwerte sich die Hausherrin. „Ich zahle Steuern, um das Heer zu erhalten! Habe ich also nicht das Recht, zu erfahren, was mit meinem Geld geschieht?“
Munias theatralische Geste trieb eine Parfumwolke in Erdrees Richtung. Der schwere Duft war zu viel für die gereizte Kehle der Glasbrecherin. Stoßweises, scharfes Krächzen brach hervor. Ein Kristallluster, der tief in die Halle hinunterhing, klirrte beunruhigend. Mit tränenden Augen rang Erdree darum, den Husten zu ersticken.
„Das arme Ding ist krank.“
Statt Mitgefühl hörte Erdree nur Missbilligung in Munias Tonfall.
„Führ sie am besten gleich in ein Zimmer,“ befahl die Hausherrin ihrem Diener. „Aber versichere dich, dass sich nichts Zerbrechliches in dem Raum befindet. Dann sag dem Koch Bescheid, dass ich einen Gast zum Abendessen habe.“
Munia hakte sich besitzergreifend bei Wiralin unter und wies ihm die Richtung, in die er sie führen sollte. Erdree duckte sich unter dem herablassenden Blick des Dieners. Zum Glück fing sie gerade noch den Wink auf, mit dem er sie aufforderte, ihm zu folgen. Auf verschlungenen Wegen führte er sie in ein winziges Zimmer. Obwohl Erdree nie zuvor in einem Herrenhaus gewesen war, begriff sie sofort, dass dies eine Dienstbotenkammer sein musste. Erdree atmete auf. Hier gab es nur ein kleines Fenster und gewiss keine Kristallleuchter. Das frisch bezogene Bett stand an einer Wand, die wohlige Wärme ausstrahlte. Es musste eine Kaminwand sein. Nachdem ein Dienstmädchen einen Krug Wasser und eine große Schale Suppe gebracht hatte, blieb Erdree allein. Zum ersten Mal, seit sie Mooresruh verlassen hatte, war sie an einem Ort, der sie nicht quälte.
III
Zum unzähligen Mal verfluchte Wiralin die Reise nach Mooresruh und das Wetter, das ausgerechnet an diesem Tag Eisregen auf Monstedt niedergehen ließ. Er hatte sich geschworen, nie wieder einen Fuß über die Schwelle von Redanshaim zu setzen. Dennoch saß er hier neben Munia im Salon. Der rote Überzug des Sofas war immer noch derselbe wie vor vier Jahren. Schweigend widmete Wiralin dem Weinglas in seiner Hand unnötig große Aufmerksamkeit. Er täuschte die Müdigkeit eines Reisenden vor, um Munias Lächeln nicht sehen zu müssen. Dieses Lächeln versuchte, Fürsorglichkeit vorzutäuschen, und sprach doch nur von Selbstzufriedenheit. Niemand anderer hatte die Narbe in seinem Gesicht so unverhohlen gemustert wie Munia. Und niemand anderer würde sich so an diesem Anblick weiden wie sie.
„Sag mir, wie kommst du damit zurecht?“ fragte Munia zuletzt. Wieder legte sie ihre Hand sanft auf seine rechte Wange.
Wiralin parierte den Reflex, der Berührung auszuweichen. Erst nach einigen Augenblicken nahm er einen Schluck Wein, um Munias Hand zu entkommen.
„Ich bin ein Soldat. Wunden und Narben gehören zum Soldatenleben dazu.“ Seine raue Stimme klang selbst in seinen Ohren nicht überzeugend.
Munia wurde sarkastisch: „Ja, ja. Der Ruhm des Soldatenlebens! Ein Auge zu verlieren ist natürlich viel besser als ein sorgloses, sicheres Leben zu führen.” Nach einer kurzen Pause rückte sie noch ein Stück näher. Diesmal legte sie ihre Hand auf sein Knie. „Ich werde nicht sagen, dass es dir recht geschieht – es schmerzt mich zutiefst, dich derart zerstört zu sehen! Aber es würde mir viel bedeuten, wenn du inzwischen eingesehen hättest, dass du äußerst undankbar warst, als du plötzlich beschlossen hast, zum Heer zu gehen.“
Wiralin stand auf, um die Rücken einiger Bücher im Regal näher zu betrachten. Kein einziger Buchtitel drang bis in sein Gehirn vor. „Ich habe damals meine Pflicht gegenüber Linland erfüllt und tue es immer noch. Als die Ronn an der Nordostgrenze auftauchten, musste ich mein Land gegen diese neue Gefahr schützen. Ist die Sicherheit Linlands nicht wichtiger als ein sorgloses, sicheres Leben?“
Munia breitete ihre Arme über die Lehne des Sofas aus, als ob sie nur darauf gewartet hätte, allen Platz für sich zu haben. Doch ihr Ton troff vor verletztem Stolz: „In deinem Taumel von Heldenhaftigkeit hast du allerdings etwas Wichtiges vergessen: Wem du es zu verdanken hast, dass du solche hehren Pflichten für Linland auf dich nehmen kannst. Wenn ich nicht mit fast übermenschlicher Großzügigkeit über deinen... jugendlichen Leichtsinn hinweggesehen hätte, wäre dir eine ganz andere Karriere bevorgestanden – nämlich die eines Sträflings im Kerker. Oder bestenfalls in einem Steinbruch.“
Die mühsam aufrecht erhaltenen Bollwerke brachen. Lange verbannte Erinnerungen stürmten auf Wiralin ein.
Sein Vater war ein Tagelöhner in einem Dorf nahe Monstedt gewesen. Nach dem frühen Tod seiner Frau hatte er seinen Sohn die meiste Zeit sich selbst überlassen. Der einzige ständige Begleiter des Heranwachsenden war der Hunger gewesen. Bald hatte Wiralin sich tagsüber aus der winzigen, dunklen Hütte in den Wald um das Gut Redanshaim geflüchtet. Der Wald bot im Sommer Beeren, Pilze und Nüsse. Und das ganze Jahr über huschte Kleinwild über den Boden und über die Baumstämme. Wiralin begann mit einer Steinschleuder, dann baute er sich immer bessere Bögen und Pfeile. Damit brachte er Hasen, Eichhörnchen und Hühnervögel zur Strecke, später auch Rotwild. Mit fünfzehn wurde er von Munias Jäger ertappt. Der Jäger führte den Wilderer seiner Herrin vor. Munia ging lange Zeit um ihn herum, betrachtete ihn von allen Seiten und schwieg mit hoheitsvoller Miene. Wiralin erwiderte abwechselnd trotzig ihren Blick oder starrte wie betäubt zu Boden. Diese Frau, die sein Leben in ihren Händen hielt, erschien ihm ebenso unwirklich wie ihr prächtiges Herrenhaus. Eine Gefahr stand ihm jedoch klar vor Augen: In Monstedt eingekerkert zu werden. Danach dürfte er sich nicht einmal mehr Hoffnungen darauf machen, sich wie sein Vater als ehrlicher Tagelöhner durchzuschlagen. Doch dann blieb die faszinierende Herrin von Redanshaim vor ihm stehen.
„Wie kann ein so schöner Junge nur so böse sein?“ lauteten ihre ersten Worte. „Beweise mir, dass du ebenso gut sein kannst wie du schön bist, und ich werde über diesen einen Fehler hinwegsehen.“