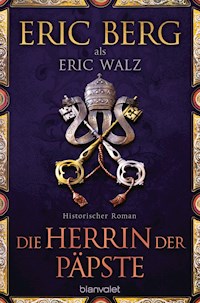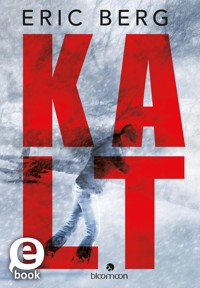2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Glasmalerin Antonia Bender
- Sprache: Deutsch
Ein Roman so bunt, farbenprächtig und detailreich wie die Glasfenster im Dom zu Trient.
Mitten im hektischen Treiben des Trienter Konzils im Oktober 1551 verliebt sich die Ulmer Glasmalerin Antonia Bender völlig unstandesgemäß: ausgerechnet in den jungen Jesuiten Sandro. Eine unmögliche Liebe – denn er ist nicht nur der Halbbruder von Antonias langjährigem Verehrer Matthias, dem mächtigen Abgesandten des württembergischen Herzogs, Sandro soll auch einen Bischofsmörder aufspüren. Daher ist Antonia froh, in der Kurtisane Carlotta eine Freundin in der fremden Stadt gefunden zu haben. Was Antonia nicht weiß: Carlotta ist nur aus einem einzigen Grund nach Trient gekommen: Sie hat vor, den Sohn des Papstes zu töten …
Lesen Sie auch die anderen beiden Antonia-Bender-Romane »Die Hure von Rom« und »Der schwarze Papst«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Mitten im hektischen Treiben des Trienter Konzils im Oktober 1551 verliebt sich die Ulmer Glasmalerin Antonia Bender völlig unstandesgemäß: ausgerechnet in den jungen Jesuiten Sandro. Eine unmögliche Liebe – denn er ist nicht nur der Halbbruder von Antonias langjährigem Verehrer Matthias, dem mächtigen Abgesandten des württembergischen Herzogs, Sandro soll auch einen Bischofsmörder aufspüren. Daher ist Antonia froh, in der Kurtisane Carlotta eine Freundin in der fremden Stadt gefunden zu haben. Was Antonia nicht weiß: Carlotta ist nur aus einem einzigen Grund nach Trient gekommen: Sie hat vor, den Sohn des Papstes zu töten …
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz
Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die Sternjägerin
Glasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze Papst
Die Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Eric Bergals Eric Walz
Die Glasmalerin
Historischer Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2009 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Wirestock Creators, Roman Sigaev, rdnzl, Glevalex, ruggedstudio) und Shutterstock.com (ntv, Med Photo Studio) LH ˑ Herstellung: DiMo E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-30255-9V001
www.blanvalet.de
Für Anna, Christoph und Manfred
Zur Erinnerung an unsere gemeinsame Kindheit
Prolog
Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren
Prolog
Trient, 8. Oktober 1551,
drei Tage vor Eröffnung des Konzils
Carlotta hatte nur ein einziges Ziel: den Sohn des Papstes zu töten. Nur deswegen war sie von Rom nach Trient gereist, nur darum nahm sie dieses Leben als Hure noch auf sich, um den neunzehnjährigen Innocento, Kardinal Innocento, zu ermorden, und zwar auf eine Weise, dass sie selbst unentdeckt blieb. Manchmal träumte sie davon, wie sie den Jüngling, eingehüllt in einen weiten Umhang mit Kapuze, nachts verfolgte und ihm in einem günstigen Moment den Dolch in den Rücken jagte. Im Schlaf spürte sie die Genugtuung, ein Gefühl wie der Klang von tausend Glocken. Ja, manchmal träumte sie von Innocento, was erstaunlich war, denn sie kannte ihn überhaupt nicht.
Mit ruhiger Hand goss sie ein wenig warmes Wasser in einem gleichmäßigen Strahl über die Füße ihres Kunden. Salvatore Bertani mochte das, er hatte es verlangt. Er räkelte sich auf seinem Bett und gab Laute von sich, die Wohlbefinden ausdrücken sollten, aber nicht von Geräuschen zu unterscheiden waren, die man bei Magenbeschwerden von sich gab. Seine zittrigen, mit kostbaren Ringen geschmückten Finger waren über der nackten Brust gekreuzt, so als würde er beten, und seine Augen waren geschlossen.
»Ja«, murmelte er in das nur vom Kaminfeuer und einer Stundenkerze beleuchtete Zimmer. »Weiter so.«
Sie massierte seine Füße, vor allem die Sohlen, wunschgemäß zuerst den linken, dann den rechten Fuß. Bertani hatte ihr alles haargenau erklärt, damit sie nichts falsch machte. Sie bediente ihn zum ersten Mal. Obwohl er oft in Rom gewesen war, war sie nie in seine Nähe gekommen, denn er hatte seine feste Konkubine gehabt, ein siebzehnjähriges Mädchen mit traurigen Augen und blauen Flecken, die sich wie eine Krankheit über ihren Körper verteilten. Sie hatte ihn kürzlich verlassen, war davongelaufen, was lange Gesprächsstoff unter den Huren der Ewigen Stadt gewesen war. Carlotta hatte ihren Namen vergessen, irgendetwas mit G, sie wusste das nicht mehr so genau. Mit ihren Kolleginnen hatte sie nie viel zu tun gehabt, denn im Gegensatz zu ihnen hatte Carlotta keine Beziehung zu ihrer Arbeit, sie spürte weder Leid noch Lust noch Gleichgültigkeit. Sie spürte nur Zorn. Der Zorn, der Hass waren bei Tag und bei Nacht ihre Begleiter geworden.
»Genug«, sagte Bertani.
Carlotta schüttelte ihre schwarzen Haare und rieb damit seine Füße ab, ganz vorsichtig, so als streichle sie ein Kunstwerk. Bertanis Füße waren die eines ganz normalen Greises, mit verwachsenen Nägeln und vielen buschigen Haaren auf den Knöcheln, aber Carlotta nahm keine Notiz davon. Sie hatte in den vier Jahren, seit sie Konkubine geworden war, ganz andere Dinge gesehen, dagegen war der rüstige alte Bertani ein Apoll. Was ihr Sorgen an ihm bereitete, hatte nichts mit seinem Aussehen zu tun, und sie wagte nur aus einem einzigen Grund, sich mit ihm einzulassen: Bertani würde ihr etwas verschaffen, das weit kostbarer für Carlotta war als das Geld, mit dem er sie für diese Nacht gekauft hatte.
»Komm jetzt her«, befahl er. »Mach weiter.«
Seine grauen Augen beobachteten Carlotta, während sie sich erhob und neben ihn vor das Bett kniete. Es war besprochen worden, dass sie jetzt die Hände faltete.
»Gut so«, flüsterte er. »Nun siehst du brav aus wie ein kleiner Engel, obwohl du eine reife Frau bist, eine verdorbene Hure. Aber ich liebe reife verdorbene Frauen, nur die ganz jungen und unverdorbenen liebe ich mehr. Wie alt bist du? Antworte!«
»Vierzig.«
Er lachte. »Du bist alt. Aber dein langes Haar gefällt mir, es fühlt sich an wie weiche Schafwolle. Vielleicht mache ich dich zu meiner Dauergefährtin.«
»Das möchte ich nicht«, erwiderte Carlotta.
Seine Finger krallten sich in ihre Schultern, dass es schmerzte.
»Diese Wahl hast du nicht. Du bist gut bezahlt worden.«
»Für heute Abend, ja. Ab morgen seid Ihr wieder ein Bischof, und ich bin eine freie Frau.«
Er lachte. »Ich könnte dich schlagen, das weißt du. Schlagen, bis du mir gehorchst.«
Welchen Schmerz, dachte sie, könnte Salvatore Bertani ihr zufügen, der größer war als der Schmerz, den sie seit Jahren mit sich herumtrug?
Er drückte ihr einen harten, leidenschaftslosen Kuss auf die Lippen, den sie geübt erwiderte. Bertani sah sie kurz an, prüfte, ob ihre Hände noch gefaltet waren, leckte sich zufrieden die Lippen und küsste sie erneut, genauso wie beim ersten Mal.
Als er sich von ihr löste, bekamen seine Augen für einen kurzen Moment einen wässrigen Glanz und den Ausdruck von Entrücktheit.
Der Schlag seiner flachen Hand traf Carlotta auf die Wange und warf sie zu Boden.
Sie blieb liegen. Die Fliesen waren kalt, Oktoberfliesen, und kühlten ein wenig ihre heiße Wange. Carlotta ertrug alles. Sie hätte aus dem Fenster schreien können, dass der angesehene Bischof von Verona, einer der Delegierten des Konzils, sie schlage und sich an ihr vergehe. Auch hätte sie sich wehren können. So schwach war sie nicht, um einen alten Mann mit dünnen Armen nicht kampfunfähig zu treten. Aber sie nahm es auf sich. So bitter es war, sie brauchte Bertani noch. Bevor er ihr nicht das Schriftstück gegeben hatte, das sie benötigte wie ein Dürstender das Wasser, war sie seine Sklavin.
Er zog sie auf die Füße. »Mach weiter«, sagte er, als sei nichts geschehen.
Er legte sich auf das Bett, und Carlotta wollte soeben mit gefalteten Händen auf seinen Körper kriechen, als aus dem Nebenzimmer Geräusche drangen.
»Was ist da los?« Bertani schreckte auf.
»Vielleicht ein Diener«, sagte Carlotta.
»Ich habe alle Diener fortgeschickt, das Haus ist leer.«
Schritte waren zu hören, Absätze von Stiefeln auf den Fliesen, ein unheimlicher Moment der Stille, dann wieder Schritte. Die Kerze flackerte im Luftzug, der durch einen offenen Spalt in der Tür drang, und verlosch. Nur das Kaminfeuer prasselte noch warm und heftig.
Stand die fremde Person schon an der Tür und beobachtete sie?
Bertani schob Carlotta zur Seite und zog eine Tunika über.
»Wer ist da?«, rief er und stand zögernd auf.
Eine Ewigkeit schien zu vergehen, bis eine Antwort kam. »Exzellenz«, rief eine männliche Stimme. »Bitte, wo seid Ihr? Verzeiht, aber ich muss Euch sprechen.«
Bertani warf sich noch einen Umhang über die Tunika und ging in den Nebenraum. Es gab einen kurzen Wortwechsel zwischen ihm und dem Fremden, dann steckte er den Kopf ins Schlafgemach, sagte Carlotta, es würde einen Moment dauern, und schloss die Tür von außen.
Carlotta hatte keinen Versuch gemacht, sich für den Fall zu verhüllen, dass der Fremde den Raum betreten hätte. In tausend Nächten hatte man sie nackt gesehen, und mit der Scham war es anders als mit dem Schmerz – die Scham verging mit der Zeit. Wie so viele andere Gefühle war sie langsam in ihr erstorben, Blättern gleich, die der kalte Herbstwind von den Bäumen riss. Carlotta war einsam geworden in diesen vier Jahren als Konkubine, nicht nur hatte sie viele Menschen verloren, sondern auch Empfindungen. Vorfreude, Interesse, die Lust daran, sich schön zu machen, diese vielen wunderbaren Gefühle des Alltags, an die man gar nicht denkt, wenn man sie hat – sie alle waren gegangen. Hier in Trient hatte sie zwei gute, freundliche Menschen kennengelernt, die sie sehr mochte, doch Zuneigung und Freundschaft hatten keine Zukunft in Carlottas Leben.
Sie öffnete eines der Fenster. Durch die Nacht zeichneten sich die Silhouetten der Bergbuckel ab, die Trient fast vollständig umgaben. An klaren Tagen leuchteten sie wie Gold, und ihre Hänge voll von Zedern strahlten etwas Majestätisches aus. Doch nachts waren es Gespenster, Riesen, gewaltige Schatten. Von ihnen wehte ein kalter Hauch herunter, dessen Böen Carlotta wie Posaunenstöße entgegenschlugen und sie erschauern ließen. Der Wind trug den Geruch modriger Blätter vor sich her. In allem entdeckte sie Verfall und Tod.
Eilig schloss sie das Fenster wieder, kauerte sich vor den Kamin und trank von dem Wein, der bereitstand. Bertanis Quartier war gemütlich, kein Palazzo, aber ein gut ausgestattetes Haus unweit des Domplatzes. Er hatte Glück mit dieser Unterkunft gehabt. Viele Prälaten strömten derzeit in die Stadt, zu viele, um sie alle angemessen unterzubringen. In drei Tagen würde die Welt hierherblicken, wenn das große Konzil, das Concilium Tridentinum, zusammentreten und die für die Christenheit derzeit dringendste Frage beraten würde: Die Zukunft der Kirche, ja, der Christenheit, hing davon ab.
Carlotta verstand kaum etwas von diesen Dingen, aber sie wusste, dass Bertani dabei eine bedeutende Rolle spielte. Sie traute ihm ohne Weiteres zu, dass er einen scharfen Verstand besaß. Längst hatte sie aufgehört, sich darüber zu wundern, dass hohe Geistliche tagsüber kraftvoll und nachts Sklaven ihrer Leidenschaft waren, bei Licht fromm und bei Dunkelheit besessen sein konnten. Sie waren besessen von Frauen oder Männern, von Schenkeln, Füßen, Bauchnabeln, Schmerzen, Schlägen, Bissen, Wunden … Bertani, bei Tageslicht ein liberaler Reformer, verwandelte sich in der Dunkelheit in einen machtverliebten Mann mit absonderlichen Vorlieben. Sollte sie ihn deswegen verachten? Im Grunde genommen unterschied er sich gar nicht so sehr von ihr. Auch sie trug ja ein Geheimnis in sich. Wer ihre unaufdringlich gekleidete Gestalt betrachtete, wer ihren langsamen Schritt beobachtete, in ihre großen, glitzernden schwarzen Augen blickte, ihre kristallklare Stimme vernahm und ihre weiche Haut fühlte, der vermutete wohl nicht, dass sie bereits einen Versuch unternommen hatte, einen Menschen umzubringen, einen Menschen, mit dem sie noch nie gesprochen und der ihr persönlich kein Leid zugefügt hatte. Nein, sie hatte mit Innocento noch nie etwas zu tun gehabt, und außer seinem Namen und seinem Gesicht kannte sie nichts von ihm.
Damals, vor sieben Monaten, war es Carlotta gelungen, bis vor die Tür des Schlafgemachs des jungen Kardinals zu kommen. Sie hatte mit einem der Bediensteten angebandelt und ihn dazu überredet, dass er sie in seine Kammer innerhalb des Palazzos mitnahm. Als er bekommen hatte, was er wollte, war er eingeschlafen. Sie hatte nicht gezögert und war durch die nächtlichen Gänge geirrt, das Messer unter dem Kleid verborgen, fast wie in ihrem Traum. Ein halbes Dutzend Türen hatte sie geöffnet und wieder geschlossen, nachdem sie festgestellt hatte, dass Innocento dort nicht schlief. Er war im Haus, da war sie sich sicher. Er war nicht ausgegangen, freitags ging er nie aus. Also suchte sie weiter, gab nicht auf, schlich auf Zehenspitzen, wich einem Beschließer auf seinem Kontrollgang aus, tauchte in immer dunkler werdende Flure ein, bis sie endlich am Ziel war.
In Innocentos Zimmer brannten zwei Kerzen neben dem Bett, wahrscheinlich, weil er sich vor der Dunkelheit fürchtete. Ein matter Lichtglanz fiel auf sein glattes, bartloses Gesicht. Das war es also, ihr Opfer. Innocento bedeutete »der Unschuldige«, und das war er tatsächlich. Er war unschuldig.
Und doch todgeweiht.
Kaum hatte sie einen Schritt in den Raum gemacht, hielt eine Hand sie zurück, zog sie auf den Gang und schloss die Tür. Es war der Diener, den sie verführt hatte. Er sah ihr Messer, er durchschaute ihre Absicht. Warum war er aufgewacht? Wieso nur war er ihr nachgeschlichen?
Sie stieß zu, bevor sie denken und er etwas sagen konnte. Er glitt an ihrem Körper hinab und starb in ihrem Schoß. Dort, wo andere Frauen Leben schenkten, nahm sie eines.
Sie war geflohen. Es war ihr unmöglich, den Plan auszuführen, nach dem, was geschehen war. Sie hatte einen Menschen umgebracht, nicht den Sohn des Papstes, sondern einen armen Tropf, der zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war.
Noch heute, noch in diesem Augenblick, als sie in das lodernde Feuer starrte, lastete jene Tat auf ihrem Gewissen.
Ihren Plan bezüglich Innocento änderte sie dennoch nicht, im Gegenteil, sie fühlte sich darin bestärkt. Die Schuld, die sie auf sich geladen hatte, durfte nicht vergebens gewesen sein. Es hatte sich zwar in Rom seither keine weitere Möglichkeit ergeben, unbemerkt an Innocento heranzukommen, doch hier in Trient hoffte Carlotta auf bessere Bedingungen. Wenn sie den Mord nur nicht im Verborgenen begehen müsste, denn an der Entschlossenheit und der Bereitschaft, dafür einzustehen, fehlte es ihr nicht.
Aber Inés – um Inés’ willen durfte sie nicht gefasst werden.
Bertani kam zurück. Was immer der Fremde ihm gesagt hatte – der Bischof war alles andere als erfreut darüber. Er fluchte leise vor sich hin und ging an Carlotta vorbei zu einer Anrichte, auf der eine Schüssel und ein Krug Wasser bereitstanden. Dort wusch er sich die Hände, zum vierten Mal an diesem Abend – die Haut war mittlerweile so bleich und weich wie die von Leichen. Hatte sich nicht auch Pontius Pilatus die Hände gewaschen, unmittelbar nach der Verurteilung Christi, dachte Carlotta, als Bertani sie mit diesen Händen berührte. Er umschloss ihr Gesicht, und er sah sie mit jenem Ausdruck an, der nichts Gutes verhieß. Carlotta machte sich auf einen weiteren Schlag gefasst.
»Ich brauche das Schriftstück«, sagte sie, »wenn ich Euch auch in Zukunft besuchen soll.«
Was kostete ihn schon ein Schriftstück? Wortlos nahm er das vorbereitete Dokument und legte es auf ihre Kleider, die sich, einem Scheiterhaufen ähnlich, in der Mitte des Raumes auftürmten. Ein Blick von ihm zum Bett genügte, damit Carlotta sich stumm darauflegte und die Arme wie einen Heiligenschein über dem Kopf verschränkte.
»Komm«, sagte sie, aber ebenso gut hätte sie »bleib weg« oder »stirb« sagen können. Bertani war ihr von diesem Moment an gleichgültig, er war nichts mehr. Kaum dass sie seinen Körper spürte, wie er sich auf sie legte. Zwischen seinen Stößen blitzte die Vergangenheit in ihr auf, die schönen Abende, als sie mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter am Strand spazierte und die Wellen beobachtete, die mit Wucht gegen die Klippen schlugen, ohne sie zerbrechen zu können. Diese Erinnerungen waren jedoch flüchtig wie Düfte, die man zu riechen meint, obwohl sie nicht da sind.
Sie hatte bekommen, was sie von Bertani gewollt hatte, den Passierschein für den Inneren Ring um den Domplatz, der vom Tag des Konzils an für alle Bürger gesperrt sein würde, die kein solches Dokument besaßen. Damit käme sie an Innocento heran, damit war sie seinem Tod ein Stück näher gekommen.
Sie presste die Faust auf den Mund und sah ins Feuer. Der Bischof hatte seinen Zweck erfüllt. Wenn es nach ihr ginge, könnte er Innocento vorausgehen und sterben.
Jetzt, dachte sie, jetzt müsste er sterben.
Er taucht die Hände ins Wasser der Schale ein. Sie zittern. Mit all seiner Willenskraft kann er sie nicht dazu bringen, mit dem Zittern aufzuhören, und das ärgert ihn. Er hat nicht mehr die Stärke wie früher. Das Alter überzieht alles wie die Kälte einer frostigen Nacht: die Kraft seiner Arme, den Atem in seiner Brust, die machtvolle Stimme, die in letzter Zeit rau geworden ist, die Lust zur Liebe, die Streitlust, die Hoffnung, ja, selbst die Gegnerschaft zum Papst. Alles gefriert langsam, stirbt ab, wird zur toten Fassade, so wie jene verschrumpelten Spätherbstfrüchte, die vom Eis eingeschlossen und konserviert werden. Junge Menschen ziehen sich vom Alter zurück und wenden sich anderen jungen Menschen zu, Frühlingskinder wie sie selbst. Das macht ihn wütend. Je älter er wird, umso wütender wird er auf das Alter, auf die Frauen und auf sich selbst.
Als er die Hände aus dem Wasser hebt, bleibt ein schmieriger, gelblicher Film zurück, der von den Salben herrühren mag, mit denen Konkubinen sich einreiben, um lange genug schön zu bleiben. Noch so ein vergeblicher Kampf, den der Mensch führt, denkt er und hält für einen Augenblick inne. Er ist müde, die Nacht war anstrengend.
Da sieht er einen roten Tropfen ins Wasser gleiten, sich entfalten, auflösen. Blut. Blut von einem seiner Finger. An einer Stelle ist die Haut eingeritzt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, nur ein Kratzer. Einer seiner Fingernägel hat die Wunde verursacht, er ist eingerissen, vielleicht bei einem seiner Schläge in das Gesicht der Konkubine.
Er nimmt sich gerade vor, der Wunde keine weitere Beachtung zu schenken, als ihn von hinten ein Stoß trifft. Der Stoß tut nicht weh, aber etwas hat sich verändert. Er will sich umdrehen, es geht nicht. Er will schreien, doch statt seiner Stimme entströmt etwas anderes seinem Mund.
Das Wasser der Schale färbt sich rot.
Erster Teil
1
9. Oktober 1551,
zwei Tage vor Eröffnung des Konzils
Als Antonia aufwachte, schlief er noch. Er war Bildhauer und hatte einen Körper, als hätte er ihn sich selbst meißeln dürfen. Gestern hatte sie diesen Mann begehrenswert gefunden, ebenso am Tag davor, als sie ihn kennengelernt hatte. Er war Italiener – alle Bildhauer schienen Italiener zu sein –, und sie liebte Italiener. Sie waren viel interessanter als Deutsche oder Franzosen oder Spanier. Wenn Italiener eine Sünde begingen, eilten sie anschließend in die Kirche und ließen sich dort davon freisprechen. Furcht vor der ewigen Verdammnis und herrlichste Lebensfreude, Frömmigkeit und Sinnlichkeit, Gelassenheit und Erregung gingen Hand in Hand bei diesem Volk. Das Jahrhundert veränderte die Menschen der südlichen Länder schnell, denn es veränderte sich selbst mit rasender Geschwindigkeit, so als strebe es einer Blüte entgegen. Neuen Musikinstrumenten entlockte man neue Töne, die Menschen tanzten beherzter, trugen gewagtere Kleider, schrieben freizügige Verse. Allen voran die Italiener. Ein herrliches Volk zum Verlieben – und zum Lieben.
Es war noch Nacht, der Tag bloß eine dünne, graue Ahnung am Horizont. Trotzdem musste sie sich ein bisschen beeilen, um rechtzeitig im Dom zu sein. Sie suchte im Dunkel des Bildhauerateliers nach ihren Kleidern, tastete sich an Gipsköpfen von Aristoteles, Medea und dem heiligen Eligius entlang, stieß sich am Flügel eines Adlers – der eher einer Krähe glich – und fand, wonach sie suchte, im Schoße Papst Julius III.
Sie zog sich die Kleider über, ohne darauf zu achten, wie sie saßen. Kleider interessierten sie nicht, und auch andere Menschen interessierten sich nicht für ihre Kleider. Manchmal fragte sie sich, was Männer an ihr fanden, denn sie hielt sich nicht für hübsch und trug keine schönen Sachen. Vielleicht lag es an der Art, wie sie mit ihnen sprach: frei heraus und ein bisschen unverfroren. Sie gab denen, die sie attraktiv fand, zu erkennen, wofür sie bereit war. Männer schätzten das. Männer schätzten, wenn man ihnen Mühe ersparte.
Mittlerweile war es ein wenig heller geworden. Antonia sah, dass der Bildhauer erwacht war, und an seinen Augen erkannte sie, dass er dasselbe dachte wie sie. Sie hatten beide bekommen, wonach sie letzte Nacht gesucht hatten. Der Kuss, den sie ihm quasi im Vorbeigehen zuwarf, hatte etwas von einem äußerst flüchtigen Parfüm an sich.
»Arrivederci«, sagte sie.
»Arrivederci«, sagte er.
Sie würden nie wieder beieinanderliegen.
Antonia kam zur richtigen Zeit. Als sie den Dom betrat, war der Boden des Langhauses in frühgotische Düsternis getaucht, während oben jeden Moment die ersten Sonnenstrahlen auf die Fenster treffen würden. Noch waren sie tot, diese Fenster, denn wie die Menschen, so begannen auch sie erst zu erwachen, wenn helles Licht durch die Scheiben strömte und die Gesichter, die Leiden, Hoffnungen und Freuden wie tausend Juwelen schillern ließ. Wofür Antonia fast ein Jahr ihres Lebens gegeben hatte, würde in wenigen Augenblicken zu leben anfangen.
Sie war fast allein. Ein einzelner Mönch kniete inmitten des Langhauses. Dumpf schloss sich die Pforte hinter ihr, der Mönch schreckte auf und wandte sich ihr zu: ein schmales Gesicht von nussbrauner Hautfarbe. Er sah sie an, zu lange, um gleichgültig zu wirken, doch das mochte Einbildung sein, denn gleich darauf vertiefte er sich wieder in seine Gebete, und Antonia blickte lediglich auf seine kreisrunde Tonsur auf dem Scheitel. Er hatte etwas an sich, das ihr seltsamerweise vertraut vorkam.
Die Sonne ging über den östlichen Bergen auf, und binnen eines winzigen Moments war alles Farbe. Manche Nischen glänzten wie mit Purpur überzogen, in anderen schimmerte Grün; der gesamte Innenraum von Langhaus und Kuppel wurde von einem unvergleichlichen tiefen Blau erfüllt. So überwältigend war die Wirkung dieses überirdischen, geheimnisvollen Lichts, dass Antonia vergaß, auf ihre Arbeit stolz zu sein.
Nach oben blickend durchschritt sie die Leere des Doms, vorbei an den Pfeilern und Skulpturen, vorbei auch an dem jungen Mönch. Sie fühlte seinen Blick, sie hörte das Rascheln seines Gewandes, als er sich erhob, doch sie wollte keinen Lidschlag des Wunders versäumen. Ja, für sie war es ein Wunder. Die einzelnen Bilder und Gestalten zählten in diesem Moment noch nicht, ebenso wenig die Details der handwerklichen Ausführung, die Strukturen und Schattierungen, Facetten und Blasen und Bleiruten, das Schwarzlot und das Silbergelb. Für kurze Zeit war sie weder Handwerkerin noch Künstlerin, sondern einfach ein Mensch, ehrfürchtig und atemlos angesichts dessen, was das Aufeinandertreffen von Licht und Glas, also von Gott und Materie, bewirkte.
So sah das Licht der ersten Erdentage aus – diesen Gedanken, den sie erstmals als Kind hatte, als ihr Vater sie im Morgengrauen an der Hand in das Ulmer Münster führte, hatte sie nie vergessen. Hieronymus, ihr Vater, hatte die Fenster des Münsters entworfen, er hatte das Licht Gottes in die Kathedrale getragen. Dieser Tag war der unvergesslichste und schönste Tag ihres Lebens gewesen – und war gleichzeitig zum schlimmsten Tag geworden.
Sie atmete tief durch und konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart. Langsam, nachdem das Auge sich an die Farben gewöhnt hatte, traten die Motive der Fenster deutlicher hervor. Die ersten Bilder leuchteten auf: Blumen, Menschen, Flammen, Sonnen. Nach und nach entwirrten sich die Linien. Zunächst erzählte jedes Fenster seine eigene Geschichte, und dann erst, wenn man länger hinsah, vereinigten diese einzelnen Geschichten sich zu einem Ganzen. Das Licht wurde zum Buch.
Jetzt wurde die Gesamtheit der Arbeiten sichtbar. Auf der einen Seite das Werk ihres Vaters, sieben Fenster für sieben Schöpfungstage, darauf siebenundsiebzig Szenen von der Erschaffung der Welt, beginnend mit dem Licht und endend beim Menschen, ein einziges farbenfrohes Fest des Anbeginns, voller Freude und Leichtlebigkeit. Doch ihnen gegenüber, auf der anderen Seite, ihr eigenes Werk, sieben Fenster für die letzten sieben Tage der Welt, mit siebenundsiebzig Szenen aus der Offenbarung des Johannes: die apokalyptischen Fanfaren, Erdbeben, brennende Wälder, der Sturz der Verlorenen ins Flammenmeer, endlose Prozessionen von Gestalten, die auf ihr Verderben zusteuern. Zwischen ihren schattenhaften Leibern und verzerrten Gesichtern waren auch Bruchstücke von Kronen und sogar Bischofsringe zu erkennen, aber auch Geldsäcke, an die sich manche verzweifelt krallten. Das letzte der sieben Fenster zeigte auseinanderstrebende Menschen, in Panik fliehend vor einstürzenden Mauern, und zwischen ihnen grüne, weiße, blaue und rote Juwelen, Glassplitter, die wie kleine Sonnen leuchteten, bevor sie in ein Meer von Blut fielen.
Die letzte Szene war einfach ein schwarzes, ein tiefschwarzes Nichts. Das Licht war verschwunden, es war den Menschen von Gott entzogen worden so wie damals vor zwanzig Jahren in Ulm.
Sie erschauerte, und für einen Augenblick kam es ihr vor, als weiche alle Kraft aus ihrem Körper, als verlasse sie etwas, das sie gefangen hielt, seit sie mit den Entwürfen für diese Arbeit begonnen hatte. Gleich darauf wurde ihr leicht zumute, und sie war glücklich.
»Geht es Euch gut?« Die Stimme klang sehr sanft, eine angenehme Stimme, die man gerne hörte.
Sie wandte sich um und antwortete nicht, sondern sah den Mann einfach an.
»Ich hatte eben den Eindruck, Euch schwindelt«, sagte er und stellte sich vor: »Bruder Sandro Carissimi, aus dem Kolleg in Neapel.«
Jeder Orden entsandte Delegierte zum Konzil; Antonia hatte schon Dominikaner, Zisterzienser, Franziskaner, Karmeliter, Serviter, Augustiner, Theatiner und Kapuziner gesehen. Es wimmelte in der Stadt nur so von Kutten.
»Ihr seid Jesuit, oder?«
»J-ja«, antwortete er irritiert.
»Das dachte ich mir. Die Kutten der Jesuiten sind schwarzweiß, viel feiner gewebt, und sie rascheln wie Laub im Herbstwald. Ich mag diese Kutten. Ich mag Jesuiten.«
Er war ein weiteres Mal verdutzt, weil sie mit ihm sprach, als kenne sie ihn schon seit Jahren und als sei er kein Mönch, sondern ein Mann in einem schwarz-weißen Gewand.
»Antonia Bender. Ich bin Glasmalerin und habe mir gerade meine Fenster angesehen.«
»Sie sind atemberaubend.«
»Ich wollte, dass sie Entsetzen auslösen. Wenn Ihr mir ein Lob aussprechen wollte, müsst Ihr sagen, dass sie entsetzlich sind.«
»Also gut, diese Fenster sind entsetzlich.« Ein Lächeln flog über seine Lippen und Augen, aber nur kurz, allzu kurz. Dann machte er wieder ein ernstes, mönchisches Gesicht.
»Danke«, sagte sie. »Aber es ist zu spät, ich weiß leider, dass Ihr es nicht ernst meint. Die Fenster gefallen Euch, aber sie sollten Euch eigentlich abschrecken.« Sie legte ihren Kopf ein wenig zur Seite. »Ihr seid also Italiener?«
Da sie sich auf Italienisch unterhielten und er Neapel erwähnt hatte, war das eine überflüssige Frage, aber sie hörte es gerne, wenn jemand sagte, dass er Italiener sei.
»Römer«, antwortete er.
»Einen Römer habe ich noch nie kennengelernt. Es heißt, in Rom sei die ganze Welt zu finden, alles Schöne und alles Elende in einem Ort. Ist das wahr?«
»Rom ist die atemberaubendste und entsetzlichste Stadt der Welt, und damit ist sie wie Eure Fenster, Antonia Bender.«
Er hatte etwas Wunderbares gesagt, es aber so beiläufig ausgesprochen, als handele es sich um das Aufsagen des Alphabets.
»Übrigens habe ich einen Fehler entdeckt«, sagte er.
Sie lächelte. »In der Kunst gibt es keine Fehler, nur Trugschlüsse.«
»Der Trugschluss befindet sich dort oben.« Er deutete auf ein Fenster über der Apsis, das auf Wunsch des Fürstbischofs von Trient von ihr angefertigt worden war. Darin waren die Bischöfe und Kardinäle porträtiert, die am Konzil teilnehmen würden. Man hatte ihr vor einigen Monaten Zeichnungen geschickt, und sie und ihr Vater hatten sie auf Glas übertragen. Vom künstlerischen Standpunkt aus waren die Porträts unbedeutend.
»Was ist damit?«, fragte sie und zuckte die Schultern.
»Ihr werdet eines der Porträts austauschen müssen, und zwar noch bevor das Konzil beginnt. Der Bischof von Verona ist letzte Nacht verstorben.«
»Salvatore Bertani?«
»So ist es.«
»Das kommt mir ungelegen.«
»Vergebt dem Bischof, ihm kam sein Tod gewiss auch ungelegen«, sagte er auf eine unnachahmlich leidenschaftslose und dennoch schlagfertige Weise, die ihr gefiel.
Während er sich wieder in die Fenster vertiefte, betrachtete sie ihn genauer, wie einen Schmetterling, der mit den Flügeln geschlagen und damit auf sich aufmerksam gemacht hat. Sie beobachtete seinen hervorstehenden Adamsapfel, der beim Schlucken auf und ab rollte, sowie seinen schmalen Hals, der sich neugierig höher zu recken schien, und wieder kam ihr manches an ihm vertraut vor, anderes jedoch nicht.
»Wie ich sehe«, begann er mit einer sanften Stimme, die nicht recht zu dem analytischen Tonfall passte, »habt Ihr die Schlange des Garten Eden in Eure Apokalypse eingefügt und mit einem Männerkopf dargestellt, statt wie sonst üblich mit einem Frauenkopf. Und dort drüben habt Ihr die Darstellung der Seele verändert. Man zeigt die Seele gern als Säugling, der vom Erzengel Michael im Arm gehalten wird. Bei Euch hält er zwei Säuglinge im Arm, doch er hält sie nicht nur, er wiegt sie, und jenes Kind, das so boshaft grinst, ist schwerer. Aus alledem schließe ich, dass Ihr Euch viel mit dem Bösen beschäftigt und dass Ihr glaubt, es sei männlich und zudem mächtiger als das Gute.«
Antonia hatte ihre Symbolik so versteckt untergebracht, dass sie geglaubt hatte, niemand würde sie bemerken, und wenn doch, nicht begreifen.
»Rex tremendae majestatis«, zitierte sie einen Satz aus der Totenmesse. »Herrscher schrecklicher Gestalten. Gott ist der Herr von demütigen Dienern, aber es gibt auch den Herrn von Scheusalen, von Kreaturen unfassbarer Grausamkeit und kalter Berechnung. Das Böse ist überall, und es ist meine Aufgabe als Künstlerin, ihm Gesichter zu geben.«
»Am gewagtesten finde ich Euer Bild von Mariä Verkündigung«, fuhr er fort. »Weil die Lilie das Symbol der Reinheit ist, wird sie gewöhnlich bei diesem Thema verwendet. Doch Ihr habt neun Lilien gemalt. Neun! Dadurch kehrt Ihr die Wirkung um, denn ein ganzer Strauß Blumen ist ein Angebot, eine Offerte und keine heilige Handlung mehr. Es scheint, Ihr unterstellt Gott egoistische Motive, als er beschloss, seinen Sohn auf die Erde zu schicken.«
Sie lächelte ihr schönstes Lächeln. »Sind wir nicht alle Egoisten, wenigstens ein kleines bisschen?«
»Der Fürstbischof wird Euch tadeln, wenn er dahinterkommt, welche Ideen Ihr in sein nobelstes Gotteshaus gebracht habt. Womöglich kürzt er Eure Entlohnung oder verweigert sie ganz.«
Ihr gelang der einzige längere Blickkontakt während der Unterhaltung. Seine Augen waren wie schwarze Hüllen. Sie verbargen etwas.
»Glaubt Ihr, er wird dahinterkommen, Bruder Carissimi?«
»Nach allem, was ich über ihn höre, wohl nicht.«
»Werdet Ihr es ihm verraten?«
»Wohl nicht«, wiederholte er.
»Dann sind wir uns einig.« Es klang wie eine Verschwörung, was sie auch beabsichtigt hatte. Sie versuchte, ihn intensiv anzusehen, erreichte jedoch nur, dass er sich abwandte.
»Es ist Zeit«, sagte er knapp. »Ich muss gehen.«
»Wartet«, rief Antonia und unterbrach zum ersten Mal die Stille des Doms. Ihr Wort verteilte sich im ganzen Kirchenraum. Sie berührte Sandro am Arm, um ihn zurückzuhalten.
»Wartet, bitte. Geht nicht meinetwegen. Es tut mir leid. Ich benehme mich manchmal ganz unmöglich. Das liegt wohl daran, dass ich viel allein bin und mit mir selbst rede. Wenn man mit sich selbst redet, ist man freizügiger als unter Menschen.«
»Ich gehe nicht Euretwegen.«
»Nein? Mir war so. Es ist seltsam, ich habe das Gefühl, dass ich Euch kenne, obwohl ich Euch nicht kenne. Wahrscheinlich ist es das, was mich so vertraut reden lässt. Manche Eurer Antworten weiß ich im Voraus.«
»Was ich von Euren Fragen und Bemerkungen nicht behaupten kann …«
»Ihr lächelt ja wieder. Das ist gut, dann habe ich das Gefühl, dass Ihr mir verziehen habt. Aber wieso hört Ihr schon wieder damit auf? Ich finde, dass …«
Aus dem Dunkel eines Seitenportals kam wie ein Habicht ein weiterer Jesuit hervorgeschossen. Er war etwas älter als Sandro Carissimi, Anfang bis Mitte dreißig, hatte wache Augen und feine Gesichtszüge, die allerdings von der langen Hakennase unschön gestört wurden. Obwohl er dürr war und die Kutte um seinen Körper schlotterte, hatte er etwas Robustes, so wie jene Schnitzfiguren, die am unteren Ende abgerundet sind und sich deswegen immer wieder aufrichten, wenn man sie umstößt.
Sein erster Blick fiel auf Antonias Hand, die noch immer Sandros Arm berührte. Nun zog sie sie vorsichtig zurück.
»Hier bist du, Bruder«, sagte er. »Ich habe dich schon gesucht.«
»Bruder Luis«, erwiderte Sandro und verneigte sich leicht. »Ich habe mich beim Aufstehen ganz plötzlich entschlossen, mein Morgengebet hier im Dom zu verrichten.«
Bruder Luis sah Antonia an und dann wieder Sandro, ohne etwas zu sagen.
»Antonia Bender, die du hier siehst, ist die Glasmalerin, die den Dom anlässlich der Konzilseröffnung neu gestaltet hat. Ich habe sie auf den Tod von Bischof Bertani aufmerksam gemacht, wegen des Porträts in der Apsis, und wir haben gerade …«
»Das ist alles überaus interessant«, unterbrach Bruder Luis, »aber der Fürstbischof erwartet uns in einer dringenden Angelegenheit.«
»Der Fürstbischof erwartet mich?« Sandro staunte.
»Das sagte ich«, antwortete Bruder Luis mit der mildesten Stimme, die ihm wohl zur Verfügung stand, die aber immer noch etwas Überlegenes an sich hatte. »Und es duldet keinen Aufschub. Es hat etwas zu tun mit … Wie auch immer, es ist wichtig.«
Antonia entging nicht, wie Sandro sich binnen Augenblicken verwandelt hatte. Eben noch ein intelligenter Beobachter, auf gleicher Augenhöhe mit ihr diskutierend, jetzt eine Art Schüler, der sich willig seinem Meister unterordnete.
Schon verschwand der andere Mönch wieder im Seitenportal, und Sandro folgte ihm. Kurz sah es so aus, als würde er sich noch einmal zu ihr umdrehen, aber das war nicht der Fall.
Werden wir uns wiedersehen, war die Frage, die sie gerne gestellt hätte. Aber ihm durfte sie sie nicht stellen. Nicht jetzt.
2
»Er wurde ermordet«, sagte Luis de Soto.
Sandro, der neben Luis die Anhöhe zum Castello hinaufging, blieb abrupt stehen. Er traute seinen Ohren nicht.
»Was hast du gesagt?«
»Salvatore Bertani. Er starb keines natürlichen Todes, sondern wurde umgebracht. Man fand ihn am Morgen erstochen in seinem Quartier. Ich wollte es dir vorab sagen, denn du hast den leidigen Fehler, im ersten Moment nicht gerade intelligent auszusehen, wenn man dich mit einer Neuigkeit konfrontiert.«
»Das ist ja schrecklich.«
»Mit ein wenig Entschlossenheit bekommst du diesen Fehler in den Griff.«
»Ich meinte nicht den Fehler, sondern den Mord, Luis.« Wenn sie allein waren, sprachen sie sich oftmals nur mit Vornamen an, ein Zeichen ihrer engen Zusammenarbeit.
Warum, dachte Sandro, wollte der Bischof sie wegen dieses Mordes sprechen? Ging es um die Auswirkungen, die dieser Tod auf das Konzil haben würde? Bertani war Reformer gewesen, sogar einer der führenden Köpfe der Reformpartei. Würde man das Konzil verschieben? Alle diese Fragen gingen Sandro durch den Kopf, ohne dass er sie laut aussprach. Er war viel zu sehr daran gewöhnt, Luis keine Fragen zu stellen, als dass er jetzt damit angefangen hätte.
Da es zur Residenz des Fürstbischofs ein steiler Weg war, kamen sie nur langsam voran. Es war ein schöner Spaziergang und ein angenehmer Gegensatz zu den vielen Tagen, die Sandro in Skriptorien zubrachte, umgeben von Staub und mumifizierten Insekten, die er zwischen Buchseiten fand. Heute schien die Sonne für Sandro, heute war die Luft frisch und kühl und der Horizont voll mit Bergspitzen. Wenn er nach links blickte, lag unter ihm das beschauliche Trient mit seinen jahrhundertealten Türmen, den gepflegten Kirchen und dem altehrwürdigen romanischen Dom, dahinter die Obst-, Reben- und Kastanienhaine, und mitten hindurch schlängelte sich in unzähligen Biegungen die Etsch, ein silbriges Band, wie zufällig von Gott dort fallen gelassen. Blickte er nach rechts den Hang hinauf, sah er die Mauern des Kastells und davor eine Wand aus Herbstlaub, teils schimmernd wie Gold, teils rot wie Blut.
»Diese Glasmalerin«, sagte Luis plötzlich und sah Sandro in die Augen, als wolle er darin lesen. »Du bewunderst sie.«
Sandro brauchte Zeit, um zu antworten, Zeit, in der er all seine Konzentration darauf verwendete, seine Augen zu zwei undurchdringlichen schwarzen Perlen werden zu lassen.
»Ihre Kunst ist ansprechend«, antwortete Luis für ihn, als ihm die Wartezeit zu lang wurde. »Aber du misst ihr hoffentlich keine allzu große Bedeutung bei.«
Sandro überlegte. »Warum nicht? Sie macht die Heilige Schrift durch Licht sichtbar. Passender kann eine Geschichte nicht erzählt werden. Nicht einmal die Maler schaffen das, denn sie brauchen Leinwände oder Mauern. Die Leinwand eines Glasmalers ist das Licht Gottes.«
»Schön gesagt«, lobte Luis. »Aber wie üblich legst du zu viel Wert auf Poesie in deiner Analyse. Über allem steht das Wort, vergiss das bitte nicht. Die Sprache ist die höchste aller Künste, denn sie ist die wirkungsvollste, mächtigste, göttlichste Kraft.«
Von einem berühmten Rhetoriker wie Luis war vermutlich nichts anderes zu erwarten.
»Rührt das Wort ›Bildung‹ nicht daher«, fragte Sandro vorsichtig, »dass sich die Menschen ein Bild von etwas machen sollen, wenn sie lernen?«
»Sehen ist das unterste Niveau des Lernens. Ein Säugling sieht die Welt, aber er versteht sie nicht. Erst die Sprache schlägt den göttlichen Funken, der uns die Welt begreifen lässt.«
»Dafür erzeugen Musik und Malerei die größeren Gefühle, und Gefühle sind genauso wichtig wie das Wissen. Die Welt ist aus Liebe, Freundschaft, Mitleid, Trauer und Demut gebaut, nicht aus Worten.«
»Kannst du dir den Sohn Gottes vorstellen, wie er die Bergpredigt mit der Leier in der Hand hält, die Saiten zupfend? Kannst du dir vorstellen, wie er, ans Kreuz genagelt, die sieben letzten Worte singt: Denn sie wissen nicht, was sie tun? Hat er die Wucherer mit Worten oder mit Bildern aus dem Tempel gejagt? Ist er durch das heilige Land gelaufen und hat Zeichnungen verteilt, oder hat er mit den Menschen gesprochen? Worte, Sandro, immer waren es Worte, die die Menschen berührten und ihre Herzen hochfliegen ließen. Siehst du, Sandro, Musik und Malerei sind menschlichen Ursprungs, nur die Sprache kommt von Gott.«
Das war einer jener Momente, in denen Sandro Luis fürchtete. Im Handumdrehen hatte dieser Mann es geschafft, den schönsten Kunstwerken das Siegel der Belanglosigkeit aufzudrücken. Die Skulpturen von Michelangelo Buonarroti, die Malereien Giottos und Raffaels, die Choräle der Komponisten, die Fenster Antonia Benders – sie alle waren binnen weniger Augenblicke zu bloßem Zierrat verkommen, zu einem unliebsamen Geschenk, für das man sich höflich bedankt und es anschließend irgendwohin stellt, wo man es möglichst wenig beachten muss. Dass es Luis gelang, alles in den Staub zu reden, was er sich vorgenommen hatte, dass er Menschen überzeugen konnte, das war eine Fähigkeit, derentwegen der Papst ihn als seinen persönlichen Delegierten zum Konzil geschickt hatte. Und Sandro als sein Assistent unterstützte ihn. Dennoch überkam ihn – bei aller Bewunderung für Luis’ Talent – manchmal ein kalter Hauch, wenn er seinen Reden zuhörte. Denn diese Reden waren eigentlich Fallen.
Da Sandro nichts mehr zu antworten wusste, senkte er ganz leicht den Kopf und gestand damit seine Niederlage ein – nicht die erste in all den Jahren. Dieses Senken des Kopfes und Luis’ anschließendes Berühren von Sandros Schulter – so als begnadige er ihn – waren zu einem Ritual geworden, zu einem Teil ihrer Sprache.
Sie waren am Tor zum Castello, der Residenz, angelangt. Zwei Wachen, die dort postiert waren, machten keine Anstalten, sie zu kontrollieren oder zu befragen. Luis blieb unter dem Rundbogen stehen und sah Sandro erneut in die Augen.
»Von hier an gehst du allein.«
»Allein?«, echote Sandro. Was sollte er allein beim Fürstbischof?
»Siehst du«, sagte Luis, »diesen Ausdruck in deinem Gesicht meinte ich vorhin. Und bitte, Sandro, ich flehe dich inständig an: Stottere nicht, wenn du dem Fürstbischof gegenübertrittst. Nichts wirkt unglaubwürdiger als Stottern.«
»Aber was …«, rief Sandro. »Ich verstehe nicht.«
Doch Luis hatte ihm bereits den Rücken zugewandt.
Sandro lief ihm geradewegs in die Arme. Wie aus dem Nichts gekommen, irgendwo in den Fluren der Residenz, stand dieser Mann vor ihm, und sie sahen sich an wie Geister, wie Menschen aus einem anderen Leben. Ihre letzte Begegnung und die Umstände, wie sie endete, lagen so viele Jahre zurück wie eine Sage. So jedenfalls kam es Sandro vor.
»Ma-Matthias«, flüsterte er.
Matthias sagte nichts, aber auch ihm standen die Überraschung und der Schreck ins Gesicht geschrieben. Er trug einen schwarzen Rock mit schwarzem Umhang und schwarzen Schuhen. Nur die Kniestrümpfe waren weiß, und in der Hand hielt er einen Hut mit Feder, den er noch nicht wieder aufgesetzt hatte. Offensichtlich kam er gerade aus dem Empfangssaal des Fürstbischofs.
Sie schwiegen. Was hätten sie sich sagen sollen? Jeder von beiden wusste, was er getan hatte und besser nicht getan hätte. Sie waren Feinde gewesen vom ersten Augenblick ihres Kennenlernens an, und als Feinde trafen sie sich wieder.
Warum? Was war der Grund, dass sie sich hier in einer Stadt, die nicht die ihre war, wiedersahen?
Keine drei Atemzüge dauerte die Begegnung, dann schob sich Matthias zwischen Sandro und der ihn begleitenden Wache hindurch und verschwand mit festen, entschlossenen Schritten.
Sandro hätte gerne mehr Zeit gehabt, sich wieder zu sammeln, doch die Wache meldete ihn an, und ohne dass er eine Pause gehabt hätte, um alle Gedanken zu sortieren, die ihm durch den Kopf gingen, stand er vor dem Fürstbischof.
Cristoforo Madruzzo war nicht mehr jung, seine Wangen waren zwei Wülste, die sich auf der Höhe des Kinns überlappten, und auf seinen Lippen lag der Ausdruck ständiger Gequältheit – alles mögliche Gründe dafür, weshalb er auf eine Begrüßung verzichtete und Sandro mit zwei Fingern näher an den Sessel heranwinkte, in dem er saß. Ihm war – wie dem Saal, wie der ganzen Residenz – anzumerken, dass er sowohl Fürst von Trient als auch Bischof von Trient war. Das Gebäude war eine Mischung aus Burg, Schloss und Kloster, und bis zu Madruzzos Kleidung spiegelte sich die Unentschiedenheit wider, wer er gerade war, Apostel oder Herrscher. Als Apostel hatten er und seine Vorgänger sich bemüht, die Moral wiederherzustellen, die ab 1450 vom Wind einer neuen, freieren Zeit davongetragen worden war. In Trient waren, wie überall, Stätten der Vergnügung entstanden, Spiel- und Hurenhäuser. Das Volk berauschte sich an Karneval und bacchantischen Festen, und die Reichen gaben verschwenderische Bälle. Dann wurden alle Hurenhäuser der Stadt geschlossen, und die Moral hielt wieder Einzug. Heute war Trient ein beschaulicher Ort voller Bürger, die es weder zu wild trieben, noch zu sittsam waren, sondern die kleine Sünden mit einem Augenzwinkern abtaten. Als Fürst unterstand Madruzzo formal Kaiser Karl, dessen südlichsten Reichszipfel Trient bildete, als Bischof jedoch dem Papst – eine Konstellation, der die Stadt das Konzil verdankte.
Sandro küsste Madruzzos Ring.
»Mein Sohn, du bist mir als wacher Geist empfohlen worden«, sagte er. »Scharfsinnig seist du, wurde mir berichtet.«
Dass Luis ihn derart gelobt hatte, wunderte Sandro ein bisschen, andererseits machte es ihn stolz.
»Zu viel der Ehre, Exzellenz«, erwiderte er höflich.
»Hoffentlich nicht. Denn wir brauchen jemanden, der scharfsinnig ist. Es hat in Trient ein Verbrechen gegeben, nicht irgendein Verbrechen, sondern ein besonders grausames, und es hat nicht irgendjemanden getroffen. Die Ermordung von Salvatore Bertani erschüttert mich zutiefst. Ich bin bestürzt. Ist dieser Tod schon an sich entsetzlich, so könnten die Folgen noch weitaus entsetzlicher sein. Und darum bist du hier, mein Sohn.«
Madruzzo gab Sandro zu verstehen, dass er sich aus dem Sessel zu erheben wünsche. Sandro griff zu. Es erforderte zwei Anläufe und einiges an Kraft, den Fürstbischof auf die Füße zu ziehen. Auf einen Stock mit goldenem Knauf gestützt, wankte er, eine rote Schleppe hinter sich herziehend, in kleinen Schritten zum Fenster.
Draußen begann sich der Himmel zu bewölken, ein geheimnisvolles Leuchten lag über dem Tal, und die Geräusche der Stadt drangen nur leise, wie aus weiter Ferne, hier herauf.
»Mein Sohn, was weißt du über Bischof Bertani?«
»Er war Vorbild für alle, die eine Kirchenreform befürworteten«, antwortete Sandro. »Er wollte es den Protestanten ermöglichen, in den Schoß einer reformierten Kirche zurückzukehren.«
»Nicht nur das. Er hat brieflich mit dem deutschen Kaiser in Verbindung gestanden und ihm Empfehlungen gegeben. Bertani war es, der den Kaiser davon überzeugte, dass ein Konzil einberufen werden müsse, das Reformen beschließt, und er hat den Kaiser gedrängt, dahingehend auf den Papst einzuwirken. Das Ergebnis ist bekannt. Wir sind hier, nicht wahr?«
»Dass Bischof Bertani einen solch großen Anteil am Zustandekommen des Konzils hatte, wusste ich nicht.«
»Es gibt noch mehr, das du nicht weißt, mein Sohn. Der Kaiser hat den Papst nahezu gezwungen, das Konzil einzuberufen, und er verlangt von ihm, die Mehrheitsbeschlüsse des Konzils anzuerkennen, ganz gleich, ob sie ihm gefallen oder nicht. Andernfalls …«
Sandro ahnte, was dieses »andernfalls« bedeutete. Karl V. war der derzeit mächtigste Monarch auf Erden. Er herrschte über das Heilige Römische Reich, Spanien und ganz Süditalien und Sizilien, dazu über die Neue Welt, ein Territorium, in das Frankreich, England, Dänemark, Schweden, Polen und noch einige andere Länder bequem hineinpassten, regierte achtundzwanzig Millionen Menschen sowie die indianische Bevölkerung, besaß die größte Flotte, das größte Goldreservoir, das größte Heer, kurz, von allem das Größte und Meiste. Was es hieß, sich gegen einen solchen Monarchen aufzulehnen, hatten die protestantischen Länder im Schmalkaldischen Krieg zu spüren bekommen wie auch der große Rivale Frankreich, das bereits viele Besitzungen an Karl verloren hatte. Obwohl Karl V. überaus fromm war, kannte er, wenn es um seine Interessen ging, auch dem Heiligen Stuhl gegenüber keine Rücksicht. Als vor zwanzig Jahren Heinrich VIII. von England sich von seiner Ehefrau Katharina trennen wollte, die eine Tante Karls war, drohte Karl, einen Krieg gegen Rom zu führen und Papst Clemens VII. abzusetzen, falls er die Annullierung vornehmen sollte. Heinrich wiederum drohte, sich von Rom zu lösen, wenn der Papst die Ehe nicht annullieren würde. Clemens annullierte nicht, und England war für die Römische Kirche verloren.
»Du verstehst, mein Sohn, weshalb ich dir das erzähle?«
Sandro nickte. »Wenn das Opfer ein besonderer Mensch war, so könnte auch der Täter ein besonderer Mensch sein.«
Über Madruzzos Gesicht huschte der Ausdruck von Sorge und Qual. »Bertani hatte viele Gegner unter den Konservativen. Wenn erneut ein Delegierter dem Mörder zum Opfer fallen sollte, dann reicht das aus, um das Konzil zu erschüttern. Ein historisches Konzil. Die Protestanten entsenden eine Delegation. Zum ersten Mal seit der Spaltung der Kirche besteht die Gelegenheit, die Gegensätze zu versöhnen. Wer weiß, wann eine solche Gelegenheit sich wiederholen wird. Ich möchte das Verbrechen so schnell wie möglich aufgeklärt haben. Von dir, mein Sohn.«
Sandro fand diese Idee absurd – was er dem Bischof so direkt nicht sagen konnte. »Ich habe noch nie ein Verbrechen aufgeklärt, Exzellenz. Das ist nicht mein Metier.«
»Nachforschungen sind dein Metier, mein Sohn. Das Aufspüren von Informationen und Details für deinen Mitbruder de Soto.«
»Ihr verfügt in Trient gewiss über Behörden, die …«
»Du bist im Moment der Einzige, der alle Voraussetzungen erfüllt.«
»Welche Voraussetzungen? Ich bin bloß ein Jesuit.«
»Ja, eben.«
Cristoforo Madruzzo sagte das mit einem speziellen Ausdruck in den Augen, und jetzt verstand Sandro. Er hatte vor wenigen Wochen, kurz vor dem Aufbruch nach Trient, seine »Letzten Gelübde« abgelegt, und damit auch das Gelübde des unbedingten Papstgehorsams. Kein anderer Orden kannte ein solches Gelübde, nur die Jesuiten waren auf diese einmalige Weise mit dem Heiligen Stuhl verbunden. Derzeit gab es nur zwei Jesuiten in Trient, Luis und ihn. Madruzzo dachte klug voraus. Einerseits musste er möglichst rasch eine Untersuchung durchführen lassen und den Täter aufspüren, um Unruhe beim Konzil zu vermeiden, dessen Gastgeber er war. Andererseits beugte er der Möglichkeit vor, dass die Nachforschungen etwas zutage bringen würden, das – in den falschen Händen – ein wahres Erdbeben auslösen könnte.
»Was auch immer deine Nachforschungen ergeben, mein Sohn, du hast den ausdrücklichen Befehl, nur mir oder dem Heiligen Vater Bericht zu erstatten.«
»Vielleicht sollte Bruder Luis die Nachforschungen leiten, und ich würde ihm assistieren.«
»Meine Wahl fiel auf dich.«
»Könnte ich mich denn gegebenenfalls mit Bruder Luis beraten?«
»Ungern, mein Sohn, sehr ungern. Natürlich ist mein Vertrauen in ihn grenzenlos« – er betonte grenzenlos derart, dass es sich wie das Gegenteil anhörte –, »doch Bruder de Soto ist ein Delegierter des Konzils und hat den wichtigen Auftrag, die Stimme des Heiligen Vaters einzubringen. Er benötigt hierfür seine ganze Kraft. Ich kann nicht verantworten, dass er abgelenkt wird.«
Der Fürstbischof runzelte gequält die Stirn, was ihn jedoch zu viel Anstrengung kostete, weshalb er damit schnell wieder aufhörte. Ein Seufzer schlüpfte ihm über die Lippen, und er ließ sich in einen Sessel nahe am Fenster fallen. »Ein Bote ist bereits auf dem Weg. Die Augen von Papst Julius ruhen schon morgen auf deinem Namen, und er vertraut darauf, dass du die versammelte Geistlichkeit vor weiteren Verbrechen beschützt, insbesondere …« Er schloss die Augen. »Morgen wird Kardinal Innocento del Monte in Trient erwartet, auch er ist ein Delegierter des Konzils. Der Kardinal ist … Ich will sagen, er liegt dem Heiligen Vater besonders am Herzen.« Er schlug die Augen wieder auf. »Ich muss dir nicht sagen, welche Möglichkeiten sich für dich auftun – falls du Erfolg hast.«
Dieses »falls« löste sich wie ein Schuss, prallte von der Decke ab, schlug gegen Wand und Boden, flog durch den ganzen Raum und drohte Sandro jederzeit zu treffen.
Madruzzo sagte: »Du wirst zum Visitator berufen.«
»Dieses Amt ist mir unbekannt, Exzellenz.«
»Der Heilige Stuhl hat es erst kürzlich geschaffen, mein Sohn. Eigentlich ist es noch inoffiziell. Visitatoren sollen nach den Vorstellungen des Papstes künftig kontrollieren, ob in den Diözesen alles mit rechten Dingen zugeht oder ob sich Geistliche irgendwelcher Verfehlungen schuldig machen. Einige Visitatoren bekommen allerdings – wie soll ich es formulieren – besonders heikle Aufgaben zugeteilt, Aufgaben, die einen eher weltlichen Charakter haben. Die Untersuchung eines mysteriösen Mordes ist so eine Aufgabe. Du unterstehst ab jetzt direkt dem Heiligen Vater, mein Sohn. Deine Kompetenzen ähneln denen eines Inquisitors: Du hast die Vollmacht, jeden zu befragen.«
Sandro schwindelte ein wenig. Das ging alles ziemlich schnell, zu schnell für ihn. Außerdem hatte er Inquisitoren nie leiden können, und nun war er selbst einer – fast jedenfalls.
»Ich bin verpflichtet, Exzellenz darauf aufmerksam zu machen, dass Jesuiten grundsätzlich keine Ämter außerhalb des Ordens übernehmen.«
»Ich weiß«, sagte Madruzzo mit einer Stimme, die sein ganzes Unverständnis für eine solche Regelung erkennen ließ, die jede Karriere innerhalb der Kirche unmöglich machte. »Ich werde den Heiligen Vater bitten, deinem Ordensgeneral Ignatius von Loyola die besonderen Umstände zu erklären. Ich bin sicher, er wird in diesem Fall eine Ausnahme machen.«
Die Handbewegung des Fürstbischofs unterstrich, dass alles gesagt war.
Sandro verneigte sich und ging zur Tür. Als er sie schon geöffnet hatte, fiel ihm Matthias ein, also schloss er die Tür noch einmal und wandte sich um.
Matthias! Eine plötzliche Wut, die er schon lange nicht mehr gespürt hatte, überkam ihn wie ein Regenschauer. Die Vergangenheit war ein Samen, der auch durch Jahre der Trockenheit nicht totzukriegen war. Nur ein paar Tropfen, eine kurze Begegnung, hatte genügt, den Sandro anderer Tage wiederzubeleben.
»Ja, Bruder Carissimi?«, fragte Madruzzo etwas lahm und müde wie jemand, der sich auf sein Mittagsschläfchen freut. »Was ist denn noch?«
Sandro stellte fest, dass er nicht mehr Sohn oder Sandro, sondern immerhin schon Carissimi war, das erste Zeichen seiner neuen Autorität. Das bestärkte ihn in seinem Vorhaben.
»Exzellenz, mich interessiert, wer heute Morgen bei Euch zur Audienz war und weshalb.«
Diese Frage brachte Madruzzo dazu, seinen Rücken, der an der Lehne des Sessels wie festgeklebt schien, nach vorn zu beugen.
»Das geht doch wohl nur mich etwas an. Diese Frage ist eine Anmaßung, Bruder Carissimi.«
»Gewiss ist sie das, Exzellenz. Und dennoch ein Recht. Sagtet Ihr nicht, ich dürfe jeden befragen?«
Cristoforo Madruzzo verschlug es die Sprache. Er erhob sich und wankte einige Schritte auf Sandro zu.
Sandro wurde plötzlich warm, sogar mehr als warm. Das Blut schoss ihm in den Kopf, und seine Knie schienen aus Butter zu sein. Er hätte das nicht fragen dürfen! Was war nur in ihn gefahren!
»Zuerst Luis de Soto«, antwortete Cristoforo Madruzzo widerwillig. »Ich habe ihm den Tod des Bischofs mitgeteilt und mich nach dir erkundigt. Und schließlich habe ich Matthias Hagen in der Stadt willkommen geheißen. Er ist der Gesandte des Herzogs von Württemberg, ein Protestant. Beim Konzil wird er ein Hauptvertreter – der Hauptvertreter – der lutherischen Seite sein. Ein kluger Kopf, wie es heißt. Er wird es Eurem Lehrer nicht leicht machen, Bruder Carissimi.«
Sandro hätte sich darüber freuen können, dass Matthias der direkte Gegner von Luis, des unschlagbaren Luis, wäre und dass Matthias unterliegen würde und als Geschlagener nordwärts über die Alpen ziehen müsste.
Aber alles, was Sandro fühlte, war ein Gewicht auf seiner Brust.
Sandros Blick streifte durch den Dom, entdeckte aber niemanden, zumindest keinen, den er kannte oder der seine Aufmerksamkeit fesselte. Vier Mönche eines ihm unbekannten Ordens rutschten, halb kniend und halb liegend, auf den Altar zu, so als näherten sie sich einer Beute, und zwei alte Franziskanerinnen verharrten wie zwei miteinander verwachsene Körper nebeneinander, wobei ihr Wispern durch den ganzen Kirchenraum hallte.
Sandro ließ sich auf dem kalten Stein nieder, das Licht der Genesis und der Apokalypse fiel auf seine Schultern, und die Erlebnisse des Vormittags klangen in ihm nach. Er faltete die Hände und schloss die Augen.
Sandros Andacht
Herr! Wieso hat Luis das getan? Und wieso hast Du es zugelassen? Ihr beide, Du und Luis, müsst doch wissen, dass ich mich nicht für eine solche Aufgabe eigne. Wieso hat Luis – wenn er die Untersuchung schon nicht selbst übernimmt – ausgerechnet mich empfohlen? Mit meiner Arbeit als Assistent ist er zufrieden, jedenfalls beanstandet er sie nicht. Aber er muss doch wissen, dass ich nicht mir nichts, dir nichts einen Mord aufklären kann. Der Fürstbischof beschreibt die Aufgabe als große Gelegenheit für mich, doch Du weißt so gut wie ich, dass sie eine noch größere Gefahr darstellt. Was, wenn weitere Morde geschehen, die ich nicht verhindern kann? Oder im Gegenteil: Was, wenn ich erfolgreich bin und etwas herausfinde, das ich lieber nicht hätte herausfinden sollen? Heute Morgen war ich noch ein Mönch, jetzt bin ich ein Beauftragter des Heiligen Vaters, Deines vornehmsten Dieners und Stellvertreters …
Bei diesem Gedanken zuckte er innerlich zusammen. Er war der unmittelbare Beauftragte des Stellvertreters Gottes auf Erden! Das war ihm unerträglich! So viel Verantwortung, so viel Licht war er nicht gewöhnt. Er war ein Assistent, und Assistenten bekamen immer nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit, ein bisschen Licht, das durch einen Spiegel auf sie fällt. Wenn Sandro in den letzten Jahren Verantwortung verspürt hatte, dann war es das Verantwortungsgefühl eines Junkers, dessen Marschall in eine Schlacht zieht. Bei dieser Aufgabe, im Windschatten eines großen Mannes wie Luis, fühlte er sich wohl.
Sein Blick fiel auf die monströsen, prachtvollen Kirchenfenster mit der Apokalypse. Abwechselnd dachte er an den gewaltsamen Tod von Salvatore Bertani, an seine Ernennung zum Visitator, das Zusammentreffen mit Matthias und …
Antonia. Ich sage den Namen immer wieder. Antonia. Sie passt eigentlich nicht in diese Andacht, Herr. Bertani, Matthias, der Papst: Sie alle lösen Angst in mir aus, auf die eine oder andere Weise. Antonias Name löst keine Angst aus. Mit ihr ist es etwas anderes: Als ich ihr heute Morgen begegnete, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl, von dem ich nicht wusste, ob ich es mögen oder bekämpfen soll, ein Gefühl, wie man es nur hat, wenn man auf etwas Unbekanntes trifft.
In diesem Moment ließ sich jemand auf die Kniebank neben Sandro nieder, und als er zur Seite blickte, sah er Luis.
»Wie ist es?«, fragte Luis. »Gehen wir zu Bertanis Quartier und sehen uns dort um?«
3
Antonia hatte bisher noch nie eine Freundin gehabt. Sie liebte Dinge, für die andere Frauen kein Verständnis hatten, und wenn sie doch Verständnis hatten, wollten sie nicht darüber reden. Antonia liebte es, sich an heißen Sommertagen nackt auf einem sauberen weißen Bett zu räkeln, sie liebte alle Attribute des Spätsommers, seine Trägheit, den beißenden Geruch der Apfelpressen und den warmen Regen der letzten Augusttage; sie liebte es, nur leicht oder gar nicht bekleidet an ihren Glasmalereien zu arbeiten; sie liebte die Farbe Rot und arabische Musik, seit sie in Spanien einer Gruppe gelauscht hatte, die im Verborgenen die Tradition ihres Volkes weiterführte.
Und sie liebte Männerbrüste. Überall gab es Soldaten, die sich in Marschpausen an Brunnen kühlten, und Steinmetze, die im Sommer mit freiem Oberkörper arbeiteten, und denen sah sie mit Vorliebe zu, wobei sie darauf achtete, nicht beobachtet zu werden. Männerbrüste, gleichgültig, ob behaart oder glatt, muskulös oder flach, faszinierten sie, und außer der Berührung von Glas war ihr die Berührung einer Männerbrust mit Fingern oder Lippen am liebsten. Davon konnte sie nie genug bekommen.
Carlotta war die Erste, die sie verstand. Natürlich hatte Antonia früher, in Ulm, Mädchen um sich gehabt, und später, in Straßburg, Amiens, Trier und Cuenca, war sie jungen Frauen ihres Alters begegnet, zumeist Töchtern von Malern oder Architekten. Aber sie hatte deren Bekanntschaft stets nur hingenommen und niemals zu Freundschaft werden lassen. Sie mochte es, keine Freunde zu haben, aber jetzt, nachdem sie Carlotta kennengelernt hatte, sprudelten alle jene Gedanken, die sie jahrelang für sich behalten hatte, aus ihr heraus, leicht und ungeniert wie Wasserspiele. Obwohl sie sich erst seit einem Monat kannten, wusste Carlotta bereits mehr von ihr als alle Architektentöchter der Welt. Carlotta war die erste Freundin, die sie hatte, und sie freute sich darauf, ihr von der Begegnung mit dem Jesuiten zu erzählen. Unterhaltungen mit Carlotta waren äußerst erheiternd.
Als sie die Tür zu ihrem Atelier öffnete, schlugen ihr Kälte und der Geruch von Schimmel entgegen. Aus der Welt der Glasmalerei wieder zurückzukommen in die Wirklichkeit des Lebens, das war für Antonia jedes Mal, als würde man von einem Palast geradewegs in den Kerker geworfen. Zwar fielen Sonnenstrahlen in den Raum – Sonnenlicht war der wichtigste Freund eines Glasmalers –, doch sie wärmten hier drinnen kaum. Man hatte Antonia und ihren Vater in einem alten, halb verfallenen und zugigen Palazzo untergebracht – Palazzo Rosato, welch unsinniger Name für ein blassblau gestrichenes Gebäude –, der innen kälter war als die Luft draußen. Ein Atelier, zwei Schlafräume, mehr war ihnen nicht gegeben worden. Nur eine Tür weiter im selben Palazzo wohnten zwei italienische Wäscherinnen, die sich jeden Tag mindestens einmal mit den französischen Küchenhilfen und einem spanischen Barbier von gegenüber stritten. Die Sprachen wirbelten durcheinander wie beim Turmbau zu Babel, wo keiner den anderen verstand. Zweimal täglich kam eine alte, krummbeinige Frau und brachte Antonia und Hieronymus kalte oder lauwarme Speisen vorbei, die sie auf dem Pult für die Entwürfe abstellte, wo sie dann zwischen Stiften, Tintenfässern, Papierrollen und Glassplittern gegessen wurden.
Dieses Quartier zeigte Antonia jeden Tag, welchen Stellenwert Glasmaler in den Augen der Geistlichkeit hatten. Es war eine bittere Ironie, dass allen Künstlern jahrhundertelang weniger Respekt entgegengebracht worden war als Stallknechten, und gerade jetzt, wo eine neue Zeit angebrochen war und Architekten und Maler und Komponisten plötzlich hofiert und umworben und gut entlohnt wurden, gerade jetzt war die Glasmalerei eine sterbende Kunst, dem Untergang geweiht. Die protestantische Hälfte Europas verdammte die Glasmalerei als Abgötterei, und so, wie ein wucherndes Unkraut den Blumen die Wurzeln kappt, so schnitt die Lehre Luthers und vor allem Calvins überall dort, wo der Wind ihren Samen hinwehte, der farbenfrohen Mystik der Glasmalerei die Lebensadern ab. Die Reformation trieb die Glasmaler vor sich her, verjagte sie aus Pommern, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg, Hessen, Württemberg, Schweden, Dänemark, der Schweiz, Böhmen, Mähren, Ungarn, Schottland, aus Teilen Frankreichs … Wie ein vom Feuer eingekreistes Tier wandte man sich mal hierhin und mal dorthin, immer in der Hoffnung, Calvins Brand zu entkommen.
Was die eigene Kirche betraf, die Kirche von Rom, so schmückte sie sich seit einiger Zeit lieber mit gewaltigen Fresken an Decken und Wänden und sparte dafür an den Fenstern. In Italien war die Lage noch schlimmer, denn Italiener hatten kein Gefühl für die Glasmalerei. Gab man ihnen eine Wand oder eine Leinwand, dann schufen sie gewaltige Bildwerke voller lebendiger Figuren. Auf Glas versagten sie kläglich. Sie nahmen es nicht ernst. Sie versuchten, auf Glas zu malen, als hätten sie eine Mauer vor sich, und brachen die alten Traditionen des Handwerks, wonach das Glas bei der Herstellung durch den Zusatz bestimmter Stoffe eingefärbt, danach in Stücke geschnitten und durch den Glasmaler mosaikartig zu einem Bild zusammengesetzt wurde. Farbe, die aufgetragen wurde, setzte man nur für Details und Gesichtszüge ein. Italienische Glasmaler hingegen pinselten Schichten über Schichten Rot, Grün und Blau auf, bis die Leuchtkraft des Glases, die Seele der Glasmalerei, buchstäblich an Farben erstickte. In Italien war man davon begeistert, für die Glasmaler der alten Tradition jedoch ging ein weiteres Land verloren. Die Aufträge wurden überall spärlicher, die Honorare ebenso, und viele Glasmaler gaben auf.
Als Antonia aus dem Nebenraum das Gelächter Carlottas hörte, hellte sich ihre Stimmung wieder auf. Wenn Carlotta lachte, bedeutete das, dass sie guter Dinge war, und wenn sie guter Dinge war, war das ein Jungbrunnen für Antonias alten Vater. Sie nahm sich schweren Herzens vor, die beiden jetzt nicht zu stören, auch wenn sie lieber sofort mit Carlotta gesprochen hätte.