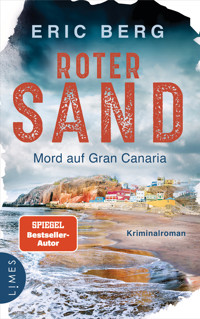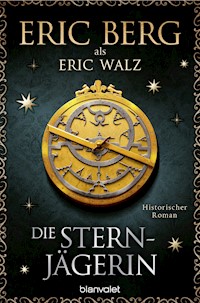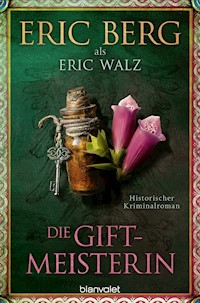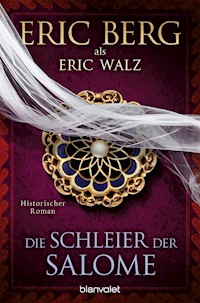2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer einen Traum hat, ist zu allem fähig…
Ohne ersichtlichen Grund und ohne emotionale Regung springt Marlene Adamski vom Balkon ihres Hauses in die Tiefe. Sie überlebt, spricht seither jedoch kein Wort mehr. Psychologin Ina Bartholdy findet keine Erklärung für das Verhalten der 62-jährigen Bäckersfrau, doch der Fall lässt sie nicht los. Sie fährt ins mecklenburgische Prerow, um nach ihrer Patientin zu sehen.
Marlene wird scheinbar liebevoll umsorgt. Doch das Verhalten ihres Ehemanns macht Ina stutzig. Keine Sekunde lässt er sie mit Marlene allein, will offensichtlich verhindern, dass sie mit Ina spricht. Was hat dieser Mann zu verbergen? Und was hat er mit den merkwürdigen Vorfällen zu tun, die sich in Prerow häufen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Ohne ersichtlichen Grund und ohne emotionale Regung springt Marlene Adamski vom Balkon ihres Hauses in die Tiefe. Sie überlebt, spricht seither jedoch kein Wort mehr. Psychologin Ina Bartholdy findet keine Erklärung für das Verhalten der 62-jährigen Bäckersfrau, doch der Fall lässt sie nicht los. Sie fährt ins mecklenburgische Prerow, um nach ihrer Patientin zu sehen. Marlene wird scheinbar liebevoll umsorgt. Doch das Verhalten ihres Ehemanns macht Ina stutzig. Keine Sekunde lässt er sie mit Marlene allein, will offensichtlich verhindern, dass sie mit Ina spricht.
Vierzehn Monate zuvor sitzt eine seltsame Runde in der Küche der Adamskis zusammen und plant etwas Ungeheuerliches …
Autor
Seit Jahren zählt Eric Berg zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. 2013 verwirklichte er einen langgehegten schriftstellerischen Traum und veröffentlichte seinen ersten Kriminalroman Das Nebelhaus, der Leser wie Kritiker gleichermaßen begeisterte. Nach Das Küstengrab ist Die Schattenbucht nun der dritte Roman des Erfolgsautors.
Von Eric Berg bereits erschienen
Das Nebelhaus
Das Küstengrab
Die Schattenbucht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ERIC BERG
Die Schattenbucht
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2016 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Redaktion: Angela Troni
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15888-0V002
www.limes-verlag.de
Für Christian
»Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört, das ich nicht auch hätte begehen können.«
Johann Wolfgang von Goethe
»In God We Trust«
Motto auf US-Dollar-Scheinen
Prolog
Nachdem ich die Auflegtaste des Telefons gedrückt hatte, blieb ich eine Weile reglos mitten im Zimmer stehen. Während der vergangenen halben Stunde war die Ungeheuerlichkeit Wort für Wort in mich hineingetröpfelt, aber erst jetzt, nach dem Ende des Telefonats, entfaltete sie ihre volle Wirkung.
So viele Tote. Nicht auf einen Schlag, sondern einer nach dem anderen über einen längeren Zeitraum, und ich hatte keinen von ihnen gekannt. In einer Welt, die von üblen Nachrichten überquillt, war das eigentlich nur eine Tragödie unter vielen. Obwohl, das war sie nicht. Nicht für mich.
Etwas geradezu Monströses war daran, ich konnte es spüren, jedoch nicht beschreiben. Ein hässliches, unbefriedigendes Gefühl. Was erschütterte mich so sehr an diesem Verbrechen? Allein die Zahl der Opfer? Ich erinnerte mich, vor einiger Zeit über diesen Fall gelesen zu haben, aber irgendwie war mir die Meldung nicht im Gedächtnis geblieben. Und nun war dieses Verbrechen per Telefon in mein Leben eingebrochen, an einem wunderschönen, strahlenden Frühlingsmorgen, an dem ich gerade mit meinem Tagespensum hatte beginnen wollen.
Stattdessen machte ich einen Spaziergang. Nach diesem Anruf konnte ich unmöglich zur Tagesordnung übergehen, ich hatte über zu viele Dinge nachzudenken, die mich am Schreiben gehindert hätten. Das Meer und der Himmel leuchteten in etlichen Schattierungen von Blau, und ein paar Wassersportbegeisterte schwebten mitten durch dieses harmonische Farbenspiel hindurch. Auf der Strandpromenade spielte jemand Ziehharmonika, ich erkannte Lieder von Edith Piaf und Adriano Celentano. Sorglose Urlauber flanierten an mir und dem Musiker vorüber.
Mit einem Mal wusste ich, was mich an diesem Verbrechen zutiefst erschreckte – und dass ich gerade deswegen darüber schreiben würde, schreiben müsste.
Jeder Mord, von dem wir erfahren, ist für sich beängstigend genug. Aber wir meinen, ein Bild von den jeweiligen Verbrechern zu haben – von den Räubern, die Rentner in ihrem Gartenhäuschen erschlagen, den Sexualverbrechern, die Frauen und Kindern auflauern, den reizbaren jungen Männern, die uns auf Bahnhöfen überfallen. Es ist der massive Einbruch der Gewalt in unseren Alltag und unsere Ordnung, den wir so sehr fürchten.
Was, wenn der Tod sich in harmloser Verkleidung bereits in unser Haus geschlichen hat? Wenn er gleich um die Ecke wohnt und Teil unseres Alltags ist? Wenn wir ihm von Zeit zu Zeit die Hand schütteln? Ihn vielleicht sogar sympathisch finden?
Das Monströse an jenem Verbrechen, von dem ich kurz zuvor erfahren hatte, war das Normale, die absolute Durchschnittlichkeit der Beteiligten. Außerdem die Langsamkeit – um nicht zu sagen Gemächlichkeit –, mit der es seine Kreise gezogen hatte. Das Verbrechen hatte sich ganz allmählich zu einem Strudel entwickelt, der alles verschlang, was auch nur in seine Nähe kam, der Tote produzierte, Leben ruinierte und den man erst bemerkt, wenn es zu spät, der Sog schon zu stark ist.
Der Darß – eigentlich die Region Fischland-Darß-Zingst, im Volksmund schlicht Darß genannt. Ich hatte nur gute Erinnerungen an die Halbinsel, auf der ich zehn Jahre zuvor das letzte Mal gewesen war, und ich fand alles ganz genauso vor wie damals. Unterwegs stieg ich immer mal wieder aus, um einigen Surfern zuzuschauen, ein paar Reitern am Strand hinterherzublicken und einen einsamen Bernsteinsucher zu beobachten, der gerade ein Loch in den Sand grub. Das Meer war aufgewühlt, und am Horizont zogen Wolken und Regenvorhänge von Süd nach Nord, während am Bodden, der bei Ahrenshoop nur wenige Steinwürfe entfernt war, ein mildes pfirsichfarbenes Prismalicht über dem stillen Wasser lag. Die unterschiedliche Stimmung dieser eng beieinanderliegenden Landschaften von Bodden und Meer zog mich sofort in ihren Bann. Das Liebliche hier – sanft dahingleitende Zeesenboote, alte Bootshäuser, wogendes Schilf, geatmete Stille. Das Raue dort – vom Wind geformte Kiefern, von Gischtfontänen umtoste Seebrücken, schroffe Steilküsten.
Es mag naiv klingen, aber an einem solchen Ort erwartete man kein Kapitalverbrechen, vor allem nicht von Einheimischen. Die Leute hier waren bodenständig, gelassen und auf diskrete Art selbstbewusst. Autodiebstähle oder Einbrüche – gut, die mochte es geben, ebenso betrunkene Touristen, die in die Vorgärten urinierten oder die Malven zum Einknicken brachten. Ich betrachtete die Bewohner dieser Region eher als Heimgesuchte. Auf die ersten Touristen, die ein wenig Wohlstand brachten, folgten Wohlhabende aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich hier Häuser kauften, die wiederum Diebe anlockten. Ob nun die Vorteile oder die Nachteile des Tourismus und des Zuzugs von Fremden überwogen, war ein weites Feld und ewiger Diskussionsgegenstand in der Kneipe, auf Festen und den Bürgersteigen. In einer Zeit, die arm an Skandalen war – weil heutzutage nun mal weit weniger als skandalös angesehen wird als noch vor dreißig Jahren –, gab es wenig, an dem die Leute sich in den Dörfern reiben konnten.
Alles ging seinen gewohnten Gang: erst der Vogelzug von Süd nach Nord, das Erblühen der Gärten, die Ankunft der Seeschwalben, die ihre Nester in die Steilküsten bohrten, das Auftauchen von Segeln über dem Wasser, zuerst wenige, mit der Zeit immer mehr, das zunehmende Kindergelächter am Strand, die gut besuchten Restaurants, Fahrrad fahrende Familien, dann ein allmählich blasser werdendes Licht, der Vogelzug von Nord nach Süd, Sand ohne Menschen, Brandung ohne Zuhörer, Wind ohne Wärme … Die Gezeiten eines Jahres.
Theoretisch war mir als Mensch und Schriftsteller natürlich klar, dass es auch in einer solch beruhigenden Umgebung Unglück geben konnte. Doch es war viel schwerer greifbar als in den Wohnsilos und U-Bahn-Stationen der Großstädte.
Ich schlenderte umher und überlegte, was es bedeutete und wie ungewöhnlich es war, wenn jemand, von dem man es nie erwartet hätte, sich umzubringen versuchte.
So fing alles an – scheinbar. Tatsächlich hatte es nämlich schon viel früher begonnen.
1
September
Dieser Fall war nicht wie die anderen – eine gesunde Frau sitzt bei Kaffee und Kuchen auf dem Balkon ihres Hauses und blickt auf das im Nachmittagslicht sanft schimmernde Wasser des Bodstedter Boddens. Plötzlich und ohne erkennbare innere Regung steht sie auf, klettert über das Geländer und stürzt sich in die Tiefe. Sie überlebt den Sprung, spricht seither jedoch kein Wort mehr.
Ina war so etwas nicht gewohnt. Hinter jedem Suizidversuch steckte eine Geschichte, die es für sie hervorzuholen galt. Manche ihrer Patienten mussten nur angepikst werden, und schon sprudelten die Tragödien ihres Lebens in schnellen Sätzen aus ihnen heraus, gespickt mit Vorwürfen an Ehepartner, Eltern, Freunde und das Leben. Andere gaben ihre Erlebnisse nur in Häppchen preis, zögerlich, jedes Wort abwägend, als sei es das alles entscheidende, unterbrochen von langen Pausen und stillen Tränen. Wieder andere betrachteten die Klinikpsychologin gar als Gegnerin, antworteten feindselig und sarkastisch oder schickten Ina weg, um sie bald darauf doch wieder herbeizuzitieren und zu beschimpfen. Über kurz oder lang und mehr oder weniger redeten sie alle auf irgendeine Weise über die kleinen und großen Katastrophen, deretwegen sie in der Klinik gelandet waren, an diesem Ort, an dem wie nirgendwo sonst der Hunger nach Leben und Lebensmüdigkeit aufeinandertrafen.
Marlene Adamski hingegen war verstummt, so wie manche Kinder, die ein schreckliches Trauma erlitten hatten. Doch diese Patientin war zweiundsechzig Jahre alt, und auf ein größeres Problem, geschweige denn ein Trauma gab es nicht den geringsten Hinweis.
In den Akten suchte Ina vergeblich nach Gründen für die Schatten, die sie unter Marlenes Augen entdeckte. Zusammen mit ihrem Ehemann führte die Frau eine gut gehende Bäckerei auf der Halbinsel Darß, nannte ein schuldenfreies Haus ihr Eigen, war physisch in bester Verfassung und hatte keinerlei Vorgeschichte, was psychische Erkrankungen anging. Letzteres allein war natürlich wenig aussagekräftig, schließlich erwuchsen Depressionen und Selbstmordgedanken selten ausschließlich aus handfesten, für jedermann erkennbaren Problemen. Ihr Dünger waren vielmehr Faktoren wie Einsamkeit, das Einerlei der Tage, Erfolgsdruck und die Unfähigkeit, aus einem als Teufelskreis wahrgenommenen Zustand auszubrechen.
Doch auch hierfür konnte Ina keinerlei Anhaltspunkte entdecken. Ihre Patientin sammelte Geld für syrische Flüchtlinge und sang im Gemeindechor. Nun gut, die Adamskis waren kinderlos. Doch während Marlenes zweiwöchentlichen Aufenthalts in der Psychiatrie am Stadtrand von Rostock hatte sie auffallend viel Besuch bekommen. Die vielen Freundinnen und Cousinen, mit denen Ina gesprochen hatte, erzählten ihr übereinstimmend, dass kaum ein Gemeindemitglied sozial engagierter und besser integriert war als Marlene Adamski. In der Bäckerei war sie die gute Seele, die Kunden kannte sie mit Namen und begrüßte sie mit einem Lächeln und per Handschlag.
Blieb die Ehe der Adamskis, über die Ina bisher nur wenig wusste. Marlenes Mann Gerd kümmerte sich rührend um seine Frau. Wenngleich er ein Mensch zu sein schien, der die Schuld zuletzt bei sich selbst suchte, kam Ina die Fürsorge, die er seiner Frau entgegenbrachte, echt vor. Kurzum, es gab einfach keinen Anhaltspunkt, was die Ursache für den Suizidversuch sein könnte, und die Psychologin stand vor einem Rätsel. Dass Marlene nicht mit ihr sprach, machte es unmöglich, das Motiv zu ergründen. Ina hätte die Sache auf sich beruhen lassen können, denn Marlene Adamskis Entlassung stand bevor, und sie würde demnächst neue Patienten betreuen: Opfer von Gewalttaten, Unfällen oder Mobbing, von Stress und Übermüdung zermürbte Menschen, Drogenabhängige, Patienten mit Gehirntumoren und schwachen Herzen, die sie zu begleiten hatte. Doch die schweigende Frau mit den Schatten unter den Augen wollte ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Hatte sie nicht auch deswegen ein halbes Jahr zuvor von Schwerin an die Klinik in Rostock gewechselt, weil sie an ihrem neuen Arbeitsplatz mehr Zeit für die Patienten hatte? Früher musste Ina sich bei den nach einem Selbstmordversuch eingelieferten Patienten mit Aussagen wie »Ich tu’s ganz bestimmt nicht wieder« zufriedengeben und nach ein paar Minuten zum nächsten Termin eilen. Im Jahr darauf sah sie die Menschen dann wieder. Schlimmer noch waren jene, die sie nicht wiedersah, weil sie beim zweiten Mal mehr »Erfolg« gehabt hatten als beim ersten. Ihre Zahl kannte Ina nicht, aber das machte es nicht einfacher. In der Rostocker Klinik hatte sie immerhin das gute Gefühl, alles für ihre Patienten tun zu können, was in ihrer Macht stand, zumal sie nur an zwei Tagen pro Woche als Angestellte arbeitete und an den anderen drei Tagen eine eigene Praxis in Ahrenshoop betrieb. Auf diese Weise konnte sie ihre Patienten länger betreuen, als es normalerweise möglich gewesen wäre. Nur bei Marlene Adamski biss sie in der Hinsicht auf Granit.
Das Schweigen der Bäckersfrau hielt Ina teilweise für bewusst gesteuert und weniger für die Folge eines Schocks, weshalb sie davon ausging, es mit etwas mehr Zeit brechen zu können. Denn trotz ihrer verbalen Zurückhaltung nahm Marlene ihre Umwelt durchaus wahr. Sie reagierte auf Bewegungen und Geräusche ebenso wie auf Menschen, die das Krankenzimmer betraten. Sie verzog den Mund, wenn ihr das Essen nicht schmeckte, und sie erwiderte Umarmungen. Lächeln sah Ina sie allerdings nie, außer ein Mal, als sie ihrer Patientin, um deren Vertrauen zu gewinnen, von ihrer Liebe für die Ostsee im Allgemeinen und den Darß im Besonderen erzählt hatte. Damals blickte Marlene geradezu selig drein, so als hätte Ina sie an einen untergegangenen Ort des Glücks erinnert. Die Psychologin spürte, sie und ihre Patientin könnten emotional zusammenfinden.
Gerd Adamski jedoch legte darauf keinen Wert.
»Das schaffen wir auch so«, sagte er, als er seiner Frau nach ihrer Entlassung in den geräumigen Audi half. Ina war mit den beiden zum Parkplatz gegangen, trotz des leichten Regens. Die äußeren Verletzungen Marlene Adamskis waren zwar fast vollständig verheilt, aber sie wirkte noch nicht ganz sicher auf den Beinen.
Er schloss die Beifahrertür und sprach, während er um das Auto herumging, mit leiser, tiefer Stimme. »Marlene hat zu viel gearbeitet, sich zu viel zugemutet. Die Bäckerei, das Ehrenamt, der Chor, der Haushalt … Sie hatte ja gar keine Zeit mehr für sich.«
»Mag sein«, erwiderte Ina. »Aber Menschen springen im Allgemeinen nicht wegen eines zu vollen Terminkalenders vom Balkon, Herr Adamski. Das ist allenfalls der Auslöser, niemals die Ursache. Ich empfehle Ihrer Frau dringend weiterhin eine professionelle psychologische Begleitung. Meine Praxis in Ahrenshoop ist die einzige auf dem Darß, aber falls Sie wen anders bevorzugen, habe ich Ihnen einige Adressen von Kollegen in Rostock aufgeschrieben.«
Er reichte ihr die Hand. Sie war klobig, behaart und von fünfundvierzig Jahren fast täglichem Teigkneten sehr kräftig, doch der feste Druck war nicht unangenehm.
»Danke, dass Sie sich um Marlene gekümmert haben, Frau Doktor. Ehrlich, ich bin sehr froh darüber. Aber das wird schon wieder. Ein bisschen Pflege und Aufmerksamkeit …«
»Mit ein bisschen Pflege werden verkümmerte Pflanzen vielleicht wieder«, sagte Ina, wobei die ungeduldige Erwiderung von ihrer sanften, geduldigen Stimme abgemildert wurde. »Natürlich sind Ihre Fürsorge und Aufmerksamkeit äußerst wichtig und hilfreich. Dennoch kann ich nicht genug betonen, dass der Heilungsprozess bei Ihrer Frau gerade erst begonnen hat. Dass sie nicht spricht, ist der auffälligste Hinweis, wenngleich nicht der einzige.«
»Auch das bekommen wir hin«, sagte Gerd Adamski mit einer solchen Sicherheit, als müsse er zu Hause nur ein Rezeptbuch aufschlagen. Bevor Ina ihn weiter bedrängen konnte, fügte er hinzu: »Sehen Sie, Frau Doktor, Sie sind Psychologin und wollen sicher nur das Beste für Marlene. Sie erzählen mir was von Ursachen und psychologischer Begleitung und so ’nem Zeugs. Aber wir kommen schon zurecht, wir sind einfache, hart arbeitende Leute. Bäcker, verstehen Sie?«
So, wie er es ausdrückte, hörte es sich an, als würde jeder Bäcker einmal im Leben einen Selbstmordversuch unternehmen, und danach sei die Bedrohung ausgeschwitzt und überstanden wie bei Mumps. Natürlich kannte Ina diese ablehnende Haltung gegenüber Psychologen, zum einen von den Erfolgsverwöhnten, die meinten, sich und ihr Leben auch ohne fremde Hilfe jederzeit im Griff zu haben, und zum anderen von denjenigen, für die psychologische Betreuung etwas für Weicheier war. Der Übergang war fließend, und Gerd Adamski gehörte eindeutig zur zweiten Kategorie.
Ina musste Marlene also ziehen lassen, und wenngleich sie nach wie vor an die Frau dachte, war sie bald schon von den neuen Patienten absorbiert.
Dann jedoch geschah etwas Merkwürdiges. Ina erhielt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf ihrem rein beruflich genutzten Handy mehrere Anrufe, bei denen sich am anderen Ende niemand meldete, sobald sie abnahm. Ein Keuchen oder dergleichen war jedoch nicht zu hören. Nach einigen Sekunden legte der Anrufer jedes Mal wieder auf.
Irgendwann fragte Ina aus einer Ahnung heraus: »Frau Adamski? Marlene?«
Und siehe da, diesmal blieb der Anrufer länger am Apparat.
Die Psychologin beschloss, Marlene aufzusuchen und sie zu überreden, Patientin ihrer Praxis zu werden. Sie rechnete mit einem kleinen Abenteuer, einem leicht ungewöhnlichen Außeneinsatz mit nutzbringenden Erkenntnissen.
Wider Erwarten wurde etwas ganz anderes daraus: ein Schicksalstag in ihrem Leben.
Zum Haus der Adamskis musste Ina sich umständlich durchfragen, obwohl sie selbst inzwischen seit gut einem Jahr auf dem Darß lebte. Eher zufällig und nicht dank einer Beschreibung oder des Navigationssystems kam sie endlich am Ziel an, ganz in der Nähe des Örtchens Wieck.
Die herrliche Aussicht entschädigte sie für ihre Mühen. Am Ende einer schmalen, von Strauchwerk begrenzten Asphaltstraße ging der Blick zur einen Seite über unberührte Wiesen unter dem riesigen Himmel. Ein paar verstreute, meist krüppelige Bäume, schier unendlich viele windschiefe Grashalme und die fahle Sonne hinter zerfledderten Schleierwolken – das war alles, und es war überwältigend schön. Eine frische Brise schlug ihr entgegen, und sie war versucht, mitten hineinzulaufen in die menschenleere Landschaft. Auf der anderen Seite führte ein kleiner Weg zum Bodden, der ungefähr dreißig Meter entfernt war. Dünne Nebelschwaden stiegen von ihm auf, schwebten behäbig darüber hinweg. Die Luft schmeckte salzig und roch nach frischer Erde.
Das Haus der Adamskis war ein echtes Schmuckstück, eine zartblau gestrichene einstöckige Bauernkate mit einer Reetdachhaube, umgeben von einer Natursteinmauer. Verstärkt wurde der malerische Eindruck von den zahlreichen Rosenbüschen im Vorgarten. Eine sechsköpfige Familie hätte in dem Haus bequem Platz gehabt, doch soweit Ina wusste, lebten Marlene und Gerd Adamski allein. Wie sie später erfahren sollte, hatte das Ehepaar die Kate im Jahr 1991 in leicht heruntergekommenem Zustand gekauft, nach und nach renoviert und dabei das eine oder andere hinzugefügt, das eigentlich nicht zu einer Kate gehörte, beispielsweise den Balkon.
Marlene war damals in Inas Alter gewesen, Ende dreißig, und hatte deshalb vermutlich kaum mehr Hoffnungen auf eine Großfamilie gehabt. Vielleicht war die Größe des Hauses aber auch nicht ausschlaggebend für den Kauf gewesen, sondern allein die Lage oder schlicht der Preis.
Auf Inas wiederholtes Klingeln hin geschah überhaupt nichts. Sie war ein wenig enttäuscht, nun da sie es bis hierher geschafft hatte und einer Begegnung mit Marlene so nahe war. Allerdings konnte es sein, dass diese ihre Arbeit in der Bäckerei wieder aufgenommen hatte, und das wäre immerhin ein gutes Zeichen.
Doch dann entdeckte Ina die Frau just auf dem Balkon an der linken Hausfront, von dem sie einige Wochen zuvor gesprungen war.
»Marlene? Ich bin es, Ina Bartholdy.«
»Was wollen Sie?«
Das waren die ersten Worte, die Ina von ihr hörte. Ihre Stimme klang leicht dumpf und rau, was nicht zu ihrem Erscheinungsbild passte. Marlene hatte eine gemütliche, warme mütterliche Ausstrahlung. Man sah ihr irgendwie an, dass sie Bäckersfrau war, zumindest fand Ina, dass Bäckersfrauen so aussehen sollten.
»Ich weiß, ich habe meinen Besuch nicht angekündigt«, antwortete sie ausweichend. »Aber ich war zufällig in der Gegend und dachte, ich schaue mal vorbei.«
Das war noch nicht einmal gelogen, jedenfalls nicht ganz. Ina hatte tatsächlich noch etwas anderes auf dem Darß vor, gar nicht weit von Wieck entfernt.
Sie wollte gerade erneut um Einlass bitten, als Marlene aufstand und im Haus verschwand.
Das war es wohl, dachte Ina, doch dann ging der Türsummer an, und sie gelangte ins Haus.
Drinnen war es ziemlich kühl und vor allem unglaublich still. Alle Fenster waren geschlossen. Kein Vogelgezwitscher drang durch die Mauern, keine Uhr tickte. Eine gewundene Holztreppe führte nach oben.
»Marlene?«
Ina warf einen kurzen Blick ins Wohnzimmer und in die Küche, bevor sie begriff, dass die Bäckersfrau im Obergeschoss auf sie wartete.
Die Schlafzimmertür stand weit offen. Marlene saß mit dem Rücken zu ihr auf dem Balkon. Erneut standen Kaffee und Kuchen auf dem kleinen runden Tisch, erneut ging Marlenes Blick über die Bäume hinweg zum Bodden, wo die Segelboote geräuschlos auf dem funkelnden Wasser dahinglitten. Sie trug eine getönte Brille, die Septembersonne schien ihr ins Gesicht.
Ina nahm sich die Zeit, das Schlafzimmer mit einem Rundumblick zu inspizieren. Es war so althergebracht eingerichtet wie alles, was sie bisher vom Haus gesehen hatte. Nicht dass es schäbig gewesen wäre. Die Möbel waren gepflegt, wenngleich sie schon eine ganze Weile nicht mehr erneuert worden waren. Von der Spiegelkommode über den Bettvorleger bis zum – derzeit unbenutzten – Anzugständer für den Hausherrn war alles vorhanden. Beige und Braun waren die vorherrschenden Farbtöne, Eiche das favorisierte Holz. Ina suchte nach irgendetwas Außergewöhnlichem. Nach einer extravaganten Lampe, einer asiatischen Spieluhr, der eingerahmten Krakelei eines Kindes. Doch sie bemerkte nichts dergleichen, so wie sie auch in der Diele, im Wohnzimmer und im Treppenaufgang nichts gesehen hatte. Die Wände waren fast kahl, nur hier und da hing ein Druck mit Blumen- oder Landschaftsmotiven. Wenn Ina bedachte, wie schön das Haus von außen war, enttäuschte einen das Innere durch einfallslose Rustikalität.
Sie trat auf den Balkon und umfasste mit beiden Händen das Geländer. Vom ersten Stock in den Tod springen – ging das überhaupt? Hatte Marlene mit ihrem Ableben etwa nur kokettiert? Gehörte sie am Ende zu jenen Verzweifelten, die vier Personen auf den Anrufbeantworter sprechen, bevor sie eine zwar kritische, jedoch nicht unbedingt tödliche Dosis Schlaftabletten nehmen und unbewusst darauf hoffen, man werde sie rechtzeitig finden? Aus ihrer Akte hätte man das durchaus schlussfolgern können. An Ort und Stelle sah die Sache allerdings anders aus. Man konnte von hier oben sehr wohl in den Tod springen, obwohl es nur der erste Stock war. Die Räume waren ungewöhnlich hoch, das Grundstück fiel auf dieser Seite stark ab, und unten erstreckte sich eine Mauer. Aus sieben Metern Höhe auf nackten Stein fallen – das hätte anders ausgehen können als mit einer ausgerenkten Schulter, einer Gehirnerschütterung sowie einigen Verstauchungen und Prellungen. Trotzdem blieb die Frage: War Marlenes Selbstmordversuch ein Hilfeschrei gewesen oder der letzte Ausweg für sie?
»Manchmal«, begann Ina leise und ohne ein Hallo vorneweg, »ist es nur eine Minute, in der wir nicht mehr weiterwissen, nicht mehr weiterwollen. Manchmal ergibt sich gerade dann eine Gelegenheit. Es ist nur ein kleiner Schlenker, der unser Auto vor einen entgegenkommenden Laster bringt. Es ist nur ein kleiner Sprung vor den einfahrenden Regionalzug. Das war gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich zur Arbeit oder eine Besorgung machen. Und dann …«
Sie hielt inne, spähte zu Marlene hinüber und konnte durch die Sonnenbrille der Frau erkennen, dass deren Pupillen auf sie gerichtet waren.
»War es so?«, fragte sie.
War Marlene eines Tages aufgewacht und hatte wie aus dem Nichts beschlossen, dass ihr Leben keinen Sinn mehr hatte? Dass ein Mann, ein Haus, ein paar Bekannte im Dorf und eine Bäckerei einfach nicht genug waren? War sie das Opfer einer spontanen Laune geworden, einer Hormonschwankung gar, nichts weiter?
Ein Lichtreflex tanzte auf Marlenes Gesicht, der vom Gartenteich nebenan stammte. Er zuckte über ihre helle, hohe Stirn, über die aufgesteckten strohblonden, leicht angegrauten Haare, die fahlen Wangen, den von Falten umrahmten Mund und das weiche, rundliche Kinn. Ina ersehnte geradezu ein Wort von ihr, an das sie anknüpfen konnte. Wenigstens ein Nicken oder Kopfschütteln, ein Zucken der Lippen. Doch nichts. Der ruhelose Lichtpunkt war alles, was sich in Marlenes Gesicht bewegte.
Ina musste das Schweigen brechen. Nur wie? Dass die Bäckersfrau sie hereingelassen hatte, hatte sicher etwas zu bedeuten.
»Ich habe in den letzten Tagen einige Anrufe erhalten, bei denen sich dann aber niemand am anderen Ende der Leitung gemeldet hat. Ich vermute, dass Sie das waren. Liege ich damit richtig?«
Marlene öffnete ganz leicht den Mund, wobei sich ihre Lippen kaum bewegten. In dem winzigen dunklen Spalt schien sich ein Wort zu formen, zusammengesetzt aus den Bruchstücken ihres ambivalenten Willens und von selbigem sofort wieder zerstört.
Kein Laut.
Ina wartete noch eine Weile, in der nur der Wind und das muntere Zwitschern der Nestflüchter zu hören waren.
»Warum fällt es Ihnen so schwer, mit mir zu sprechen?«
Wieder öffnete Marlene den Mund, wieder bereitete sie einen Anlauf vor. Die Grenze des Schweigens hin zur Sprache war für sie wie ein schwindelerregender Abgrund, der sie zögern ließ, auch wenn er mit einem einzigen Schritt zu überwinden war. Vielleicht war das, was auf der anderen Seite auf sie wartete, so wenig erstrebenswert, so furchteinflößend sogar, dass sie allen Mut zusammennehmen musste. Obwohl Ina ihre Patientin im Grunde nicht kannte, glaubte sie, dass Marlene diesen Mut in sich trug. Etwas davon lag in ihren Augen, die nie ängstlich in die Welt blickten, auch nicht, als sie sich in der Klinik zum ersten Mal wieder geöffnet hatten, oder später, als Ina ihr die vielen Fragen gestellt hatte.
Auch in Marlenes Biografie steckte jede Menge Courage. Die Cousinen der Bäckersfrau hatten Ina im Krankenhaus erzählt, dass Marlene mit neunzehn Jahren in Dresden eine Affäre mit einem sowjetischen Soldaten begonnen hatte. Damals nannte man das noch Affäre, und in der DDR galt ein sowjetischer Gefreiter nicht unbedingt als gute Partie, vor allem nicht, wenn man kurz vor einem Lehramtsstudium stand. Da Marlene sich ganz offen mit dem jungen Mann zeigte, beschimpften die Leute sie. Manche rissen sogar die Fenster auf, nannten sie eine Hure und knallten die Fenster mit Nachdruck wieder zu. Eines Tages war der Mann, für den sie ihren Ruf hergegeben und ihr Studium riskiert hatte, über alle Berge. Marlene hörte nie wieder von ihm. Ein Jahr später verliebte sie sich erneut. Auch dieser Mann war ihren bürgerlichen Eltern nicht gerade willkommen. Gegen die Widerstände ihrer Familie und des Bildungsministeriums brach Marlene ihr Studium ab und wurde die Frau des pommerschen Bäckers Gerd Adamski.
»Sie wissen doch, dass alles, was sie mir anvertrauen, unter uns bleibt«, versuchte Ina, die Frau zu ermuntern.
Diesmal öffneten sich Marlenes Lippen ein Stückchen weiter. Vielleicht hätte sie zu reden begonnen, wäre nicht just in diesem Moment die zufallende Haustür zu hören gewesen und gleich danach die Stimme ihres Mannes, der nach ihr rief. Sofort verschloss Marlene sich wieder, und nur wenige Sekunden später stand Gerd Adamski im Schlafzimmer. Sein Blick gab Ina unmissverständlich zu verstehen, was er von ihrem Besuch hielt. Boxer starren so kurz vor Beginn des Kampfes zur anderen Ringseite hinüber. Die Stimme des Bäckers klang allerdings gelassen.
»Frau Doktor, guten Tag. Was für eine Überraschung. Wer hat Sie denn geschickt?«
»Guten Tag, Herr Adamski. Im Rahmen einer Nachsorge wollte ich mich vergewissern, dass mit Ihrer Frau alles in Ordnung ist.«
»Tja, wie Sie sehen, ist alles in Ordnung.«
»Nun ja … Dürfte ich Sie bitte mal kurz sprechen, Herr Adamski? Wenn möglich nicht hier.«
»Ich wollte gerade dasselbe vorschlagen. Bitte hier entlang.«
Seine Verärgerung verbarg er hinter übertriebener Freundlichkeit. An der Tür ließ er Ina den Vortritt, wobei er ihr mit ausgestrecktem Arm den Weg wies – zur Treppe nach unten. Bevor sie hinabstieg, bemerkte sie eine offen stehende Tür, die ihr zuvor entgangen war. War etwa noch jemand im Haus? Die Möbel in dem Zimmer waren nagelneu und sehr schick, allerdings türmten sich darauf Teller, Chipstüten und allerlei Elektronik.
»Bitte sehr, Frau Doktor«, drängte Gerd Adamski sie, und sein mächtiger Kugelbauch kam ihr dabei so nah, dass sie beinahe auf der Treppe gestolpert wäre.
Im Wohnzimmer, das aufgeräumt, aber ein bisschen staubig war, stellte der Bäcker Ina zur Rede.
»Was Ihr unangemeldetes Kommen angeht … Ach bitte, nehmen Sie doch Platz. Also, da muss ich Ihnen sagen, dass mir das nicht gefällt.«
»Hätten Sie mich denn mit Ihrer Frau sprechen lassen, wenn ich meinen Besuch angekündigt hätte?«
»Nein. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, und ich habe meine Gründe dafür.«
»Würden Sie sie mir erläutern?«
»Das muss ich nicht.«
»Bitte, ich möchte es verstehen.«
»Ich habe alles dazu gesagt.«
»Herr Adamski, ich gehe davon aus, dass Sie das Beste für Ihre Frau wollen. In dem Fall verstehe ich jedoch nicht, wie Sie ernsthaft etwas gegen meine Visite haben können. Das kann Ihrer Frau nicht schaden.«
»Da bin ich anderer Meinung. Wir haben ganz tolle Fortschritte gemacht, auch ohne Sie.«
»Worin bestehen diese Fortschritte?«, fragte Ina und bemühte sich sehr um einen ruhigen, sachlichen Tonfall.
»Wir haben miteinander geredet. Marlene hat mir versprochen, dass sie das nie wieder tun wird.«
»Oh«, sagte Ina.
Nur zu gerne hätte sie ihr Gegenüber darauf hingewiesen, dass das Ehrenwort eines Patienten in diesem Fall so viel wert war wie das eines mehrmals vorbestraften Einbrechers vor dem Richter. Mit Polemik und feinsinnigen Bemerkungen hätte sie diesen Mann jedoch nur noch mehr gegen sich aufgebracht.
»Herr Adamski, ich arbeite nun schon sehr lange in meinem Beruf und habe im Laufe der Jahre Erfahrungen gemacht und Einblicke gewonnen, die nicht jedem offenstehen.«
»Und ich kenne meine Frau besser als jeder andere.«
»Zweifellos. Bedenken Sie aber bitte, dass Ihre Frau schon einmal etwas getan hat, das Sie nicht vorhergesehen haben. Das Sie nicht vorhersehen konnten. Was Ihre Frau belastet, steckt so tief, dass niemand es mit einem kurzen Blick erfassen oder mit ein paar Worten hervorholen und auslöschen könnte. Daher möchte ich Sie bitten, mir diese Bescheinigung hier zu unterschreiben. Sie ermöglicht mir die Nachbetreuung Ihrer Frau auf Kosten Ihrer privaten Krankenversicherung.«
Gerd Adamski umklammerte das Dokument mit beiden Händen und hielt es mit halber Armeslänge Abstand vor seinen Kugelbauch, während er es in aller Ruhe durchlas. Ina war klar, dass er nie und nimmer seinen Namen daruntersetzen würde. Er wusste es ebenfalls. Allerdings nahm er sich sehr wichtig, daher musste er nicht nur anderen, sondern auch sich selbst immer wieder vorführen, dass er alles im Griff hatte, von allem etwas verstand, überall mitreden konnte. Er wusste am besten, was gut für ihn und seine Frau war – das war für ihn selbstverständlich dasselbe. Natürlich dirigierte er die Geschäfte und sagte stets, wo es langging. Eine solche Rolle erforderte ein ganz bestimmtes Prozedere, und es erforderte Würde. Deshalb veranstaltete er nun so ein Tamtam.
»Nein, das unterschreibe ich nicht. Sie haben Ihre Methode, und wir haben unsere.«
»Worin besteht Ihre Methode denn?«, hakte Ina nach.
Er erhob sich leicht keuchend von dem niedrigen Sofa. »Wir sind Ihnen keine Rechenschaft schuldig.«
Ina wollte ihn gerade fragen, wer eigentlich mit »wir« gemeint war, als Marlene hereinkam. Sie sah weder die Besucherin noch ihren Mann an, griff nach dem Dokument auf dem Tisch, unterschrieb es und ging wieder nach oben, bevor irgendeiner von ihnen etwas sagen konnte. Sofort schnappte Ina sich die Bescheinigung, ließ Gerd Adamski stehen und folgte ihrer Patientin. Doch als sie im ersten Stock ankam, war die Schlafzimmertür bereits geschlossen.
Zumindest für diesen Tag war ihr Besuch beendet.
Vierzehn Monate zuvor
Wir sind schon eine seltsame Truppe, dachte Marlene, als sie den Kirschkuchen auf den Esstisch stellte und dabei in die Runde blickte. So seltsam wie der Grund, der sie an diesem Nachmittag zusammengeführt hatte. Seit zwei Jahren trafen sie sich einmal im Monat, und zwar immer im Haus von Marlene und Gerd, weil Daniels Frau nichts von diesen Treffen erfahren durfte, Bodos Behausung zu klein war und man in Romys Wohnung fürchten musste, irgendwo kleben zu bleiben. Zwei Jahre lang hatten sie sich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen beraten, aber nie war es um so viel gegangen wie an diesem Nachmittag. Die Nervosität war mit allen Sinnen zu spüren, sie lag in ihrem Schweigen, in ihren hochroten gesenkten Köpfen, in ihren Augen, die jeden Blickkontakt vermieden, in ihren verschwitzten Händen.
»Er ist noch warm«, sagte Marlene an Daniel Trebuth gewandt und brach damit die beklemmende Stille. »Und extra ohne Butter und Eier gebacken. Außerdem habe ich Sojamilch genommen. Das war doch richtig so, oder?«
Bei der letzten Besprechung hatte sie nicht daran gedacht, dass Daniel Veganer war und daher weder Butter noch Eier oder Milch aß, die natürlich im Teig verarbeitet waren. Sie hatte sich über sich selbst geärgert und es diesmal besser gemacht. Freudig schnitt sie ihm ein besonders großes Stück ab und sah zu, wie er davon kostete.
»Und?«, fragte sie.
»Hervorragend. Das haben Sie wirklich ganz toll hingekriegt, Frau Adamski.«
»Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Ich finde aber, wir kennen uns jetzt gut genug, dass wir Du zueinander sagen können. Schließlich sind wir eine Art Bande, da duzt man sich doch, oder nicht?«
»Wir sind keine Bande!«, brauste Marlenes Mann auf.
»Das war ein Scherz, Gerd.«
Er brummte etwas in sich hinein und steckte sich einen Bissen von dem veganen Kuchen in den Mund.
»Ich nehme das Du gerne an«, sagte Daniel. »Dann sollten wir aber alle Du zueinander sagen.«
Die Runde stimmte zu, und Marlene lächelte zufrieden. Sie mochte Daniel, auch wenn er so komische Sachen aß wie Bratwurst aus Sojabohnen, Schnitzel aus Weizenpampe und Hähnchenschenkel aus Blumenfasern. Sie glaubte, dass seine Frau die treibende Kraft dahinter war und er nur notgedrungen mitmachte, um den Familienfrieden nicht zu gefährden. Daniel war ein sehr rücksichtsvoller Mensch, und genau deswegen vertraute sie ihm nicht ganz. Obwohl … so konnte man das nicht sagen. Sie würde ihn jederzeit mit ihren Enkelkindern – falls sie welche hätte – in den Zoo gehen lassen oder ihm ihren Hausschlüssel geben, damit er nach dem Rechten sähe. Selbstverständlich würde sie ihm als Bibliothekar geradezu blind vertrauen, wenn es darum ging, das richtige Buch für sie aus dem Regal zu ziehen. Mit seinen Sandalen, der Schubertbrille und den Klamotten aus dem Naturmodenladen seiner Frau sah er ein bisschen bemitleidenswert, ein bisschen bieder und ein bisschen zum Knuddeln aus. Aus all diesen Gründen konnte Marlene sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Daniel der Richtige für das geplante Unterfangen war.
»Wir sind uns also einig?«, fragte Gerd schmatzend, warf die Gabel auf den Teller und schob den kaum angebrochenen Kuchen mit leicht hängenden Mundwinkeln von sich. Er lehnte sich so weit zurück, dass sein Kugelbauch voll zur Geltung kam. »Wir machen es nämlich nur, wenn alle mitziehen. Bei so einer Aktion geht das gar nicht anders. Wenn nur einer Nein von euch sagt, ist die Sache gestorben. Ich bitte um Handzeichen.«
»Warte mal, Gerd«, unterbrach ihn Marlene. »Romy, kaust du etwa schon wieder Kaugummi?«
Die junge Frau nickte.
»Aber doch bitte nicht, während wir Kuchen essen, Kind. Immer wieder sage ich dir das. Komm, raus damit.«
»Ich habe ihn mir ja schon hinter die Zähne geklebt.«
Marlene schüttelte tadelnd und zugleich gutmütig den Kopf. »Für eine frischgebackene Bäckereifachverkäuferin gehört es sich nun mal nicht, einen Kaugummi im Mund zu haben, während sie Kuchen isst.«
Gehorsam nahm die Gescholtene den Kaugummi aus dem Mund. Romy hatte erst kürzlich beim dritten Anlauf die Prüfung geschafft. Eine Zierde ihrer Zunft war sie dennoch nicht: schmächtig, fast nur Haut und Knochen. Mit ihrer Körpergröße von einem Meter siebenundfünfzig wäre sie hinter dem Tresen von Marlenes und Gerds Bäckerei fast unsichtbar, prangte da nicht diese leuchtend lila Haarsträhne in ihrem schwarzen Lockenkopf. Davon abgesehen schwitzte sie schnell und ungewöhnlich stark. Irgendwie sah sie immer aus, als käme sie gerade aus der Dusche, und trotzdem wirkte sie nie ganz sauber.
»Können wir jetzt weitermachen?«, fragte Gerd.
»Entschuldige, aber das war wichtig.«
»So, ich bitte also nochmals um Handzeichen.«
Eine Hand nach der anderen hob sich, die von Gerd als Erstes, es folgten die von Bodo, von Romy und nach einigem Zögern auch die von Daniel.
Schließlich waren alle Augen auf Marlene gerichtet.
»Hoppla«, sagte sie überrascht, als hätte sie vergessen, dass sie auch dazugehörte.
Selbstverständlich stand sie hinter dem Plan. Allerdings hätte sie sich gewünscht, dass er gar nicht erst nötig, dass die Sache auch anders zu lösen wäre. Gewiss dachten auch die anderen so. Wer beging schon gerne ein Verbrechen, wenn es sich vermeiden ließ?
»Beschlossen«, sagte Gerd, und Marlene schenkte allen Kaffee nach.
Kurz kam ihr der Gedanke, Sekt zu reichen, aber das wäre wohl doch nicht ganz angemessen.
»Marlene, hol doch mal den Rotkäppchen«, sagte Gerd.
Da keiner widersprach, ging sie in die Küche. Von dort hörte sie, wie die anderen die letzten Details des Unterfangens besprachen. Wortfetzen drangen an ihr Ohr: Haustür, Kapuze, Seil, Klebeband, Audi, Mercedes … Der heikelste Part war sicherlich der Überfall selbst, doch damit hatte sie rein gar nichts zu tun. Das war die Sache von Gerd, Bodo und Daniel.
Da kein Sekt im Kühlschrank war, ging sie in den Keller. Die Vorräte lagerten in Regalen gleich hinter der Heizungsanlage und der schweren Metalltür, aber Marlene lief nach kurzem Zögern daran vorbei in den Gang, der in den ungenutzten Teil des Gewölbes führte.
Das Haus war auf einer weitläufigen Bunkeranlage des Zweiten Weltkriegs gebaut worden, die aus massivem Stahlbeton bestand. Angeblich waren dort einst Kunstschätze vor den Bomben der Alliierten in Sicherheit gebracht worden. Der hintere Teil des Kellers war verzweigt und ihr unheimlich, weshalb Marlene ihn so gut wie nie betrat. Das letzte Mal war sie dort gewesen … Du liebe Güte, das musste zehn Jahre her sein, als die Enkel ihrer Cousine dort unten Verstecken gespielt hatten.
Marlene öffnete eine weitere Metalltür, und ein großer, finsterer Raum tat sich vor ihr auf. Es war weder feucht noch muffig darin, aber kühl, und die nackte Glühbirne, die von der Decke hing, hatte einen Wackelkontakt. Sie würde die Birne ersetzen und außerdem für ein bisschen Wärme in dem Raum sorgen müssen.
Sie seufzte. Schon bald wäre alles ausgestanden. Endlich! Marlene sehnte diesen Tag herbei, das glückliche Ende der Geschichte, das ebenso schwer greifbar und seltsam weit weg war wie deren Anfang.
»Marleeeene«, drang Gerds tiefe Stimme bis hinunter in den Keller. »Wir haben Duhurst.«
Hastig nahm sie den Sekt und ging nach oben. Als sie die Gläser verteilte und dabei in die Gesichter der anderen blickte, dachte sie darüber nach, was jeden von ihnen wohl dazu veranlasst hatte, die Hand zu heben: Romy, ihre junge Verkäuferin, die sie zuerst ausgebildet und dann ins Herz geschlossen hatte, Bodo, der Kumpel des halben Darß, Daniel, der seine Familie über alles liebte, und schließlich ihr Gerd. Jeder von ihnen hatte einen Grund. Es musste so sein, denn es gehörte ein gewisser Grad an Verzweiflung dazu, das zu tun, was sie vorhatten.
Was mache ich hier eigentlich?
Diese Frage ging Daniel einige Tage nach dem entscheidenden Treffen durch den Kopf, während er mit Gerd und Bodo am frühen Morgen in einem Gebüsch auf der Lauer lag. In der Nacht hatte es geregnet, die Tropfen hingen schwer an den Zweigen des Rhododendrons und fielen ihm bei jeder noch so kleinen Bewegung in den Kragen, von wo sie ihm kalt den Rücken hinunterliefen und sich mit seinem körperwarmen Schweiß vermischten.
Ich schaffe das nicht, dachte er.
Im Geiste ging er immer wieder durch, was er zu tun hatte. Es musste alles ganz schnell gehen. Töller durfte weder die geringste Chance haben, sich zu wehren, noch um Hilfe zu rufen. Obwohl … Letzteres würde ihm kaum etwas nutzen. Sein Haus lag ziemlich abgelegen in der Nähe einer Steilküste. Die Straße war fast einhundert Meter entfernt, das Meer rauschte, und die Möwen schrien. Der schmale Weg, der am Haus vorbeiführte, stellte das einzige Risiko dar, aber er war stark aufgeweicht vom Regen, und so früh am Morgen waren sicher kaum Spaziergänger unterwegs.
Nichtsdestotrotz rutschte Daniel im Gebüsch vor Töllers Haus das Herz in die Hose – oder das Gewissen ins Herz, so genau ließ sich das nicht auseinanderhalten.
»Entschuldigt bitte, aber ich kann das nicht«, sagte er.
»Was?«, war die einhellige Antwort, aus zwei Kehlen geschrien, wenn auch mit halb erstickter Stimme.
»Es muss einen anderen Weg geben.«
»Du warst einverstanden«, keifte Gerd im Flüsterton.
»Da wusste ich noch nicht, wie schwer das wird«, erwiderte Daniel. In seiner Stimme lag etwas Unsicheres, Weinerliches, was ihn ärgerte.
»Was hast du denn gedacht? Dass wir uns Töller mit einem Zauberstab und ein bisschen Abrakadabra schnappen? Du tust gleich genau das, was wir eingeübt haben, mein Junge. Ende der Diskussion.«
Dieses »mein Junge« konnte Daniel überhaupt nicht leiden. Er war sechsunddreißig Jahre alt, aber Gerd behandelte ihn ständig, als hätte er gerade eine Lehrstelle als Bäcker bei den Adamskis angetreten.
»Nein«, sagte Daniel. »Nein, ich …«
»Hör mal, so geht das nicht. Wir haben dir vertraut, wir haben zusammen geübt …«
»Ich weiß. Es tut mir ja auch leid, aber ich finde …«
»Verdammt, für solche Sperenzchen haben wir jetzt keine Zeit. Reiß dich gefälligst zusammen, mein Junge. Gute Güte, da würden ja selbst Romy oder meine Marlene einen besseren Job machen als du.«
Es war ganz und gar nicht Daniels Art, patzige Antworten zu geben, aber dieser Gerd war ein Mensch, mit dem er sich normalerweise nie an einen Tisch gesetzt hätte, ein Prahlhans und Besserwisser.
Bevor er jedoch etwas entgegnen konnte, mischte Bodo sich ein.
Er war nicht so ein grober Klotz wie Gerd, viel freundlicher und diplomatischer, und weil er einige Jahre jünger war als Daniel, ging ihm auch diese patriarchalische Art ab, mit der Daniel so gar nicht zurechtkam.
»Wenn du jetzt nicht mitmachst«, sagte Bodo, »dann war’s das. Finito, Sense, aus. Eine solche Chance kommt nie wieder. Mach dir das klar.«
ENDE DER LESEPROBE