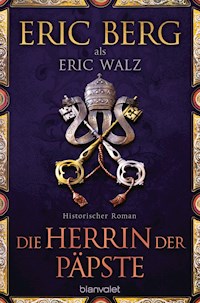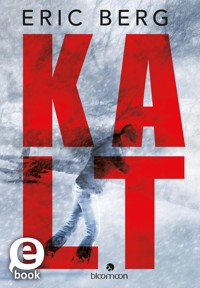10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Doro Kagel
- Sprache: Deutsch
Acht Freunde, acht Geheimnisse, eines davon ist tödlich ... Doro Kagel ermittelt in ihrem 3. Fall auf Fehmarn!
Überraschend erhält Doro Kagel einen Anruf. Ihr Jugendfreund Jan-Arne wurde auf Fehmarn ermordet – kurz bevor er im Krankenhaus starb, flüsterte er ihren Namen. In Doro werden sofort Erinnerungen wach: an den jungen Vagabunden Bolenda, dessen Leiche sie und ihre Clique damals am Weiher fanden, und dessen Tod nie aufgeklärt wurde. Und an das »Geheimnisspiel«, bei dem jeder der acht Freunde damals anonym ein Geheimnis auf einen Zettel geschrieben hatte. Eines der Geheimnisse lautete: Ich weiß, wer den Bolenda getötet hat.
Doro fährt nach Fehmarn und begegnet ihren alten Freunden wieder, doch kurz nach ihrer Ankunft sind zwei weitere von ihnen tot! Anscheinend hat Jan-Arne den Fall des Bolenda neu aufgerollt, und ihn Doro gewissermaßen vererbt. Schnell gerät auch sie in Gefahr …
Doro Kagel ermittelt in:
Das Nebelhaus
Die Mörderinsel
Die Toten von Fehmarn
Die Doro-Kagel-Krimis haben Ihnen gefallen? Dann lesen Sie auch diese Ostseekrimis von Eric Berg:
Das Küstengrab
Die Schattenbucht
Totendamm
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Überraschend erhält Doro Kagel einen Anruf. Ihr Jugendfreund Jan-Arne, zu dem sie seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hatte, wurde auf Fehmarn ermordet. Kurz bevor er im Krankenhaus starb, flüsterte er Doros Namen. In Doro werden sofort Erinnerungen wach an ihren letzten Besuch auf der Insel vor vielen Jahren – an den jungen Vagabunden Bolenda, dessen Leiche sie und ihre Clique damals am Weiher fanden, und dessen Tod nie aufgeklärt wurde. Und an das »Geheimnisspiel«, das sie und ihre Freunde damals spielten. Ein wenig angeschwipst, hatte jeder der acht Freunde anonym ein Geheimnis auf einen Zettel geschrieben. Einer der Zettel lautete: Ich weiß, wer den Bolenda getötet hat.
Doro fährt nach Fehmarn und begegnet ihren alten Freunden wieder, doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft sind zwei weitere von ihnen tot. Es stellt sich heraus, dass Jan-Arne den ungeklärten Fall des Bolenda aufgerollt hat, den Doro nun gewissermaßen erbt. Schnell gerät auch sie in Gefahr.
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. 2013 verwirklichte er einen lang gehegten schriftstellerischen Traum und veröffentlichte seinen ersten Kriminalroman »Das Nebelhaus«, der 2017 mit Felicitas Woll in der Hauptrolle der Journalistin Doro Kagel verfilmt wurde. Seither begeistert Eric Berg mit jedem seiner Romane Leser und Kritiker aufs Neue und erobert regelmäßig die Bestsellerlisten.
Von Eric Berg bereits erschienen
Das KüstengrabDie SchattenbuchtTotendamm
Doro Kagel ermittelt in:
Das NebelhausDie MörderinselDie Toten von Fehmarn
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
ERIC BERG
Die Toten von Fehmarn
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verlage Blanvalet und Limes, die seit zwanzig Jahren einen Weg mit mir gehen, und ohne die all das nicht möglich gewesen wäre.
Copyright © 2022 by Limes Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: GettyImages (ICHAUVEL), mauritius images (Radius Images)
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26172-6V002
www.limes-verlag.de
»Drei können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind.«
Benjamin Franklin
»Forsche nie nach des Freundes Geheimnis.«
Johann Caspar Lavater
1
»Jan-Arne Asmus ist tot, und stell dir vor, er hat deinen Namen auf dem Totenbett geflüstert.«
Ich war von der Nachricht völlig überfordert, weshalb ich kein Wort erwiderte. Nicht nur, dass meine Mutter ohne ein »Hallo, ich bin’s. Wie geht’s?« ihre Neuigkeit ins Telefon gepustet hatte. Dass sie überhaupt anrief, war eine Sensation.
Wir hatten zuletzt vor drei oder vier Monaten gesprochen, immer war ich diejenige, die anrief, und immer wirkte sie so, als hätte sie den Tag auch gut ohne meinen Anruf bewältigt. Damit nicht genug. Den Namen Jan-Arne Asmus hatte ich eine kleine Ewigkeit nicht mehr gehört. Kaum, dass ich mich an sein Gesicht erinnerte. Er war in meinem Alter, allein deshalb traf mich sein Tod. Am meisten irritierte mich jedoch, dass er ausgerechnet an mich gedacht haben sollte, kurz bevor er gestorben war.
»Du sagst ja gar nichts«, stellte meine Mutter fest. »War ich zu unsensibel, Doro? Na ja, ihr habt ja mal miteinander poussiert.«
Dieser Ausdruck war schon zu der Zeit hoffnungslos veraltet, als ich Jan-Arne kennengelernt hatte. Mitte der Achtziger.
»Wir haben nie poussiert, Mama.«
Ich sagte die Wahrheit. Zwischen ihm und mir war nichts gewesen, und wenn doch, hätte meine Mutter davon nichts mitbekommen. Dafür hatte sie sich viel zu wenig für mein Privatleben, ach, für mein ganzes Leben interessiert.
»Wenn du meinst. Aber von den Leuten aus der Fehmarn-Clique hattest du mit ihm am längsten Kontakt. Gib es doch zu.«
Allein diese Wortwahl! Ich sollte zugeben, mit jemandem über mein zwanzigstes Lebensjahr hinaus in Kontakt gestanden zu haben.
»Ja, das gebe ich zu«, sagte ich todernst.
»Siehst du. Siehst du.«
So wie sie es hinausposaunte, galt es weniger mir als jemandem, mit dem sie gewettet hatte. Ich vermutete, dass ihre Mitbewohnerin bei ihr war, Frau Rötel. Das war nicht schwer zu erraten. Wenn sie nicht gerade zerstritten waren, saßen die beiden eigentlich immer zusammen, also fünfzig Prozent ihrer Zeit.
»Du hast noch gar nicht gefragt, woran er gestorben ist.«
»Woran ist er denn gestorben?«
»Überfahren.«
»Schlimm. Auf der Straße?«
»Nein, nicht so überfahren. Ein Auto ist buchstäblich über seinen Brustkorb gerollt.«
Was für eine grausame Art zu sterben, dachte ich und unterdrückte meine Vorstellungsgabe mit aller Gewalt, sonst wäre mir übel geworden.
»Du meinst, er wurde ermordet?«, fragte ich.
»Ich kenne mich in diesen Dingen natürlich weniger gut aus als eine Expertin wie du, aber man muss sich schon ziemlich dämlich anstellen, um versehentlich jemandem einmal vorwärts und einmal rückwärts über den Oberkörper zu rollen, meinst du nicht?«
Dass jemand, den ich kannte, und sei es nur aus ferner Vergangenheit, auf diese beinahe an Mafiamethoden erinnernde Weise zu Tode gekommen sein sollte, war befremdlich und erschütternd zugleich.
»Was wirst du nun tun?«, fragte meine Mutter.
Ich dachte daran, für Jan-Arne im Geiste eine Kerze zu entzünden, am Abend bei einem Glas Chardonnay an ihn zu denken, ein paar alte Fotos auszukramen, Yim von ihm zu erzählen … So in der Art.
»Gib mir bitte seine Adresse, ich schreibe seiner Familie eine Karte … falls er eine hat. War er verheiratet und hatte Kinder?«
»Doro, der Mann ist mit deinem Namen auf den Lippen gestorben, herausgequetscht aus seiner zerdrückten Brust, das Gesicht des Mörders vor seinem geistigen Auge. Und du willst eine schwarzweiße Karte mit dem Aufdruck In tiefer Trauer hinschicken? Was wirst du tun, wenn ich sterbe? Versendest du dann auch eine Karte? Oder veranstaltest du ein Grillfest?«
»Nur wenn du im Sommer stirbst«, erwiderte ich flinkzüngig. Tatsächlich lief mir jedoch ein Schauer über den Rücken bei der erneuten Erwähnung von Jan-Arnes Tod und dessen Umstände. Auch wenn meine Mutter den Vorfall dramatisierte, was wahrscheinlich war – »mit deinem Namen auf den Lippen«, »das Gesicht des Mörders«, du lieber Himmel! –, irgendetwas war sicherlich an der Geschichte dran. Denn sie war zu blutig, als dass jemand sie sich komplett ausgedacht haben könnte.
»Du musst natürlich nach Fehmarn kommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als Gerichtsreporterin bist du prädestiniert, Kriminalfälle zu lösen.«
Ich fiel aus allen Wolken. Ein absolutes Novum. Sie wollte, dass ich sie besuchte. Das war so unglaublich, dass ich in Erwägung zog, mich geirrt zu haben, dass vielleicht doch alles eine Erfindung von ihr war, zumindest die Sache mit meinem Namen auf dem Sterbebett. Möglicherweise war meine Mutter einsamer, als sie sich das eingestehen wollte. Vielleicht dachte sie, dass es ein Fehler gewesen war, mit Ludwina Rötel zusammenzuziehen. Oder sie verschwieg mir etwas, ihre Gesundheit betreffend.
Sie mit meinem Verdacht zu konfrontieren, hätte mir nichts als weitere vier Monate Funkstille eingebracht, und auch wenn die Telefonate mit ihr anstrengend werden konnten und ich unmittelbar danach nicht gerade bester Dinge war, war ich am darauffolgenden Tag stets froh, ihre Stimme gehört zu haben.
Selbst wenn ich nach einem Grund hätte suchen wollen, ihren Vorschlag abzulehnen – es gab keinen. Die Pfingstferien waren vorüber, die Sommerferien hatten noch nicht begonnen, die Redaktion meines Wochenmagazins war gut besetzt und ich mit allen Aufträgen auf dem Laufenden. Eine Woche am Meer würde mir guttun.
Würde uns guttun, dachte ich und meinte damit nicht meine Mutter, sondern meinen Mann Yim. Sein Fischrestaurant hatte die Corona-Pandemie nicht überlebt. Das Schiff, das auf der Spree vor Anker lag, hatte ohnehin nur Platz für vierzehn Tische geboten, die Yim auf die Hälfte hatte reduzieren müssen. Trotz staatlicher Hilfen hatte es nicht gereicht, und bevor er in die Insolvenz gerutscht wäre …
»Also gut, ich komme. Übermorgen.«
An der zeitverzögerten Reaktion meiner Mutter bemerkte ich, dass sie nicht mit einer Zusage gerechnet hatte.
»Und Yim wahrscheinlich auch«, fügte ich hinzu.
»Muss er nicht kochen?«
»Mama, ich habe dir doch geschrieben, dass er die Nixe schließen musste.«
»Mit der Post?«
»Nein, per Brieftaube. In einer E-Mail natürlich.«
»Ach so. Ich komme in dieses Akkord-Dingsda nicht mehr rein, habe das Passwort vergessen.«
»Wenn ich bei dir bin, kümmere ich mich um deinen Account.«
»Frau Rötel richtet das Gästezimmer her. Ich erwarte dich … euch dann am Freitag.«
Sie beendete das Gespräch, wie sie es begonnen hatte, ohne einen Gruß.
Die Strecke von Berlin nach Fehmarn führte über ruhige brandenburgische und mecklenburgische Landstraßen, alle paar Kilometer von kleinen Dörfern unterbrochen. Wir fuhren mit meiner alten Karre, da Yim sein Cabrio verkauft hatte, um das Restaurant etwas länger über Wasser zu halten. Nun war beides weg, und das lag wie Blei auf der Fahrt, verlieh unserem Schweigen Schwere und unseren Worten einen Beigeschmack. Sein Unglück war immer da. Selbst wenn es sich nicht offen zeigte, bestimmte es unser Zusammensein.
Als Yims betriebliche Rücklagen aufgebraucht waren, hatte er vor der Wahl gestanden, auch unsere privaten Ersparnisse einzubringen. Ich war dafür gewesen, er dagegen, und er hatte Recht behalten, denn sie wären mit allem anderen den Bach runtergegangen. Nun hatte er »nichts mehr«, wie er es formulierte, womit er darauf anspielte, dass die verbliebenen Ersparnisse zu einhundert Prozent aus meinen Honoraren resultierten. Selbstredend sah ich das anders, es war unser Geld. Aber ich wusste auch, dass es mir im umgekehrten Fall wie Yim gehen würde. Seit dem Abitur stand ich auf eigenen Füßen und hatte mich stets allein über Wasser gehalten. Diese Unabhängigkeit mit einem Mal zu verlieren und von dem Geld meines Mannes zu leben hätte mein Selbstverständnis auf den Kopf gestellt.
Während inzwischen die dritte Amy-Macdonald-CD lief, sah Yim nur wortlos aus dem Beifahrerfenster, wo ein Regenschauer über dem flachen sattgrünen Land mit seinen Kühen und Reihern niederprasselte. Natürlich war er enttäuscht und – viel schlimmer – orientierungslos. Gutes Essen war sein Leben. Er hatte immer entweder als angestellter Koch oder als selbständiger Gastronom gearbeitet, und beides war nun auf unabsehbare Zeit nicht mehr möglich.
Unvermittelt drehte er die Musik leiser.
»Was war das für ein Mann, der Tote?«
»Jan-Arne?« Ich war froh, dass Yim von sich aus seine ruinöse Gedankenspirale unterbrach. »Gesehen habe ich ihn zuletzt vor beinahe dreißig Jahren auf Fehmarn. Mein letzter Kontakt zu ihm liegt an die zwanzig Jahre zurück, ich weiß also nicht wirklich, wie er war. Als wir uns kennengelernt haben … herrje, da kann ich nicht älter als neun gewesen sein.«
Natürlich kannte Yim die Geschichte, wie und warum ich als Kind nach Fehmarn gekommen war. Seit ich denken konnte, fuhr meine Familie im Sommer für drei Wochen auf die Insel, wo wir auf einem kleinen Bauernhof mit Gästezimmern wohnten, bei den Rötels. Irgendwann zerstritt meine Mutter sich mit Frau Rötel, und wir wechselten im darauffolgenden Jahr den Bauernhof, nicht aber die Insel. Fehmarn war fester Bestandteil unseres Jahres, auch weil dort die einzige deutlich ältere Schwester meines Vaters lebte, an der er sehr hing, weil sie ihn praktisch großgezogen hatte.
Der gewaltsame Tod meines wenige Jahre älteren Bruders Benny, der von einem Sexualverbrecher überfallen wurde, zerstörte meine Kindheit. Mein Vater brachte sich bald danach um, meine Mutter verbitterte. Sie und ich waren als Einzige übrig geblieben, doch mir kam es vor, als hätte ich auch sie verloren. Wir besprachen nur noch das Nötigste, meist praktische Dinge. Erst als sich mein Notendurchschnitt binnen eines Schuljahres von 2,2 auf 3,6 verschlechterte, bemerkte meine Mutter, dass außer ihr noch jemand litt. Was die Tode betraf, bekam ich Hilfe von einer Psychotherapeutin. An die einhundert Sitzungen schafften es tatsächlich, mich zu stabilisieren. Doch danach blieb ich mit meinen ganz normalen Kinder- und später Teenagerproblemen allein, weil sie, verglichen mit dem ungeheuren, nicht nachlassenden Schmerz meiner Mutter, geradezu lächerlich wirkten.
Die Sommer verbrachte ich von da an bei Tante Thea in Alt-Petri im Nordwesten von Fehmarn. Sechs komplette Wochen. Mein elftes, mein zwölftes, mein dreizehntes, mein vierzehntes, mein fünfzehntes Lebensjahr. Anfangs fremdelte ich noch mit diesem Arrangement: ein weggeschicktes Kind, irgendwo geparkt, damit man es nicht um sich haben musste. Die alte, kinderlose ledige Tante, die ständig Probleme mit ihrem Hörgerät hatte, das nicht richtig eingestellt war. Der Labskaus, den sie immer zusammenrührte. Doch dadurch verbrachte ich viel Zeit außer Haus, konnte tun und lassen, was ich wollte. Thea war kein besorgter Mensch, und es war auch niemand da, der sich nach mir erkundigt hätte. Also ließ sie mir weitgehend freie Hand, was meine Freizeit anging. Schon im ersten Jahr lernte ich gleichaltrige Kinder kennen, aus Alt-Petri, Westermarkelsdorf, Schlagsdorf und von den vielen Höfen dazwischen. Mit einigen schloss ich Freundschaften.
»Es war toll damals auf Fehmarn«, sagte ich zu Yim. »Ich kam im Jahr darauf wieder, und es war, als wäre ich nie fort gewesen. Dazwischen schrieben meine neuen Freunde mir Briefe … na ja, nicht alle. Da waren auch ein paar Bauernlümmel dabei, sehr nette Bauernlümmel, die einen Stift nur in die Hand nahmen, wenn der Lehrer sie dazu zwang. Jan-Arne hat allerdings regelmäßig geschrieben. Kein Wunder, er ist später Journalist geworden, wie ich. Das war auch der Grund, weshalb wir den Kontakt so lange aufrechterhielten, während des ganzen Studiums.«
»Und danach?«
»Er schlug einen völlig anderen Weg ein als ich, wurde Reporter in Kriegs- und Krisengebieten. Irgendwann hörte er auf, meine E-Mails zu beantworten, und so verlief unsere Freundschaft im Sand. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er einen Job für CNN zu erledigen hatte. Im Kongo, glaube ich.«
»Was ist mit den anderen?«
»Keine Ahnung. Dieser letzte Sommer, der Sommer des Jahres … es muss 1990 gewesen sein, nein, 1991, der war irgendwie anders. Verrückt.«
»Du warst vierzehn, kein Kind mehr.«
Yim hatte Recht, das spielte eine Rolle. All die verwirrenden Gefühle … Aber da war noch etwas anderes.
Wieso musste ich ausgerechnet in diesem Moment an die Leiche denken? Jene Leiche, die ich und die anderen Kinder der Clique vor dreißig Jahren auf Fehmarn entdeckt hatten.
»Einer von uns war eines Abends, ziemlich am Anfang der Ferien, auf die Idee gekommen, an einem einsamen Weiher in der Nähe einer kleinen Kapelle ein Lagerfeuer zu machen«, schilderte ich. »Auf der Suche nach Brennholz teilten wir uns auf. Ich stapfte mit Maren Westhof durch Schilf und Unterholz. Ich weiß noch genau, dass Maren schnatterte und schnatterte und ich dachte: Du lieber Himmel, kann irgendetwas dieses Mädchen zum Schweigen bringen? Mit einem Mal standen wir vor dem leblosen Körper eines Mannes, der mit dem Kopf nach unten im Uferwasser trieb. Natürlich rannten wir sofort zum Sammelplatz zurück, laut schreiend, glaube ich. Ein paar von den anderen waren von ihren Exkursionen bereits zurück, doch keiner glaubte uns. ›Netter Versuch, gute Show, steigt mal besser von Wodka auf Buttermilch um, Mädels‹, das waren so die Sprüche. Ich ließ nicht locker, nahm Jan-Arne an der Hand und zog ihn hinter mir her. Zuerst fand ich die Stelle nicht mehr. Und als wir dort ankamen, war die Leiche nicht mehr da.«
»Sie war wirklich weg?«, fragte Yim.
»Wir haben überall gesucht, aber sie war verschwunden.«
»Waren du und diese Maren …?«
»Nein, wir waren nicht betrunken und auch nicht hysterisch. Jedenfalls nicht mehr, als unter solchen Umständen tolerabel ist.«
»Wart ihr euch sicher, dass der Mann tot war?«
»Hundertprozentig. Das lag daran, dass er … Na ja, er war eine Wasserleiche, mit allem, was dazugehört. Auch wenn er mit dem Gesicht nach unten schwamm, war das unübersehbar. Die Hände, weißt du, die Hände …«
Ich schluckte und fuhr schweigend durch einen Kreisverkehr.
»Überspring es einfach.«
»Ja, also … Maren und ich beharrten darauf, nicht zu spinnen, und am Ende gingen wir alle zusammen zur Polizei. Die schickte eine Streife dorthin, wo wir die Leiche gesehen hatten, aber da sie leider nicht auf wundersame Weise wiederaufgetaucht war … Ich erspare dir die Schilderung der feixenden Beamten. Zwei Tage lang waren Maren und ich das Gespött der Clique, sogar Jan-Arne glaubte uns nicht mehr. Zu guter Letzt war sich nicht mal mehr Maren sicher, ob wir doch einem Scherz zum Opfer gefallen waren.«
»Jetzt kommt die große Auflösung.«
»Teilweise, mein Schatz. Am dritten Tag nach unserem Erlebnis wurde eine Leiche aus dem Weiher geborgen, die einem Angler unter die Rute gekommen war.«
»Wer war der Tote?«
»Der Bolenda.«
»Was bitte?«
Um das zu erklären, musste ich ein wenig ausholen. Der Bolenda … Der Mann war ein Phänomen gewesen auf Fehmarn. Die Leute nannten ihn entweder bei seinem Nachnamen – sein voller Name war André Bolenda, doch niemand rief ihn so – oder einfach »Inselgeist«. Letzteres war durchaus zwiespältig gemeint. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Bolenda Mitte zwanzig. Zuvor war er ein Jahrzehnt lang über die Insel gestreift, tauchte mal hier auf und mal da, und während die einen ihn für harmlos hielten und das mit dem Inselgeist eher humorig meinten, war er den anderen unheimlich. Das lag an seinem plötzlichen Erscheinen – er stapfte manchmal unerwartet aus irgendeinem Gebüsch hervor – und seinem Aussehen. Er war recht groß und schlaksig, trug einen ungepflegten Bart, einen ausgefransten Schlapphut und muffig riechende Kleidung. Man hätte ihn für einen Obdachlosen halten können, und ganz sicher schlief er bei seinen Streifzügen über Fehmarn nicht selten unter freiem Himmel. Dabei besaß er wohl irgendwo ein kleines Häuschen. Wo, darüber gingen die Meinungen der Insulaner auseinander. Die im Nordteil sagten, er wohne im Süden, und umgekehrt. Auch wenn er manchmal am Strand und an Kinderspielplätzen gesehen wurde, so sprach er doch niemals jemanden an, weder Alt noch Jung. Zweifellos lebte er eine ungewöhnliche Existenz, das allein war jedoch kein Vergehen – und schon gar kein Grund, ihn umzubringen.
»Ich bin dem Bolenda in den fünf Sommern, die ich bei meiner Tante auf Fehmarn verbracht habe, bestimmt ein halbes Dutzend Mal begegnet. Trotzdem habe ich ihn nicht gleich erkannt, als er vor mir im Wasser lag. Der Schlapphut war weg, die Klamotten waren nass … Ist ja auch egal. Ich weiß wirklich nicht, wie ich jetzt auf den Bolenda komme.«
»Da fehlt noch was an der Geschichte.« Yim sah mich ernst von der Seite an.
»So? Was denn?«
»Das Ende. Ohne Ende ist es keine Geschichte, sondern ein Ereignis.«
»Oh, Verzeihung, Herr Lektor«, scherzte ich und legte ihm kurz die rechte Hand aufs Knie.
Es stimmte, eigentlich fehlte fast alles, was das Ereignis zur Geschichte machte. Soviel ich wusste, war der Mord am »Inselgeist« nie aufgeklärt worden. Zwar verließ ich Fehmarn ein oder zwei Wochen später für lange, sehr lange Zeit, da sich die Gesundheit Tante Theas verschlechterte und ich überdies in der zehnten und elften Klasse einen festen Freund hatte. Doch Jan-Arne oder eines der Mädchen, mit denen ich anfangs noch Brieffreundschaften pflegte, hätte es mir gewiss berichtet. Nun denn, das war nicht das erste Verbrechen, bei dem der Mörder unentdeckt blieb, insofern also nichts Besonderes. Was ich jedoch bis heute nicht verstanden hatte, war die Tatsache, dass die Leiche erst zwischen dem Uferschilf lag und zehn Minuten später fort war. Eingeklemmt zwischen all den Halmen des Rieds, konnte sie unmöglich von allein auf den Weiher hinausgetrieben sein, wo man sie Tage später fand.
»Merkwürdig«, murmelte ich. »Ich habe die Insel kurz nach einem suspekten Todesfall verlassen, und nun betrete ich sie kurz nach einem zweiten.«
In den rund dreißig Jahren zwischen diesen beiden Verbrechen war ich zweimal auf Fehmarn gewesen: zur Beerdigung meiner Tante Thea vor siebzehn und anlässlich des Einzugs meiner Mutter in das geerbte Haus vor fünf Jahren. Sie hatte ihren eigenen Bungalow mit dem viertausend Quadratmeter großen Grundstück, in dem ich groß geworden war, gegen das leicht heruntergekommene Reetdachhäuschen mit dem Hobbit-Garten eingetauscht – ihre erste Entscheidung seit sehr langer Zeit, die ich nachvollziehen konnte. Das gesunde Klima, das Meer quasi vor der Tür, der Himmel, der manchmal zum Greifen nah schien, die Geräusche und Gerüche der Elemente … Nicht zu vergessen die Gelassenheit der Insulaner, die auf das oft gereizte Gemüt meiner Mutter mildernd wirkten. Und schließlich, dass sie mit Fehmarn die schönsten Stunden ihres Lebens verknüpfte. Das alles sprach für diesen Umzug. Thea hatte sie oft bedrängt, zu ihr zu ziehen, als ihre Gesellschafterin, aber ich glaube, meine Mutter mochte meine Patentante nicht besonders. Nun hatte sie ihrerseits eine Gesellschafterin ins Haus geholt, die nur wenige Jahre jünger war als sie selbst, um die siebzig. Ausgerechnet unsere frühere Pensionswirtin, mit der sie sich einst überworfen hatte.
Ich musste nur einen Blick auf die Namensschilder vor dem Haus in Alt-Petri werfen, und schon verstand ich den Sinn hinter dieser Maßnahme. Auf dem Klingelschild stand Kagel/Rötel, auf dem Briefkasten Rötel/Kagel. Mir war sofort klar, dass dem kein salomonisches Einverständnis zugrunde lag, sondern ein ausgiebiges, wahrscheinlich tagelanges Ringen. Was dem einen alten Menschen ein Haustier ist, dem zweiten ein ehrenamtliches Engagement, dem dritten das Malen von Bildern oder die Pflege des Gartens, das war für meine Mutter der Streit – er gab ihr das Gefühl, lebendig zu sein.
Mit einem festen Tritt öffnete ich die Gartenpforte, während Yims skeptischer Blick über das kleine Anwesen schweifte. Er ahnte wohl, dass die Bewohnerinnen ihn bitten würden, das eine oder andere instand zu setzen. Etwa das zerbrochene Rosenspalier, das nur noch durch die trauernde Rose zusammengehalten wurde, den angeknacksten Tontopf mit der Hanfpalme, aus dem unten die Erde auslief, die man oben wieder einfüllte, oder das Küchenfenster, von dem die Farbe inzwischen so stark abgeblättert war, dass es weit mehr nackte als weiße Stellen aufwies. Yim war handwerklich recht geschickt und obendrein hilfsbereit. Aber wenn er das Gefühl bekam, dass jemand ihn ausnutzte oder seine Hilfe nicht wertschätzte, konnte er schnell bockig werden. Und meine Mutter war nicht gerade für ihren Charme und ihr Feingefühl bekannt.
Die beiden hatten sich nur ein einziges Mal gesehen, bei unserer Hochzeit. Ich will es mal so ausdrücken: Keiner hatte am anderen etwas auszusetzen. Damit ist ihre Beziehung hinreichend beschrieben. Sie sahen sich nie, sie sprachen sich nie. Bei jedem Telefonat mit meiner Mutter, also alle drei, vier Monate, richtete ich die Grüße aus, die er mir aufgetragen hatte, und danach übermittelte ich ihre Grüße an ihn, die sie mir keineswegs aufgetragen hatte.
Frau Rötel öffnete uns die Tür. Sogleich umarmte sie mich heftig, obwohl ich in beiden Händen schwere Taschen trug, und ließ mich nicht los, bis ich atemlos darum bat.
»Doro, die kleine Doro, wie gut du aussiehst. Aber ein bisschen mager, was? Als kleines Mädchen hattest du mehr auf den Rippen. Mal sehen, ob wir dich aufgepäppelt kriegen. Heute Abend gibt’s Kaninchen. Magst du dir eins aussuchen? Sind hinterm Haus.«
»Also … ich …«
Sie lachte aus voller Brust, wobei sich diverse Lücken in der Zahnreihe zeigten. »Da leck mich doch am Ärmel, du hast dich völlig verändert.«
Was ich von Frau Rötel nicht sagen konnte. Sie ließ sich – was nur auf sehr wenige Menschen zutraf – mit einem einzigen Wort beschreiben: hemdsärmelig. Das galt für ihr Aussehen, ihre Wortwahl, ihr Auftreten, ihr Benehmen, ihre Stimme, ihren Händedruck, einfach alles. Oft zeichnen sich hemdsärmelige Menschen durch eine hintergründige Herzlichkeit aus, die dann und wann zum Vorschein kommt, und tatsächlich gehörte ich als Kind zu den Personen, die diese Charaktereigenschaft erleben durften. Ich wusste aber auch, dass es Menschen gab, denen Frau Rötel jene Seite nie zeigte.
»Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Yim Nan.«
Bin ich die Einzige, die nicht weiß, ob man Menschen, die man als Kind gesiezt hat, als Erwachsene einfach so duzen darf?
Frau Rötel jedenfalls half mir aus dieser kleinen Unsicherheit heraus, indem sie Yim, ohne zu fragen, duzte, womit die Sache entschieden war.
»Ludwina, ist Mama da?«
»Sie ist einkaufen. Habe Brot und Wurst zum Frühstück besorgt, aber Renate hat gesagt, dass du lieber Müsli isst. Yims, bring die Taschen gleich hoch, dann stehen sie nicht im Weg, ja? Erste Tür links.«
»Mache ich. Übrigens, ich heiße Yim.«
»Ich mache euch erst mal eine heiße Schoki. Die hast du früher so gern gemocht, Doro. Euer Auto kann da aber nicht so stehen bleiben, der muss ein paar Meter vor, man kommt sonst so schlecht durchs Gartentor. Ihr habt doch keinen Hund, oder?«
»Nein.«
»Hunde machen nämlich bloß Dreck und springen aufs Sofa. Die Leute machen ein Gewese um die Viecher, als hätten sie ein Baby dabei.«
»Wir haben keinen Hund.«
»Komm, Doro, setz dich da hin, ich koche gleich die Milch. Auf dem Gasherd geht das ganz schnell. Deine Mama wollte ihren Elektroherd behalten, Gas war ihr zu unsicher, aber du siehst ja, wer sich durchgesetzt hat. Yims muss den Wagen wegfahren. Wenn Renate den da stehen sieht …«
»Wenn es so dringend ist, parke ich ihn gleich um.«
»Probier mal die Kekse. Habe ich heute Morgen gebacken, mit extra viel Butter, so wie du sie magst.«
Sie beobachtete sehr genau, wie ich einen Keks anknabberte.
»Als Kind hast du sie mir aus den Händen gerissen, ich kam gar nicht hinterher mit backen.«
Sie hatte ein pausbäckiges Kind mit strahlenden Augen, fettigen Fingern und Krümeln in den Mundwinkeln erwartet und fand nun eine Frau vor, die nach fast einer Minute noch den halben Keks in Händen hielt.
»Aber die Zeiten ändern sich«, sagte sie, räumte die Schale vom Küchentisch und widmete sich dem Kakao.
»Sehr lecker«, rühmte ich das Backwerk ebenso ehrlich wie pflichtbewusst. »Aber Yim und ich haben uns vor einer Stunde ein Sandwich geteilt. Ich werde nachher bestimmt noch einen essen.«
Dieses Zugeständnis beeindruckte Ludwina nicht. Sie rührte in der Milch, blickte dann und wann kopfschüttelnd aus dem Fenster, weil – wie ich vermutete – der Wagen noch nicht umgeparkt war, und kommentierte meinen Lobgesang auf die Insel, das Wetter und den hübschen Garten mit keinem Wort.
Als Yim den Fuß über die Küchenschwelle setzte, wurde er zeitgleich von zwei Frauen bestürmt. Ludwina sagte: »Der Wagen muss da weg.« Ich sagte: »Könntest du bitte das Auto ein paar Meter nach vorne fahren?«
»Na klar«, erwiderte Yim lachend, was Ludwina offenbar eine zu schwache Antwort war.
»Jetzt, ja?«
»Ja, jetzt«, erwiderte er, warf mir einen Blick zu und ging nach draußen.
Der Kakao war fertig. Serviert bekam ich ihn mit den Worten: »Da musste also erst jemand abkratzen, damit du uns mal besuchen kommst.«
Eine Armeslänge entfernt stand sie vor mir, die Fäuste in die Seiten gestemmt, die Beine unnatürlich weit auseinander und den gewölbten Bauch vorgestreckt. Ich roch den Buttergeruch ihrer geblümten Kittelschürze. Sie blickte auf mich hinab, und ich begriff, das war kein lockerer Spruch.
Ich widmete mich dem Kakao und stellte mich taub, was ihren provokanten Tonfall betraf. »Armer Jan-Arne, er war immer so aufgeweckt und engagiert. Nichts hat ihn kaltgelassen, aber er war absolut kaltblütig, im Sinne von nervenstark. Ich weiß noch, wie er mal erwähnte, dass er sich jede Woche etwas vornimmt, das er noch nie getan hat.«
»Wozu soll das gut sein?«
»Um das Leben auszuloten, Ludwina.«
Sie blies die roten, runden Backen auf. »Hat er sich am Anfang dieser Woche etwa vorgenommen, sich umbringen zu lassen?«, fragte sie und fügte hinzu: »Wie ist der Kakao?«
Er war mir zu süß, aber hätte ich ihr das gesagt, hätte sie mir die Tasse entwunden und in die Spüle geleert. Also war er genau richtig, so wie ich ihn mochte. Das versöhnte sie derart, dass sie Yim eine Tasse davon anbot, als er zurückkehrte.
»Ich habe den Motor gar nicht gehört«, sagte sie.
»Ich habe nur die Handbremse gelöst und den Wagen geschoben.«
»Aber mindestens zwei Meter, ja?«
»Drei.«
Sie ging zum Fenster und überzeugte sich selbst. »Dann hast du dir den Kakao verdient, Yims.«
Hilfesuchend sah er mich an, denn mit seinem feinen Gespür hatte er bereits verstanden, wie der Hase in diesem Haus lief und dass Berichtigungen und Ablehnungen nicht gut ankamen. Mit einer Stimme, die gerade so freundlich war, dass sie nicht als schleimig missverstanden werden konnte, sagte er: »Mein Name wird Yim ausgesprochen, und leider vertrage ich keine Milch, weil mir ein Enzym fehlt, wie den meisten Asiaten.«
Ludwina sah ihn mit großen Augen an, stemmte wieder die Fäuste in die Seiten, streckte den rundlichen Bauch heraus und rief: »Leck mich am Ärmel, ihr Chinesen habt einen ganz schön empfindlichen Magen, wie? Deswegen esst ihr auch so viel pappigen Reis.«
Ihr Gelächter über ihren eigenen Witz – oder was sie dafür hielt – unterbrach seine Korrektur: »Ich bin Kambodschaner. Aber es stimmt, wir essen viel Reis.«
»Aber Vegetaner bist du hoffentlich nicht.«
»Nein.«
»Heute Abend gibt’s Kaninchen. Geh mal ums Eck und such dir zwei aus, ja?«
Ich war froh und dankbar, dass Yim mir diese Prozedur ersparte. Früher hatte es oft Kaninchen gegeben, mit denen ich mich zuvor angefreundet, die ich mit Rüben und Salat gefüttert hatte. Natürlich verweigerte ich dieses Essen stets, mir wäre schlecht geworden. Aber meine Eltern und meinen Bruder hielt das nicht davon ab, sich ab und zu die niedlichen Nager zu wünschen. Ludwina Rötel, in Polen geboren und aufgewachsen, bereitete sie wie Bigosch zu, mit reichlich Speck, Soße und Sauerkraut – genau das Richtige für einen warmen Juniabend. Dennoch, diesmal würde ich einen Teller davon essen, allein um es mir nicht gänzlich mit der Köchin zu verderben.
»Was hat es eigentlich damit auf sich, dass Jan-Arne meinen Namen auf dem Sterbebett geflüstert haben soll? Wer behauptet das?«
»Annemie«, antwortete Ludwina und setzte sich auf den frei gewordenen Platz am Küchentisch. »Sie ist Krankenschwester, unten in Eutin. Da haben sie ihn hingebracht. Ein Wunder, sagt Annemie, dass er überhaupt noch einen Tag lang gelebt hat. Er war völlig zerquetscht. Die Rippen haben sich in alles Mögliche hineingebohrt.«
Man durfte sich das wirklich nicht ausmalen, schon gar nicht mit vollem Magen am Küchentisch.
Annemie war Ludwinas Tochter. Sie war im gleichen Alter wie ich, und als meine Familie damals Urlaub auf dem Bauernhof machte, spielten wir viel miteinander. Jahre später war sie Teil meiner Fehmarn-Sommerclique, aber wie bei den meisten anderen auch verlief unsere Brieffreundschaft schon sehr bald im Sand, nachdem ich nicht mehr auf die Insel fuhr.
»Wie geht es Annemie?«, fragte ich.
»Na ja. Sie hat einen hässlichen Mann und eine Tochter, die nichts taugt. Sie lässt sich ausnutzen.«
»Von wem?«
»Von allen.«
»Aha. Weißt du, ob sie und Jan-Arne in Kontakt standen?«
»Ach, seit einer Ewigkeit nicht mehr. Der Jan-Arne war seit dem Studium fast gar nicht mehr auf der Insel. War immer dort, wo die Fetzen fliegen, in Afghanistan, Balkan, Sahara … Da hat es ihn auch erwischt, in Mali, glaube ich. Heißt das so? Mali?«
»Was meinst du mit erwischt?«
»Ein Splitter von einer Granatdingsbums. Vor zwei Jahren ungefähr, können auch drei sein. Seitdem war er gelähmt, von hier bis da.« Ludwina machte eine Handbewegung von der Hüfte abwärts. »Zuerst hat er allein gewohnt, ist völlig verlottert in der Zeit, hatte zu nichts mehr Lust, heißt es. Hier spricht sich so etwas schnell herum, weißt du? Ich glaube, vor Jan-Arne war noch kein Fehmaraner in Mali, und wenn, ist er dort nicht zusammengeschossen worden. Vor einem Jahr oder so ist er wieder bei seinen Eltern eingezogen. An Geld hat es ihm anscheinend nicht gefehlt, er war gut versichert, was man so hört. Ich habe ihn mal im Bus getroffen. Der Fahrer hat eine Rampe ausgefahren, über die er dann reingekommen ist. Was für ein Umstand, sage ich dir. Zehn Minuten hatte der Bus am Ende Verspätung, so ein Mist. Aber er sah gut aus. Der Jan-Arne, meine ich. Gut für jemanden im Rollstuhl.«
Ich hörte davon zum ersten Mal. Wie hätte es auch anders sein können? Meine Mutter redete nie mit mir über die Vergangenheit, und obwohl sie wusste, dass Jan-Arne und ich früher befreundet waren, hatte sie es nicht für nötig gehalten, mir von seinem Schicksal zu erzählen. Na ja, bis zu seinem tragischen, ominösen Tod.
»Vor ungefähr einem halben Jahr hat Jan-Arne bei mir angerufen«, sagte Ludwina.
»Bei dir?« Ich staunte. »Wieso das?«
»Nicht direkt bei mir. Auf dem Hof von meinen Söhnen. Dort, wo ihr früher Urlaub gemacht habt, du, deine Mama, dein Papa und Benny.«
Mit Ludwinas Söhnen hatte ich damals nicht viel zu tun gehabt, sie waren einige Jahre älter als ich und Annemie. Ich wusste von ihnen nur, dass sie nach dem frühen Tod von Ludwinas Mann den Betrieb gemeinsam führten. Nachdem beide geheiratet hatten und ihre Enkel erwachsen geworden waren, war es Ludwina ein wenig zu eng auf dem Hof geworden, und so war sie letztendlich bei meiner Mutter gelandet.
»Weil meine Söhne Annemies neue Handynummer noch nicht hatten, haben sie ihm meine Nummer gegeben, und ich habe ihm dann Annemies Nummer gegeben. So war das.«
»Hast du ihn gefragt, warum er Annemie sprechen wollte?«
»Was denkst du denn? Nicht dass der sich an meine Annemie heranmachen will. So hässlich ist ihr Mann nun auch wieder nicht, als dass sie sich scheiden lassen und einen Krüppel heiraten müsste.«
Eine halbe Stunde mit Ludwina, und ich fühlte mich unwohl. Als Gerichtsreporterin war ich zwar ständig mit deftiger Sprache konfrontiert, aber das hier war etwas anderes. Das hier war privat, es war das Haus meiner Mutter.
»Was hat er denn als Grund genannt?«
»Den Bolenda. Die Leiche, die ihr damals gefunden habt. Er wollte Nachforschungen anstellen, wie er das nannte. Mein Gott, was gibt es denn da noch nachzuforschen? Das interessiert doch keinen Menschen mehr, dass vor dreißig Jahren ein bekloppter Gammler im Teich ersoffen ist. Außer seiner Mutter vielleicht, aber die ist ja selbst bekloppt. Überleg mal, das war vor dreißig Jahren, und die Frau rennt immer noch über die Insel und sucht ihren Sohn.«
»Sie sucht ihn?«
»Ich sag ja, die Frau ist dumm wie ein Schuh.«
Bis dahin hatte ich noch nie von Bolendas Mutter gehört. Er war für mich damals jemand gewesen, der einfach da war und über den man so gut wie nichts wusste. Ich hatte mir über ihn keine Gedanken gemacht, bevor ich seine Leiche fand, und danach wollte ich ihn so schnell wie möglich vergessen.
Plötzlich jedoch fand ich es spannend, mehr noch, ergreifend, dass es diese Mutter gab, die umherirrte und sich nach Jahrzehnten noch immer nicht mit dem Tod ihres Sohnes abgefunden hatte. Ganz sicher hatte Jan-Arne mit ihr gesprochen, und das würde ich wohl auch tun. Wenn selbst bei mir, die ich mich über einen Mangel an interessanten Fällen nicht beklagen konnte, journalistische Neugier aufkam, wie war es dann erst Jan-Arne ergangen? Für ihn, der seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte – zumindest nicht in der Weise, wie er es viele Jahre lang getan hatte –, konnte so eine feine Schnüffelei ein echtes Lebenselixier sein.
»Was hat er Annemie gefragt, und was hat sie geantwortet?«, wollte ich wissen.
»Sie meinte nur, dass sie ihm nicht helfen konnte. Mehr weiß ich auch nicht. Frag sie doch selbst. Sie ist auf der Beerdigung von Jan-Arne. Jetzt gerade.«
Ich stellte es Yim frei, mich zum Friedhof zu begleiten oder sich mit Ludwina anzufreunden, während sie zwei Kaninchen das Genick brach. Er entschied sich für Letzteres, da er Friedhöfe hasste und als Koch wenig zimperlich war, was die Zubereitung tierischer Speisen anging. Außerdem fand er, dass einer von uns vor Ort sein sollte, wenn meine Mutter vom Einkaufen zurückkam.
Unter der angegebenen Adresse auf dem Festland fand ich den Eingang zu einem Friedwald, eine Begräbnisstätte, bei der die Urne ohne Grabstein oder Kreuz unter einem Baum vergraben wird. Das hauptsächlich von Buchen und Birken bestandene Areal war nicht größer als zwei Fußballfelder und glich eher einem Hain als einem Wald.
Als ich eintraf, kamen mir die Trauernden bereits entgegen. Ohnehin hatte ich nicht vorgehabt, an der Zeremonie teilzunehmen – mit dem cremefarbenen Etuikleid war ich unpassend gekleidet. Trotzdem war ich sofort losgefahren, um Annemie nicht zu verpassen. Dabei war ich mir nicht sicher, ob ich sie überhaupt wiedererkennen würde. Dreißig Jahre sind eine lange Zeit, auch für das Gesicht.
Tatsächlich kam mir bis auf Jan-Arnes Eltern niemand der gut zwei Dutzend Menschen bekannt vor, und hätte eine der Frauen in meinem Alter nicht eine weiße Krankenhauskluft unter dem geöffneten schwarzen Sommermantel getragen …
»Annemie Rötel?«
Sie blieb stehen und sah mich ratlos an. »Annemie Bertram, Rötel ist mein Mädchenname.«
»Wie dumm von mir. Deine Mutter hat mir gesagt, dass du verheiratet bist. Doro … Doro Kagel. Ich bin zwar auch verheiratet, habe aber meinen Namen behalten.«
»Doro!«, rief sie erfreut und schien einen Moment lang zu überlegen, mich zu umarmen, entschied sich jedoch dagegen, was auch meine Unschlüssigkeit zugunsten der Zurückhaltung vergrößerte. Als ich schon dachte, wir hätten uns geeinigt, fiel sie mir doch um den Hals.
»Doro, du meine Güte, ist das lange her. Du trägst die Haare ganz anders.«
Ich lachte. »Als Kind habe ich sie eigentlich gar nicht getragen, sondern nur mit mir herumgeschleppt.«
»Und in einer anderen Farbe.«
Annemies Haare waren schwarz und glatt wie eh und je, und vom Pony konnte sie offenbar auch nicht lassen. Sie verdeckte damit ihre hohe Stirn.
Ich erkundigte mich nach ihrem Leben, die üblichen Fragen nach Kindern, Job und Wohnort. Sie hatte Fehmarn gewissermaßen verlassen und wohnte im holsteinischen Oldenburg und damit nahe genug, um der Insel verbunden zu bleiben. Ich erzählte ihr meinerseits von Yim, meinem erwachsenen Sohn Jonas und meiner Arbeit als Gerichtsreporterin.
»Aber das weißt du sicher schon alles von deiner Mutter«, kürzte ich die höfliche Berichterstattung ab.
»Nein, nein, gar nicht. Ich sehe meine Mutter so gut wie nie. Wir … wir verstehen uns nicht besonders gut.«
Ich seufzte. »Das haben wir leider gemeinsam, ich besuche meine Mutter eigentlich auch nur, weil …« Ich warf einen Blick in den Friedwald. »Eine nette Geste von dir, an Jan-Arnes Beerdigung teilzunehmen. Befreundet wart ihr ja eigentlich nicht mehr, oder?«
»Ein wenig schon noch.«
»Dann war es ihm sicher ein Trost, dass du in seinen letzten Minuten bei ihm warst.«
»Ich werde das nie vergessen, Doro. Er lag im Sterben, er muss unsagbare Schmerzen gehabt haben, aber er hat mich definitiv angelächelt. Da war er noch bei Bewusstsein, etwas später nicht mehr. Und in dieser Minute hat er zweimal deinen Namen geflüstert. Nur ich habe das gehört, sonst niemand.«
Natürlich glaubte ich ihr. Welchen Grund könnte sie haben, eine solche Geschichte zu erfinden oder auch nur zu übertreiben? Mit Annemies Wesen verhielt es sich wie mit ihrer Frisur – sie hatte es beibehalten: eine leise Stimme, reservierte Gesten, die Augen in einem permanenten Ruhezustand. Kein Mensch, der etwas konstruiert, um Beachtung zu erhalten. Trotzdem kam es mir unglaublich vor.
Da Jan-Arne und ich privat nie über ein freundschaftliches Verhältnis hinausgekommen waren und uns zudem unser halbes Leben lang weder gesehen noch gesprochen hatten, konnte ich mir dieses Geschehnis nur mit unseren Jobs erklären. Er hatte im Fall Bolenda ermittelt, und ich hatte die Leiche zusammen mit Maren Westhof damals am Weiher gefunden. Na und? Das war es aber auch schon. Ich wusste nichts über diesen ominösen Todesfall, und Jan-Arne hatte nichts Gegenteiliges geglaubt, sonst hätte er mich längst kontaktiert. Wollte er, dass ich die Ermittlungen weiterführe? Wieso ich? Er hatte im Laufe seiner Karriere sicher dutzende, wenn nicht hunderte Journalisten kennengelernt, so wie ich auch, und es finden sich unter den Kollegen immer ein paar, mit denen man über die Arbeit hinaus befreundet ist.
Ich konnte es mir nicht erklären.
»Du, ich muss los«, sagte Annemie und streichelte mich am Arm, wie sie es früher oft getan hatte. Sie hatte immer schon körperliche Nähe gesucht, und zwar sowohl zu Jungs wie zu Mädels.
»Die Klinik hat mir nur für zwei Stunden freigegeben. Wie wär’s mit heute Abend … irgendwo?«
»Meine Mutter erklärt mir den Krieg, wenn ich heute Abend weggehe.«
»Schade. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Sonntag habe ich frei und nächste Woche Frühdienst.«
»Das mache ich. Annemie, nur noch eine Frage.«
Sie öffnete die Autotür. Plötzlich wirkte sie hektisch, was gar nicht zu ihr passte. »Ich komme zu spät.«
»Hat Jan-Arne sonst noch irgendetwas gesagt?«
Sie zupfte an ihrer Uhr, biss sich auf die Lippe, sah mich an und sagte: »Das Geheimnisspiel. Das hat er noch gesagt: das Geheimnisspiel.«
Das Geheimnisspiel. Seit vielen, vielen Jahren hatte ich nicht mehr daran gedacht, und doch wusste ich sofort, was gemeint war. Etwa eine Woche bevor meine letzten Ferien auf Fehmarn endeten, trafen wir uns eines späten Abends. Wir, das war die komplette Insel-Clique, ich nannte uns damals die Achterbande: Annemie Rötel, Maren Westhof, Jan-Arne Asmus, Hanko Fennweck, Pieter Kohlengruber, Freya Popp und Lutz Meyerbeer. Lutz war neben mir der Einzige, der nur in den Ferien auf Fehmarn war, allerdings auch in den Oster- und den Herbstferien. Seine Mutter hatte dorthin geheiratet, während er bei seinem Vater in Münster lebte. Die anderen waren Kinder der Insel, deren Familien fast alle in der Landwirtschaft oder dem Tourismus verwurzelt waren.
Wir wollten eine Sonnenuntergangsparty machen, natürlich mit Alkohol. Von uns war aber noch keiner achtzehn, also versuchte jeder Einzelne, irgendwo etwas abzustauben. Ich war wenig erfolgreich. Tante Thea tat nur ab und zu einen Fingerhut voll Rum in ihren Tee, und die Flasche war fast leer. Überhaupt war die Ausbeute mager, ein bisschen was hiervon und davon. Nur Jan-Arne hatte mehr Glück. Weiß Gott wie, war er an eine Kiste mit sechs Flaschen französischem Johannisbeerlikör gekommen. Grässlich süßes Zeug, fünfzehn Prozent Alkohol. Dass es so etwas gab, war mir völlig neu, und den meisten anderen auch. Ich weiß noch, wie Hanko sich darüber lustig machte, dass wir ausgerechnet auf so ein »Weibergesöff« für unsere Party angewiesen waren. Aber er gab nur an. Er war fünfzehn Jahre alt und hätte nach einem Glas Gin feuchte Augen und einen Hustenanfall bekommen.
Wir tranken den klebrigen Crème de Cassis pur und natürlich nicht aus Likörgläsern, sondern Plastikbechern. Mit der Sonne ging auch unser Verstand unter.
Drei oder vier Flaschen waren ausgetrunken, als jemand die Idee vom Geheimnisspiel aufbrachte, eine Abwandlung von »Wahrheit oder Pflicht«. Jeder sollte ein Geheimnis auf einen Zettel schreiben, das ihn selbst betraf oder von dem er Kenntnis hatte, und in einen Becher werfen. Doch nicht irgendein langweiliges Geheimnis wie etwa: »Ich habe noch nie geknutscht«. Es sollte etwas sein, das erstens echt war, zweitens dunkel und drittens ein Hammer. Was mit dunkel und Hammer gemeint war, blieb offen.
Der gesamte Prozess von der ersten Erwähnung der Idee bis zur Umsetzung lag, was mich betraf, in dunstigem Cassis-Nebel verborgen. Ich war zu einem Drittel abgefüllt, doch ich war nicht so betrunken, dass ich gar nichts mehr mitbekommen hätte. Ein paar zierten sich, andere fanden die Idee blöd. Letztendlich setzten wir sie in die Tat um.
Es war stockfinster. Wir saßen um eine kleine Feuerschale, die Hitze schlug uns ins Gesicht, von hinten erfasste uns eine frische Meeresbrise. Die Falter schwirrten durch die erhellte Nacht, verschwanden zuckend wieder im Dunkel. Dann wurde es still. Acht junge Menschen saßen, über ihre Zettel gebeugt, da.
Jemand sagte: »Benutzt Blockbuchstaben, damit man eure Schrift nicht erkennt.«
»Und was passiert danach?«, wollte jemand wissen.
Wir einigten uns, die Zettel nacheinander zu ziehen und vorzulesen, anschließend wollten wir über jedes der Geheimnisse sprechen, ohne den Urheber zu kennen.
War das überhaupt möglich, acht dunkle Geheimnisse? Selbst wenn am Ende nur einer von uns ein solches Erlebnis hatte – warum sollte er oder sie es aufschreiben?
Ich kann nicht über die Motive der anderen sprechen, nur über meines. Warum schrieb ich damals auf, was ich vorher noch nie und niemandem preisgegeben hatte, nicht einmal meinem Tagebuch?
Es war eine Mixtur, bei der der Creme de Cassis die vielleicht auffälligste, aber nicht die wichtigste Zutat war. Gut, wir waren alle mehr oder weniger benebelt, aber der Tod des Bolenda hatte uns angerührt und verändert. Nach allem, was man hörte, war er ermordet worden, und wir hatten uns in den Jahren und den Monaten zuvor nicht selten über ihn lustig gemacht, was uns nun beschämte. Auch wenn ein Sonnenuntergangsbesäufnis meine Theorie scheinbar konterkariert – ich bin der Meinung, wir waren durch diesen grausamen Fund ernsthafter geworden, konnten jedoch, halb noch Kinder, halb schon erwachsen, nicht damit umgehen. Das Geheimnisspiel war dem Namen nach ein Spiel, und doch war es keins mehr. Es war ein Spiegelbild dessen, was in uns rumorte.
Ein dritter Punkt kam noch hinzu. Wir kannten uns seit mindestens fünf Jahren, einige sogar noch länger, und hatten ein gewisses Vertrauensverhältnis. Wir waren sehr unterschiedliche Typen, von schüchtern bis selbstbewusst, von still bis laut, von sanft bis ruppig. Wir waren Mädchen und Jungen, wir waren dreizehn, vierzehn, fünfzehn, zwei von uns sogar schon sechzehn, wir gingen auf die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium, Lutz sogar auf eine Privatschule. Trotzdem erinnere ich mich an keine Rangfolge, keinen Chef, keinen Underdog, dafür aber an viele gemeinsame Unternehmungen, sehr viel Abwechslung und Spaß. Ich dachte, ein geteiltes Geheimnis würde unsere Freundschaft noch vertiefen, sogar wenn nie herauskäme, was ich und die anderen aufgeschrieben hatten. Ich wollte, ich musste es einfach mal loswerden, was mir auf der Seele brannte, und ein anderer sollte es laut aussprechen, in die Nacht und das Feuer hinein.
»Ich mache den Anfang.« Hanko rührte im Becher.
Er war ein kleiner, kompakter Kerl mit Händen wie Schmirgelpapier, der älteste Sohn eines Bauern, weshalb er oft arbeiten musste, statt mit uns herumzustreunen. Ich glaube, er war Legastheniker, jedenfalls hatte er Probleme beim Lesen und Schreiben, was ihm peinlich war. Er lief dann immer rot an, so wie in jenem Moment, als er den Zettel zog, schluckte, noch mal schluckte und endlich laut vorlas: »ICHHABEEINESCHWEREUNHEILBAREKRANKHEIT.«
Das war allerdings ein Klopper, und ich glaube, wir waren plötzlich alle hellwach. Wer bis dahin geglaubt hatte, das Spiel sei albern, und wir würden es schnell vergessen, der hatte sich geirrt und wusste es jetzt. Eine Sexbombe zu sein, über magische Kräfte wie Harry Potter zu verfügen, einen König zum Vater zu haben, sich im Zeugenschutzprogramm zu befinden – solche Dinge hätte keiner von uns für voll genommen. Wir hätten die Köpfe geschüttelt und darüber gelacht. Aber eine schwere, vielleicht sogar tödliche Krankheit dachte sich keiner aus.
»Okay, sprechen wir drüber«, sagte jemand.
Hanko verneinte: »Erst wenn alle Zettel gezogen sind, haben wir gesagt.«
Der Becher ging an Freya Popp weiter, die von allen nur Poppy genannt wurde, außer von ihren Eltern. Sie war ein aufgewecktes Mädchen, zog sich mit Vorliebe bunt an und machte für ihr Leben gern Späße. Unmöglich für sie, einfach nur einen Zettel zu ziehen, nein, sie machte eine richtige kleine Show daraus, bis wir sie mit Buhrufen oder Schimpfwörtern drängten. Mit spitzen Fingern angelte sie einen Zettel, faltete ihn auf, zog die Augenbrauen in die Höhe und las den Satz gewiss ein halbes Dutzend Mal, bis wir dem Spektakel mit weiteren Buhrufen und Schimpfwörtern ein Ende bereiteten.
Sie sagte: »Das ist ein Rätsel, was meint ihr? Hier steht: MEINEMUTTERHATMICHNICHTGEBOREN.«
Ein Rätsel, in der Tat, und weit mehr nach unserem Geschmack als das vorherige Geheimnis. Es ließ der Fantasie viel Raum, und ich freute mich schon darauf, über diesen Satz zu diskutieren.
Der Becher ging an mich. Ich fürchtete, meinen eigenen Zettel zu ziehen, denn es war nicht das Gleiche, so etwas niederzuschreiben oder es selbst laut vorzulesen, auch wenn keiner wusste, dass ich die Verfasserin war. Glücklicherweise blieb es mir erspart.
Ich las und schmunzelte. Ja, das war ein hübsches Geheimnis, so gar nicht düster.
»ICHLIEBEJEMANDENAUSDIESERRUNDE.«
2
Wie viel Zeit fünf Jahre waren – ich meine, was sie ausmachen –, bemerkte ich, als ich meiner Mutter gegenüberstand. Tiefe Furchen hatten sich von den Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln eingegraben, die Haare waren dünner, die Augen verschwommener, und ihre einst klaren, bestimmten Gesten, mit denen sie ihre Umgebung einschüchterte, waren nun von einem Zittern begleitet. Seltsamerweise hatte ich sie mir nie alt vorstellen können. Ihre Energie, die unbestritten war, und die unheimliche Kraft, mit der sie die Menschen zu kommandieren versuchte, hatten es mir jahrzehntelang unmöglich gemacht, ihr Verwundbarkeit zuzugestehen. Das änderte sich an diesem Spätnachmittag mit einem einzigen Blick.
Sie gab mir die Hand wie einer Fremden.
»Da bist du also.«
Bevor ich sie umarmen konnte, wandte sie sich ab.
»Wie du siehst, haben wir es uns in den letzten fünf Jahren gemütlich gemacht, Frau Rötel und ich.«
Sie warf mir einen prüfenden Blick zu. »Das war Ironie, liebe Doro. Die Rötel hat leider keinen Geschmack. Damit meine ich nicht, sie hätte einen schlechten. Sie hat überhaupt keinen. Alles muss praktisch sein.«
Sie stieß die Tür zum Wohnzimmer auf. »Nimm nur mal diesen Raum als Beispiel. Der Landhausstil deiner Mutter und der Unstil der Bäuerin im ewigen Kampf gefangen, wie Gut und Böse.«
Ein halbes Dutzend verschiedener Hölzer in verschiedenen Farben, eine antike Tischlerarbeit neben besseren Spanplatten, ein Orientteppich neben gekettelter Meterware.
»Die gute Stube«, sagte meine Mutter und ließ sich auf dem in die Jahre gekommenen Cordsofa nieder. »Der Sessel beißt nicht.«
Kaum saß ich, sah sie mich an wie eine Hausfrau den Versicherungsvertreter, so als wäre ich an der Reihe, etwas zu sagen.
»Wo ist Yim?«
»In der Küche mit seiner neuen Freundin Ludwina, polnische Kaninchenpampe zubereiten. Sie bricht den kleinen, zarten Geschöpfen mit ihren Walkürenhänden das Genick, als wären es Stangenbohnen. Wie ich höre, hast du keine Zeit verschwendet und die kleine Rötel schon aufgesucht. Dann wirst du ja wohl nicht lange bleiben, nehme ich an.«
»Ich bin gerade erst angekommen.«
»Was hat sie gesagt?«
»Annemie? Nicht viel. Wir wollen uns in den nächsten Tagen mal zusammensetzen.«
Ich hatte das Geheimnisspiel meiner Mutter gegenüber nie erwähnt, und das sollte auch so bleiben. Mal abgesehen davon, dass sie eventuell mehr darüber hätte erfahren wollen, was mir unangenehm gewesen wäre – es war eine Episode meiner Jugend, die ich mit ihr nicht teilen wollte. Sie hatte mich damals in den Ferien aus ihrer Nähe verbannt, deswegen gehörten diese Tage ganz alleine mir.
Meine Mutter schlug vor, dass ich den Tisch im Esszimmer gleich nebenan decken sollte, und während ich das tat, stellte sie mir eine Frage nach der anderen, von »Was macht die Arbeit?« bis hin zu »Gehst du noch zum Yoga?«. Kein Thema behandelten wir länger als zwei Minuten, und sobald ich in die Tiefe gehen wollte, wies sie mich darauf hin, dass ich eine Serviette falsch platziert oder einen unpassenden Teller gewählt hatte. Danach stellte sie mir einfach eine neue Frage. Es war eines von diesen Gesprächen, die ich schon in meiner Jugend hassen gelernt hatte. Sogar ein bisschen Smalltalk über das Wetter wäre mir lieber gewesen. Die zwanzig Minuten, die wir auf diese Weise verbrachten, kamen mir wie eine Stunde vor. Dann war endlich das Essen fertig.
Das Kaninchen-Bigosch schmeckte überraschend gut, wenngleich das Gericht viel zu schwer war und Ludwina die Angewohnheit hatte, einem viel zu viel auf den Teller zu tun.
»Was machen Sie denn da, Frau Rötel?«, schimpfte meine Mutter, und das gewiss nicht zum ersten Mal. »Man sieht ja vor lauter Kraut und Soße das Porzellan nicht mehr.«
»Essen Sie lieber Porzellan oder Soße?«, kam prompt die Gegenfrage.
»Es ist hoffnungslos, Sie kapieren es einfach nicht.«
So verliefen die meisten Gespräche der beiden Frauen. Mal war meine Mutter die Anklägerin, mal Ludwina. Bemerkenswert fand ich, dass sie sich nach fünf Jahren des Zusammenlebens immer noch siezten. Andererseits siezte meine Mutter eigentlich jeden, außer mich. Nicht einmal Yim wurde die Ehre des Du zuteil.
»Yim, sagen Sie mir … Jetzt, da Sie gescheitert sind, was haben Sie mit Ihrem Leben vor?«
Wir saßen um den ovalen Esstisch herum, die Standuhr aus Mahagoniholz tickte aufdringlich, und Ludwina unterdrückte mehr schlecht als recht ein Rülpsen.
Nach einer ungläubigen Pause ließ ich Gabel und Messer auf den Teller fallen. »Mama«, mahnte ich. »Yim ist nicht gescheitert. Er hat nur …«
»Pleite gemacht, oder? Das adäquate Wort dafür ist scheitern. Aber wenn es dir lieber ist, können wir auch von einem Schiffbruch sprechen, was bei einem Restaurantschiff vielleicht zutreffender wäre, ja sogar irgendwie komisch.«
»Sarkastisch«, korrigierte ich.
»Na, meinetwegen auch sarkastisch, darauf können wir uns einigen. Doch zurück zu meiner Frage, Herr Schwiegersohn.«
Yim stocherte in seinem Bigosch. Die meisten Menschen fangen in sorgenvollen Zeiten an, mehr zu essen und zu trinken. Bei ihm war es genau umgekehrt. Als das Restaurant nach seiner Eröffnung gut angenommen worden und er mit Lob überschüttet worden war, da hatte er in zwei Jahren sechs, sieben Kilo zugenommen. Nur mit viel Sport und einer jährlichen Fastenkur im März hatte er sein Gewicht annähernd halten können. Im letzten halben Jahr dagegen hatte er vier Kilo abgenommen.
»Ich habe nach einer Anstellung als Koch gesucht«, erklärte er. »Genau wie zehntausend andere ehemalige Restaurantbesitzer.«
»Bitter, keine Frage. Aber das Leben ist keine Krabbelgruppe, mein Bester. Solange Sie noch Schmalz im Kopf und Saft in den Muskeln haben, steht Ihnen die ganze Welt offen. Gehen Sie doch zurück nach China. Dort braucht man Köche, dort braucht man eigentlich alles.«
»Er ist als kleiner Junge hierhergekommen. Deutschland ist seine Heimat.«
»Eine Heimat ohne Arbeit ist ein Rattenloch. In China gibt es genug Arbeit.«
»Er war kein Chinese, sondern Kambodschaner, das weißt du sehr gut«, wies ich meine Mutter zurecht.
»Mein Gott, es war mir entfallen.«
»Und überhaupt, warum sollten wir woanders hingehen? Wir haben uns hier etwas aufgebaut.«
»Was soll das sein? Ihr lebt doch noch immer zur Miete.«
»Ich habe einen Job, den ich liebe, und Yim hatte sein Restaurant.«
»Hatte.«
»Diese Diskussion ist überflüssig«, sagte ich. »Wir werden weder nach China noch nach Kambodscha gehen.«
Sie tat, als hätte sie mich nicht gehört, und machte einfach weiter. »In der heutigen Zeit könntest du problemlos mit dem Flugzeug auf die Schnelle nach Deutschland kommen, um deine alte Mutter zu sehen. Wenn du den bisherigen Rhythmus beibehältst, wären das maximal noch zwei Besuche.«
»Ach, darum geht es also. Um mich zu kritisieren, weil ich eine schlechte Tochter bin, ist es nicht nötig, meinen Mann herabzuwürdigen. Ich habe dich fünf Jahre lang nicht besucht, weil …«
»Unsinn. Es ist mir egal, dass du fünf Jahre lang nicht hier warst.«
»Ich weiß«, murmelte ich. »Das war ja der Grund.«
Ich stand auf, bedankte mich bei Ludwina für das Essen und ging vor die Tür.
Vom Haus meiner Mutter sind es nur fünfhundert Meter bis zur Küste. Die Sonne war bereits untergegangen, doch ihr Abglanz legte sich über die Weiden und sprießenden Kornfelder und schuf einen goldenen Frieden. Der Westwind trug das Meer an mich heran, noch bevor es zu sehen war. Rhythmisch schwoll das Geräusch an und ebbte wieder ab, als ich mich noch am Fuß einer Düne befand, um mir an deren Krone mit einem wohligen Donnern entgegenzuprallen. Da lag er vor mir, der Ozean mit seiner ganzen Kraft und Schönheit.
Ich näherte mich dem Ufer nicht weiter, sondern ließ mich an Ort und Stelle nieder, zwischen Büscheln von langem Gras, getrocknetem Tang und Muscheln. Zu meiner Rechten, ein Stück entfernt, erhob sich der Leuchtturm von Westermarkelsdorf, der damals nicht selten den Treffpunkt für uns Kinder gebildet hatte. Zur Linken die Windräder, die neu waren, keine Schönheiten zwar, aber im verblassenden Licht beinahe romantisch und beeindruckend. Das Ufer war steinig und felsig, das Meer im schwindenden Tag vom selben Grau wie die Steine.
Von irgendwo erklang ein Lied, geschmettert aus den Kehlen älterer Männer, gesungen in nordischem Platt. Als es zu Ende war, schwächte sich auch die Brandung ab, zumindest kam es mir so vor, und es wurde fast still.
Als Kind hatte ich die Stille der Insel am Abend nicht wahrgenommen. Sie hatte mir Angst gemacht, ohne dass ich wusste, dass es die Stille war, die mich ängstigte. Mein instinktives Gegenmittel war jegliche Form von Aktion, meistens die körperliche, gelegentlich die mit dem Kopf. Auf Fehmarn hatte ich meine ersten »Storys« geschrieben, kleine Reportagen ohne Bedeutung, über das Verhalten der Touristen an den Stränden und in den Restaurants, über Tante Theas Schnack mit der Nachbarin und auch über ein paar meiner Freunde. Eigentlich waren es eher Tagebucheinträge. Selbst wenn ich allein war, fühlte ich mich auf diese Weise in Gesellschaft. Das hatte mir ungemein durch die schwere Zeit geholfen.
Denn sie war schwer gewesen. Noch heftiger, als es von außen den Anschein hatte.
Yim setzte sich neben mich. Ich hatte ihn schon kommen hören und erschrak daher nicht.
Ich lächelte ihn an, als er den Arm um mich legte. »Wie hast du mich gefunden?«
»Ich habe von Weitem eine Silhouette im Restlicht erkannt, und mein Herz rief mir zu, das bist du«, sagte er augenzwinkernd und mit einer theatralischen Geste. »Leider ist es viel profaner. Ludwina meinte, ich könnte dich hier finden.«
»Tut mir leid, dass ich in deinem Beisein über dich geredet habe, als wärst du nicht da«, sagte ich. »Aber da du dich nicht selbst verteidigt hast …«
Yim erwiderte: »Ich sehe mich eher als Ringrichter. Einer muss den Job ja machen.«
Nach kurzer Überlegung stimmte ich ihm zu. »Was meine Mutter über dich gesagt hat …«
»Sie ist unsensibel und hat was von einem Biest, aber gelogen hat sie nicht. Ich bin tatsächlich gescheitert. Ich habe keine Arbeit mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«