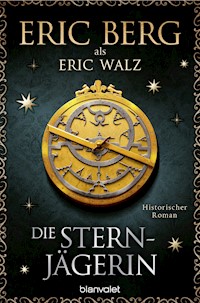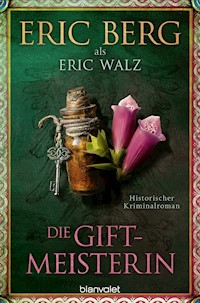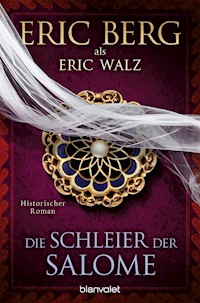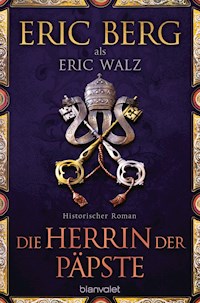3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Glasmalerin Antonia Bender
- Sprache: Deutsch
Glasmalerin Antonia und Jesuit Sandro ermitteln in einem Fall von Giftmord!
Rom 1552. Warum stirbt ein Schüler während der Eröffnung des Collegium Germanicum, der deutschen Schule der Jesuiten, durch Gift? Der junge Jesuit Sandro Carissimi ermittelt mit der Unterstützung der lebenslustigen Glasmalerin Antonia Bender, die er in Trient kennen gelernt hat. Die Nachforschungen sind heikel, führen sie doch in die allerheiligsten Gemächer des Vatikans, wo den Mächtigen mehr an den Geheimnissen der Kirche, als an den Geboten Gottes liegt ...
Lesen Sie auch die anderen beiden Antonia-Bender-Romane »Die Glasmalerin« und »Die Hure von Rom«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Rom 1552. Warum stirbt ein Schüler während der Eröffnung des Collegium Germanicum, der deutschen Schule der Jesuiten, durch Gift? Der junge Jesuit Sandro Carissimi ermittelt mit der Unterstützung der lebenslustigen Glasmalerin Antonia Bender, die er in Trient kennen gelernt hat. Die Nachforschungen sind heikel, führen sie doch in die allerheiligsten Gemächer des Vatikans, wo den Mächtigen mehr an den Geheimnissen der Kirche, als an den Geboten Gottes liegt …
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz
Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die SternjägerinGlasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze PapstDie Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs
Besuchen Sie uns auch www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Eric BergalsEric Walz
Der schwarze Papst
Historischer Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2009
by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Kathy; Roman Sigaev)
LH · Herstellung: DiMo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-30257-3V001
www.blanvalet.de
Für M.Für die schönen Tage
Prolog
Rom, 16. Juni 1552
Das Kraut gedieh wenige Schritte vom Tiberufer entfernt, an einer einsamen Stelle außerhalb der Stadt. Eine mächtige Trauerweide spendete ihm Schatten, und vom Fluss stieg an jedem frühen Morgen Dunst auf, der das Ufer in Feuchtigkeit hüllte. Eine einzelne Pflanze zunächst – hergeweht vom Wind oder angespült vom Tiber, fallengelassen von der Hand Gottes oder des Teufels inmitten einer fast biblischen Landschaft –, die sich vermehrt hatte und von einer kleinen Schar Nachkommen umgeben war. Um die Weide und das Kraut herum breitete sich ein Meer von Geröll aus, das unter der Sonne glühte.
Nicht ein Vogel sang, nicht eine Grille zirpte. Sogar der Tiber, der in den Apenniner Bergen entsprang, sich durch das uralte, etruskische Land schlängelte, Rom durchquerte und die Stadt dabei gelegentlich das Fürchten lehrte, selbst dieser Strom wirkte hier, auf seiner letzten Etappe zum Meer, ohne Leben.
Eigentlich liebte das Kraut mit Namen Poleiminze die Gesellschaft von üppigem Grün und Tümpeln, wie es sie flussaufwärts zahlreich gab, und es hatte in dieser Einöde deswegen schwere Zeiten erlebt. Aber nun, wo es tapfer aufragte und zur blasslila Blüte ansetzte, schien es mit seiner Giftigkeit, die in seinen Säften steckte, wie geschaffen für eine Landschaft wie diese: eine Landschaft im ewigen Todeskampf.
An jenem Morgen fand sein und das seiner Familie Dasein im Schatten der Weide ein jähes Ende. Man rupfte es mit Stumpf und Stiel aus, beendete sein Leben, um mit seiner Hilfe schon bald das Leben eines Menschen zu beenden.
Erster Tag
1
Rom, 17. Juni 1552
Die Prunkbarke des Papstes trotzte den Naturgesetzen. Ein Dutzend Pferde am linken Ufer und ein Dutzend am rechten Ufer zogen das Schiff den Tiber hinauf quer durch Rom – zwei Dutzend tierische Apostel, die den Stellvertreter Christi gemächlich über die Wasser gleiten ließen. Julius III. saß unter einem Baldachin und stieß immer wieder Seufzer der Befriedigung aus, während er auf seine Stadt blickte und die leichte Brise und den kühlen Wein genoss. Ein Knabe, der auf dem Bug in Sonnenschein gehüllt war und schwitzte, sang Hirtenlieder. So sah in den Augen des Papstes ein gelungener Mittag aus.
Sandro Carissimi stand hinter seinem Sessel, der typische Platz für einen Privatsekretär. Genau wie der Papst auch, ließ er seinen Blick über die Ufer streifen, sah, wie die Wäscherinnen mit den ohnehin krummen Rücken sich mühsam verneigten und wie die jungen Fischer ihre Mützen abnahmen, sah die Kinder im Spiel innehalten und die Soldaten auf den Brücken salutieren. Auf den ersten Blick schien es, als würden nur die wenigen ungezähmten Wesen dem Herrn der Stadt und geistlichen Verwalter des Erdkreises ihren Respekt verweigern, die schreienden Möwen, quakenden Frösche, stechenden Insekten …
»Au!« Julius schlug sich auf seinen Nacken. »Biester«, schimpfte er – und trank weiter.
Doch der Respekt der gezähmten Wesen, der Römer, war nur äußerlich. Sandro wusste das, er kannte die Stadt schon sein ganzes achtundzwanzigjähriges Leben lang. Doch der Papst, der mehr als doppelt so alt war, bemerkte es nicht.
Unheimlich, dachte Sandro, wie es Menschen mit müheloser Leichtigkeit gelang, das, was sie nicht sehen wollten, zu übersehen. In diesem Fall lag die tatsächliche Respektlosigkeit in den leeren Augen der Wäscherinnen, in den zornig in die Mützen gekrallten Fischerhänden und in dem hinter vorgehaltener Hand versteckten Gekicher der Kinder, die diesen höchsten aller Geistlichen nur mit karnevalesken Festen von verschwenderischer Pracht in Verbindung brachten. In ihrem Alter fand man Verschwendung, vor allem, wenn sie mit unnützem Zeug zu tun hat, noch lustig. Die Erwachsenen und die Alten jedoch hielten nichts davon, da sie darunter litten. Für die Stadt und ihre Bürger war kein Geld da, und so konnte die Armut in aller Ruhe um sich greifen und sich zum Elend entwickeln.
Julius wusste davon nichts, oder besser gesagt, er wollte nichts wissen. Sandro hatte in den vergangenen Monaten mehrmals versucht, den Papst empfänglicher für die Bedürfnisse der Bürger zu machen, und vereinzelt war ihm dies auch gelungen. Aber Massa hatte seine Bemühungen stets untergraben.
Bruder Laurenzio Massa, der Kammerherr und damit höchste Beamte des Papstes, stand neben Sandro, die Hände wie üblich über dem kugelrunden Bauch gefaltet. Er war ein raffinierter Mann, der die Nöte des römischen Volkes sehr wohl kannte, sich jedoch nicht im Mindesten dafür interessierte. Massa war ein politischer Kopf. Er dachte strategisch und in Allianzen, die ihn weiterbrächten, und Sandro war überzeugt, dass Massa jeden Abend vor dem Einschlafen und jeden Morgen beim Aufstehen statt eines Gebets die Namen möglicher Bündnispartner vor sich hin murmelte. Was seinen, Sandros, Namen anging, so befand dieser sich zweifellos auf der Liste mit der Überschrift: »Meine Feinde«. Zu Recht, denn Sandro konnte Massa nicht ausstehen, war ihn mehrfach scharf angegangen und war überdies – ohne es zu wollen – zum Vertrauten des Heiligen Vaters geworden. Er hatte zuerst eine Mordserie an Bischöfen während des Konzils von Trient und später den Mord an der Geliebten des Papstes aufgeklärt, und sein Name wurde seitdem oft in den Fluren und Sälen des Vatikans geflüstert. Von manchen wurde er umschmeichelt, von anderen insgeheim zum Gegner erklärt, und mit keinem von ihnen wollte er etwas zu tun haben. Gegen seinen Willen befand er sich nun genau dort, wo er nie hatte hinkommen wollen: mitten in der Schlangengrube des Petrushügels, einzig beschützt vom zweihundertzwanzigsten Nachfolger des ersten Papstes.
»Sandro«, rief Julius und drehte seinen schweren Körper auf dem Sessel in dessen Richtung. »Was ziehst du wieder für ein Gesicht? Du siehst schon so verdrießlich aus wie Massa.«
Es passte Sandro gar nicht, in irgendeiner Form mit Massa gleichgesetzt zu werden, daher blickte er etwas freundlicher.
»Die Hitze ist schuld, Eure Heiligkeit.«
»Unsinn. Ich kenne deine Mienen und weiß, wann du ein Hitze-Gesicht machst. Heute hast du dieses Mir-passt-alles-nicht-Gesicht. Was passt dir nicht? Wir haben einen wunderbaren Tag, die Sonne scheint, der Fahrtwind weht uns ins Gesicht, der kühle Wein erfrischt … Hast du dir etwa noch keinen Wein genommen? Du musst doch nicht darum bitten, Sandro. Du nicht.«
Julius gab einem Lakai ein Zeichen, der daraufhin einen Becher füllte.
Sandro hätte gerne auf den Wein verzichtet. Seit Monaten versuchte er, davon loszukommen. Aber wie war das möglich, wenn Julius ihm immerzu einen gefüllten Becher in die Hand drückte und Ablehnung nicht gelten ließ? Und der Wein war dabei nur ein Symbol für alles Übrige, in das der Papst ihn nach und nach hineinzog: in die apostolische Politik, in den Prunk, in ein auf Karriere ausgerichtetes Denken, in dem die Mildtätigkeit eine immer geringere Rolle spielte, bis sie irgendwann vertrieben worden sein würde. Schon jetzt kam Sandro wegen der vielen Arbeit kaum noch dazu, in das Hospital seines Jesuitenordens zu gehen und dort die Armen und Kranken zu versorgen, wie er es sich vorgenommen hatte. Er durfte sich nichts vormachen. Er trank kühlen Wein und dachte an eine Frau, die er liebte und für sich gewinnen wollte – er war der Inbegriff eines päpstlichen Günstlings, ob es ihm nun passte oder nicht.
»Oh, jetzt weiß ich, was dich stört«, rief Julius. »Dass ich den Knaben dort vorn am Bug singend in der Sonne schmoren lasse, habe ich recht? Ja, so ist mein Sandro. Also bitte.«
Julius klatschte zweimal in die Hände und winkte den Knaben zu sich heran. »Du hast sehr hübsch gesungen, mein Sohn. Sehr hübsch. Deine Stimme ist formidabel. Willst du einmal Kirchenmusiker werden?«
Der Knabe schüttelte den Kopf. »Papst.«
Julius und Sandro lachten, und sogar Massa verzog kurz das Gesicht zu einem schmalen Grinsen.
»Du bist wenigstens ehrlich«, sagte Julius. »Ein Papst, der so schön singt wie du, wäre mal etwas anderes. Wenn ich die Hostie hebe und dabei meine Stimme zu Gott aufsteigen lasse, kommt bloß ein armseliges Gekrächze heraus.«
Massa wollte etwas sagen, aber Julius hob die Hand und gebot ihm Schweigen. »Verschone mich mit deinen Schmeicheleien, Massa. Ich weiß, dass ich krächze. Der Wein hat meine Stimme verändert.« Julius wurde kurz nachdenklich, dann erinnerte er sich der Anwesenheit des Knaben. »Ich habe dich zu lange in der Sonne stehen lassen. Nimmst du mir das übel?«
»Jetzt nicht mehr«, sagte der Junge.
Julius lächelte. »Sandro, gib dem Jungen einen Obolus nach deinem Ermessen. Wie ich dein Ermessen kenne, wird es reichlich sein. Aber lass mir noch ein paar Denare übrig, hörst du? Meine Schatzkammer ist weniger gut gefüllt, als die Leute glauben.«
Sandro entlohnte den Knaben großzügig, wies ihm einen Stuhl im Schatten zu und kehrte wieder auf seinen Platz zurück. Er fühlte sich jetzt etwas besser. Nicht nur, weil der Knabe sich ausruhen konnte, sondern auch, weil Julius von sich aus gehandelt und sich sogar indirekt entschuldigt hatte. Zwischen Julius’ Vergnügungssucht und Ignoranz, die er überreich besaß, und seinen zahlreichen Sünden, von denen Sandro ein paar kannte, blitzte immer öfter auch der Charakter auf, den er in jungen Jahren gehabt hatte, bevor er seine geistliche Karriere begann. Julius war durchaus in der Lage, seine Fehler und Schwächen zu erkennen, und das waren die Voraussetzung und der erste Schritt, sich zu ändern.
Die Barke, die vor zwei Stunden außerhalb der Stadtmauer im Quartiere Ostiense abgelegt hatte, näherte sich ihrem Zielort am Castel Sant’ Angelo. Der Ausflug ging seinem Ende entgegen, und Sandro freute sich schon auf seinen freien Nachmittag. Er hatte viel vor. Doch seine Freude währte nicht lange.
Je näher man dem Ufer kam, wo eine Delegation wartete, die den Papst in den Vatikan geleiten sollte, desto genauer konnte Sandro eines der Delegationsmitglieder erkennen. Sein Blick verfinsterte sich. War das etwa … Hatte dieser Mann eine Ähnlichkeit mit … Das war nicht möglich.
Doch. Luis. Luis de Soto. Er war es.
Sie fixierten einander wie zwei Amselmännchen, als sie sich in ihrer schwarzen Jesuitenkluft gegenüberstanden. Luis hatte sich in dem Dreivierteljahr, seit sie sich bei dem Konzil von Trient zuletzt gesehen hatten, nicht verändert: das hagere Gesicht, das arrogante Schmunzeln … Immer noch derselbe Hochmut, mit dem Unterschied, dass Sandro ihn heute erkannte. Damals hatte er zu Luis, dem begabten Rhetoriker, aufgesehen. Kaum zu fassen, dass er jahrelang einem aufgeblasenen Karrieristen, der beinahe über Leichen gegangen wäre, als Assistent gedient hatte. Erst die Geschehnisse in Trient hatten ihm die Augen geöffnet.
»Was tust du hier?«, fragte Sandro, kaum dass er den Landesteg verlassen hatte.
»Ist das die angemessene Begrüßung für deinen ehemaligen Lehrmeister?«
»Du hast mich nichts gelehrt, ausgenommen, vorsichtiger zu sein bei der Auswahl der Objekte meiner Bewunderung.«
»Dankbarkeit ist nicht gerade dein hervorstechendes Charaktermerkmal, Sandro Carissimi. Dass du Visitator und mit der Aufklärung von Verbrechen betraut wurdest, verdankst du meiner Fürsprache, schon vergessen? Und nur durch dieses Amt hast du das Vertrauen des Heiligen Vaters gewinnen können, weswegen du heute sein Privatsekretär bist. Du siehst, mein lieber Sandro, ich habe mehr mit deiner Karriere zu tun, als du wahrhaben willst.«
»Nenne mich nicht ›lieber Sandro‹, diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei.«
»Deine unterschwellige Aggression macht mich sehr traurig.«
»Schön, ich kann ja mal mit offener Aggression versuchen, deine Trauer in Ärger umzumünzen. Du bist ein …«
In diesem Moment verneigte sich Luis, und Sandro hielt inne, da Julius III. den Steg herunterkam. Luis küsste den Fischerring.
»Ich freue mich, Eure Heiligkeit wohlauf zu sehen.«
»Glaube ich, de Soto, glaube ich. Da du von meinem Leben profitierst …« Julius wandte sich an Sandro. »Ich habe deinen Ordensgeneral Ignatius von Loyola gebeten, de Soto als Kandidaten für den Rektorenposten des Collegium Germanicum in Betracht zu ziehen, das heute Abend in der Via dell’Umilta eröffnet wird. Du hast sicher davon gehört.«
Sandro nickte. »Von dem neuen jesuitischen Collegium – ja, von Luis de Soto als Rektor – nein.«
»Möglicher Rektor«, korrigierte Julius. »Der hochgeschätzte Ignatius hat sich in seiner unnachahmlich eigensinnigen Art die endgültige Entscheidung darüber vorbehalten. Übrigens, de Soto, ist die Entscheidung schon gefallen?«
»Noch nicht, Eure Heiligkeit. Aber ich bin der einzig Geeignete.«
Julius nickte. »Ihr wärt nicht Luis de Soto, wenn Ihr das nicht glauben und hinausposaunen würdet.« Julius ging ein paar Schritte und wandte sich dann noch einmal um. »Sandro, ich erwarte dich morgen Vormittag zum Dienst. Und Ihr, de Soto, begleitet mich in den Vatikan.«
Mit diesen Worten stieg der Papst in die bereitstehende Sänfte, und Sandro musste zusehen, wie Luis, den er hasste wie niemanden sonst, sich zu seinem Gönner gesellte. Während er der Sänfte nachblickte, fragte er sich, wieso er sich dermaßen ärgerte. Luis war ein abgeschlossenes Kapitel, und er hatte nichts von ihm zu befürchten. Der Papst mochte Luis nicht besonders, aber er war viel zu sehr Machtpolitiker, um sich seine Fähigkeiten nicht zunutze zu machen, so wie damals, als Luis Verhandlungsführer des Heiligen Stuhls bei dem Konzil wurde. Was Julius wohl heute mit ihm zu besprechen hatte?
Ärgerlich war nur, dass es Menschen wie Luis immer wieder gelang, sich wichtig oder gar unentbehrlich zu machen. Es war ihm in den letzten Monaten gelungen, seine Position in der Ordenshierarchie weiter zu festigen. Luis als Rektor einer der bedeutendsten Jesuitenschulen war fast schon eine Anwartschaft auf das höchste Amt des Ordens, das des Pater General – ein Gedanke, der bei Sandro augenblicklich Übelkeit hervorrief.
Eine junge Stimme war von hinten zu hören. »Verzeiht, ehrwürdiger Vater.«
Sandro wandte sich einem Jesuiten zu, der wenig älter als zwanzig Jahre war. Er wirkte schüchtern, hatte aber wache Augen unter dichten Brauen. Die Kindheit war noch nicht ganz von ihm gewichen, was sich auch durch einige Pickel auf Wange und Stirn äußerte. Seine Bräune ließ auf einen Spanier oder Portugiesen schließen. Da er zu jung war, um die Priesterweihe schon zu besitzen, sprach er Sandro pflichtgemäß mit »Vater« an.
»Ich bin Miguel Rodrigues«, erklärte der junge Mann, »und Luis de Soto ist mein Mentor.«
Sandro übertrug augenblicklich seine Abneigung gegen Luis auf dessen Assistenten.
»Mein Beileid«, sagte er.
Miguel Rodrigues schien die Spitze gelassen zu nehmen und schmunzelte. »Ich habe schon viel von Euch gehört.«
»Das kann ich mir denken.«
»Oh, nicht von Bruder de Soto, falls Ihr darauf anspielt. Er spricht so gut wie nie über Euch. Aber Eure Erfolge als Visitator sind bis nach Portugal gedrungen, wo ich bis vor wenigen Monaten unserem Orden diente. Nun werde ich als Lehrer für Kirchengeschichte ins Collegium Germanicum berufen.«
»Ihr entschuldigt mich, Bruder Rodrigues, ich habe heute noch viel vor.«
»Einen Moment, bitte«, rief Miguel Rodrigues und eilte ihm nach.
Sandro verlangsamte seinen Schritt nur geringfügig. »Was gibt es denn noch?«
»Ich bin beauftragt worden, ehrwürdiger Vater, Euch zur Eröffnung des Collegiums heute Abend einzuladen.«
»Falls es Euer sogenannter Mentor ist, der mir diese freundliche Einladung zukommen lässt, könnt Ihr ihm ausrichten, dass er sie sich …«
»Nein, nein«, unterbrach ihn Miguel, bevor er sich in der Wortwahl vergreifen konnte. »Keineswegs, ehrwürdiger Vater. Es ist der ehrwürdige Pater General, der Euch bittet, zu erscheinen.«
Sandro blieb abrupt stehen – wofür ihm der keuchende Miguel, dessen körperliche Konstitution eher schwächlich war, einen dankbaren Blick zuwarf.
Der Pater General. Niemand Geringerer als Ignatius von Loyola selbst, der Gründer des Ordens, den man unter der Hand auch den »schwarzen Papst« nannte, erbat seine Anwesenheit. Wobei »bitten« im Jesuitenorden lediglich eine höfliche Umschreibung für »befehlen« war. Einer Bitte Loyolas nicht zu folgen, das war nahezu gleichbedeutend mit einem Ordensausschluss.
»Wann findet die Eröffnung statt?«, fragte Sandro, der seinen freien Nachmittag gekappt sah. Wegen seiner Arbeit hatte er in den letzten Wochen viel zu selten Gelegenheit gehabt, Antonia zu sehen, und nun sollte also die Eröffnung einer Schule die ohnehin knappe Zeit ihrer Begegnung noch verkürzen.
»Zur sechsten Stunde wird eine Messe in der Kapelle in der Via dell’Umilta gefeiert, und danach findet das gemeinsame Abendmahl statt«, antwortete Miguel. »Der ehrwürdige Pater General möchte im Anschluss daran noch ein wenig mit Euch diskutieren.«
»Worüber diskutieren?«
Miguel Rodrigues zuckte ahnungslos die Schultern. »Mehr weiß ich nicht, ehrwürdiger Vater. Vielleicht findet Ihr die Antwort in der schriftlichen Einladung.« Er überreichte Sandro einen Brief, in dem allerdings auch nicht mehr stand als das, was Miguel Rodrigues bereits erwähnt hatte.
»Gut, ich werde zur sechsten Stunde da sein. Bis dann, Bruder Rodrigues. Gott zum Gruß.«
»Gott zum Gruß.« Miguel zögerte noch einen Moment, so als halte etwas, das er noch nicht losgeworden war, ihn davor zurück, zu gehen. So war es Sandro, der ihm die Entscheidung abnahm und in Richtung Piazza del Popolo, in Richtung Antonia davonging. Dort erwartete ihn allerdings eine weitere missliebige Begegnung – die mit dem Liebhaber der Frau, die er liebte.
»Was machst du denn da?«, fragte sie lachend und versuchte mit gespielter Mühe, sich aus seiner Umarmung zu winden.
»Wonach sieht es denn aus?« Er küsste sie.
Es war ein Kuss, der nicht zaghaft und nicht heftig war, nicht zu kurz und nicht besitzergreifend. Milo, fand sie, konnte hervorragend küssen, vielleicht sogar am besten von allen Männern, mit denen sie je angebandelt hatte – und das waren nicht wenige gewesen. Sie wusste jedoch, dass ihr Urteilsvermögen bezüglich Milo getrübt war, denn sie hatte sich in ihn verliebt, so wie sie sich damals in Trient auch in Sandro verliebt hatte.
»Sandro«, flüsterte sie.
Er hatte es gehört. »Was sagst du?«
»Ich wollte sagen, dass Sandro jeden Moment hereinkommen kann.«
»Na und?«
»Er soll nicht glauben, dass wir beide hier wilde Liebe machen.«
»Er ist Geistlicher und sollte gegen die Wahrheit nichts einzuwenden haben.« Doch Milo war ein Mann, der ihre Wünsche respektierte, und er löste die Umarmung. »Am liebsten würde ich dich aus Rom entführen, Antonia, und irgendwohin bringen, wo uns keiner kennt, weißt du das? So wie Paris Helena entführt hat.«
Sie strich ihm zärtlich über das kurz geschnittene Haar. »Ein schlechter Vergleich. Paris war ein Schwächling, der immerzu irgendwelche Göttinnen brauchte, um seine Haut zu retten, und Helena war eine eingebildete Ziege, die den Untergang der Menschheit in Kauf genommen hätte, um den schönen Paris zu kriegen.«
Milo seufzte. »Siehst du, das kommt dabei heraus, wenn ein dummer römischer Ragazzo wie ich sich mit einer Glasmalerin unterhält, einer Künstlerin. Das ist der Grund, weswegen ich wenig rede und lieber Taten sprechen lasse.«
Antonia schmunzelte. »In den letzten Tagen haben wir jede Menge Taten vollbracht. Und man muss ja auch nicht immer reden. Schweigen wir doch ein bisschen. Ich finde schweigende Männer ausgesprochen anziehend.«
Sie standen sich im Abstand von fünf Schritten gegenüber, sie an die eine Zimmerwand gelehnt, Milo an die andere, zwischen ihnen nur das leere Zimmer, und sie sahen sich an, lächelten, kokettierten, setzten die Körpersprache ein, um Sehnsucht, Begehren oder Belustigung auszudrücken. Zwei Pantomimen der Liebe. Das war das Wunderbare, das Begeisternde an Milo, dass er jedes Spiel und jede Verrücktheit, die ihr einfiel, mitmachte, dass er mit erstaunlichem Feingefühl die Schwankungen ihres Temperaments erfasste und fast immer das Richtige tat. Nur jemand, der aufrichtig liebte, konnte diese Fähigkeit entwickeln, und dieser Gedanke bereitete Antonia ein plötzliches Hochgefühl. Sie wurde geliebt.
Und zwar auf eine lebendige Weise. Sandros Liebe war von den ersten Tagen in Trient an immer etwas gewesen, das er eingeschlossen hatte, so wie man eine verrückte Großmutter einschließt und die Schreie, die sie von sich gibt, geflissentlich überhört. Er hatte sich nie zu Antonia bekannt und war ihr lange Zeit aus dem Weg gegangen. Einen Winter und einen Frühling lang hatte Antonia die Hoffnung gehabt, dass Sandro sein Keuschheitsgelübde wie die meisten römischen Geistlichen nicht ernst nähme und dass der schöne Gigolo und reiche Kaufmannssohn, der er – nach allem, was sie wusste – vor acht Jahren, bevor er Jesuit wurde, gewesen war, wieder zum Vorschein käme. Vergeblich. Es war zum Eklat gekommen, und erst im Zuge ihrer gemeinsamen Ermittlungen im Fall der ermordeten Konkubine des Papstes hatten sie sich wieder versöhnt. Aber da war bereits Milo in Antonias Leben getreten. Und sie war froh darüber.
Plötzlich erschauerte Antonia.
»Was ist los?«, fragte der aufmerksame Milo, der selbst in den Momenten größter Entspannung und Harmonie einen inneren Späher zu haben schien.
»Ach, nichts. Es ist nur …«
»Dieses Zimmer?«
Sie blickte zu ihm auf. Er war fast einen Kopf größer.
Sie befanden sich nicht in irgendeinem Zimmer, sondern in dem ihrer kürzlich verstorbenen Freundin Carlotta, der fast mütterlichen Vertrauten, die gerade wegen ihres früheren Berufes als Hure so viele Facetten des Lebens gekannt und Antonia mehr als einmal klugen Rat und viel Trost gegeben hatte. Was blieb, waren Scherben der Erinnerung, kleine, leuchtende Teile gemeinsam verbrachter Stunden. Manche dieser gläsernen Juwelen waren Sätze, die Carlotta gesagt hatte: »Natürlich bist du eine unmoralische Frau. Ich würde dich nicht zur Freundin haben wollen, Antonia, wenn du moralisch wärst.« Mit ihr hatte Antonia, die sich sonst nur in der Liebe und in ihrer Glasmalerei mitteilen konnte, sprechen können wie mit keinem anderen Menschen. Carlotta, das war auch die Umarmung einer großen Schwester, das waren Herbstspaziergänge in klarer Luft, das waren Worte, die niemand sonst auszusprechen wagte, der warme Geruch von Puder, ein melancholischer Blick …
Das leere Zimmer, in dem sie standen, kam Antonia mit einem Mal wie eine Totenkammer vor. Sie öffnete das Fenster.
»Hier ist sie also in den Tod gesprungen«, flüsterte sie. »Es ist schon zwei Monate her, aber mir ist, als sei es heute Morgen passiert. Sie ist so – so gegenwärtig.«
»Quäl dich nicht«, bat Milo.
»Aber wir sind doch hier, um uns zu quälen. Wir wollen herausfinden, ob es tatsächlich Selbstmord war oder ob Sandros Verdacht stimmt, dass man sie …« Ihre Stimme versagte.
Sie blickten gemeinsam hinunter auf die Piazza del Popolo, standen ganz nah beieinander, spürten weder den Luftzug, noch vernahmen sie hinter sich ein Geräusch, obwohl sie nicht mehr allein im Zimmer waren.
Sandro sah sie dort stehen, zwei Liebende wie Schlingpflanzen verbunden. Eine Weile bewegte er sich nicht. Er schmeckte Salz auf den Lippen, denn es war heiß, und der Schweiß rann ihm über die Schläfen, hinunter bis zum Kinn. Sein Blick verriet nicht, was in ihm vorging, obwohl er sich keine Mühe hätte geben müssen, etwas zu verbergen, da Antonia und Milo ihn nicht bemerkten.
Sandro war nicht absichtlich leise eingetreten. Es war wohl so, dass man, wenn man am geöffneten Fenster oberhalb der Piazza del Popolo stand, einfach nicht hörte, wenn jemand zur Tür hereinkam.
Er machte einen Schritt vorwärts, der ihm seltsamerweise schwerfiel, so als trage er ein Gewicht in den Schuhen. Der nächste Schritt ging schon etwas leichter, und mit jeder Bewegung auf die ahnungslosen Liebenden zu gewann er an Entschlossenheit. Sein Blick streifte Antonias strohblondes, leicht rötlich schimmerndes Haar, das sie stets lose und unvollkommen aufsteckte, ihren schlanken Körper im schlichten Kleid; ihren Hals und die Ohren, die sie nie schmückte, ihre hellhäutige Hand, die auf Milos Rücken lag. Und dann glitt Sandros Blick über Milo, den fünfundzwanzigjährigen Sohn einer Bordellvorsteherin, wie üblich barfuß, mit lässigem Hemd und Fischerhosen bekleidet. Gegen einen solchen Mann sah Sandro in seiner schwarzen Kutte wie ein frühchristliches Relikt aus.
Sandro streckte seine Arme dem Paar entgegen. Er war fast bei ihnen. Über ihre Schultern hinweg sah er die Piazza, die Fuhrwerke, die Bettler …
Ein kräftiger Stoß würde genügen. Das Fenstersims war so niedrig, dass es unterhalb der Hüfte verlief. Es war das Einfachste von der Welt, hier jemanden umzubringen.
Er stand hinter ihnen. Seine Hände schwebten hinter ihren Nacken. Und dann …
»So muss es gewesen sein.«
Antonia und Milo fuhren erschrocken herum.
»So muss es gewesen sein«, wiederholte er und sah die beiden, die kein Wort herausbrachten, abwechselnd an.
»Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät«, sagte er betont beiläufig. »Ich stelle mir vor, dass Carlotta am Fenster stand und auf den Platz hinunterschaute. Der Mörder trat unbemerkt ein, so wie ich eben, und gab der Ahnungslosen einen kräftigen Stoß. Arme Carlotta. Sie ist mit einer Plötzlichkeit aus dem Leben gerissen worden, die mich wütend macht.«
Milo erholte sich erwartungsgemäß als Erster von dem Schreck, den er ihnen versetzt hatte. »Vielleicht war es so«, räumte er ein. »Ihr wisst ja, ehrwürdiger Vater, dass ich Eure Theorie, Carlotta sei ermordet worden, für möglich halte.«
Milo hatte ihn wieder »ehrwürdiger Vater« genannt, obwohl er ihm schon mehrmals vorgeschlagen hatte, dass ein »Bruder Sandro« in Anbetracht des Altersunterschieds von drei Jahren und der Tatsache, dass sie sich privat kannten, durchaus genügen würde.
»Aber«, fuhr Milo fort, »sie kann auch von selbst gesprungen sein, aus Verzweiflung darüber, dass ihr Weg sie wieder zurück ins Hurenmilieu führte.«
Sandro wägte den Einwand ab. »Es spricht allerdings einiges gegen Selbstmord. Carlotta hätte im Teatro, dem Hurenhaus Eurer Mutter, angefangen, das sie kannte und wo sie sich verhältnismäßig wohlfühlte. Sie hätte dort nicht als Hure gearbeitet, sondern als Assistentin der Vorsteherin, Eurer Mutter.«
»Trotzdem ein Weg zurück ins Milieu, dem sie versucht hatte zu entkommen.«
»Weiterhin hat sie mir wenige Tage vor ihrem Tod gesagt, dass jemand in ihre Wohnung eingebrochen sei, in dieses Zimmer, und dass der Einbrecher mit aller Vorsicht und ohne etwas zu stehlen vorgegangen sei. Nur, weil er zwei Gegenstände nicht wieder genau an ihren Platz legte, hatte Carlotta den Einbruch überhaupt bemerkt. Nicht zu vergessen die Information Eurer Mutter, dass ein unbekannter Mann sich im Milieu der Huren ausführlich nach Carlotta erkundigt hatte. Das spricht dafür, dass sich jemand …«
»Ein übliches Vorgehen im Milieu«, fiel Milo ihm ins Wort. »Als künftige Assistentin der Vorsteherin des angesehensten Hurenhauses der Stadt zog Carlotta die Aufmerksamkeit der anderen Hurenhausbesitzer auf sich.«
»Bis hin zum Einbruch?«, fragte Sandro skeptisch.
»Ich kenne das Milieu besser als Ihr, ehrwürdiger Vater, und ich sage Euch, so etwas ist nicht außergewöhnlich.«
Sandro grinste. »Wenn Ihr meint, mein Sohn.« Er wandte sich dem leeren Zimmer zu und breitete die Arme aus. »Und wie erklärt Ihr das hier?«
»Das leere Zimmer? Wir alle wissen doch, dass Carlotta ihre Habseligkeiten ins Teatro gebracht hatte.«
»Und Ihr meint, sie war noch ein letztes Mal hergekommen, um sich von dem Zimmer und dem Haus zu verabschieden, in dem sie eine ganze Weile gelebt hatte?«
»Richtig«, sagte Milo. »Ich denke, dass Carlotta in diesem Moment, in dem leeren Zimmer, als ihr klar wurde, dass das Leben nichts mehr für sie bereithielt, von der Verzweiflung besiegt wurde.«
Sandro zog die Augenbrauen hoch. »Von der Verzweiflung besiegt – was für eine monumentale Formulierung. Alle Achtung!«
»Meinetwegen nennt es, wie Ihr wollt. Dass sie erschöpft war, dass sie für kurze Zeit irre wurde, dass ihr nichts mehr etwas bedeutete. Könnte doch sein, oder? Ist zumindest genauso wahrscheinlich wie Eure Mordtheorie.«
Sandro nickte. Dass er sich mit seiner Erwiderung Zeit ließ, brachte Ruhe in die Diskussion, die bereits am Rande der Gereiztheit verlaufen war.
Er ging eine Weile in dem Zimmer auf und ab, dann sagte er: »Wenn ein gewisses Indiz nicht wäre, würde ich Euch recht geben.«
»Ein Indiz?«
Sandro zeigte auf einen ausgetrockneten Lappen, der in der Ecke neben der Zimmertür lag. »Am Tag nach Carlottas Tod, als wir alle hier waren, habe ich den Lappen angefasst. Er war feucht. Ich vermute, Carlotta hatte ihn in den Brunnen vor dem Haus getaucht, danach wischte sie hier den Boden. Wir alle wissen, wie gewissenhaft sie in Haushaltsdingen war.«
»Ich – verstehe nicht, worauf Ihr …«
Sandro strich seinen Zeigefinger über den Boden, dann hielt er ihn Milo vors Gesicht. »Kein Schmutz. Nur ein bisschen Staub, der sich in den letzten Wochen seit ihrem Tod hier angesammelt hat. Und seht Euch den Lumpen an: dreckig. Das heißt, sie hat hier am Tag ihres Todes, genauer gesagt eine Stunde vor ihrem Tod, geputzt. Verzeihung, aber ich kann einfach nicht glauben, dass ein Mensch ein Zimmer putzt, bevor er sich aus dem Fenster stürzt, weil er – wie Ihr es ausdrücktet – von der Verzweiflung besiegt wird.«
Sandro ließ einen Moment verstreichen, und als er weitersprach, hatte sich sein nachdenklicher Tonfall in einen tatkräftigen Tonfall verwandelt. »Das heißt, wir haben es mit einem Mörder zu tun, den es zu finden gilt. Ich schlage vor, wir befragen Leute, die sich gewöhnlich auf der Piazza herumtreiben, beispielsweise Händler und Bettler. Vielleicht hat ja doch jemand irgendetwas gesehen. Außerdem brauchen wir eine Personenbeschreibung des Mannes, der sich im Hurenmilieu nach Carlotta erkundigte.«
Er hatte, entgegen seiner sonstigen Art, in fast befehlsmäßigem Ton gesprochen und seine beiden Zuhörer damit ein weiteres Mal an diesem Tag überrascht. Er selbst war nicht minder verblüfft, als er sich reden hörte.
»Einverstanden«, sagte Antonia. Es war das Erste, was sie zur Diskussion beitrug, obwohl sie ihr aufmerksam gefolgt war.
Sandro lächelte sie an. »Danke«, sagte er erleichtert, korrigierte sich aber sofort. »Ich meine – das freut mich. Dann sind wir uns also einig?«
Sandro und Antonia warfen Milo einen Blick zu.
»Sicher.« Milo gab nach. »Wieso nicht? Suchen wir einen Mörder.«
Sandro wandte sich zur Tür und grinste zufrieden in sich hinein. Er hatte das Gefühl, zum ersten Mal, seit er sich mit Antonia versöhnt hatte, zum ersten Mal seit zwei Monaten, seit sie mit Milo zusammen war, einen Punkt gemacht zu haben.
»Dann also los«, sagte er.
Sie hatten beschlossen, sich aufzuteilen – leider nicht derart, wie Sandro es gerne gehabt hätte. Antonia würde die Huren im Trastevere befragen, bei denen der unbekannte Mann Erkundigungen über Carlotta eingezogen hatte, und Sandro und Milo nahmen sich vor, Passanten zu befragen, ob sie Carlottas Sturz beobachtet hatten. So schritten sie nebeneinander her, diese beiden, die dieselbe Frau liebten, ein Jesuit und der Sohn einer Bordellbetreiberin. Eigentlich ein Witz, aber nicht zum Lachen.
Die Piazza war an diesem Mittag nahezu unbelebt, denn die Sonne brannte vom Himmel herunter, und die Römer flohen zu dieser Stunde von den Plätzen in die schattigen Gassen. Die Steinmetze, die Reparaturarbeiten am Stadttor vornahmen, unterbrachen ihre laute Arbeit, herrenlose Fuhrwerke parkten unter Bäumen, zwei Soldaten der Stadtwache dösten vor der Pforte einer Taverne, ein Gemüsehändler schlief unter seinem Verkaufstisch, eine Bettlerin kauerte mit ihrem Kind neben einem Brunnen – es lag eine schwere Stille über der Piazza, so als habe die Stadt das Atmen eingestellt.
»Keine guten Voraussetzungen«, sagte Milo.
Sandro antwortete mit einer Stimme, der man anhörte, dass er sich darüber freute, widersprechen zu können. »Im Gegenteil. Als Carlotta starb, war die Piazza so leer wie heute.«
»Woher wollt Ihr das so genau wissen? Carlotta starb vormittags.«
»Stimmt. Aber auf dem Petersplatz zelebrierte der Papst eine große Messe anlässlich der Teilfertigstellung des Petersdoms. Ich selbst war dort und habe die Menschenmassen gesehen. Gewiss war auch die Piazza del Popolo leerer als an anderen Vormittagen.«
»Händler und Bettler scheren sich wenig um eine Papstmesse.«
»Carlotta starb sonntags, da dürfen Händler nicht arbeiten. Wir finden demnach ungefähr dieselben Bedingungen vor wie an jenem Vormittag.«
Mit diesen Worten ließ er Milo stehen und wandte sich der Bettlerin mit dem Kind zu. Sie war noch keine alte Frau, aber das Elend hatte ihre Züge wie eine entstellende Krankheit überzogen. Sandro kannte die Stadien des Elends. Seine Arbeit im Hospital der Jesuiten hatte ihn gelehrt, die Zeichen des nahenden Todes zu erkennen. Die Bettlerin, die nicht mehr die Kraft zum Betteln hatte, war fast verhungert und von Schädlingen befallen. Ungewiss, ob sie noch zu retten sein würde. Aber das Kind …
»Warst du im Hospital der Jesuiten?«, fragte er, erhielt jedoch keine Antwort. Er musste seine Frage noch zweimal wiederholen, bevor sie den Willen fand, ihn anzusehen und mit einer verneinenden Geste zu antworten.
»Wieso nicht?«, erkundigte er sich. »Das Hospital steht allen Bedürftigen offen.«
»Es – es liegt im dritten Bezirk«, sagte sie.
»Ja – und?«
Mit gequältem Unwillen sah sie ihn an und erklärte mit schwacher Stimme: »Um in den dritten Bezirk zu kommen, muss ich den vierten, fünften oder achten Bezirk durchqueren.«
»Mag sein, aber ich weiß noch immer nicht …«
»In diesen Bezirken ist Betteln nicht erlaubt, und die Stadtwachen schickten mich immer wieder zurück.«
Sandro erhob sich. Innerhalb eines Atemzuges wuchs eine gewaltige Empörung in ihm, die ihn trotz der Hitze wie auf Flügeln quer über den Platz zu den dösenden Wachen vor der Taverne trug.
»Du und du, ihr beide begleitet die Frau und das Kind zum Jesuitenhospital im dritten Bezirk, notfalls tragt ihr sie, und zwar sofort, verstanden?«
Die Wachen, unsanft aus süßem Nichtstun geholt, sahen sich an und lachten. »Befiehlt uns wer?«, fragte der eine den anderen, und der andere antwortete: »Befiehlt uns ein Mönch.« Daraufhin lachten sie erneut.
»Befiehlt euch Sandro Carissimi, der Privatsekretär und Visitator Seiner Heiligkeit«, korrigierte Sandro, woraufhin die beiden Männer Haltung annahmen und Entschuldigungen stammelten. Genau genommen hatte Sandro natürlich keinerlei Befugnis, Befehle zu erteilen, vor allem, da es sich nicht um die Schweizergarde handelte, sondern um die Stadtwache. Doch die Erwähnung des Papstes machte dieses Manko wieder wett.
»Sofort«, wiederholte Sandro.
Er folgte den beiden Wachleuten zum Brunnen und überwachte die Umsetzung seines Befehls. Die Frau stützte sich auf die Schulter des einen Wachmanns, der andere trug ihr Kind.
»Einen Moment noch«, sagte Sandro. »Vor ungefähr zwei Monaten, am Tag der großen Papstmesse vor dem Dom, stürzte eine Frau aus einem der oberen Stockwerke dieses Hauses dort. Hat einer von euch den Sturz beobachtet?«
Die beiden Wachen verneinten und erklärten, dass an jenem Tag fast alle Wachen rund um den Petersplatz postiert worden waren, um die Zugangsstraßen zu kontrollieren und im Gedränge nach Dieben Ausschau zu halten.
»Und du?«, fragte Sandro die Bettlerin.
Sie schüttelte den Kopf, aber sie warf ihm dabei einen Blick zu, als würde sie wünschen, ihm eine andere, eine hilfreiche Antwort geben zu können. Dann schien ihr etwas einzufallen. Sie wies mit dem Finger auf ein Gebäude auf der anderen Seite der Piazza, und als Sandro genauer hinsah, bemerkte er eine Greisin an einem offenen Fenster, die immer dort zu sitzen schien, ausdruckslos, reglos, mit gleichbleibendem Ausdruck, wie ein Porträt in Öl. Wenn sie wirklich den ganzen Tag dort am Fenster verbrachte, könnte sie etwas gesehen haben.
»Danke«, sagte er, und als die Frau sich in Begleitung der Wache entfernte, fügte er ein stilles »Alles Gute« hinzu.
Normalerweise setzte Milo alles daran, einem Rivalen immer einen Schritt voraus zu sein, auch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es zum Beispiel ums Treppensteigen in einem Mietshaus ging. An diesem Tag jedoch blieb er freiwillig eine Stufe hinter Carissimi, obwohl es ihm ein Leichtes gewesen wäre, die Geschwindigkeit zu diktieren. Er hatte nachzudenken, und er fand, dass ihm das im Rücken Sandro Carissimis leichter fiel.
Er hatte Carissimi von Anfang an nicht unterschätzt – berufsmäßige Mörder, wie Milo einer war, durften sich keine Arroganz erlauben, und diese Haltung, zu der sein heimlicher Beruf ihn zwang, hatte er auf sein ganzes Leben übertragen, auch auf die Liebe und den Kampf um diese Frau. Er wollte Antonia, und er erkannte, dass Sandro Carissimi sie ebenfalls wollte. Mehr musste er nicht wissen, um Carissimis Tod zu wünschen und vorzubereiten. Auch wenn er nicht von Massa, dem Kammerherrn des Papstes, beauftragt worden wäre, Carissimi zu töten und es wie einen Unfall aussehen zu lassen, würde er diesen Mord begehen. Denn so wie Massa fürchtete, dass Carissimi immer größeren Einfluss auf den Papst gewinnen und Massa am Ende aus dem Amt drängen könnte, so konnte Milo nicht ausschließen, dass Carissimi ihm gefährlich werden würde. Und zwar in zweierlei Hinsicht.
Zum einen spürte er, dass Antonia etwas für Carissimi empfand, das über Freundschaft oder die Hochgefühle wegen der erfolgreichen Partnerschaft bei der Aufklärung mehrerer Mordfälle hinausging. Sie hatte sich ein halbes Jahr lang erfolglos um Sandro Carissimi bemüht, als sie ihn, Milo, noch nicht gekannt hatte. Dass er in ihr Leben getreten war, hatte es ihr sehr viel leichter gemacht, mit Carissimi abzuschließen und eine Freundschaft zu ihm aufzubauen, aber sein Instinkt sagte Milo, dass es nun Carissimi war, der sich um Antonia bemühte, vielleicht weil er – wie viele römische Geistliche früher oder später – über seinen Schatten gesprungen war und das eine oder andere Gelübde nun nicht mehr so ernst nahm. Milo wäre Manns genug gewesen, diesen Kampf auf sportliche, anständige Weise zu führen, denn obwohl er seinen Rivalen nicht unterschätzte, war er sich auch seiner eigenen Stärken bewusst. Er war fähig, Antonia zu faszinieren, zur rechten Zeit Dinge zu sagen, die sie berührten, mit ihr Nächte zu verbringen, die sie glücklich machten, und er war auch in der Lage, seinen Körper und ein bisschen zur Schau gestellte Unmoral einzusetzen, an denen Antonia als Frau und Künstlerin großen Gefallen fand. All das war er bereit, in die Waagschale zu werfen, und er glaubte, Carissimi damit ausbooten zu können. Ja, er wäre Manns genug gewesen …
Aber Carissimi suchte Carlottas Mörder, und an diesem Punkt endete Milos sportlicher Anstand. Noch ahnte niemand, dass er der Mörder war, dass er in des Papstes Auftrag, überbracht durch Massa, Carlotta da Rimini aus dem Fenster gestoßen hatte. Doch dieses »noch« barg zu viele Risiken. Milo hatte selbst und hautnah miterlebt, mit welchem Scharfsinn Carissimi den Mord an der Geliebten des Papstes aufgeklärt hatte. Zwar wusste Milo, dass Massa und Julius III. kein Interesse daran hatten, dass Carissimi den Mordfall Carlotta da Rimini löste – wegen dem er sozusagen privat und in seiner Freizeit ermittelte –, aber Milo verließ sich ungern auf andere, und es wurde Zeit, dass er das Problem aus der Welt schaffte, indem er endlich Massas Geheimauftrag, der natürlich ohne Wissen des Papstes erfolgt war, erfüllte.
Wie dringend dies war, zeigte sich schon daran, dass Carissimi in diesem Moment an die Tür einer Greisin klopfte, die womöglich Zeugin des Verbrechens gewesen war. Milo bezweifelte, dass ihre Aussage ihn, selbst wenn sie etwas gesehen haben sollte, in Gefahr brächte. Aber am Anfang einer Ermittlung wiegte sich jeder Täter in Sicherheit, nur um irgendwann verdutzt festzustellen, dass eine Spur zur nächsten führte, bis vor die eigenen Füße.
Carissimi wandte sich zu ihm um. »Sie öffnet nicht. Ich weiß, sie ist da drin, ich habe sie von unten gesehen, sie saß am Fenster des obersten Stockwerks, und hier ist das oberste Stockwerk. Ihr habt sie doch auch gesehen?«
»Ja, ich habe sie gesehen«, antwortete Milo. »Vielleicht ist sie taub.«
»Wie auch immer, ich muss diese Frau sprechen.«
»In Ordnung. Tretet zur Seite.«
»Ihr habt doch nicht etwa vor, die Tür einzurammen?«
Milo grinste ihn schief an. »Ich weiß, Ihr haltet mich für einen hirnlosen Muskelprotz, aber ich sage Euch, dass außer meinen Armen und Beinen auch andere Körperteile sehr gut funktionieren, unter anderem mein Gehirn.« Er drängte sich an Carissimi vorbei zur Tür, tastete die Scharniere und das Schloss eine Weile ab und erkannte bald, wie und wo er sie zu packen hatte. Es war eine alte Tür, die dem Zustand des Hauses entsprach, und Milo hob sie einfach aus den Angeln.
»Bitte sehr«, sagte er und machte eine theatralische Verbeugung. »Der Weg für Seine Exzellenz, den Visitator des Papstes, ist frei.«
Carissimi nickte ebenso anerkennend wie widerstrebend. »Wo lernt man so etwas?«
»Na, wo wohl? Im Hurenhaus meiner Mutter. Was glaubt Ihr, wie viele verklemmte Türen ich da schon öffnen musste! Nach Euch, ehrwürdiger Vater.«
Sie traten ein. In der Wohnung roch es muffig und säuerlich, ein bisschen nach feuchter Wäsche und ein bisschen nach Nachttopf. Ein kurzer Korridor führte ohne Abzweigungen in das einzige Zimmer der Wohnung. Es war Schlafzimmer, Küche und Speisekammer in einem, mit einem sehr kleinen Kamin, in dem ein leerer Kupfertopf hing, einem Bett, dessen Laken zahlreiche blassgelbe Ringe aufwies, und einem Sammelsurium an ungespülten Schüsseln und Schalen, deren Inhalte mehr oder weniger vertrocknet waren. Irgendwo zwischen alledem, so als wäre sie nicht die Verursacherin, sondern ein Bestandteil des Durcheinanders, saß die korpulente Greisin am Fenster. Ihre grauen Haare standen in alle Richtungen ab, und es reichte aus, sie aus der Distanz anzusehen, um zu wissen, dass sie so roch wie die Wohnung.
»Was ist?«, fragte sie schroff. »Was fällt euch Lümmeln ein, hier hereinzukommen? Euch gebe ich …« Sie schwang die flache Hand und murrte; Überbleibsel einer lange vergangenen Zeit, in der ihre Gesten und Worte noch Eindruck auf Lümmel gemacht hatten.
»Ich grüße Euch«, sagte Carissimi in unnachahmlicher Höflichkeit. Er trat einen Schritt näher. »Verzeiht unser Eindringen, aber Ihr habt nicht auf mein Klopfen reagiert.«
»Wenn man auf Klopfen nicht reagiert, bedeutet das, dass man in Ruhe gelassen werden will. Hat deine Mutter dir das nicht beigebracht? Wer bist du?«
»Sandro Carissimi. Ich bin Jesuit.«
»Es gibt ein Sprichwort: Bringe deine Töchter vor den Dominikanern in Sicherheit, und dein Geld vor den Jesuiten. Scheint was dran zu sein. Dass sie sogar in Wohnungen einbrechen, hätte ich nicht gedacht.«
Milo musste lachen und ließ sich auch nicht von Carissimis missbilligendem Blick davon abbringen.
»Ich kläre den Tod einer Frau auf«, sagte Carissimi, wieder an die Greisin gewandt, die sich jedoch lieber den Flug der Schwalben ansah, so als stünden nicht zwei fremde Männer in ihrem Zimmer.
»Welcher Frau?«, fragte sie mürrisch.
»Sie wohnte auf der anderen Seite der Piazza, dort drüben, in dem Haus links von der Kirche.«
»Was geht mich das an?«
»Nun, Ihr wirkt, als würdet Ihr viel Zeit am Fenster verbringen, und da habe ich mir gedacht …«
Die Greisin warf blitzschnell ihren Kopf herum und funkelte Carissimi mit ihren grauen Augen an. »Ja«, stieß sie hervor. »Ja, ich sitze hier tagein und tagaus. Meine Beine machen nicht mehr mit, mein Rücken tut so weh, dass mir die Tränen kommen, und außer meinem Enkel, der einmal am Tag vorbeikommt, kümmert sich kein Aas um mich. Dir passt das natürlich gut in den Kram, was? Die Alte am Fenster hat vielleicht was gesehen, die ist ein solches Wrack, wo soll sie schon anders sein als am Fenster, die kommt mir gerade recht. Gut, dass sie so unbeweglich ist wie ein abgestorbener Rosenbusch, gut, dass ihre Beine nicht mehr mitmachen, wie? Hast du dir fein ausgedacht. Aber ich weiß nichts, habe nichts gesehen. Hörst du? Nichts, gar nichts, nicht das Geringste. Die Schwalben sehe ich, die Bäume, die Käfer, die über das Fensterbrett krabbeln, ich sehe das Leben … Den Tod sehe ich nicht, so weit habe ich es noch nicht gebracht. Mein Gatte hat mir genug Geld hinterlassen, so dass ich seit sechs Jahren an diesem Fenster sitzen kann, ohne was zu verdienen. Niemand muss mir was schenken, auch meine Kinder nicht, auch nicht mein Enkel. Der muss mir die Sachen bringen, die ich bezahle, fertig. Und das Geld reicht noch einmal für sechs Jahre. Dann bin ich tot. Und wenn nicht, ja dann … Eine Bettlerin wie die da unten werde ich nicht, darauf kannst du dich verlassen.« Sie schlug mit der flachen Hand auf das Fensterbrett. »Bevor es so weit kommt, werde ich den Tod aufsuchen. Ich wette, er breitet seine Arme aus, wenn er mich sieht. Da unten grinst er schon, auf dem Pflaster direkt unter meinem Fenster. Aber er muss warten. Vorerst hab ich nichts mit ihm zu schaffen. Also mach, dass du wegkommst, du und dein Tod!«
Carissimi schwieg eine Weile und sagte dann: »Wenn Eure Augen so gut sind, eine Bettlerin am Brunnen der Piazza zu sehen, sind sie auch gut genug, das Haus auf der anderen Seite zu sehen.«
Die Alte ignorierte ihn, sah den Schwalben bei ihren akrobatischen Flugmanövern zu.
»Die Frau, von der ich spreche«, insistierte Carissimi, »war eine gute Freundin von mir. Sie hatte viel Unglück im Leben. Ihr Mann und ihre Tochter starben vor Jahren unter traurigen Umständen, und vor kurzem starb auch der Mann, mit dem sie ihre zweite Ehe eingehen wollte, ein Glasmaler. Sie hatte schwere Zeiten erlebt, aber sie hat nie aufgegeben. Ich glaube nicht, dass sie in den Tod gesprungen ist. Sie hat es nicht verdient, dass ihr Mörder einfach so davonkommt. Damit verrät man ihr ganzes Leben, ihren Kampf …«
»Ach, hör doch auf«, murrte die Alte, ohne ihn anzusehen. »Ihr seid doch alle gleich, ihr Pfaffen. So verlogen … Verrat. Kampf. Hat es nicht verdient. Floskeln sind das, alles Floskeln. Die Bettlerin da unten, die Bettlerin mit dem Kind, die du von den Wachen hast abführen lassen, die du vom Platz vertrieben hast, die hat ihr Schicksal auch nicht verdient. Scher dich weg, sage ich.«
Carissimi seufzte. »Gut, ich werde gehen, wider besseres Wissen, denn ich glaube, Ihr habt etwas gesehen. Aber ich gehe nicht, ohne eines richtiggestellt zu haben. Die Bettlerin habe ich in das Jesuitenhospital bringen lassen, wo man ihr Leben und das Leben des Kindes retten kann. Sie hatte vorher vergeblich versucht, dorthin zu gelangen. Lebt wohl.«
Carissimi verließ das Zimmer, und Milo folgte ihm. Gerade, als er dabei war, die Tür wieder in die Angeln zu heben, rief die Frau: »Komm zurück. Komm wieder her. Nun mach schon.«
Sie kehrten in das Zimmer zurück.
Die Alte zog ein reuevolles Gesicht, aber nur sehr kurz, dann stellte sich die Schroffheit wieder ein.
»Ich habe gesehen, wie die Frau aus dem Fenster stürzte, ein paar Wochen ist das her, ich weiß nicht genau. Ein Tag ist wie der andere. Sie hat nicht geschrien, doch selbst wenn … Der Platz war leer, niemand hätte sie gehört. Überhaupt: Was bringt so ein Schrei? Er ändert ja nichts.«
Ihre Finger klopften nervös auf das Fensterbrett. »Weil sie nicht geschrien hat, habe ich geglaubt, dass sie ihren Tod wollte, dass sie darauf vorbereitet war, so wie ich einmal darauf vorbereitet sein werde … Aber in der Nacht träumte ich von ihr, ich sah ihren Sturz, und in der Nacht darauf wieder und wieder. Und wenn ich dann aufwachte und mich an den Augenblick erinnerte, als ich sie in die Tiefe fallen sah, ich meine den wirklichen Sturz, nicht den im Traum, dann glaubte ich plötzlich eine zweite Gestalt zu bemerken, einen im Dunkel des Zimmers verborgenen Schatten.«
»Einen Mann?«
»Hör doch zu, Pfaffe, ich sage dir, ich sah einen Schatten. Er stand einen Schritt hinter dem Fenster, von mir aus betrachtet. Vielleicht der Teufel selbst … Was weiß ich!«
»Aber Ihr habt ganz sicher jemanden gesehen?«
»Wenn ich’s doch sage.«
»Wieso habt Ihr das nicht gemeldet?«
»Bist du verrückt? Weißt du, was sie mit einem machen, der drei Tage später ankommt und sagt, er habe einen Schatten gesehen? Sie holen dich aus deiner Wohnung, dann fragen sie dich aus. Wenn du an einen Halunken gerätst, dessen Sohn oder Neffe gerade eine günstige Wohnung sucht, dann sperrt er dich wegen Irreführung für ein paar Wochen in ein Verlies, und wenn du rauskommst, ist deine Bleibe weg. Oder er übergibt dich einem geistlichen Gericht, das dich maßregelt, weil du behauptet hast, den Teufel gesehen zu haben. Die drehen sich alles hin, wie sie’s brauchen. Ich habe nichts gesehen, und dabei bleibt es. Dir sage ich es, weil du der Bettlerin geholfen hast, und dem da sage ich es …«
Milo sah sich mit einem Mal ihrem Blick ausgesetzt, einem Blick aus alten, aber scharfen Augen. Einen Moment lang kam es ihm vor, als sehe sie in ihn hinein, als erkenne sie in ihm jenen Schatten im Dunkel von Carlottas Zimmer.
Er riss sich zusammen und hielt ihrem Blick stand, auch wenn er sie am liebsten gepackt und über das Fensterbrett gestoßen hätte, jenem Tod entgegen, der schon mit offenen Armen grinsend auf sie wartete.
»Der da passt nicht zu dir«, sagte sie zu Carissimi. »Dem sind Bettlerinnen egal. Ich sage dir, der ist kalt wie Eisen im Winter.«
Carissimi konnte sich ein befriedigtes Schmunzeln nicht verkneifen, aber er war natürlich viel zu höflich, um einem Dritten gegenüber seine Befriedigung einzugestehen.
»Ich versichere Euch«, sagte Carissimi zu der Alten, »dass auch mein Begleiter ein liebendes Herz hat.«
Die Alte murrte: »Ein liebendes Herz mag er haben, eine Seele hat er nicht. Und ohne die wird auch die Liebe egoistisch.«
Eine Weile schwiegen sie, dann sagte Carissimi: »Ich danke Euch für die Offenheit und …«
»Schon gut, schon gut. Und jetzt raus. Dass Ihr mir aber ja die Tür wieder einhängt. Und dass du es dir nicht einfallen lässt, noch einmal herzukommen.«
»Vielleicht ein kurzer Besuch – irgendwann?«
»Nein. Verschwinde. Nun mach schon. Geh. Na, wird’s bald.« Ihre Hand schlug auf das Fensterbrett, dann schluckte die Frau schwer, und abrupt wandte sie, seit Jahren eine Zuschauerin in der Theatervorstellung des Lebens, sich wieder den Schwalben und den Bäumen zu.
2
Das Collegium Germanicum war einem Gebet des jesuitischen Ordensgenerals Ignatius von Loyola entsprungen. Eines frühen Morgens, so hieß es, sei ihm mitten in einer tiefen Andacht die Idee gekommen, eine ganz besondere Schule zu gründen, eine Schule nämlich, deren Ziel es war, geistige Rekruten für den Kampf um das für den Katholizismus fast schon verlorene Deutsche Reich auszubilden. Wieder einmal sah Loyola, der einst Soldat gewesen war, seine Jesuiten als Speerspitze der Gegenreformation. Das Collegium sollte jedem jungen deutschen Mann offenstehen, egal, von welchem Stand er war, gleichgültig, aus welchem Teil des Landes er kam. Die Schulgebühren waren lächerlich niedrig. Man musste weder in den Orden eintreten noch überhaupt eine geistliche Laufbahn anstreben, denn aus der Schule sollten nicht nur die künftigen Prälaten des Reiches hervorgehen, sondern auch Kanzler, Sekretäre, Ärzte, Bankiers, kurz, Scharen grauer Eminenzen, die Herrscher beeinflussen und Völker dirigieren konnten. Auf dem Stundenplan standen deshalb nicht nur Fächer wie Schreiben, Rechnen, Theologie, Griechisch und Latein, sondern auch Buchhaltung, Rhetorik, Heilkunde, Astronomie, Völkerkunde und Handel.
Der Anfang war – wie jeder gute Anfang – bescheiden. Nur wenige Schüler hatten sich zum ersten Trimester eingefunden: ein bayrisches Brüderpaar aus gutem Hause, neunzehn und siebzehn Jahre alt, sowie der siebzehnjährige mittellose Sohn eines Tiroler Schultheißen. Und das Schulgebäude stellte sich, zu Sandros Erstaunen, als unscheinbares, ein bisschen enges Haus heraus. Zwar lebten alle Jesuiten statt in Klöstern in einfachen Häusern zusammen, denen manchmal ein Hospital oder eine Armenküche angeschlossen war, aber hier handelte es sich ja immerhin um eine Schule, die sich anschickte, Geschichte zu schreiben. Was pompös als »Collegium Germanicum« daherkam, war vorerst eine mit drei Schülern und vier Jesuiten belegte Unterkunft, mehr Obdach denn Lehranstalt.
Dass das Collegium dennoch sogleich für Furore sorgte, lag an dem Verbrechen, das am Abend der Eröffnung in seinen Mauern verübt wurde.
Sandro kam zu spät zum Eröffnungsgottesdienst in die Kapelle gegenüber dem Germanicum. Als er zusammen mit seinem Diener und Gehilfen Angelo eintraf, waren die Festreden diverser geistlicher Würdenträger schon beendet und die Messe halb gelesen.
»Ich habe Euch gesagt, dass wir uns beeilen müssen, Exzellenz«, sagte Angelo, der, mehr als Sandro selbst, um ein tadelloses Bild Sandros bemüht war. Angelo war, seit sie sich kannten, von übereifriger Fürsorge gewesen, sei es, weil er einfach nur seine Arbeit gut machen wollte, oder sei es, weil Übereifer und Fürsorglichkeit Wesenszüge seines Charakters waren. Aber seit Sandro den Mord an der »Hure von Rom«, Julius’ Geliebter, aufgeklärt hatte und stadtbekannt geworden war, verhielt sein gleichaltriger Diener sich wie eine stolze Mutter und Glucke.
»Rom ist heiß wie ein Ofen, Angelo. Ich wollte mich frisch machen, bevor ich meinen Ordensgeneral treffe. Hätte ich ihm verschwitzt unter die Nase treten sollen? Außerdem sei froh, wäre ich nicht noch einmal in den Vatikan zurückgekehrt, würdest du jetzt nicht hier sein und die einmalige Gelegenheit haben, den General der Jesuiten kennenzulernen.«
»Den schwarzen Papst«, ergänzte Angelo bedeutungsvoll.
Sie hielten sich im Hintergrund, in der Nähe des Kirchenportals. Die schmucklose, kleine Kapelle war in ebenso schmucklose Düsternis getaucht, die nichts Geheimnisvolles und nichts Erhabenes hatte. In ihr roch es abgestanden, so als habe seit einem Jahrhundert kein menschliches Wesen mehr einen Fuß in sie hineingesetzt, aber es mochte sein, dass diese Wahrnehmung mit Sandros Besuch in der muffigen Wohnung der Greisin zusammenhing und eher eine Sinnestäuschung war.
Er blickte auf die Rücken und gebeugten Häupter der Schüler und vor allem seiner Mitbrüder und fragte sich, wer von ihnen wohl Ignatius von Loyola war. Denn er hatte den Mann, der vor rund zwölf Jahren die »Societas Jesu« gegründet und innerhalb dieser kurzen Zeit dem Orden einen sagenhaften Zulauf beschert hatte, noch nie gesehen. Alles, was er über ihn wusste, gründete sich auf offizielle Verlautbarungen und inoffizielle Gerüchte, und Sandro wusste, das Erstere stets zu einer idealisierten Darstellung und Letztere zu einer diffamierenden Darstellung neigten.
Plötzlich rannte einer der Messeteilnehmer an Sandro vorbei nach draußen, ein noch sehr junger Mann in einem roten Talar, offensichtlich also einer der künftigen Schüler des Collegiums. Er wirkte gehetzt. Sandro sah ihm hinterher …
»Den Kelch des Heiles will ich ergreifen und anrufen den Namen des Herrn«, ertönte es laut vom Altar her, und Sandros Aufmerksamkeit richtete sich gezwungenermaßen wieder in den Kirchenraum. Der Jesuit, der die Messe las und nun im Begriff war, die Heilige Kommunion zu spenden, war von imposanter Statur, groß und kräftig, mit einem besonders großen Kopf und einem energischen Zug im Gesicht, und an seinem Dialekt erkannte Sandro, dass es sich um einen Deutschen handelte, denn Antonia sprach im selben Dialekt. Er segnete jeden Einzelnen der Kommunikanten, die sich, ihrem Rang gemäß, vor ihm aufreihten. Sandro empfing die Kommunion als einer der Letzten.
»Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre deine Seele zum Ewigen Leben.«
»Amen«, sagte Sandro und der jesuitische Priester legte ihm das gebrochene Brot auf die Zunge. Nach ihm folgten nur noch Angelo sowie die beiden Schüler in ihren roten Talaren.
Statt mit der Liturgie fortzufahren, verharrte der jesuitische Priester, und Sandro fragte sich, worauf er wohl warte. Eine Weile verging, in der nichts geschah, bis der Schüler, der vorhin hinausgerannt war, zurückkehrte. Er schritt zum Altar, der Priester brach ein großes Stück Brot und übergab es dem Schüler, der halb andächtig, halb schuldbewusst den Kopf senkte.
»Amen.«
Nach dem Ende der Messe – es schlug die siebte Stunde – zog eine Gruppe von etwa zwanzig Menschen an Sandro vorbei durch das Portal ins Freie, um auf der anderen Seite der Gasse sofort wieder vom Collegium verschluckt zu werden. An der Spitze der Gruppe schritt ein in sich gekehrter, glatzköpfiger Mann mit kleinen Ohren, der Sandro nicht angesehen hatte, und doch hatte Sandro das Gefühl gehabt, von ihm bemerkt worden zu sein.
Und dieses – eher unangenehme – Gefühl blieb präsent, ja, verstärkte sich noch. Im Speisesaal angekommen, stellte jeder aus dem Zug sich hinter einen Stuhl. Die Tische waren in eirunder Form angeordnet, und Ignatius hatte den Platz an der oberen Krümmung inne. Er hielt, bevor man gemeinsam das Abendmahl einnehmen würde, eine kleine Ansprache. Es gingen weder Strenge noch Kälte von ihm aus. Seine Stimme war sanft, seine Miene und die zu Boden blickenden Augen waren von Gelassenheit erfüllt, trotzdem glaubte Sandro die ganze Zeit über, von Ignatius skeptisch beobachtet zu werden. Er hielt es allerdings für möglich, dass jeder in diesem Raum dasselbe Gefühl hatte.
»… und so wird es von unser aller Entschlossenheit und Verbundenheit abhängen, ob diese neue Lehranstalt den großen Ambitionen, die mit ihr verknüpft sind, Genüge tut.« Ignatius machte eine ziemlich lange Pause, in der die Stille im Saal nur von gelegentlichem Räuspern unterbrochen wurde. »Meine Brüder und meine Schüler des Collegium Germanicum. Morgen ist der erste Unterrichtstag. Am Anfang wird alles noch ein wenig ungeordnet vonstatten gehen, aber die familiäre Atmosphäre dieses Hauses wird es ermöglichen, schnell die Ordnung herzustellen. Eine kleine Schülerzahl hat den Vorteil, dass man sich besser auf steigende Schülerzahlen vorbereiten kann. Auch der Ölbaum, unter dem Jesus Christus ruhte, gedieh nicht über Nacht, sondern erreichte sein hohes Alter durch sparsames Wachstum. So soll es sein. Da jedoch auch eine kleine Schule wie diese einen Rektor benötigt, werde ich in den nächsten Tagen eine Entscheidung bekannt geben.«
In diesem Moment machte Sandro eine interessante Entdeckung. Sein Blick war während der Ansprache des Ignatius über die anderen Personen im Saal geglitten. Neben ihm stand ein korpulenter Mitbruder mittleren Alters mit einem Atemgeräusch, wie man es haben kann, wenn man die Abruzzen bestiegen hat, nicht aber im Ruhezustand nach einem Gottesdienst. Der etwa mittvierzigjährige Bruder daneben – es handelte sich um den stimmkräftigen Jesuiten, der die Messe gelesen und die Kommunion erteilt hatte – fühlte sich offensichtlich davon gestört, denn er stieß ihn leicht an und runzelte die Stirn in strenger, höchst tadelnder Weise, von der sich der Dicke auch durchaus beeindrucken ließ, denn er atmete von da an zwar immer noch tief und schnell, aber deutlich leiser. Dahinter befand sich der Einzige, der nicht Jesuit war, sah man einmal von Angelo, den Schülern und hochgestellten Gästen ab. Er trug ein weltliches, eher altmodisches Gewand und einen langen, grauen Bart, und er betrachtete fast die ganze Zeit über die Hände auf seinem Schoß, nur unterbrochen von gelegentlichen Seitenblicken auf Ignatius. Da er den Platz neben dem Pater General einnahm, musste er, der kein Jesuit war, für Ignatius von besonderer Wichtigkeit sein. Aber auch bei der Wahl, wer an seiner anderen Seite sitzen sollte, hatte Ignatius eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Weder einem der anwesenden Prälaten war dieser Vorzug zuteilgeworden, noch Luis, dem nach Ignatius in Italien bekanntesten Jesuiten, sondern dessen jungem Assistenten Miguel Rodrigues. Luis saß rechts von Miguel, es folgten die drei Schüler und schließlich, am unteren Endes des Ovals, die geladenen Prälaten.
Gerade als Sandros Blick auf seinen ehemaligen Freund und Meister Luis de Soto fiel, erwähnte Ignatius den Rektorenposten, und in diesem Moment sah Luis auf und suchte etwas auf Sandros Seite der Sitzreihe. Sandro beugte sich leicht vor, um zu erkennen, wen oder was Luis betrachtete, und tatsächlich sah er, dass der Jesuit mit dem großen Kopf und strengen Habitus Luis’ Blick erwiderte. Umgehend hatte dieser Mitbruder seine volle Sympathie, da es sich offensichtlich um einen Konkurrenten von Luis handelte. Es schien, als seien die Würfel noch nicht gefallen.
Die erfreulich kurze Ansprache war beendet, Ignatius schätzte das Wesentliche. Der dicke Mitbruder neben Sandro stand auf und gab einem der Schüler ein Zeichen. Gemeinsam gingen sie durch eine Seitentür aus dem Saal und kehrten nach wenigen Augenblicken mit schweren Töpfen zurück, wobei sie von einer schon etwas älteren, korpulenten, aber rüstigen Frau unterstützt wurden, die den schwersten aller Töpfe trug. Der Vorgang wiederholte sich noch ein paar Mal, bevor alle Gerichte auf der Tafel standen. Die Mischung der Speisen war ungewöhnlich, so als hätten zwei konkurrierende Köche aus verschiedenen Ländern einen Wettstreit ausgefochten. Viele Speisen waren Sandro bekannt: Kaninchen in Öl und Wein, Fischsuppe, ausgebackenes Gemüse, gedämpfte Kalbsnieren, Flusskrebse … Ein Festmahl, in seiner Üppigkeit gänzlich unjesuitisch, aber in Anbetracht des besonderen Tages offenbar von Ignatius von Loyola geduldet. Für Sandro fremd waren das Fleischgeschnetzelte mit gegartem Dörrobst, die gekochten Schweinefüße sowie das nach Bier schmeckende Hühnerklein. Dazu gab es bereits vorportionierte Platten mit Brot, Salz, Käse, ein paar Kirschen, einen mit Rahm vermischten Rettichsalat sowie Wasser und Wein.
Es kam nicht zu einer Unterhaltung, an der sich alle beteiligt hätten, stattdessen wurden die Gespräche leise geführt. Der Pater General redete mit Miguel Rodrigues, der Stimmkräftige mit dem Gelehrten und der Dicke mit sich selbst. Er lobte das Essen, während er es in unaufhörlicher und geradezu Achtung gebietender Folge in sich hineinschaufelte, wobei er den Schweinefuß – wie Sandro meinte – ohne ein einziges Mal zu atmen verspeiste. Als er sah, dass Sandro seinen Schweinefuß von sich schob, fragte er, ob er ihn nehmen dürfe. Sein starker Dialekt wies ihn als Nicht-Italiener aus. Vermutlich kam er aus dem Reich, was in einer Schule für Deutsche nicht überraschte.