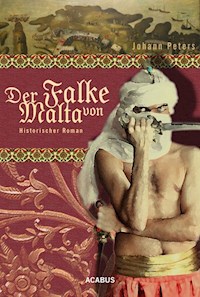Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im 16. Regierungsjahr des Pharao Ramses IX. werden im Tal der Könige Pharaonengräber geplündert. Schnell findet sich ein Verdächtiger: der einfache Steinhauer Amenpanufer wird von der Medjaiwache gestellt, die Beute aus den Gräbern bei einem stadtbekannten Hehler gefunden. Der Fall scheint geklärt, und doch bleibt Pa-Ser, Bürgermeister von Theben-Ost, skeptisch. Handelte Amenpanufer im Alleingang? Als der Schreiber der Grabstätten seine Arbeiter ebenfalls des Grabraubes verdächtigt, wird Pa-Ser klar, dass er die Ausmaße der Grabraube völlig unterschätzt hat. Ist etwa Paveru, der Herr der Gräber, selbst in diese Verbrechen verwickelt? Nach und nach werden die Machenschaften der Grabräuber aufgedeckt, doch die Verwicklungen der Mächtigen Thebens in das lukrative Geschäft sind schwer zu beweisen. Zahlreiche Intrigen machen die Aufklärung der Diebstähle nahezu unmöglich, und doch müssen Schuldige bestraft werden. Am Ende gibt es ein Opfer. Und einen Sieger: die Gier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johann Peters
Die Grabräuber von Theben
Peters, Johann: Die Grabräuber von Theben, Hamburg,
ACABUS Verlag 2012
Originalausgabe
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-058-0
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-137-2
Print (Paperback):ISBN 978-3-86282-057-3
Lektorat: Karina Woller, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: Sophia Schmidt, ACABUS Verlag
Umschlagmotiv: © frenta - Fotolia.com; © Glassseeker - Fotolia.com
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2012
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Für meine Frau Daniela, denn die größte von allen, ist die Liebe
Abend des 10. Tages des dritten Monats im 16. Regierungsjahr Ramses IX.
Paveru stand allein auf der großen Terrasse, von der aus er einen schönen Blick über den Teich, den die Arbeiter schon vor Jahren für ihn angelegt hatten, genießen konnte. Die Nacht war angenehm mild und der Mond spiegelte sich auf der Wasseroberfläche. Achet, die Zeit der Nilschwemme und der großen Hitze des Sommers, war schon fortgeschritten und Peret, die Zeit der Aussaat, näherte sich mit großen Schritten. Die Überschwemmung war in diesem Jahr endlich wieder einmal ausreichend gewesen, sodass die Bauern der Ernte mit gutem Gefühl entgegensehen konnten. Noch immer führte der Nil eine Menge Wasser mit sich, auch wenn er bereits wieder in sein angestammtes Flussbett zurückgekehrt war. Doch über die Ernte machte Paveru sich keine Gedanken. Mit den Feldern der Lebenden hatte er wenig zu tun. Sein Hauptaugenmerk galt den Feldern, die von den Toten bewohnt wurden.
Langsam verließ Paveru die Terrasse und ging in den Garten hinab. Einzelne Fruchtbäume standen hier weit verstreut. Die Villa, die er hier draußen etwas außerhalb von Theben am Westufer des Nil bewohnte, war sehr großzügig gebaut. Passend dazu war der Gartenbereich eher wie ein Park angelegt. Er führte ein gutes Leben, eigentlich. Die Ärzte machten ihm gelegentlich Vorhaltungen wegen seiner extremen Körperfülle. Sie sagten, der runde Bauch und das viele Fett rund um das Kinn wären nicht gut für seine Organe. Aber er aß einfach zu gern, als dass er seine Figur dem anpassen könnte, was die Ärzte für gesund hielten. Außerdem brauchte er keinen Wert auf Schönheitsideale zu legen. Wenn er eine Frau haben wollte, bekam er sie auch.
Der Mann, den er um diese späte Stunde hier draußen erwartete, achtete seit Jahren auf äußerste Diskretion. Ein wichtiger Umstand, wenn man bedachte, welche Feinde er sich in Theben schaffen könnte, wenn man von ihren regelmäßigen Treffen erführe. Trotzdem hätte er sich eine menschenwürdigere Zeit aussuchen können, dachte Paveru, während er unter einer Palme stehen blieb.
Paveru musste nicht lange warten, bis sich ein Schatten von einem der anderen Bäume löste. Der rundliche Mann sah dem Schatten gelassen entgegen. Sein Gast trug einen weiten Umhang und eine Kapuze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Paveru musste grinsen bei dem Gedanken daran, dass sein Informant jedem, der ihm so in der Stadt begegnete, sofort verdächtig vorgekommen wäre. Aber der hochgewachsene Mann liebte derartige Maskeraden, sie hatten für ihn einen Hauch von Abenteuer.
Der Schatten war mittlerweile so nah herangekommen, dass sie sich flüsternd verständigen konnten.
„Warum heute Nacht, zu dieser Stunde?“, fragte Paveru, noch immer erbost darüber, um seinen Schlaf gebracht worden zu sein.
„Ich habe wichtige Informationen für dich. Du solltest dir anhören, was ich zu sagen habe“, antwortete sein Gesprächspartner gleichmütig.
„Habe ich das je nicht getan?“
Der Gast schwieg für einen Moment. Diese beiden Männer verband keine Freundschaft, es war mehr ein gemeinsames Geschäftsinteresse, das sie zusammenschweißte. Aber jeder von ihnen wusste, dass er sich auf den anderen verlassen konnte.
„Also, was hast du mir zu sagen?“, fragte Paveru, bemüht seine Stimme nicht allzu gereizt klingen zu lassen.
„Es wird morgen passieren. In den Nachmittagsstunden. Du solltest ihnen zuvorkommen, wenn du deinen Plan durchführen möchtest“, erklärte Paverus Besucher eindringlich.
„Ich werde ihn durchführen“, murmelte Paveru bestimmt.
„Dann sorge dafür, dass bis zu dem Zeitpunkt, da Re am höchsten steht, die Arbeit getan ist. Sonst wird uns einiges entgehen“, entgegnete sein Gast.
„Und du bist dir sicher, dass er der Richtige ist?“, fragte Paveru nicht zum ersten Mal, seitdem sie diesen Plan gefasst hatten.
„Er ist der Kopf des Ganzen“, bestätigte sein Gegenüber.
Paveru nickte gemächlich. Er dachte nach. Die Entwicklung kam schneller als er gedacht hatte, aber wirklich überrascht war er trotzdem nicht. Es wurde höchste Zeit, dass er etwas tat. Das Westufer war sein Reich. Jemand hatte es gewagt, in dieses Reich einzudringen und seine Spuren zu hinterlassen. Das würde er nicht dulden. Zumindest nicht ohne eine gewisse Gegenleistung.
*
Das Tal, in welchem die Könige und Pharaonen seit Generationen begraben wurden, lag verlassen vor ihnen. Um diese Stunde hielt sich kein Arbeiter mehr in der Nähe der Grabanlagen auf. Nur einige wenige Medjai hielten an den Eingängen des Tales Wache. Einmal pro Stunde patrouillierte eine kleine Gruppe der nubischen Einheit durch das Tal, um sicherzugehen, dass keine ungebetenen Gäste hier waren. Die Wachen konnte man leicht umgehen.
Amenpanufer und seine sieben Gefährten waren mit zwei Schilfbooten vom Ostufer des Nil herübergekommen. Die kleinen Gefährte lagen an unterschiedlichen Stellen sicher vertäut zwischen den Büschen des Ufers. Ihr Vorhaben war gefährlich, es war das mit Abstand Gefährlichste, was ein Mensch tun konnte. Sie würden das Grab eines Pharao schänden. Jeder von ihnen kannte seit seiner Kindheit die Geschichten über das Schicksal, das Grabräuber dereinst ereilt, wenn ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit mit der Feder der Maat gewogen wird. Es wird für zu schwer befunden und der Eingang in das ewige Leben bleibt ihnen verwehrt. Auch war jedem von ihnen klar, was sie anrichteten, wenn sie eine Grabkammer öffneten und den Toten die Schätze stahlen. Sie zerstörten dessen Leben nach dem Tod oder machten es zumindest weniger lebenswert. Doch das alles störte sie wenig. Jeder von ihnen hatte eine Familie zu ernähren. Die armen Arbeiter aus der Stadt Theben kannten den Hunger nur zu gut und der Steinhauer Amenpanufer war in Sorge, da seine Frau in Kürze ein weiteres Kind zur Welt bringen würde. Schon die beiden bereits vorhandenen Kinder verlangten ihm eine Menge ab. Ein drittes Kind zu versorgen, war mit seinen kargen Einkünften nahezu unmöglich.
Senep hatte die Führung übernommen und sie auf Umwegen zu einem alten Beamtengrab geführt. Dieses war durch einen Vorhof vor neugierigen Blicken geschützt. Von hier aus konnte man, so hatte es Seneps Quelle ihnen erklärt, einen Durchgang zu dem Grab eines Pharao schlagen. Amenpanufer und Inebni machten sich an die Arbeit. Sie waren beide Steinhauer von Beruf und ihnen oblag es, die Gräber zu öffnen. Schon nach einigen kurzen Momenten hatten die beiden Männer mit ihren Meißeln ein ansehnliches Loch in den Stein gearbeitet. Es dauerte nicht lange und der Durchgang war groß genug, um hindurchschlüpfen zu können. Der Informant, der ihnen die Lage der Grabkammer verraten hatte, war sich sicher, dass hier einige sehr wertvolle Schätze zu finden wären.
Die Tatsache, dass der Zugang, welchen sie geschlagen hatten, von diesem künstlich angelegten Vorhof aus in das Grab führte, sorgte dafür, dass man ihre Tat auch bei Tage nicht sofort entdecken würde. Das erleichterte ihnen den Verkauf der gestohlenen Ware. Es war immer besser, Waren aus einem Grab zu verkaufen, dessen Inhalt noch nicht von den Medjai gesucht wurde. Auch wenn es immer Wege gab, die wichtigsten Beamten milde zu stimmen.
Senep gab seinem Sohn Kerasher ein Zeichen, dass dieser voran in die Grabkammer kriechen sollte. Kerasher hatte gerade seinen zwölften Sommer gesehen und war noch klein genug, um selbst durch die schmalsten Gänge zu passen. Er begleitete seinen Vater auf jedem ihrer Raubzüge.
Es dauerte einen Moment, bis der Junge seinen Kopf wieder aus dem Loch herausstreckte und den anderen Männern grinsend zunickte. Seine Augen leuchteten regelrecht im Licht der Sterne. Er hatte bereits einen kleinen Teil der Schätze gesehen, die dem hier liegenden Mann mit auf den Weg ins Jenseits gegeben worden waren. Keiner der Acht wusste genau, wer hier begraben worden war. Es war ihnen auch egal. Alles, was zählte, war der Gewinn, den diese nächtlichen Unternehmungen einbrachten. Und dieser war keinesfalls zu verachten. Senep schloss für einen Moment die Augen und schickte ein kurzes Stoßgebet gen Himmel. Das tat er jedes Mal, bevor sie eine Grabkammer betraten. Weniger, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, eher, weil er so den direkten Auswirkungen irgendwelcher Flüche, wie Krankheiten oder schweren Schicksalsschlägen, zu entgehen hoffte.
Senep folgte seinem Sohn als Erster. Dann schob Amenpanufer sich langsam durch den schmalen Zugang hindurch in die Grabkammer. Als auch er drinnen war und Inebni draußen seinen Wachtposten bezogen hatte, zündeten sie eine Fackel an. Sie mussten vorsichtig sein, da der Lichtschein durch das Loch nach außen dringen konnte. So würden die Medjai möglicherweise auf sie aufmerksam werden. So mancher Grabräuber war bereits gefasst worden, weil er zu sorglos an sein Werk gegangen war. Aus diesem Grund verteilten sich die anderen vier Männer in der Umgebung, um nach herannahenden Wachen Ausschau zu halten.
Die Reichtümer, die in diesem Grab aufgehäuft waren, übertrafen die Erwartungen der Männer bei Weitem. Neben allerhand Edelhölzern in Form von Stühlen, Kisten und Truhen fanden sie Goldvasen, Amulette und goldene Dolche. Dann öffneten sie den Sarkophag des verstorbenen Herrschers. Bisher hatten sie sich nur am Eigentum des Toten vergangen. Das war zwar bereits eine schwere Sünde, aber der Diebstahl der Grabbeigaben hatte nur wenig Einfluss auf das jenseitige Leben des Verstorbenen. Nun aber entnahmen sie die Totenmaske und wickelten den Toten aus den Binden, welche nach der Einbalsamierung um seinen Körper gewunden worden waren. Jedes der goldenen Schutzamulette, das dabei zum Vorschein kam, wanderte in einen kleinen Sack. Dann hatten sie nur noch den balsamierten Leichnam selbst vor sich. Sie rissen den Halsschmuck und die Ringe des Verstorbenen ab und steckten sie ein. Anschließend rafften sie zusammen, was sie tragen konnten. Die Diebe packten mehrere Säcke voll und schoben diese durch das Loch hinaus. Draußen nahm Inebni die Sachen entgegen und legte die Säcke auf den Boden. Senep verließ die Kammer als Erster. Ihm folgte sein Sohn. Als Amenpanufer noch einen letzten Blick auf die Verwüstung richtete, die sie hier hinterließen, erfasste ihn ein eigenartiger Übermut. Leise lachend warf er die Fackel mitten in einen Stapel von hölzernen Gegenständen. Als die Flammen hinter ihm hochschlugen, spürte er die Hitze, die durch das kleine Loch entwich. Schnell beeilte er sich, zu den anderen ins Freie zu kommen. Leise murmelte er: „Wir müssen schnell verschwinden. Mir ist da drinnen die Fackel hinuntergefallen. Das ganze Grab brennt.“
Inebni schüttelte erschrocken den Kopf. „Hat dich der Wahnsinn gepackt? Das Feuer wird bis in die frühen Morgenstunden rauchen und dann entdecken die Wachen den Einbruch.“
Senep fuhr Amenpanufer aufgebracht an: „Das war keine Unvorsichtigkeit, das war reine Absicht. Woher rührt nur dein Hass auf die Toten?“
„Schau dir an, was sie besitzen. Was für Schätze selbst nach ihrem Tod in ihren Grabkammern liegen. Und wir? Wir darben Tag für Tag vor uns hin. Der Pharao gibt uns nichts zu essen. Der Wesir und die Priester auch nicht. Wir sollen vor Hunger sterben, während Männer, die vor hundert Jahren starben, großartige Reichtümer in ihren Gräbern haben“, zischte der Gescholtene wütend zurück.
Inebni mischte sich sichtlich nervös in den Streit ein: „Schweigt endlich. Wir werden das Loch mit Erde und Steinklumpen verschließen. Amenpanufer pack’ mit an. Und du Senep sende deinen Sohn los. Er soll die anderen zusammensuchen. Und Ruhe jetzt. Ich habe keine Lust, noch heute Nacht vor den Aufseher der Gräber geschleppt zu werden.“
Murrend packte Amenpanufer mit an. Das Loch war schnell wieder verschlossen, auch wenn die heiße Luft und die stinkenden Dämpfe, die aus dem Inneren des Grabes kamen, ihnen die Arbeit nicht gerade erleichterten. Als sie ihre Spuren bestmöglich verwischt hatten, wurden die Lasten auf die acht Männer aufgeteilt. Jeder bekam zwei Säcke, die er zu tragen hatte. Das tatsächliche Aufteilen der Beute würden sie später nachholen, wenn sie in Sicherheit waren. Dann teilte sich die Gruppe auf. Amenpanufer, Inebni, Senep und Kerasher waren gemeinsam in einem Boot gekommen. Die anderen vier Männer hatten weiter flussaufwärts festgemacht. So war das Risiko geringer, entdeckt zu werden, als wenn sie mit zwei Booten an der gleichen Stelle angelegt hätten.
Die Männer machten sich auf den Rückweg zu ihren Booten. Kurz bevor sie die Stelle erreichten, an der sie das Schilfboot versteckt hatten, gab Senep ihnen ein Zeichen, still zu sein. Leise zischte er: „Legt euch auf den Boden.“
Sofort warfen die Männer sich der Länge nach hin. Amenpanufer fragte leise: „Was gibt es?“
„Da vorn, ich habe einen Schatten gesehen. Hört ihr nicht die Stimmen?“, flüsterte Senep nervös.
„Ich höre nichts“, entgegnete Amenpanufer verwirrt.
„Weil du taub bist, du Schwachkopf“, zischte Inebni genervt. Auch er hatte die gedämpften Stimmen gehört. Jemand machte sich an ihrem Boot zu schaffen.
„Das werden die Medjai sein. Ich hatte gleich so ein ungutes Gefühl“, murmelte der Steinarbeiter. Amenpanufer schnaubte verächtlich. Er schob sich etwas weiter vorwärts, um zu sehen, ob wirklich jemand an der Stelle war, wo ihr Boot lag. Ihn nervte die ewige Angst seiner Gefährten. Sie waren noch nie erwischt worden, warum sollte das heute Nacht anders sein? Während er sich auf dem trockenen Boden fortbewegte, zog er die beiden Säcke, die er getragen hatte, hinter sich her. Plötzlich klirrte Metall auf Metall. Der Lärm hallte weithin durch die Nacht. Sofort blieb Amenpanufer wie erstarrt liegen. Alles um die Vier herum war totenstill. Dann hörten sie die Schritte mehrerer Männer schnell näherkommen.
„Weg hier. Wir müssen sofort verschwinden“, zischte Senep aufgebracht. Wenn die Medjai sie entdeckten, würde ihr Ende schmerzhaft sein. Die vier sprangen auf die Beine und begannen zu rennen. Das Boot war verloren und sie mussten irgendwie versuchen, auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Aber zuerst galt es, die Medjai abzuschütteln, die ihnen mittlerweile laut rufend auf den Fersen waren.
„Wir müssen uns aufteilen! Sonst werden sie uns fangen“, rief Inebni den Gefährten zu. Amenpanufer verschwand in einer Felsspalte und drückte sich fest an die Wand, sodass er in der Dunkelheit mit dem Felsen verschmolz. Bitte, ihr Götter, lasst sie weiterlaufen. Bitte, dachte Amenpanufer, während er die Augen zukniff, um nicht sehen zu müssen, ob sich ihm ein Feind näherte. Hier in der Felsspalte saß er völlig in der Falle. Seine einzige Hoffnung war, dass der Schatten des Berges ihn beschützte. Er drückte sich so fest er konnte an das warme Gestein und lauschte in die Nacht hinaus. Senep und sein Sohn rannten weiter den Pfad entlang, der das Ufer säumte, während Inebni versuchte, etwas vom Fluss weg zu kommen. Als die Medjai an Amenpanufer vorbeigerannt waren, ohne ihn wahrzunehmen, wagte dieser endlich wieder richtig zu atmen. Seine Beine und seine Brust schmerzten. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis er wieder klar denken konnte. In der Ferne hörte er noch immer die Rufe der Verfolger. Zum Boot konnte er nicht zurückkehren, dort waren bestimmt Wachen aufgestellt worden. Vorsichtig riskierte er einen Blick aus der Felsspalte hinaus. Als er weit und breit niemanden sah, eilte er zum Fluss hinab und glitt leise ins Wasser. Die Medjai würden, wenn sie das Wasser an dieser Stelle absuchten, seinen Kopf im Mondlicht über der Wasseroberfläche sehen können. Er würde tauchen müssen, um aus der Reichweite ihrer Pfeile zu kommen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, meine Brüder, dachte der junge Mann und tauchte unter.
*
Inebni rannte so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gerannt war. Leise flehte er dabei die Götter um Gnade an. Ein absurder Versuch sein dem Tode geweihtes Leben zu retten. Er hatte immer gewusst, dass es einmal so enden würde. Seine Frau war nie glücklich über seine nächtlichen Ausflüge und so oft sie darüber sprachen, machte sie ihm Vorhaltungen wegen seines gotteslästerlichen Handelns. Amun wird dir nicht ewig gestatten, die Gräber seiner Kinder zu schänden, hatte sie schon oft zu ihm gesagt. Inebni spürte, dass heute der Tag gekommen war, an dem die Götter beschlossen hatten, seine Taten zu bestrafen. Als ein Pfeil nah an seinem Kopf vorbeizischte, lief er noch etwas schneller. Doch der nächste Pfeil traf ihn genau zwischen den Schulterblättern. Zwei weitere Pfeile trafen ihn zeitgleich in den Rücken. Die Wucht des Aufpralls warf ihn zu Boden. Er spürte den beißenden Schmerz, als er versuchte sich mit beiden Händen abzustützen. Ein dünnes Rinnsal roten Lebenssaftes bahnte sich einen Weg über seine Lippen, sein Kinn hinab. Ihm wurde plötzlich kalt. Die näherkommenden Schritte seiner Verfolger hörte er nur noch in der Ferne. Als sie ihn erreichten, hatte er die Reise ins Jenseits bereits angetreten.
*
Senep und Kerasher waren immer weiter am Fluss entlang gerannt. Schließlich hatten sie das Gefühl, ihre Verfolger abgeschüttelt zu haben. Der alte Mann beschloss, dass es Zeit war, den Nil zu überqueren. Hier, direkt in der Nähe der Stadt, war das kein ganz leichtes Unterfangen. Der Fluss hatte in dieser Jahreszeit starke Strömungen und hier und dort konnte es passieren, dass man unter Wasser gezogen wurde. Nur erfahrene Schwimmer trauten sich bei Tag eine Überquerung des Nils zu, bei Nacht war dieses Unterfangen nahezu aussichtslos. Dennoch trieb Senep seinen Sohn ins Wasser.
„Versuch keine Geräusche zu machen. Sie werden uns sehen, wenn sie das Wasser absuchen. Aber wenn wir still sind, werden sie weiterlaufen und vermuten, wir wären noch an Land.“
So leise wie möglich glitten die beiden ins Wasser. Senep, der bereits auf der Flucht einen Großteil der Beute verloren hatte, schwamm mit kräftigen Zügen los. Kerasher aber war noch immer vollbepackt. Nachdem sie etwa ein Viertel des Weges zurückgelegt hatten, spürte der Junge, dass die Säcke immer schwerer wurden. Das Leder nahm das Wasser auf wie ein Schwamm. Und doch war er nicht bereit, seine Schätze aufzugeben.
Verzweifelt kämpften Senep und Kerasher gegen die Strömung an, doch Senep hatte alle Hände voll damit zu tun, sich selbst über Wasser zu halten. Dass sein Sohn verschwunden war, merkte er erst, als er etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte. Einen kurzen Moment hielt er inne, um die Wasserfläche hinter sich abzusuchen. Leise rief er einige Male den Namen seines Sohnes. Doch laute Rufe von der Westseite des Flusses brachten ihn zur Besinnung. Kerasher musste von der Strömung unter Wasser gezogen worden sein. Senep konnte nichts anderes mehr tun, als sein eigenes Leben zu retten. Mit Tränen in den Augen schwamm er, weit ausholend, auf das andere Ufer zu. Kerasher würde kein Begräbnis erhalten. Er war für immer verloren und seine Seele würde für alle Zeiten durch die Dunkelheit irren. Senep sah nichts mehr, die Tränen nahmen ihm völlig die Sicht. Seine Schwimmzüge waren rein mechanisch. Als er endlich am anderen Ufer ankam, weit abgetrieben von der Stelle, an der sie ins Wasser gestiegen waren, rollte er sich auf dem trockenen Land zusammen und schluchzte wie ein kleines Kind.
*
Amenpanufer brauchte lange für die Überquerung des Nil. Unterwegs musste er die beiden Ledersäcke, die er noch immer trug, loslassen, damit sie ihn nicht in die Tiefe zogen. Aber der Steinhauer war jung und kräftig und so schaffte er es, den Strömungen des Flusses zu entgehen. Auf der anderen Seite angekommen, machte er sich auf den Weg zu seinem bescheidenen Haus. Unterwegs musste er zweimal Patrouillen der Stadtwache ausweichen. Wenn sie ihn bei Nacht triefnass festnähmen, wäre schon am Morgen bei der Anzeige der Grabschändung klar, dass er zu den Räubern gehörte. Seine einzige Hoffnung war, dass die Gefährten den Medjai entkommen waren. Wenn man nur einen von ihnen lebend gefangen hatte, würde er unter der Folter auch die Namen der anderen preisgeben und dann war sein Leben keinen Laib Brot mehr wert.
Als Amenpanufer sich schließlich, trocken gerieben und nach einer kleinen Stärkung, kurze Zeit später völlig erschöpft auf seinem Bett ausstreckte, schreckte seine Frau Ahwere aus ihrem Schlaf hoch. Leise fragte sie:
„Bist du es, Amenpanufer?“
„Natürlich, meine Sonne“, antwortete der junge Mann zärtlich.
„Hat alles gut geklappt?“, fragte sie schlaftrunken.
„Wie immer“, log der junge Mann. Er wollte seine schwangere Frau nicht unnötig ängstigen. „Nun schlaf, du brauchst deine Kräfte.“
Eng an ihren Mann gedrückt schlief die junge Frau wieder ein. Vielleicht würde sie ihn bald überreden können, mit diesen nächtlichen Streifzügen aufzuhören. Sie hatten geheime Goldvorräte zur Seite geschafft. Wenn sie diese auf dem Schwarzmarkt verkauften, würde es ihnen gut gehen. Sie konnten auch ein Schiff nehmen und das Land Kemet verlassen. Es gab nichts, was sie hier hielt. Hier erwartete sie nur Armut und vielleicht der Tod, wenn sie irgendwann einmal entdeckt wurden. Morgen würden sie darüber sprechen. Und dann würde die ewige Angst um Amenpanufer ein Ende haben. Morgen. Vielleicht.
Der Mann, der sich aus dem Schatten des Nachbarhauses herausbewegte, warf sich die Kapuze seines Umhangs über den Kopf. Langsam, um möglichst nicht aufzufallen, schlurfte er die Straße hinab, dann bog er in eine Gasse ein und überzeugte sich davon, dass er seinerseits nicht verfolgt wurde. Möglicherweise hatte er heute wichtige neue Hinweise bekommen. Was diese wert waren, würde sich noch herausstellen.
11. Tag des dritten Monats im 16. Regierungsjahr Ramses IX.
Die Sonne brannte heiß vom strahlend blauen Himmel herab. Das Tal der Könige, der Ort, an dem die Pharaonen ihre letzte Ruhe fanden, glich einem Ameisenhaufen. Arbeiter bewegten sich zwischen dem Grab ihres Herrschers und den Hütten, die im Tal aufgebaut worden waren, hin und her. Wasserträger versorgten diejenigen, die in dem stickigen Grab arbeiteten, mit dem lebenswichtigen Nass. Die Temperaturen in dem kleinen Talkessel waren bereits in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne noch ziemlich tief stand, unerträglich hoch. Doch die Arbeiter im Tal waren die Hitze gewohnt. Die meisten von ihnen arbeiteten bereits seit mehreren Jahrzehnten an den Gräbern ihrer jeweiligen Herrscher.
Einer der Männer, die bereits zwei Herrscher kommen und gehen gesehen hatten, war Pentaweret, ein Maler, wie es kaum einen Zweiten im Lande Kemet gab. Viele Männer beherrschten die rituellen Bilder, die notwendig waren, um einen Leichnam auf die andere Seite zu begleiten. Doch nur wenige hatten die Gabe, Grabbemalungen in solcher Vollendung anzubringen wie Pentaweret. Sein Gehilfe Djan war noch ein sehr junger Mann mit nur wenig Erfahrung, aber in ihm war die Gabe der göttlichen Schrift, die sich in Bildern manifestierte, fast genauso groß wie in Pentaweret selbst. Der Junge durfte dem alten Meister die Farben mischen und Handreichungen machen. Vielleicht würde er in ein oder zwei Jahren, wenn die Gänge zum Grabmal hin fertig waren und die Verzierungsarbeiten in den Kammern des Grabes selbst begannen, soweit sein, dass er selbst die ersten rituellen Bilder anbringen durfte.
Pentaweret kannte alle Geschichten über das Jenseits und den Weg dorthin. Kein Wunder, war er doch einer derjenigen, die es dem Pharao erst ermöglichten, diesen Weg dereinst zu gehen. Seit sechzehn Jahren arbeiteten die mehr als sechzig Arbeiter nunmehr am Grab ihres Herrn und ein Ende der Arbeiten war nicht in Sicht. Man würde so lange in diesen Stollen und Kammern schuften, bis der Pharao sich zu seinen Vorvätern gelegt hatte. Dann erst würden die Arbeiten aufhören und man würde an einer anderen Stelle mit neuen Arbeiten beginnen, für einen anderen Herrscher.
Wie viele seiner Mitarbeiter glaubte Pentaweret schon lange nicht mehr an die Göttlichkeit des Pharao. Ramses IX. war schwach, so wie viele seiner Vorgänger. Die großen Zeiten eines wahren Gottes, wie Ramses II. es gewesen sein mochte, waren lange vorbei. Kemet war in den letzten Jahrzehnten immer ärmer geworden und auch die privilegierten Arbeiter im Dorf der Wahrheit hatten das zu spüren bekommen. Während früher ihre Nahrungsmittelrationen reich bemessen waren, wurden sie heute oft nur noch mit dem Notwendigen versorgt. Und selbst das war bereits wesentlich mehr, als vielen Menschen in Theben zur Verfügung stand. Die Zufriedenheit der Arbeiter in dem kleinen Dorf, das auf dem Westufer in der Nähe der Arbeitsstätte errichtet worden war, hielt sich in Grenzen. Und so kam es immer öfter zu heimlichen Treffen einzelner Arbeitergruppen, in denen wenig anderes als ihre Probleme besprochen wurde.
Etwas mehr als ein Jahr war es her, dass bei einem solchen Treffen zum ersten Mal davon gesprochen worden war, sich nach einem Nebenverdienst umzuschauen. Die Medjai waren im Dorf wie auch auf der Baustelle allgegenwärtig und auch der Bauleiter und oberste Schreiber der Gräber, Harscherie, schien wie ein Geist immer dann aufzutauchen, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen konnte. Doch mit der Zeit gelang es einigen Arbeitern, Pläne zu schmieden, wie sie Reichtümer aus den alten Gräbern herausschaffen konnten. Im Tal, in dem seit mehr als fünfhundert Jahren eine Totenstadt nach der anderen ausgehoben worden war, lagen viele dieser Ruhestätten direkt nebeneinander. So war es ein Leichtes von hinten in ein Grab einzusteigen, ohne das Siegel der Mauer, die man vor den Eingang gesetzt hatte, zu beschädigen. Nur die Totenstädte, an denen sie selbst mitgewirkt hatten, ließen die Männer in Frieden, aus Angst, bei einer Entdeckung könnte der Verdacht unweigerlich auf sie fallen.
Pentaweret hatte mit einigen seiner Kameraden abgesprochen, dass er heute in der zweiten Hälfte des Tages mit ihnen gemeinsam durch einen Nebengang des Tales in eine alte Höhle gehen wollte. Diese Höhle muss vor vielen Jahrzehnten einmal als Begräbnisstätte gedacht, dann aber verworfen worden sein. Doch von hier aus konnte man leicht in mehrere Gräber eindringen, die alle in der Nähe waren. Aber bis zu der Stunde ihres Treffens hatte der Maler noch eine Menge zu tun. Und er durfte Harscherie oder die Medjai auf keinen Fall auf sich aufmerksam machen.
Harscherie war bei den Arbeitern des Dorfes der Wahrheit allgemein verhasst. Er selbst lebte zwar auch dort, doch war sein Haus abgeschottet von denen der anderen. Er teilte die Lebensmittelvorräte ein und man sagte ihm nach, dass er diejenigen, die ihm angenehm waren, den anderen gegenüber oft bevorzugte. Und so kam es vor, dass manche Sonderration Wein den einen Haushalt gar nicht, andere Häuser aber in doppelter Menge erreichte. Die Folge war allgemeines Misstrauen dem Spürhund des Pharao gegenüber. Auch die Tatsache, dass er aus jeder Kleinigkeit gleich den Verdacht schöpfte, die Arbeiter könnten die Gräber berauben, machte ihn nicht unbedingt beliebter. Pentaweret selbst hasste den Mann wie kaum einen Zweiten. Das Erscheinen des Schreibers war für ihn gleichbedeutend mit dem Schlagen seines schlechten Gewissens. Denn auch wenn er nur an wenig von dem, was er Tag für Tag auf die Wände der Gräber malte, glaubte, er hatte doch das Gefühl, dass ihre Taten falsch waren. Doch das Gold, welches sie bei jedem ihrer Beutezüge zutage förderten, schien in dem Moment, wenn er es in der Hand hielt, Entschädigung genug für die paar Stunden der Schlaflosigkeit und der schlechten Träume.
Harscherie lief an diesem Morgen wie so oft durch das Tal, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die krausen Locken seines Haares wild in alle Richtungen abstehend, und beobachtete das Treiben der Arbeiter. Er vertraute niemandem. Wie konnte er auch? Ein Fehler und sein Kopf würde auf einem goldenen Tablett dem Pharao zu Füßen gelegt. Wenn in seiner Amtszeit alles gut lief, würde er im Alter ein ruhiges und angenehmes Leben führen, trotz des stetigen Niederganges Kemets. Doch wenn es gerade in der Zeit, in welcher er als oberster Schreiber der Gräber amtierte, unter den Arbeitern zu Grabräubereien kommen sollte, und wenn er diese möglicherweise erst zu spät aufdeckte, oder wenn sie gar durch jemand anderes zur Anzeige gebracht werden würden, dann war sein Leben keinen Lehmklumpen mehr wert.
Ausgerechnet in der vergangenen Nacht hatte es offensichtlich einen Fall von Grabschändung gegeben. Doch nach Aussage der Medjai, die den Räuber zur Strecke gebracht hatten, handelte es sich offensichtlich um einen Mann aus Theben, der versucht hatte, ein Grab auszurauben. Er war von den Kriegern gestellt und schließlich getötet worden. Die Männer hatten Harscherie versichert, dass ihnen niemand entkommen war, trotzdem glaubte der Schreiber nicht, dass der Getötete allein gearbeitet hatte. Entweder hatte er Unterstützung aus dem Arbeiterdorf gehabt oder seine Helfer waren vor ihm bereits auf die andere Seite zurückgekehrt. Vielleicht verschwiegen die Soldaten ihm auch etwas aus Furcht vor Strafe. Über diesen Fall zerbrach er sich bereits den Kopf, seitdem er lange vor Sonnenaufgang von einem Medjai geweckt worden war, der ihm den Vorgang geschildert hatte. Er würde Paveru, seinem Vorgesetzten, Bericht erstatten müssen.
Harscherie konnte auf einige Erfolge zurückblicken. Er hatte als Schreiber im Dienste der Armee begonnen, sich bis in die Tempelhallen von Karnak hochgearbeitet, bis der Wesir selbst ihm schließlich diesen Posten übergeben hatte. Dabei war sein eigentlicher Vorgesetzter Paveru, der Aufseher über alle Gräber, übergangen worden. Paveru hatte einen anderen Mann für diesen Posten im Auge gehabt, doch der Wesir hatte sich durchgesetzt und seinen Schützling auf dieser Position platziert.
Aber das war nun fast zwölf Jahre her und der jetzt herrschende Wesir mit seinem Amtssitz im Tempel von Karnak teilte die Vorliebe seines Vorgängers für Harscherie nur mäßig. So war dem Schreiber klar, dass bereits der kleinste Verstoß gegen seine Pflichten für Paveru ein geradezu herbeigesehnter Anlass wäre, ihn aus dem Amt zu entfernen.
Das Treiben der Arbeiter im Auge behaltend, setzte Harscherie sich im Schneidersitz in eine schattige Ecke des Tales. Er hatte schon am frühen Morgen eine neue Bestellung für Lebensmittel und Werkzeuge diktiert. Die für das Überleben des Dorfes und für die Arbeiten an dem Grab des Pharao wichtigen Dinge würden in den Abendstunden des heutigen Tages im Dorf eintreffen. Der Mann war sich der Abneigung seiner Untergebenen nur allzu sehr bewusst. Nicht nur, dass er nicht zu ihren abendlichen Spielrunden eingeladen wurde oder dass sie ihn auf der Straße mieden, auch seine Frau und ihre Kinder wurden von den anderen Mitgliedern des Dorfes geschnitten. Es war schmerzhaft zu sehen, wie das seiner Gattin zu schaffen machte, doch sie alle würden diesen Zustand nur noch wenige Monate ertragen müssen. Nach zwölf Jahren war es Zeit, dass ein neuer Schreiber über die Gräber eingesetzt wurde, eine Vorsichtsmaßnahme um sicherzugehen, dass es nicht zu gemeinsamen Diebeszügen der Aufseher und der Arbeiter kam. Harscherie war diese Regelung gerade recht, er hatte das Leben im Dorf der Wahrheit satt. Sein kleiner Landsitz und die Rente, die ihm zustand, würden für einen angenehmen Lebensabend mehr als ausreichen.
Harscherie hatte von seinem Beobachtungspunkt aus freien Blick bis tief in die Grabkammer hinein. Er beobachtete das Treiben der einzelnen Arbeiter. Da waren die Steinarbeiter, die gerade dabei waren die hintersten Enden des Grabstollens zu verputzen. Da waren die Wasserträger, die ständig durch die Reihen der anderen Arbeiter rannten und jedem einen kühlen Trunk anboten. Der Lehrling des Malers hatte gerade eine neue Farbe angemischt und sein Meister beugte sich prüfend über die Palette, um zu schauen, ob die Farbe dem entsprach, was er gefordert hatte. Das Nicken und die leise gesprochenen Worte des alten Mannes entlockten dem Jungen ein Strahlen. Offensichtlich hatte Pentaweret seinen Schüler gelobt.
Der alte Maler war Harscherie ein Rätsel. Irgendetwas an diesem Mann gefiel ihm nicht. Er konnte nicht sagen, was es war. Die Glatze und das eingefallene Gesicht waren eher Zeichen des Alters als Beweis für einen schlechten Charakter. Und Pentaweret selbst hatte sich Harscherie gegenüber nie etwas zuschulden kommen lassen. Doch der Schreiber wusste, dass sich im Haus des Malers des Nachts oft einige Arbeiter trafen. Offiziell spielten sie die Nacht durch, doch das glaubte Harscherie nicht. In der letzten Zeit hatte er die Frauen des Dorfes beobachtet und einige der Gattinnen seiner Untergebenen konnten sich feinere Kleider leisten als seine eigene Ehefrau. Das war höchst ungewöhnlich und für Harscherie alarmierend. Er würde die Männer im Auge behalten müssen, wenn nicht in den letzten paar Monaten seiner Amtszeit noch etwas geschehen sollte, was für ihn unangenehme Folgen haben könnte.
Harscherie schreckte aus seinen Überlegungen hoch, als der Anführer der kleinen Einheit Medjai-Krieger sich vor ihm aufbaute. Nach einer knappen Verbeugung sagte der Mann mit dem eigenartigen Akzent der Nubier: „Mein Herr, der Aufseher der Gräber kommt mit einem Schreiber und mehreren Wachen den Pfad zum Tal herauf.“
Harscherie zog die Augenbrauen zusammen.
„Warum hat man mich nicht früher informiert?“
„Ich habe es selbst gerade erst erfahren.“
„Gut. Sorge dafür, dass deine Männer im Tal verteilt sind und dass ihnen nichts entgeht. Ich will nicht, dass der Aufseher das Gefühl hat, wir würden unsere Arbeit nicht richtig machen.“
Der Nubier nickte und entfernte sich eilig. Harscherie sah dem Krieger hinterher. Der Mann war zuverlässig und machte seine Arbeit. Er und seine Einheit dienten Harscherie schon so lange er hier war und er hatte nie einen Grund gehabt, an ihrer Loyalität zu zweifeln. Wenigstens auf seine Soldaten konnte er sich also verlassen, wenn da nicht die nagenden Zweifel an deren Schilderung der Vorgänge der letzten Nacht gewesen wären. Langsam erhob der Schreiber sich aus dem Staub und klopfte mehrmals auf sein Gewand, um es von dem feinen Sand zu befreien, der sich in den Poren und Falten der Galabäa sammelte. Das lange Gewand, welches der Schreiber so wie die meisten Ägypter der oberen Schicht trug, war komplett in Weiß gehalten und ein Gürtel bildete die einzige Verzierung. Während die Arbeiter zumeist nur einen Lendenschurz trugen, war Harscherie stets darauf bedacht, seinen Stand hervorzuheben. Dazu gehörte auch, dass er als Schreiber eben nicht wie ein Arbeiter auftrat.
Er streckte sich einmal, um den Schmerz aus seinen müden Knochen zu vertreiben. Er war nicht mehr der Jüngste und die Zeit, in der er den ganzen Tag auf den Beinen sein konnte, ohne die Folgen der Aktivitäten zu spüren, war schon lange vergangen. Als er den Herrn der Gräber in Begleitung eines Schirmträgers, einiger Schreiber und mehrerer Soldaten den Weg ins Tal entlang kommen sah, ging er ihm entgegen. Harscherie war nervös, da es unmöglich war vorherzusehen, wie Paveru auf seinen Bericht reagieren würde. Bei seinem Vorgesetzten angekommen, verneigte er sich kurz. Mit einer beringten Hand fuchtelte Paveru gönnerisch in der Luft herum, als wollte er anzeigen, dass eine solche Geste unnötig wäre. Doch Harscherie wusste, dass sie es nicht war. Der Herr des Westufers, der, was die politische Macht anging, auf einer Stufe mit dem Bürgermeister der Stadt Theben stand, war ein Mensch, der sehr viel Wert darauf legte, dass man seine Stellung anerkannte und ihm den nötigen Respekt zollte. Aus diesem Grund reihte der Schreiber sich nun auch neben seinem Herrn in den Zug ein und wartete bis Paveru erklärte, warum er hier war. Sie liefen einen Moment schweigend nebeneinander her, bis sie das Grab Ramses IX. fast erreicht hatten. Dann blieb Paveru abrupt stehen. Harscherie blieb ebenfalls stehen und sah seinen Vorgesetzten fragend an.
„Sag mir, Harscherie, wie weit sind die Arbeiten am Grabmal unseres Herrn und Pharao, möge er ewig leben?“
„Die Männer kommen gut voran. Die Wände des Stollens sind nahezu vollständig verputzt und der Maler ist bereits dabei, die ersten heiligen Bilder in den Gängen anzubringen.“
„Das ist gut, das ist sehr gut“, murmelte Paveru leise.
„Gibt es einen Grund zu besonderer Eile?“, fragte Harscherie besorgt. Sollte der Pharao schwer erkrankt sein oder sich gar ein Unfall ereignet haben, so würde die Arbeit in den nächsten Tagen nicht mehr ruhen dürfen. Man würde noch so viel wie möglich schaffen müssen, bevor der Herrscher seine Reise ins Jenseits antrat. Paveru sah seinen Vorarbeiter fragend an. Dann schüttelte er lachend den Kopf, sodass sein dickes Doppelkinn von einer Seite zur anderen schwappte.
„Nein, mein guter Harscherie, dem Pharao geht es bestens. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Ich möchte mir aber den Maler Pentaweret gern für einige Stunden ausleihen. Da die Arbeiten hier so gut vorangehen, wirst du sicher nichts dagegen haben, wenn er mich für den Rest des Tages begleitet.“
Harscherie deutete eine Verbeugung an. Im Prinzip hatte er eine Menge dagegen. Jeder andere Ägypter musste eine Menge dafür bezahlen, wenn er sein Grab von einem Mann wie Pentaweret verziert sehen wollte. Paveru holte sich je nach Bedarf die besten Arbeiter des Landes von der Baustelle des Pharao weg, um sie in seinem eigenen Grab einzusetzen. Das entsprach nicht dem, was Harscherie unter verantwortungsbewussten Umgang mit Macht verstand. Aber er würde seinem Vorgesetzten deshalb mit Sicherheit keine Vorhaltungen machen.
„Du kannst ihn für den Rest des heutigen Tages haben. Doch in den frühen Morgenstunden muss er seinen Platz im Grabmal unseres Herrn des Pharao, möge er ewig leben, wieder einnehmen. Die Arbeiten gehen gut voran, aber im Moment ist er einer der wichtigsten Bestandteile dieser Arbeit.“
Paveru zog eine Augenbraue nach oben, sodass seine eingeölte Glatze mehrere Falten warf. Harscherie fragte sich schon, ob er es übertrieben hatte, als der Herr der Gräber sein falsches Lächeln aufsetzte und dem Schreiber auf die Schulter klopfte.
„Durch und durch ein Diener unseres Herrn. Es ehrt dich, dass du so um den Fortschritt bemüht bist. Morgen wird Pentaweret dir wieder zur Verfügung stehen.“
„Hab Dank, mein Herr. Doch es gibt noch etwas, was ich dir zu berichten habe.“
„Wenn du den Vorfall der vergangenen Nacht meinst, ich wurde bereits darüber informiert. Der Grabräuber wurde getötet, aber man hat noch kein Grab gefunden, zu dem die geraubten Dinge passen. Ich habe angeordnet, dass sie in den Tempel gebracht werden sollen. Dort wird man feststellen können, wessen Ruhestätte geschändet worden ist.“
Harscherie verneigte sich tief. Leise murmelte er: „Die Weisheit meines Herrn kennt keine Grenzen. Kann ich dir sonst noch irgendwie zu Diensten sein?“
Gönnerisch lachend erwiderte Paveru: „Nein, Harscherie. Ich möchte dich nicht länger von deinen Aufgaben abhalten. Ich werde Pentaweret mitnehmen und mich zurückziehen.“
Nach einer erneuten Verbeugung drehte Harscherie sich um und ging auf den Eingang des Stollens zu. Er hätte zu gern gewusst, woher Paveru seine Informationen hatte. Das Wichtigste war, dass der Mann ihm das Verbrechen der letzten Nacht offensichtlich nicht anlasten wollte. Das beruhigte Harscherie sehr. Doch dass Paveru bereits von dem Fall wusste, machte ihm Sorgen. Vielleicht sollte er doch etwas besonnener im Umgang mit seinen Soldaten werden. Möglicherweise erfuhr Paveru mehr, als dem alten Schreiber lieb war.
Im Inneren des Ganges brannten mehrere Fackeln. Der Schreiber fragte sich immer wieder, wie bei dem flackernden Licht ein korrektes Anbringen von Schriftzeichen und Bildern überhaupt möglich war. Aber Pentaweret schaffte es irgendwie, die Bilder und die Worte in Perfektion auf die Wände zu bannen. Dafür bewunderte Harscherie den Arbeiter. Aber auch nur dafür. Bei dem alten Maler angekommen, sagte der Schreiber:
„Paveru, der Aufseher der Gräber, wünscht dich zu sprechen.“
Von einer Holzleiter herab fragte Pentaweret, ohne von seiner Arbeit aufzusehen: „Was will er von mir?“
„Du sollst ihn begleiten. Ich nehme an, er wird deine Dienste als Maler in Anspruch nehmen wollen.“
Pentaweret sah Harscherie grinsend an. Mit unüberhörbarem Hochmut in der Stimme antwortete der Arbeiter: „Das wollen viele. Warum sollte er bekommen, was anderen verwehrt bleibt?“
„Weil er derjenige ist, der dich stützen oder dich zu Fall bringen kann“, zischte Harscherie wütend. Jetzt wusste er wieder, was ihm an Pentaweret nicht gefiel: dessen Arroganz, die er bei jeder Gelegenheit zur Schau trug.
Betont langsam stieg der Maler die Stufen der Leiter hinunter. Dann sah er seinen Lehrling an und sagte: „Geh ins Dorf und berichte meiner Frau, dass ich später komme. Dann hilf den Kindern bei ihren Schreibübungen.“
Der junge Lehrling verbeugte sich tief und lief los, um den Auftrag seines Herrn auszuführen.
„Und wo wartet unser mächtiger Herr nun?“
„Draußen, vor dem Stollen.“
„Dann wollen wir ihn nicht länger warten lassen, nicht wahr, Harscherie?“
Mit einem Lächeln auf den Lippen drehte der Maler sich um und verließ den Stollen. Das Erscheinen des Aufsehers der Gräber machte ihm einen Strich durch die Rechnung und das ärgerte ihn. Doch seine Frau würde das Notwendige veranlassen, damit die anderen nachher nicht auf ihn warteten. Er durfte sich seinen Ärger nur nicht anmerken lassen. Harscherie hatte recht, niemand in ihrem direkten Umfeld hatte so viel Macht wie Paveru. Es wäre unklug, diesen Mann zu verärgern. Und Pentaweret war nicht unklug. Höchstens hin und wieder etwas unvorsichtig.
*
Pentaweret hatte sich der Gruppe von Männern, angeführt von Paveru und dessen Schirmträger, angeschlossen. Die Männer folgten dem schmalen Pfad, der aus dem Tal herausführte. Als der Weg breiter wurde, stießen sie auf eine Sänfte, die dort offensichtlich von Paveru zurückgelassen worden war. Nachdem der Aufseher der Gräber seine Sänfte bestiegen hatte, wurde der Weg fortgesetzt. Pentaweret bemitleidete die Träger, die den stark übergewichtigen Beamten den ganzen Weg bis zum Fluss und dann am Ufer entlang bis zu dessen weitläufiger Villa tragen mussten. Paveru, da war Pentaweret sich sicher, besaß bestimmt auch ein Haus in der Stadt. Aber es war bekannt, dass er sich meistens in seiner Villa außerhalb Thebens aufhielt. Vielleicht waren seine immerwährenden Differenzen mit Pa-Ser, dem Bürgermeister von Theben, ein Grund für diese Vorbehalte gegen die Stadt. Möglicherweise mochte er aber auch einfach die Ruhe, die das Leben abseits der Straßen dieser Metropole mit sich brachte.
Pentaweret wurde von einem Diener in Empfang genommen. Während Paveru sich kurz zurückzog, um sich frisch zu machen und sich von seinen Ankleidedienern ein frisches Gewand anziehen zu lassen, ließ man Pentaweret stehend in der Halle warten. Es dauerte eine Weile, bis Paveru sich wieder zu seinem Gast bequemte, der sichtlich ungehalten war aufgrund dieser herablassenden Behandlung. Doch Pentaweret war klar, dass gerade Paveru ein sehr gefährlicher Mann für ihn sein konnte. Niemand hatte derart großen Einfluss auf dem Westufer des Nil wie Paveru. Und kein anderer Mann konnte seinen Machenschaften so einfach auf die Schliche kommen. Oder war er das möglicherweise schon? Pentaweret erschrak bei dem Gedanken. Er war davon ausgegangen, dass er sich um die Grabkammer des Beamten kümmern sollte. Doch wenn dem so wäre, hätte Paveru doch keine Zeit damit verschwendet, ihn erst in sein Haus zu holen und ihn dort warten zu lassen. Pentaweret sah sich nervös um. Er wusste, dass die Medjai-Krieger, die sie begleitet hatten, vor der Tür Wachposten bezogen hatten. Aber wozu? Hier draußen würde Paveru am helllichten Tage kaum Gefahr drohen. In Theben hatte es schon lange keinen Fall von Gewalt gegen hohe Beamte mehr gegeben. Viel wahrscheinlicher war, dass die Soldaten ihn, Pentaweret, an der Flucht hindern sollten.
Mitten in diesen Gedankengängen öffnete sich die Tür und Paveru erschien im Raum, gewaschen und in ein neues, langes weißes Gewand gekleidet. Die von frischem Öl glänzende Glatze gab dem rundlichen Gesicht des Mannes und den tief liegenden Augen eine unangenehme Note. Der Kopf des Aufsehers der Gräber erinnerte den Maler an den eines Stieres. Doch sein Körper war wesentlich weniger muskulös als der eines solchen Tieres. Paveru gab sich nicht einmal die Mühe, seinen Bauch zu verstecken. Die enge Kleidung, welche er trug, stellte seine Leibesfülle offen zur Schau.
Pentaweret hielt unweigerlich die Luft an, als nach dem Beamten drei Medjai den Raum betraten. Zwei der Krieger blieben an der Tür stehen, der dritte ging auf die gegenüberliegende Seite der Halle und postierte sich dort vor einer Tür, die in die hinteren Räume des großen Hauses führte. Der Aufseher hatte offensichtlich ein Interesse daran, dass der Maler den Raum nicht verließ.
„Wie ist dein Name, Maler?“
Pentaweret atmete zischend aus. Natürlich kannte Paveru seinen Namen. Allein die Frage war eine Demütigung sondergleichen. Es gab im Dorf der Arbeiter nur einen Experten seiner Qualität, und wenn Paveru das nicht gewusst hätte, wäre Pentaweret wohl kaum hier. Aber dem alten Mann blieb nichts anderes übrig, als das Spiel des Beamten mitzuspielen.
„Pentaweret nannten mich meine Eltern, mein Herr“, antwortete er respektvoll.
„Pentaweret. Ein interessanter Name. Und kein ungefährlicher. Wusstest du, dass ein Pentaweret einmal in ein Attentat auf Ramses III. verwickelt war?“, fragte Paveru möglichst unbefangen.
„Ich kenne die Geschichte rund um das damals Vorgefallene. Eine Nebenfrau des einzig Einen wollte ihn beseitigen, um ihren Sohn auf den Thron zu setzen“, erklärte der Maler, ohne sich anmerken zu lassen, wie unwohl er sich gerade in seiner Haut fühlte.
„Weißt du auch, wie es diesem Pentaweret ergangen ist?“
„Ich nehme an, wie allen anderen, die an der Verschwörung beteiligt waren. Er wird den Tod gefunden haben“, antwortete Pentaweret achselzuckend.
„Nein. Er wurde verschont. Aus einem einfachen Grund. Er hatte mächtige Fürsprecher“, erklärte Paveru, die Hände vor seinem dicken Bauch faltend.
Der Maler spürte, dass er zu schwitzen begonnen hatte und das, obwohl der Raum angenehm temperiert war. Warum erzählte Paveru ihm all dies? Er versuchte, sich seine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen. Betont lässig zuckte er mit der Schulter.
„Ich denke, dass meine Eltern diesen Pentaweret nicht im Sinn hatten, als sie mir den Namen gaben.“
„Das mag gut sein. Aber glaubst du, deine Eltern hatten im Sinn, dass aus ihrem Sohn das werden würde, was aus ihm geworden ist?“, fragte Paveru lauernd.
„Einer der besten Handwerker des Landes Kemet? Ich hoffe es doch“, antwortete Pentaweret mit einem gespielten Lächeln auf seinen Zügen. In seinem Inneren begann sich Nervosität breitzumachen.
„Ein Räuber und Gotteslästerer? Ein Schänder von Heiligtümern? Ich bin mir nicht sicher, ob deine Eltern sich einen solchen Sohn gewünscht haben.“
Pentaweret musste gegen die in ihm aufsteigende Panik ankämpfen. Seine Stimme klang etwas zu hoch, als er sichtlich erregt fragte: „Wer klagt mich einer solchen Tat an? Nenn mir den Unverschämten und ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen lassen!“
Grinsend hob Paveru beide Hände zu einer abwehrenden Geste.
„Spar dir das Geheule eines alten Waschweibes. Ich weiß, dass du dich oft mit anderen Arbeitern im Dorf triffst. Und auch, dass ihr zuweilen die Gräber der Vorfahren ‚besucht‘ ist mir nicht unbekannt. Du kennst die Strafe, die auf die Schändung eines königlichen Grabes steht?“ Die letzte Frage hatte Paveru mit einem hämischen Grinsen auf den Lippen gestellt.
„Ich weiß nicht, wovon du sprichst, mein Herr. Es muss sich dabei um einen schrecklichen Irrtum handeln.“ Pentaweret war mittlerweile kreidebleich geworden. Seine Stimme klang bittend, seine Blicke suchten den Raum nach einer Fluchtmöglichkeit ab. Die Medjai hatten die Hände auf den Schwertern in ihren Gürteln liegen, doch ihr Blick war starr geradeaus gerichtet, so als würden sie Paveru und Pentaweret gar nicht wahrnehmen. Wie sollte er dieser Situation nur entkommen? Die Götter hatten sich offensichtlich diesen Augenblick ausgesucht, um ihn für seine Untaten zu bestrafen.
„Weißt du, Pentaweret, ich habe mich oft gefragt, wie Menschen aussehen, die keine Angst vor einer göttlichen Strafe haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich dabei um einen ganz normalen Mann wie dich handeln würde. Du bist sehr angesehen, deine Kunst wird weithin gelobt. Wie kommt es, dass jemand wie du die Grabkammern der Pharaonen ausraubt?“ Paverus Stimme hatte wieder einen freundlichen, fast schmeichelnden Tonfall angenommen.
„Wie kann ich dich von meiner Unschuld überzeugen, da du offensichtlich bereits über mich gerichtet hast?“ Trotz lag in Pentawerets Stimme. Doch dieser diente ihm nur dazu, seine Angst zu verbergen.
„Ich habe dir bereits gesagt, du sollst dir deine Verteidigung aufsparen. Sagen wir es einmal so, ich habe meine Augen und Ohren überall, auch an den Wänden und Fenstern deines Hauses. Ich weiß, wann du aufstehst, wann du isst und wann du mit deiner Frau das Bett teilst. Also versuche nicht, mich für dumm zu verkaufen!“ Während Paveru gesprochen hatte, war er immer lauter geworden. Seine Stirn wurde von einer steilen Zornesfalte geteilt. In diesem Moment begriff Pentaweret, dass es sinnlos war, weiterhin zu leugnen. Wütend entgegnete er: „Seit Jahren werden unsere Lebensmittelrationen immer karger. Die Kleider unserer Frauen müssen immer länger halten, der Wein und das Bier, welches man uns liefert, sind von immer minderer Qualität. Man verlangt von uns für den Pharao zu arbeiten, ihm ein Leben in der Ewigkeit zu ermöglichen. Aber man will uns nicht mehr den Respekt und die Ehren erweisen, die wir einst genossen haben.“
Paveru hatte den Kopf etwas schief gelegt und sah sein Gegenüber an. In den Augen Pentawerets stand jetzt blanker Zorn. Offensichtlich hatte der alte Maler sich mit seiner Situation abgefunden und sah keinen Ausweg mehr, ansonsten hätte er diese Worte nie ausgesprochen. Im Prinzip hatte er gerade die Schändung der Gräber gestanden. Paverus Lächeln wurde breiter. Er war am Ziel und das mit wesentlich weniger Anstrengung, als er vermutet hatte.
„Wie viele Gräber im letzten halben Jahr?“, fragte der Beamte mit unbewegter Stimme.
„Vier“, antwortete Pentaweret, ohne lange nachzudenken. Sein Ende war ohnehin besiegelt, weiteres Leugnen würde ihm nichts einbringen, das war dem Maler längst klar geworden.
„Und Harscherie?“ Staunen schwang in Paverus Frage mit. „Ich habe den Schreiber immer für einen echten Bluthund gehalten“, fügte er nachdenklich hinzu.
„Der alte Wichtigtuer? Er würde es nicht einmal bemerken, wenn man vor seinen Augen ein Loch in eine der Grabwände hauen würde. Nein, Harscherie weiß nichts von dem, was dort vor sich geht.“
„Wer begleitet dich auf deinen Streifzügen?“
„Du hast doch gesagt, du wüsstest, wer zu mir gehört. Ich werde keinen Freund verraten.“ Da war er wieder, der offene Hochmut dieses Mannes. Paveru staunte ob der Tatsache, dass Pentaweret noch immer den Mut hatte, in dieser Form zu sprechen. Dieser Mann musste mit seinem Leben bereits abgeschlossen haben. Anders konnte der Aufseher der Gräber sich sein Verhalten nicht erklären.
„Was wäre, wenn ich dir eine Möglichkeit gäbe, dem Verfahren, das ich eigentlich gegen dich einleiten müsste, zu entkommen?“, fragte Paveru, seiner Stimme wieder diesen nachdenklichen Klang verleihend.
Pentaweret zog eine Augenbraue nach oben und sah Paveru fragend an. Er wusste, dass viele leitende Beamte des Landes korrupt waren. Aber dass auch der Aufseher der Gräber ein unehrliches Spiel spielte, hatte er bislang nicht vermutet.
„Und wie würde diese Möglichkeit aussehen?“, erwiderte Pentaweret die Frage des Beamten mit einer Gegenfrage. Dem Ton seiner Stimme war anzuhören, dass er zwischen Hoffen und Bangen schwankte.
„Ich verlange die Hälfte von allem, was ihr aus den Gräbern herausholt“, erklärte Paveru leichthin.
„Die Hälfte? Mein Herr, es ist ein großes Risiko in ein solches Grab einzusteigen. Niemand wird mich mehr begleiten wollen, wenn wir die Hälfte unserer Beute abgeben müssen“, versuchte der Maler selbst in dieser aussichtslosen Situation noch zu feilschen.
„Du bist hier nicht auf dem Basar, Pentaweret. Das ist deine einzige Chance dem sicheren Tod zu entgehen. Oder wünschst du, dass ich den Wesir informiere?“, erwiderte Paveru hart.
Pentaweret sah den Aufseher der Gräber voller Wut an. Aber auch sein Hass auf diesen Mann änderte nichts an der Situation. Er würde in Zukunft die Hälfte aller Beutestücke abliefern müssen, wenn er nicht vor Gericht enden wollte.
„So sei es. Garantierst du mir und meinen Gefährten im Gegenzug Straffreiheit?“
„Solange ihr nicht von einer anderen Stelle gefasst werdet, natürlich. Sollten euch die Medjai oder Harscherie erwischen, werde ich nichts für euch tun können und jede Mittäterschaft bestreiten.“
Pentaweret verbeugte sich zum Zeichen seiner Zustimmung. Als er das Haus betreten hatte, war er erstaunt über die Pracht und den Reichtum, die ihn hier erwarteten. Nun war klar, dass er in den nächsten Jahren noch einiges zum Wachstum dieses Reichtums würde beitragen müssen.
*
Amenpanufer hatte schlecht geschlafen. Im Traum war er immer wieder seinen Kumpanen begegnet. Er sah sich und seine Freunde bereits an Pfählen außerhalb der Stadt hängen. Noch nie war er so verängstigt gewesen wie an diesem Morgen. Was, wenn sie einen der anderen erwischt hatten? Die Behörden würden ihn foltern lassen und die Soldaten würden es mit Sicherheit schaffen, ihm die Zunge zu lockern. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Männer des Wesirs sein Haus durchsuchten und ihn festnahmen. Und was würde dann aus seiner Frau und den Kindern werden? Ohne seine Zusatzeinnahmen waren sie arm. Ahwere war unmöglich in der Lage, die Kinder allein zu ernähren. Und als Witwe eines Gotteslästerers und Grabschänders würde kein anderer Mann sie je wieder ehelichen wollen. Viel schlimmer noch, die Soldaten der Stadtwache würden ihre Rechte wohl kaum durchsetzen, wenn es darauf ankam. Ahwere war eine schöne Frau und ihr Schicksal war unschwer vorherzusehen, sollten Amenpanufers Machenschaften entdeckt werden. Sie würde zu einem Spielball der Männer ihrer Nachbarschaft werden, ohne die Möglichkeit ihrem tristen Dasein in irgendeiner Art und Weise zu entkommen. Auch wenn Frauen für gewöhnlich eine Menge Rechte hatten und auch wenn eine Vergewaltigung streng geahndet wurde, niemand würde die Witwe eines Schwerverbrechers beschützen.
All diese Gedanken und Sorgen plagten Amenpanufer, als er sich am Morgen auf den Weg machte, um seiner Arbeit nachzugehen. Er war einer der vielen Steinarbeiter, die im Tempelbezirk von Karnak damit beschäftigt waren, eine weitere Kapelle zu bauen. Viele Herrscher der Geschichte hatten sich hier verewigt, indem sie den Tempelbezirk vergrößert und verschönert hatten. Und natürlich wollte Ramses IX. dem in nichts nachstehen. Auch wenn die Bezahlung der Arbeiter bei Weitem nicht so gut war wie die der Männer im Tal der Könige, so waren die Verhältnisse, unter denen sie hier arbeiten mussten, doch wenigstens erträglich. Sie bekamen Wasser und Nahrungsmittel und hatten die Möglichkeit, sich in den heißesten Stunden des Tages zurückzuziehen, um in der Kühle ihrer Häuser den Nachmittag abzuwarten.
Als die anderen Arbeiter sich auf den Weg zu ihren eigenen Behausungen machten, trat auch Amenpanufer den Heimweg an. In der niedrigen Lehmziegelhütte, die der Arbeiter mit seiner Frau und den Kindern bewohnte, herrschte reges Treiben. Die beiden Schwestern Ahweres waren zu Gast, um dafür zu sorgen, dass es ihrer Schwester in der Zeit der Schwangerschaft an nichts mangelte. Ein Umstand, der Amenpanufer beruhigte, war doch die letzte Geburt bereits sehr schwer für seine Gemahlin gewesen. Auch bei diesem Kind schwang wieder die Angst mit, seine Frau verlieren zu können. Ein Gedanke, den der junge Mann kaum ertragen konnte.
Die Verbindung zwischen ihm und Ahwere war eine Ehe aus Liebe. Es gab keine familienpolitischen Gründe hinter ihrer Hochzeit. Sie beide stammten aus ärmeren Verhältnissen und keiner von ihnen hatte einen Vorteil durch die Hochzeit gehabt. Ahwere hingegen hatte eher noch einen Nachteil, denn sie hätte bei Weitem wohlhabendere Männer haben können. Doch ihre Entscheidung war auf Amenpanufer gefallen, ein Umstand, der den jungen Arbeiter sehr stolz machte.
Als Amenpanufer das Haus betrat und in den kleinen Innenhof kam, sah er seine Frau und ihre beiden Schwestern in einer Ecke des Hofes sitzen und sprechen. Lächelnd näherte er sich den Dreien und setzte sich neben Ahwere auf eine steinerne Bank. Er wartete, bis Neferi, die ältere der beiden Schwestern, mit ihrem Bericht des heutigen Einkaufes auf dem Basar fertig war, und fragte Ahwere dann leise: „Wie geht es dir heute?“
Ihr Blick sagte ihm, dass es ihr nicht so gut ging. Doch sie versuchte ein Lächeln aufzusetzen und antwortete: „Gut, wenn dein Sohn mich nicht so oft treten würde. Ich habe das Gefühl, in meinem Leib rennt eine Horde wildgewordener Nilpferde umher.“