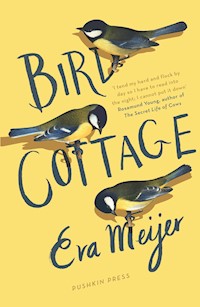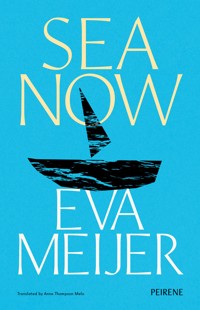11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die heilende Kraft der Sprache, der Kunst, des Laufens, über Hunde und Katzen, über das Schweigen und Bäume im Winter.
Depression gilt in Deutschland inzwischen als Volkskrankheit, über 5 Millionen Menschen erkranken jährlich daran. Die Philosophin Eva Meijer erzählt von ihrer eigenen Erfahrung mit Depression und kommt dabei zu erstaunlichen neuen Erkenntnissen. Mit den Mitteln der Philosophie, mit Verweisen auf Wittgenstein, Camus, Foucault u.v.a. erklärt und untersucht sie das Phänomen, nimmt der Depression den Schrecken und zeigt, wie die Beziehung zwischen Individuum und Welt, die bei der Krankheit verloren geht, auf vielfältige Weise wiederhergestellt werden kann und was das Leben lebenswert macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Was bedeutet Depression? Woran lässt sie sich erkennen? Wie fühlt es sich an, depressiv zu sein, und wie erklärt man das jemand anderem? Und vor allem: Wie lässt sich mit ihr leben, und was macht das Leben lebenswert?
Depression gilt in Deutschland inzwischen als Volkskrankheit, über 5 Millionen Menschen erkranken jährlich daran. Die Philosophin, Schriftstellerin und Singer-Songwriterin Eva Meijer erzählt von ihrer eigenen Erfahrung mit Depression und kommt dabei zu erstaunlichen neuen Erkenntnissen. Mit den Mitteln der Philosophie, mit Verweisen auf Wittgenstein, Camus, Foucault u. v. a. erklärt und untersucht sie das Phänomen, nimmt der Depression den Schrecken und zeigt, wie die Beziehung zwischen Individuum und Welt, die bei der Krankheit verloren geht, auf vielfältige Weise wiederhergestellt werden kann und was das Leben lebenswert macht.
»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt« – der Satz von Ludwig Wittgenstein aus seinem »Tractatus logico-philosophicus« ist Ausgangspunkt für die erhellenden, sehr persönlichen und letztlich tröstlichen Gedanken dieser originellen und in überraschender geistiger Breite analysierenden Philosophin.
Zur Autorin
Eva Meijer, geboren 1980 in Hoorn, Niederlande, ist Philosophin und Schriftstellerin. Sie hat Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und essayistische Bücher veröffentlicht und wurde zu einem Thema über die Sprachen der Tiere promoviert; die Dissertation erschien bei der New York University Press. Ihr Roman »Das Vogelhaus« gewann den Leserpreis des BNG-Literaturpreises und wurde für den Libris- und den ECI-Literaturpreis nominiert. 2017 wurde Eva Meijer für ihr Gesamtwerk mit dem Halewijn-Preis ausgezeichnet, und ihr Sachbuch »Was Tiere wirklich wollen« erhielt den Hypatia-Preis für das beste philosophische Buch, das von einer Frau geschrieben wurde. Eva Meijer forscht an der Universität von Wageningen.
Zur Übersetzerin:
Hanni Ehlers, geboren 1954 in Ostholstein, studierte Niederländisch, Englisch und Spanisch am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg und ist die Übersetzerin von u. a. Anna Enquist, Joke van Leeuwen, Connie Palmen und Leon de Winter.
Eva Meijer
Die Grenzen meiner Sprache
Kleine philosophische Untersuchung zur Depression
ESSAY
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Inhalt
Einleitung
1. Vom Verfärben der Gedanken und vom Tod an deinem Tisch: eine kleine Historie
2. Von schiefen Bäumen und der Formung der Seele
3. Vom Heilen und vom Wert des Wahnsinns
4. Von der Weisheit in meinen Füßen und der Erinnerung im Leib
5. Von der Standhaftigkeit und deiner Verwurzelung in der Welt: eine Art Schlussfolgerung
Anmerkungen
Nachsatz
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem TitelDe grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie bei Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Mai 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2019 Eva Meijer und Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Anton Vrede
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
CP · Herstellung: sc
ISBN: 978-3-641-25097-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Einleitung
Am Ende. In einer Kapsel, einer Welt in der Welt (ein Selbst im Selbst), Gedanken, die sich wie Kuckucksjunge in einem Nest aus anderen Gedanken breitmachen und ihre gesunden Stiefgeschwister ohne Pardon hinausschubsen, ein immer gegenwärtiger Schatten, eine Bestätigung, eine Wahrheit, eine Illusion, schwerer Sand am Übergang zwischen Strand und Meer, Schimmel, der mit seinen Sporen alles zu durchdringen weiß, ein Rauschen, ein Verschwinden, ein Grau, das jegliche Farbe schluckt, bis nur noch die Erinnerung an Farbe bleibt.
Depression hat was von Trauer und kann durch Trauer ausgelöst werden. Sie hat auch was von Angst und Kummer – all das Sammelbegriffe für Zustände, wenn du etwas verlierst, etwas zu verlieren fürchtest, fällst, gefallen bist. Aber Depression ist etwas anderes, sie geht mit einer anderen Art von Verlust einher – dem von Realität. Einschneidende Erlebnisse bewirken, dass du die Welt anders siehst – wenn du dich verliebt hast, gewinnst du eine Welt dazu, wenn du jemanden verlierst, büßt du eine Welt ein –, und können dir das Gefühl vermitteln, du seist ein anderer Mensch als vorher. Der Bezug zur Welt bleibt jedoch erhalten, du bist weiterhin darin verwurzelt, selbst wenn du sie vorübergehend nicht mehr wiedererkennst. Du bleibst, wer du bist. Eine Depression dagegen zieht gerade diese Verbindung zwischen dir und der Welt in Zweifel: Du fühlst dich nicht nur nicht mehr darin zu Hause, sondern begreifst auch, dass es so etwas wie ein Zuhause, einen sicheren Ort nicht gibt. Eine Depression kann dein Gehirn schädigen, und dein Lebenssinn kann wie von Fäulnis zersetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, nach einem ersten auch ein zweites Mal depressiv zu werden, ist überdurchschnittlich groß, nach zwei Depressionen ist es wahrscheinlicher, noch einmal depressiv zu werden, als dass es nicht mehr dazu kommt, und so können Depressionen Teil deines Lebens werden.
Ende 2017 wurde mir in einem Beziehungsstreit vorgeworfen, dass ich so oft trübselig sei. Ich war verwundert, denn zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich gar nicht sonderlich trübselig. Die Melancholie, die mein Leben begleitet, war zwar da, aber nicht stärker als sonst. Und ich war ganz gewiss nicht depressiv. Das kann ich mit solcher Sicherheit sagen, weil ich schon Phasen durchlebt habe, in denen ich depressiv war. Nicht lange nach diesem Streit las ich das Buch einer körperbehinderten Autorin, die klipp und klar schrieb, dass sie nicht ohne ihre Behinderung leben wollte, und ich fragte mich, wie ich das eigentlich sah. Ich habe lange gedacht, dass mein Leben es nicht wert sei, gelebt zu werden, weil das Unglück so oft viel schwerer wog als das Glück. Ich will damit nicht sagen, dass ich nie etwas Schönes erlebt habe, ganz im Gegenteil, aber über weite Strecken meines Lebens war meine Stimmung am untersten Limit. Das wünsche ich niemandem. Gleichzeitig hat das aber meine Weltsicht erweitert und mir zur Entwicklung eines guten Arbeitsethos verholfen. Ich lebe in meiner Arbeit. Ob es auch meine Empathie und Phantasie gefördert und mich sensibler gemacht hat, weiß ich nicht; es könnte auch so sein, dass diese Eigenschaften schon vorhanden waren und mit zu den Depressionen beigetragen haben. Auf jeden Fall hat mir das alles zu denken gegeben.
Daraus ist der vorliegende Essay entstanden, eine kleine philosophische Untersuchung zur Depression unter Verwendung meiner eigenen Erfahrungen. Nicht, um mich wie Rousseau in seinen Bekenntnissen völlig zu entblößen, ohne das Geringste zu verschweigen. Ich will kein wahrheitsgetreues Bild meines bisherigen Lebens zeichnen und auch kein Selbstporträt entwerfen, sondern ich benutze mein eigenes Leben als Brennglas, durch das ich Struktur und Bedeutung der Depression beleuchte. Das stellt nur einen kleinen Teil dessen vor, was ich über mich selbst erzählen könnte (und was in Worte gefasst wird, weicht immer von den zugrunde liegenden Geschehnissen ab). Gleichwohl geht es um einen wichtigen Teil meines Lebens und etwas, was mich stark geprägt hat.
Ich denke zwar nicht, dass man nur besser zu verstehen braucht, was eine Depression ist, um davon geheilt zu werden. Doch es ist etwas wert. Depression ist kein rein chemisches Problem – ein depressiver Mensch trägt sich mit fundamentalen menschlichen Fragen. Diese rühren zudem an diverse andere philosophische Themen, etwa das Verhältnis zwischen Körper und Geist, Sprache, Autonomie, Machtverhältnisse und Einsamkeit. Dieser Essay befasst sich darüber hinaus auch mit der anderen Seite, den Tieren etwa, den Bäumen, den anderen Menschen, der Kunst, das heißt auch mit Trost und Hoffnung und dem, was dem Leben Sinn geben kann.
1. Vom Verfärben der Gedanken und vom Tod an deinem Tisch: eine kleine Historie
In meiner Erinnerung war der Mai 1994 ungewöhnlich sonnig und warm.1 Meine Mitschüler saßen in jeder Pause draußen im Gras, flochten Gänseblümchenkränze und spielten Gitarre – die Welt funkelte, das Leben war eine einzige Verheißung. Doch während sie fröhlich umherhüpften, versank ich mit jedem Schritt tiefer in unsichtbarem Morast. Mir war, als zöge mich eine zu stark aufgedrehte Schwerkraft auf den Boden runter. Ich war vierzehn und kannte die Schwermut schon seit einiger Zeit.
Ihre Bekanntschaft hatte ich zum Beispiel an meinem achten Geburtstag gemacht; da durfte ich mir als Geschenk meiner Tante etwas im Spielzeuggeschäft aussuchen. Ich entschied mich für einen Plüschhund mit Welpen im Korb. Ich fand das sehr niedlich, hatte aber zugleich das Gefühl, dass ich nicht richtig gewählt hatte, dass ich mich für etwas Vernünftigeres hätte entscheiden müssen. Der Geburtstag war nicht schön, es gab Streit, und ein eigenartiger Grauschleier legte sich über den Tag. Ich begriff, dass irgendetwas nicht stimmte – wie konnten andere so tun, als wäre alles in bester Ordnung? Dieses Gefühl kam und ging, bis es in jenem Mai in den Vordergrund trat und andere Dinge konsequent immer weiter verdrängte.
Auf den Mai folgte ein Juni, in dem alles immer trister wurde, wie in einem Zeichentrickfilm, aus dessen Bildwelt nach und nach die Farbe wegfließt, bis alles schwarz-weiß ist. In diesem Schwarz-Weiß verwischten sich danach die Kontraste: Das Weiß wurde weniger hell, bis schließlich alles in ein einziges Grau in Grau überging. Die Welt um mich herum wurde zu einer anderen, einer Welt, in der etwas nicht ohne weiteres gut werden würde, in der es eigentlich viel wahrscheinlicher war, dass überhaupt nichts mehr gut wurde. Während mein Körper von dieser Schwere erfasst war, verklumpten sich meine Gedanken um ein Thema: Ich wäre besser nicht da. Danach habe ich den Mai, die Frühlingsdüfte, das Grünen und Wachsen jahrelang gehasst, und auch heute noch stimmt es mich nicht heiter, wenn sich der Sommer ankündigt, und Vorfreude, wie manche andere sie in diesen Monaten empfinden, kenne ich nicht.
Um die Zeit herum las ich zum ersten Mal Der Ekel von Jean-Paul Sartre2, worin die Hauptfigur, Roquentin, genau das gleiche Gefühl von Sinnlosigkeit erfährt. Ich fand das Buch sehr beängstigend. Mir war, als rührte das, was Sartre beschrieb und ich empfand, an eine nackte Wahrheit, eine Trostlosigkeit des Daseins, die nun, da ich sie entdeckt hatte, nie mehr weggehen würde. Für Sartre ist dieses Nichts freilich keineswegs nur schlimm, sondern auch der Ansporn zur Freiheit. Der Mensch ist ja, wie er meint, nicht nur Körper, sondern auch mit Bewusstsein ausgestattet, und er muss sich der Absurdität und Sinnlosigkeit des Lebens stellen, um sich aus seiner physischen Situation zu befreien. Man sollte dies nicht mit der Idee von einem Gott, der Illusion von Trost oder dem Bestreben, den Wünschen anderer gerecht zu werden, verdecken, sondern sich frei wünschen, und indem man eigene Entscheidungen trifft und die Verantwortung dafür übernimmt, kann man sich selbst entwerfen. Aber das mit der Freiheit wusste ich damals nicht. Ich las von Roquentin, der in der Bibliothek seine historischen Recherchen anstellt, von seiner zunehmenden Entfremdung und der sich anschließenden Erkenntnis, dass es nicht an ihm liege, sondern die Welt so sei. Sein Ekel ist keine Reaktion auf Zufälligkeiten, sondern resultiert aus dem gewachsenen Wissen um das Dasein. Der auch oft in der Bibliothek arbeitende Autodidakt und alle anderen Menschen, die an das Schöne und Gute glaubten, seien naiv und blauäugig. Hinter dem Bösen gebe es nichts zu finden; man solle sich nichts vormachen.
Pubertierende und Existenzialisten begreifen etwas Wahres, etwas Trostloses vom Leben. Kinder haben, auch wenn sie vielleicht nicht in einer heilen Welt leben – es ist bereits die reale Welt, in der Katzen totgefahren und Tiere gegessen werden und in der andere Kinder (oder sogar sie selbst) vielerorts in der Welt Kriege mitmachen –, oft noch nicht die Härte des Erwachsenen oder sind wie er an solche Härten gewöhnt. Ihre Welt ist noch magisch und lebendig, alles ist noch möglich. Heranwachsenden präsentiert sich die Welt freilich mit ganzer Heftigkeit. Erste Lieben können grenzenlos sein, man fließt über vor Gefühlen aller Art. Die Sinnlosigkeit des Lebens kann sich auch folgendermaßen darstellen: So ist es, das ist die Wahrheit über das Leben, und jeder, der einfach Spaß hat, lebt in einer Illusion.
Ich dachte, dass es nie mehr besser werden würde, dass ich mich nun immer so fühlen würde, und abgesehen davon, dass ich Schuldgefühle hatte, dachte ich vor allem häufig an den Tod. Der Tod, mein eigener Tod, nahm zu der Zeit Gestalt an, als ein Schatten, der mich ständig begleitete. Ich hatte keine konkreten Selbstmordabsichten, doch der Gedanke daran war allgegenwärtig. Ich sprach darüber, mit meinen Freunden, in der Schule und mit mehreren Therapeuten; Letztere meinten, das würde sich schon wieder geben. Ich trug damals gern knallige Farben, und das war für die Reihe von Psychologen und Psychiatern, mit denen ich sprach, ein Grund dafür, mich nicht ernst zu nehmen. Einer schrieb wortwörtlich, dass es wohl nicht so schlimm sei, denn ich sei nicht ganz in Schwarz gekleidet gewesen, sondern hätte eine grüne Wollmütze mit einem Schmetterling darauf getragen, und zudem hätte ich seiner Meinung nach alle möglichen Talente. Ich trank, schwänzte die Schule und legte mich mit Lehrern an, und ich sang. Das half alles ein bisschen, ließ mich irgendwie die Tage überstehen. Ich hatte nicht das Gefühl, krank zu sein, sondern hielt mich für schlecht, und das, was ich tat, zielte darauf ab, dieses Gefühl auszutricksen oder zu verdrängen. Abend für Abend hockte ich Selbstgedrehte rauchend und Musik hörend auf der Fensterbank, schrieb Songs und Gedichte und Briefe, die ich dann manchmal verbrannte. Alles kreiste um einen Abgrund: So ist es, ich bin allein, ich mache alles falsch – immer wieder.
Der philosophische und der konkrete Selbstmord 3
In Der Mythos des Sisyphos fragt sich Albert Camus, ob die Erkenntnis, dass das Leben sinnlos ist, notwendigerweise zum Selbstmord führen müsse.4,5 Ob wir Selbstmord begehen sollten, ist für ihn die Grundfrage der Philosophie. Das Leben sei chaotisch und willkürlich und absurd – wir fragen, und die Welt verwehrt uns eine vernünftige Antwort, bietet uns nicht den Sinn oder die Bedeutung, die wir uns ersehnen. Dem könne man damit begegnen, dass man an einen Gott glaubt, der das Universum nach seinem Ebenbild erschaffen hat und es mit einer Ordnung und einem Ziel ausgestattet hat. Oder man könne akzeptieren, dass das Leben sinnlos ist, und in den Tod springen, weil das Leben es deswegen nicht wert sei, gelebt zu werden. Es gebe freilich noch eine dritte Option: das Absurde anzunehmen. In einer Welt, in der das Absurde evident sei, könnten wir Menschen uns dafür entscheiden, das Absurde und den damit verbundenen Widerspruch (nämlich die Auflehnung dagegen und den Wunsch, ihm zu entkommen, wobei auch das absurd ist) auf sich zu nehmen. Dann sei nicht Selbstmord die Lösung, sondern so viel wie möglich zu leben, das Leben in seinem ganzen Reichtum auszuschöpfen. Wie Don Juan, der sinnlos, aber mit ganzer Überzeugung der Leidenschaft nachjagt, wie der Schauspieler, der tausend Menschenleben durchlebt, wie der Künstler, der nicht versucht, dem Absurden Bedeutung zu verleihen, sondern es so wiedergibt, wie es ist.
Camus hat natürlich recht, wenn er dafür plädiert, dass wir das Absurde auf uns nehmen sollten. Die Absurdität des Lebens ist auch eine Quelle der Heiterkeit, und Humor ist eine unserer besseren Waffen gegen die Sinnlosigkeit. Aber gerade daran hapert es auch, wenn du depressiv bist: Du erkennst nicht mehr, wozu diese Absurdität gut sein soll und was daran spaßig sein könnte. Beziehungen verlieren genauso ihre Bedeutung wie die Kunst; du verlierst den Zugang zu dir selbst und der Welt um dich herum. Ich hatte zur Zeit meiner ersten Depression gute Freunde, die wussten, wie es mir ging, doch das half gar nichts, denn ich glaubte, endlich erkannt zu haben, dass ich allein war, und deshalb war ich es auch. Meine Gedanken isolierten mich. Und alles war grau, ich war vollkommen grau, Hülle für das Gefühl, das von mir Besitz ergriffen hatte. Niemand anders sah, dass jetzt alles grau war, niemand erkannte, wie ich wirklich war – wenn andere lieb zu mir waren, bestätigte mich das nur in meinem Selbsthass. Es war auch so aussichtslos. Dabei sagte meine Mutter, die Zeit auf der weiterführenden Schule sei die schönste Zeit im Leben.
Trotz meines häufigen Schwänzens und meiner Aufmüpfigkeit schaffte ich das Abitur ohne Probleme, worauf ich nach England ging, um Gesang zu studieren. Ein Neuanfang, mit Wurzeln im Alten. Ein paar Monate später beging meine Tante Selbstmord. Das kam nicht gänzlich unerwartet; sie litt schon seit längerem an einer schweren Neuralgie, und wir wussten, dass sie so nicht weiterleben wollte, einen halbherzigen Selbstmordversuch hatte sie auch schon hinter sich. Und doch kam es für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der die Welt in ein Davor und ein Danach spaltete. Das tut der Tod natürlich immer, aber bei mir verschob sich wirklich etwas in meinem Denken über das Wesen der Dinge. Nicht immer wird alles wieder gut (bestimmte Brüche sind auch gut zwanzig Jahre danach noch vorhanden). Was unvorstellbar ist, kann durchaus geschehen. Ich spreche hier nicht von Trauer oder Betroffenheit. Die waren auch da, obwohl meine Traurigkeit nichts gegen die ihrer Mutter, ihrer Schwestern und ihrer beiden Töchter war. Aber es ist wirklich etwas zerbrochen. Ob Selbstmord schlimmer ist als ein anderer Tod, weiß ich nicht, das wird wohl ganz davon abhängen, wer stirbt und wie. Es ist aber etwas anderes, zumal im Fall von einer, bei der die Behandlungsmöglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft waren, ja nicht einmal richtig zur Anwendung kamen. Dann wird viel und laut lamentiert: »Hätte ich doch bloß …!« und »Wäre ich doch bloß …!« Bei meiner Tante hätte sich das Blatt auf verschiedenste Weise wenden lassen, scheint mir zumindest – am Tag selbst, wenn man sie nicht allein gelassen hätte, in den Tagen und Wochen davor, wenn man sie von einem Psychiater hätte untersuchen lassen, sie vielleicht stationär in einer Klinik untergebracht hätte; vielleicht hätte sie medikamentös behandelt werden können. Ich habe eigentlich nie mit ihr über ihren Todeswunsch gesprochen.
Die allgemeine Traurigkeit nach ihrem Tod und die unschönen Begleitumstände taten meiner Stimmung zwar nicht gut, aber an meiner Einstellung zum Selbstmord änderte das nichts: Selbstmord ist ein Ende, keine Lösung. (Von einer Lösung kann nur die Rede sein, wenn etwas gut wird, wenn ein Übergang vom Alten zum Neuen bewerkstelligt wird, während Selbstmord bloß das Problem aus der Welt schafft.) Aber man sollte das eigentlich nicht machen, wenn man Kinder hat. Das wäre zumindest mein eigener Vorsatz – über die Tiefe des (unerwarteten) Leids einer anderen kann ich mir kein Urteil erlauben.