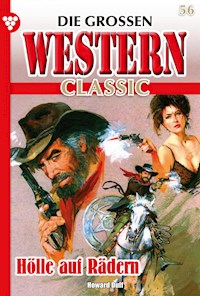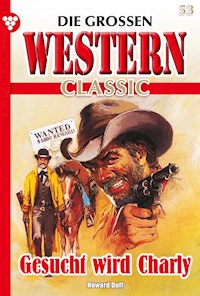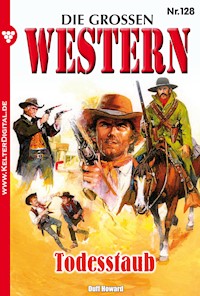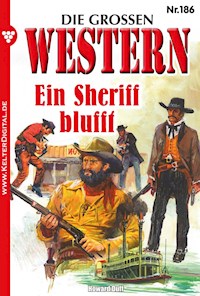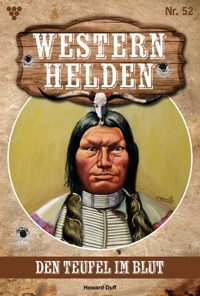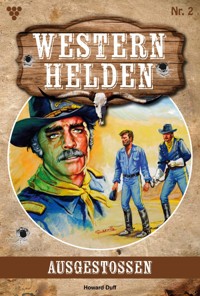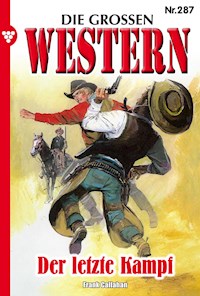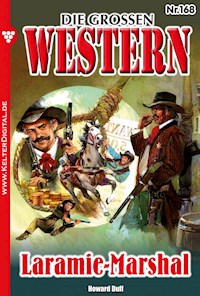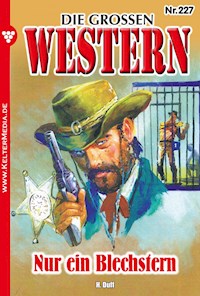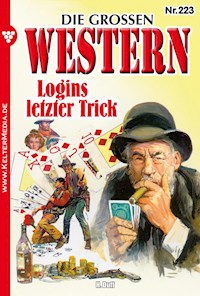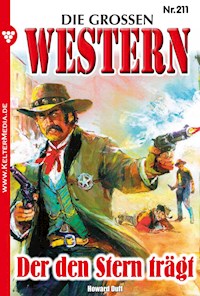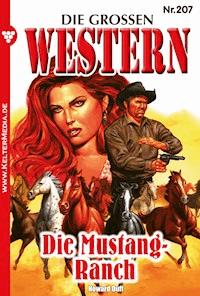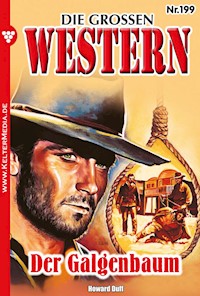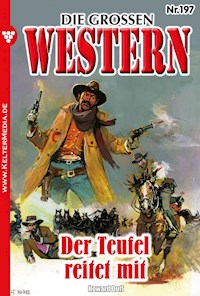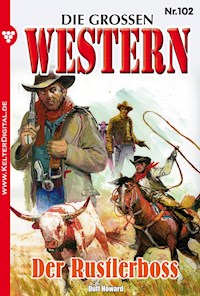
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Plötzlich wusste er, dass es schiefgehen würde und irgendetwas auf ihn zukam, was er wie eine düstere und beklemmende Ahnung in sich gehabt hatte. Howard sah die Frau und die Schrotflinte, deren Kolben sie unter den rechten Oberarm geklemmt hatte. Die glühende Sonne schien auf die offene Brettertür des Hauses und den Doppellauf der Flinte. Rico Howard war nur sechzehn Schritte entfernt, darum sah er im Bruchteil einer Sekunde, dass die beiden Hähne gespannt waren und die Frau Zeige- und Mittelfinger an den Abzügen hatte. Sie hatte ihn nicht gesehen, weil er hinter der Bretterwand des Holzschuppens stehen geblieben war und genau das getan hatte, was ihm aufgetragen worden war: nur aufzupassen und die Hügelseite und den schäbigen Fahrweg im Auge zu behalten. Dort zeigte sich nichts. Tot und still, als wäre die Gegend ausgestorben, lag die Kette der Chupadera Hills im Nordosten. Der Mann Rico Howard hatte zum Lagerschuppen nach rechts geblickt, weil sich im Nordosten nichts geregt hatte – und nur darum sah er durch den breiten Spalt zwischen den Brettern die Bewegung in der Haustür. Die Frau, dachte Howard mit einem Gefühl völligen und lähmenden Schrecks, die Frau – wo kommt die Frau her? Das geht schief, das geht ins Auge. Vorige Woche war hier doch keine Frau. Starkey sagte, seine Frau wäre vor Jahren gestorben, und er mit dem Jungen allein. Und nun ist da eine Frau. Sie trägt Stiefel, einen Reitrock und hat die verfluchte Schrotflinte. Und da sind Bill und Jake. »Ihr seid wahnsinnig, ihr Halunken! Glaubt ihr wirklich, ihr kommt damit durch? Ich schwöre euch, ihr habt dann die erste und letzte Lieferung gebracht. Keinen Cent …« Das andere hörte Howard wie aus weiter Ferne, denn die hagere Frau mit dem strengen Gesicht, dem straff nach hinten gekämmten und zu einem Knoten geflochtenen Haar verließ jetzt ihren Spähplatz zwischen Tür und Angel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 102 –Der Rustlerboss
Howard Duff
Plötzlich wusste er, dass es schiefgehen würde und irgendetwas auf ihn zukam, was er wie eine düstere und beklemmende Ahnung in sich gehabt hatte.
Howard sah die Frau und die Schrotflinte, deren Kolben sie unter den rechten Oberarm geklemmt hatte. Die glühende Sonne schien auf die offene Brettertür des Hauses und den Doppellauf der Flinte.
Rico Howard war nur sechzehn Schritte entfernt, darum sah er im Bruchteil einer Sekunde, dass die beiden Hähne gespannt waren und die Frau Zeige- und Mittelfinger an den Abzügen hatte.
Sie hatte ihn nicht gesehen, weil er hinter der Bretterwand des Holzschuppens stehen geblieben war und genau das getan hatte, was ihm aufgetragen worden war: nur aufzupassen und die Hügelseite und den schäbigen Fahrweg im Auge zu behalten.
Dort zeigte sich nichts. Tot und still, als wäre die Gegend ausgestorben, lag die Kette der Chupadera Hills im Nordosten.
Der Mann Rico Howard hatte zum Lagerschuppen nach rechts geblickt, weil sich im Nordosten nichts geregt hatte – und nur darum sah er durch den breiten Spalt zwischen den Brettern die Bewegung in der Haustür.
Die Frau, dachte Howard mit einem Gefühl völligen und lähmenden Schrecks, die Frau – wo kommt die Frau her? Das geht schief, das geht ins Auge. Vorige Woche war hier doch keine Frau. Starkey sagte, seine Frau wäre vor Jahren gestorben, und er mit dem Jungen allein. Und nun ist da eine Frau. Sie trägt Stiefel, einen Reitrock und hat die verfluchte Schrotflinte. Und da sind Bill und Jake.
Der Schock, der Howard gelähmt hatte, war so plötzlich verschwunden, wie er gekommen war, denn Starkey schrie voller Wut:
»Ihr seid wahnsinnig, ihr Halunken! Glaubt ihr wirklich, ihr kommt damit durch? Ich schwöre euch, ihr habt dann die erste und letzte Lieferung gebracht. Keinen Cent …«
Das andere hörte Howard wie aus weiter Ferne, denn die hagere Frau mit dem strengen Gesicht, dem straff nach hinten gekämmten und zu einem Knoten geflochtenen Haar verließ jetzt ihren Spähplatz zwischen Tür und Angel. Dann setzte sie den linken Fuß vorsichtig auf die erste der drei Felsstufen vor der Haustür.
War die Frau die drei Stufen hinunter, brauchte sie sich nur nach links zu wenden. Keine fünfzehn Schritte von ihr entfernt standen Starkey und dessen siebzehnjähriger Sohn mit hochgereckten Armen am Planwagen, den sie zur Hälfte beladen hatten. Die Kiste, die sie gemeinsam herangeschleppt hatten, war nicht mehr auf den Wagen gekommen.
Bill Franklin, der sehnige, hagere Mann aus Texas, der genauso wenig zu verlieren hatte wie Jake Harper, sein bulliger, wesentlich älterer Partner, war von der anderen Hausecke und hinter der Regentonne hervorgetreten. Harper hatte sich am Stall gezeigt.
Jetzt standen Harper und Franklin nur sechs Schritte vor dem Wagen. Sie hatten die Starkeys in die Zange genommen – und doch waren sie so gut wie tot, wenn die Frau ohne Anruf auf sie feuerte.
Rico Howard zauderte keine Sekunde mehr. Er sprang blitzschnell um die Ecke der Bretterwand. Und dann sagte er scharf und mit vor Erregung schriller Stimme:
»Halt! Weg mit der Flinte! Verdammt, die Flinte wegwerfen, oder …«
Und weiter kam Howard nicht.
Die Frau zuckte förmlich herum. Sie hatte die zweite Stufe erreicht, hob mit einem Ruck die langen Läufe an und sah Rico Howard in der nächsten Sekunde.
Sie schießt nicht, dachte Howard. Er hatte sein Gewehr auf sie angeschlagen und glaubte fest daran, dass das auf sie gerichtete Gewehr genügen würde, um die Frau zur Aufgabe zu bringen.
In diesem Augenblick blickte er der Frau voll ins Gesicht, schrie und sah noch, dass ihre Augen sich jäh weiteten und wusste, dass er den Fehler seines Lebens begangen hatte.
In den Augen der hageren Frau war eine derartige Härte und Unerbittlichkeit, dass sich irgendetwas in Howard zusammenkrampfte.
Sie schießt doch, fuhr es dem mittelgroßen, schlanken Howard durch den Kopf.
Die jähe Panik in sich, warf sich Howard zurück. Er wollte hinter die Bretterwand hechten, aber es war bereits zu spät. Der Mann Rico Howard, der noch nie auf eine Frau geschossen hatte, starrte den Bruchteil einer Sekunde in die Doppelmündung der langläufigen Schrotflinte. Als er sich zurückwarf, glaubte er noch zu sehen, dass sich der Doppellauf senkte.
Und dann brüllte die Schrotflinte auch schon los.
Es kam Howard vor, als fiele ein Kanonenschuss. Das wilde Brüllen in den Ohren, flog Rico Howard zurück, spürte einen fürchterlichen Schlag am linken Bein und landete neben der Ecke, statt hinter sie zu kommen. Die Gewalt des Schrotschusses schleuderte den schlanken Mann herum. Ein stechender, grimmiger Schmerz schoss von seinem Oberschenkel aus bis in seine Hüfte empor. Dann lag er, wollte sich abstemmen, schrie und hatte die Tür immer noch im Blickfeld. Ehe er sich herumwälzen konnte, wandte sich die Frau zur Flucht, sie wollte ins Haus zurück.
Was dann geschah, kam Rico Howard wie ein höllischer Traum vor. Rechts von ihm war Jake Harper bei seinem schrillen Geschrei herumgeflogen. Der stiernackige, bullige Harper sah nur die Stiefel unter der Tür hervorlugen. Harper, ein Mann, der immer erst schoss und danach seine Fragen stellte, feuerte augenblicklich.
Der schwere Fünfundvierziger in Harpers Faust spuckte Feuer. Der schwergebaute Mann war zwar ein langsamerer Schütze als Billy Franklin, doch er zauderte nie, seine Waffe auch zu gebrauchen.
»Bill, pass auf!«
Harper brüllte es, während er bereits feuerte. Er hielt halbhoch auf die Tür, durch deren mürbe Bretter das Geschoss sauste, als gäbe es keinen Widerstand.
Der am Boden liegende Rico Howard vergaß in diesem Moment den wilden, beißenden Schmerz. Vor Grauen wie gelähmt, blickte Howard voller Entsetzen auf die hagere Frau. Und dann begriff er, welchem Irrtum Harper erlegen war.
Jake Harper konnte nicht ahnen, dass hinter der Tür eine Frau den verzweifelten Versuch unternahm, sich noch ins Haus zu retten.
Harper sah ja nur die Stiefel, und er feuerte auf den vermeintlichen Mann, der Howard niedergeschossen hatte, so schnell er nur konnte.
Rico Howard sah überdeutlich, wie die erste Kugel einen handlangen Splitter aus der Tür fetzte. Das Geschoss traf danach die Frau. Sie zuckte heftig zusammen, taumelte, stolperte und schien förmlich in die jäh aus der Innenseite der Tür platzenden und umherschwirrenden Holzsplitter zu wanken.
Was weiter rechts am Wagen geschah, sah Howard nicht – er konnte vor Grausen keinen Blick von der unter Harpers Schüssen herumkommenden Tür wenden.
Rechts am Wagen hatte sich Bill Franklin erschrocken umgeblickt. Kaum erkannte der alte Starkey seine Chance, stürzte er sich auf Franklin, doch da fuhr der sehnige Mann ihm schon wieder entgegen. Dennoch erreichte der Händler Franklin.
Starkey, groß, breitschultrig und sicher kräftiger als Franklin, schrie und stieß Franklin die Faust gegen die rechte Schulter. Franklin strauchelte, knickte ein, fiel auf die Knie und riss die Rechte hoch. Er tat es, ehe Starkey ausholen und ihm den Stiefel unter die Rechte treten konnte.
Der gellende Schrei, den der Junge ausstieß, ging im Brüllen von Harpers Revolver unter. In die vier Schüsse Harpers krachte nun ein fünfter hinein, Bill Franklin schoss und traf. Die Kugel fuhr Starkey unter den Rippen in den Leib. Zwar taumelte Starkey weiter vorwärts, doch er streifte Franklin nur. Der sehnige Mann aus Texas warf sich nach rechts und flog der Länge nach hin. Jetzt zeigte sich, wie schnell er sein konnte, und doch war er für jemand zu langsam.
Als Franklin sich vor dem zusammenbrechenden Starkey zur Seite schob, verlor er den hart am Hinterrad des Wagens stehenden Jungen aus den Augen. Nur einer sah, wie sich der junge Starkey abstieß und plötzlich um das Hinterrad und damit aus dem Blickfeld Franklins rannte.
Rico Howard wollte Franklin eine Warnung zuschreien, brachte jedoch keinen Ton hervor. Aus weit aufgerissenen Augen hatte Howard gesehen, wie die Frau gegen die Wand getaumelt und nicht mehr ins Haus zurückgekommen war. Der Anblick der zusammensinkenden Frau war für Howard zu viel. Ihm war, als nähme der grässliche Albtraum aus Mord und Tod kein Ende mehr. Fortblickend, um es nicht mit ansehen zu müssen, hatte Howard nun jedoch kein weniger grauenhaftes Bild vor sich.
Als hätte Franklin etwas vom Verschwinden des Jungen geahnt, fuhr der sehnige Mann aus Texas auf. Er sprang zur Deichsel des Wagens, hatte nach links geblickt und den Jungen nicht mehr gesehen. Während Franklin über die Deichsel sprang und am linken Vorderrad des Wagens vorbeistürzte, sah er gerade noch den um die Schuppenecke fliehenden jungen Starkey.
»Stehen bleiben!«
Franklins scharfer Schrei kam genauso zu spät wie das Hochzucken seiner Faust und die Kugel, die er dem Jungen nachschickte. Der junge Bursche war fort. Das Geschoss jaulte von der Schuppenecke fort und klatschte als Querschläger irgendwo links in den Hof.
*
Für Howard nahm der Albtraum immer grässlichere Ausmaße an. Der schlanke Howard schrie schon die ganze Zeit, bemerkte es jetzt aber erst. Irgendwie war Howard auf die Knie gekommen, hatte sich an der Bretterwand hochgezogen und spürte nun keinen Schmerz mehr. Das blutige Drama versetzte ihm einen derartigen Schock, dass er beinahe den Verstand verlor und pausenlos nur ein Wort herausschrie.
»Nein – nein – nein!«
Es war, als könnte seine Kehle kein anderes Wort hervorbringen. War sie anfangs wie zugeschnürt gewesen, so entließ sie jetzt den immer wiederkehrenden Schrei in einer schrillen durch Mark und Bein gehenden Tonhöhe. Howard kam gar nicht zu Bewusstsein, dass er aufgestanden war und sein Gewehr beim Sturz verloren hatte. Er torkelte, schwankte, das nackte Entsetzen in den Augen, das Gesicht verzerrt, der Haustür entgegen. Und nun bekam er auch mehr als das eine Wort hervor.
»Die Frau!«, gellte Howards Stimme über den Hof der einsam gelegenen Handelsranch. »Jake – die Frau, die Frau, Jake!«
Es kam ihm vor, als tanzte das Haus vor ihm hin und her. Es schwankte von rechts nach links, stellte sich schief wie die weite Kette der Berge im Hintergrund.
Rico Howard blickte in panischem Schrecken auf die an der Wand zusammengesunkene Frau. Die Tür, von Jake Harpers Kugeln herumgetrieben, war gegen die linke Schulter der an der Wand schief sitzenden Frau geprallt.
Sie ist nicht getroffen, dachte Howard, sich verzweifelt einredend, dass alles, was er sah, nichts als ein furchtbarer Traum sein musste – nein, sie lebt.
Und dann war es ihm, als wäre aus seiner Einbildung Wahrheit geworden. Die Frau mit den strengen Gesichtszügen hob langsam den Kopf. Sie war totenbleich, ihre Lider flatterten, und sie blickte Howard, der in diesem Moment die Türkante erfasste, sich krampfhaft an ihr festhielt und auf sie herabstierte, mit einem furchtbaren Ausdruck an.
Er schrie immer noch, konnte den Blick der Frau nicht ertragen und wandte den Kopf. Und dann sah Rico Howard gleichsam von einer Hölle in die andere.
Das schrille Wiehern eines Pferdes ließ den schlanken Howard zum Corral blicken. Howard hatte den jungen Starkey vergessen gehabt. Der Junge war in seiner Todesangst davongerast, hatte sich hinter dem Schuppen nach links gewandt und war am Stall vorbeigeflogen. Er musste erkannt haben, dass er nicht mehr in den Corral, in dem ein halbes Dutzend Pferde stand, kommen konnte. Darum floh er blindlings zur Senke, durch die der Chupadera Wash eine tiefe Rinne gegraben hatte. Er hatte den Corral zwischen sich und Franklin gebracht, der ihm fluchend nachstürzte.
Bill Franklin sah den jungen Starkey nicht mehr, während er am Stall entlangrannte. Die Pferde im Corral rasten jetzt, durch die Schüsse erschreckt, hin und her. Staub zog hoch, der sich wie eine Wolke über dem Corral erhob und Franklin die Sicht vollständig nahm. Der Mann aus Texas glaubte, dass der Junge im Corral war. Franklin sprang an die Stangen. Er war nahe genug heran, um durch die Staubwolke jedes Pferd ausmachen zu können und sah nichts von dem Geflohenen. Es war der Instinkt des Jägers, der Franklin augenblicklich nach links um den Corral rennen ließ – und jetzt sah er den Jungen.
Der etwa siebzehnjährige Bursche verschwand gerade im tiefen Einschnitt des Chupadera Wash. Er hatte einen Vorsprung von mehr als vierzig Schritten herausgeholt, weil Franklin zu lange am Corral gezaudert hatte.
Die Pferde, schoss es Franklin durch den Kopf, unsere Pferde.
Ohne es zu ahnen, war der junge Starkey dorthin geflüchtet, woher die Männer gekommen waren. Dort hinten im ausgetrockneten Bett des Chupadera hatten sie ihre Pferde abgestellt und waren dann auf die Gebäude zugeschlichen.
Der Junge sah die Pferde, als er mit einem Sprung, die Knie an die Brust reißend, von der Kante auf den steil abfallenden Hang des Chupadera heruntersprang.
Gleichzeitig rannte Franklin, die drohende Gefahr erkennend, nach rechts und stürmte dem tiefen Graben des Chupadera entgegen. Er hatte keine Sekunde zu verlieren – und er war noch nicht am Einschnitt, als er das Wiehern der Pferde vernahm.
Was dann geschah, bestätigte Franklins schlimmste Befürchtungen. Der große sehnige Mann aus Texas hatte bis zu diesem Moment ohne nachzudenken gehandelt. Als ihn Starkey angesprungen hatte, hatte er dessen Angriff abgewehrt und blindlings gefeuert. Jetzt erst wurde sich Franklin der tödlichen Gefahr bewusst, die ihnen drohte – und schon wieherten die Pferde unten im Schlauch des Chupadera los.
Franklin ahnte, dass sich der Junge das beste Pferd schnappen und auf ihm – die anderen freilassend und davonjagend – fliehen würde. Es gab keinen Siebzehnjährigen in diesem Land, der nicht sofort das beste Pferd – und hier war es das von Howard – erkannt hätte.
»Der verfluchte Junge«, knurrte Franklin voller Wut und Sorge.
»Wenn der Bursche Howards Gaul hat, dann …«
Und dann fuhr der sehnige Texaner zusammen.
Der Hufschlag setzte unter ihm ein, das Trommeln der Hufe begann.
Auf dem Rand des Einschnittes anhaltend, sah Franklin genau das, was er gefürchtet hatte. Der Junge hing tiefgeduckt im Sattel von Howards hochbeinigem Fuchswallach. Er hatte die anderen beiden Pferde gepackt, riss sie hinter sich her und trieb sie schreiend der Biegung des Chupadera entgegen. Noch zwanzig Schritte, dann musste er in Sicherheit sein.
Franklin handelte im Bruchteil einer Sekunde. Er wusste, er konnte den Jungen nicht mehr einholen, wenn der um die Biegung verschwunden war.
Sich blitzartig auf die Knie niederlassend, packte Franklin seinen schweren Colt mit beiden Händen. Und dann zielte er, so ruhig er konnte. Er ließ den Fuchswallach in die Visierlinie laufen. Das Tier war knappe fünfundvierzig Schritte entfernt, und für den Colt war die Entfernung beinahe zu weit. Dennoch zweifelte Franklin nicht daran, dass er treffen würde.
Als das Pferd den jungen Starkey in die Ziellinie trug, drückte Franklin ab. Er wusste, er konnte nur diesen einen Schuss gezielt auf den Jungen abfeuern, den nächsten musste er dem Pferd geben.
Das Brüllen hallte über den engen Schlauch des Chupadera hinweg, im Abdrücken glaubte Franklin noch zu sehen, dass sich der Junge umdrehte und zu ihm emporblicken wollte.
Die Kugel traf. Der Junge verlor augenblicklich den Halt. Er rutschte nach links, stieß einen kurzen, schrillen Schrei aus und fiel dann an der Flanke des Fuchswallachs herab. Er stürzte zwischen die Pferde von Franklin und Harper.
»Verdammter Bursche«, knirschte Franklin wütend. »Was stiehlst du uns die Pferde? Die Pest, die Gäule jagen weiter.«
Franklin warf sich herum. Er war sicher, den jungen Starkey machte nichts mehr auf dieser Welt lebendig.
Die Stille, die Franklin erwartete, als er zehn Sekunden später in den Hof stürmte, kam ihm gespensterhaft vor. Jake Harper war im Bogen um die aufstehende Haustür gerannt. Der bullige, stiernackige Mann mit dem bereits ergrauten Haar und dem seltsamen Perlmuttglanz seiner hellgrauen Augen stand geduckt links der Haustür. Rico Howard umklammerte die Türkante.
»Verdammt, der Junge wollte auf unseren Pferden türmen. Ich habe ihn erwischt, aber die Pferde sind durch den Chupadera davongerast. Jake, hörst du nicht?«
Jake Harper wandte langsam den Kopf. Der bullige Mann starrte Franklin wortlos entgegen, und er sah aus, als wäre er um Jahre gealtert.
Franklin konnte jetzt endlich um die Tür und an dem seltsam zusammengekrümmt vor ihm stehenden Howard vorbeiblicken.
In derselben Sekunde, in der Franklin sah, auf wen Harper wie ein Rasender geschossen hatte, bekam der sehnige Texaner keinen Ton mehr über die Lippen. Und dann geschah das, was sie alle niemals vergessen sollten, die Frau öffnete langsam die Lider und hob matt die Rechte. Ihre Stimme klang dünn, seltsam leer und geisterhaft flüsternd.
»Mörder«, flüsterte die hagere Frau. Sie schien die drei Männer nacheinander anzublicken – zuerst Harper, dann Franklin und schließlich, indem ein drohender Ausdruck in ihre Augen trat, auch Rico Howard. »Mörder. Seid verflucht – ihr blutigen Mörder.«
Es war Howard, als bräche aus ihren Augen ein Blick tödlichen und furchtbaren Hasses – ein Blick, der ihn verfolgen und in keiner Nacht mehr ruhig schlafen lassen würde.
Bis zu dieser Sekunde hatte er sie angestarrt und nichts als ein abgrundtiefes Grausen empfunden. Nun war es Howard, als kämen ihm ihre schrecklichen Augen immer näher. Ihr Arm reckte sich, und ihre langen Finger krümmten sich. Es war, als wollte sie nach ihm greifen.
Rico Howard, der Mann aus Santa Rita, dessen Mutter eine Mexikanerin gewesen war, stieß einen dumpfen Laut des Entsetzens aus. Aufgewachsen in einer Welt, in der vieles von jenem heimlichen Aberglauben seiner mexikanischen Verwandten geprägt worden war, ließ Rico Howard die Türkante los und wich mit einem tierhaft schrillen Schrei zurück.
Er hatte sich nicht getäuscht. Die sterbende Frau wollte ihn packen, ihr furchtbarer Blick ließ ihn nicht frei. Er schrie – und dann kam der jähe Schmerz, raste durch sein linkes Bein und krallte sich in seinen Leib.
Rico Howard, der Mann aus Santa Rita, drehte sich unbeholfen und plötzlich einknickend um. Dann stürzte er zu Boden, die flüsternde, raunende Stimme der hageren Frau im Ohr:
»Ihr seid alle verflucht – ihr werdet alle sterben.«
Die schreckliche Stimme drang durch das Rauschen, das sich zum brüllenden Tosen steigerte und durch seine Trommelfelle den Weg in seinen Kopf fand.
Ich falle, dachte Rico Howard, ich falle. Hilfe, ich falle.