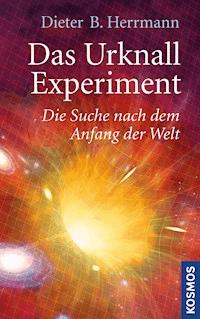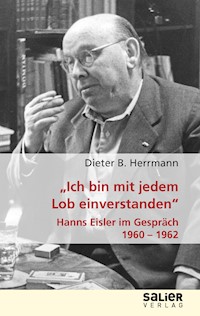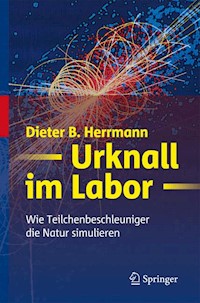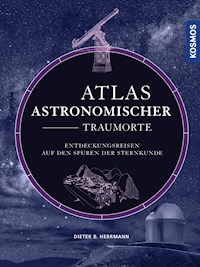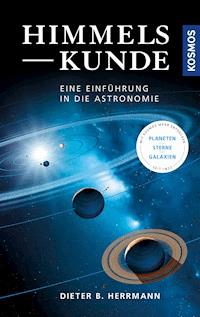14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von der Antike bis zur modernen Teilchenphysik, von Pythagoras bis Einstein: Immer wieder hat sich gezeigt, dass unser Universum im Grunde ganz einfach konstruiert ist. Der bekannte Astronomie-Historiker Prof. Dieter B. Herrmann verfolgt erstmals den verblüffenden Zusammenhang von Harmonie und Wahrheit in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Ein historischer Streifzug mit brisanter Aktualität und Stoff für viele angenehme Lesestunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Impressum
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de.
Über Neuigkeiten informieren Sie regelmäßig unsere
Newsletter, einfach anmelden unter kosmos.de/newsletter.
© 2017, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-15854-8
Projektleitung: Sven Melchert
Redaktion: Justina Engelmann
Produktion: Ralf Paucke
eBook-Konvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Mir kommen die Wege, auf denen die Menschen
zur Erkenntnis gelangen, fast ebenso bewunderungswürdig vor
wie die Natur der Dinge selbst.
Johannes Kepler
Die Qual mit der Wahl
Es gibt Themen in der Wissenschaft, denen sich der Mensch schon so lange widmet, wie die Wissenschaft überhaupt existiert – sie sind wahre »Dauerbrenner«. Dazu gehört auch der Gegenstand dieses Buches. Über die Harmonie der Welt machte man sich schon vor mehr als 2000 Jahren Gedanken. Dass sich dies bis heute nicht grundlegend geändert hat, lässt freilich erkennen, dass trotz allen Grübelns und Forschens offensichtlich noch keine allgemein akzeptierte Lösung gefunden wurde.
Was unter Harmonie konkret zu verstehen sei – schon daran schieden und scheiden sich die Geister. Der Begriff gilt als vage und daher schwer zu definieren. In unterschiedlichen Zusammenhängen oder verschiedenen Zeitepochen wird er durchaus verschieden verstanden. Auch im alltäglichen Leben verwenden wir diesen Begriff sehr häufig, sprechen von einer »harmonischen Ehe«, gar von »harmonischen Persönlichkeiten« und jeder glaubt zu wissen, was damit gemeint ist. »Harmonie« – obwohl nicht streng definiert – wird intuitiv verstanden, etwa in dem Sinne, dass alles »in Ordnung« sei – also geordnet, strukturiert und somit das Gegenteil von chaotisch.
Die Suche nach der Harmonie des Universums beschäftigt Forscher und Wissenschaftler schon seit vielen Jahrhunderten. Die Abbildung zeigt das Frontispiz des Himmelsatlas’ Harmonia Macrocosmica von Andreas Cellarius (1596–1665).© Andreas Cellarius/Wikimedia Commons
Bereits bei dem Versuch, Harmonie zu definieren, benötigen wir also andere Begriffe. Von »ausgeglichen« ist dann zum Beispiel die Rede, wobei offen bleibt, was sich da gegenseitig ausgleicht. Sind es vielleicht Gegensätze, die sich im Gleichgewicht befinden? Oder ist der Begriff »harmonisch« einfach nur ein subjektiver Ausdruck für das, was uns gefällt? Handelt es sich um einen Brückenschlag zwischen Ästhetik und Rationalität? Dass Esoteriker – eine ebenfalls nicht scharf definierte Gruppe von Menschen – die Harmonie inbrünstig zum Zentrum ihrer »ganzheitlichen Weltsicht« erklärt haben, macht die Sache auch nicht gerade einfacher.
In der Kunst wird Harmonie immer als ästhetischer Begriff verstanden. Zwar gibt es auch dort ein mehr als 2000-jähriges Nachdenken über den Harmoniebegriff, er wird aber meist mit Schönheit oder in der Musik mit »Wohlklang« gleichgesetzt. Doch gerade in Musik, Malerei oder Architektur gilt ja auch der bewährte Satz: »Über Geschmack lässt sich nicht streiten.« Außerdem unterliegt der ästhetische Schönheitsbegriff, auf den sich die Mehrheit der Rezipienten in einer bestimmten Zeit einigen kann, nachweislich dem historischen Wandel. So soll beispielsweise Goethe die Musik Beethovens noch wie »Maschinenlärm« empfunden haben. Wer würde ihr heute eine solche Eigenschaft zuschreiben? Gibt es aber vielleicht dennoch auch hier »Invarianten«, durch alle Zeiten unveränderliche Gesetze, eben »absolute Harmonien«, an denen die Künstler jedweder Epoche nicht vorbeikommen, wenn sie etwas »Schönes«, künstlerisch Kreatives und Anspruchsvolles schaffen wollen, das allenthalben Gefallen erregt und mehrheitlich Zustimmung findet?
Schon seit Längerem sprechen auch Mathematiker und Physiker von der »Schönheit« ihrer Gleichungen und sogar von deren »Eleganz«. Wie können aber Kriterien, die der Empfindung und dem Geschmack unterworfen sind, etwas mit der Suche nach objektiven wissenschaftlichen Wahrheiten zu tun haben? Interessanterweise konterkariert der Volksmund den Harmoniebegriff als Wahrheitskriterium mit der kurzen Redewendung: »Das ist zu schön, um wahr zu sein.« Dahinter verbirgt sich offenbar die Überzeugung: Das Wahre ist nicht schön, und das Schöne ist nicht wahr.
Das Spektrum der verschiedenen Begriffe und deren Bedeutungen drückt wohl eher etwas anderes aus: Im Grunde geht es immer um die Suche nach allgemeinen, möglichst einfachen Grundprinzipien, aus denen sich die Vielfalt der Welt erklären lässt. Viele der in der Geschichte dafür verwendeten Begriffe, insbesondere die der »Harmonie« und der »Symmetrie«, können durchaus auch als Synonyme für Strukturgesetze gelesen werden, denen die »Ganzheit« möglicherweise unterliegt. Und dahinter verbirgt sich offensichtlich ein Streben des Menschen, durch geistige Arbeit und auf der Grundlage von Beobachtungen Ordnung in das äußerst komplexe Geschehen zu bringen, das ihn umgibt. Ob eine letztlich einfache Ordnung in diesem Sinne tatsächlich existiert oder ob sie nur eine Wunschvorstellung des Menschen darstellt, ein Phantom, dem er vergeblich nachjagt, ist auch heute noch immer lebhaft umstritten und insofern eine offene Frage. Das Bestehen von Naturgesetzen, die sich mannigfach durch Beobachtungen, aber auch in der Praxis unseres Alltags bewährt haben, lässt aber hoffen, dass die Suche nach »Harmonie«, wie man sie auch immer definieren mag, letztlich von Erfolg gekrönt sein könnte.
In diesem Buch wollen wir Menschen auf der langen Suche nach »Harmonie« im Universum begleiten. Dabei werden wir immer wieder bemerkenswerten Forscherpersönlichkeiten begegnen, die – obwohl als Wissenschaftler der Suche nach Wahrheit verpflichtet – von Grundüberzeugungen, ja »Vor-Urteilen« und Glaubenssätzen geleitet wurden. Begriffe wie »Harmonie« und »Symmetrie« dienten ihnen als Fackeln in dunklem Gelände, ließen sie aber dennoch oft genug im Stich und konnten sie nicht vor Irrwegen bewahren. Doch gerade das macht die Geschichte spannend und widerspruchsvoll.
Nun hoffe ich, dass Sie mir auf dem mitunter durchaus beschwerlichen Weg durch die Welt der Harmonien und Symmetrien folgen mögen und zu eigenem Nachdenken über das nie endende große Abenteuer der Naturforschung angeregt werden. Gerne übrigens auch zu Einspruch oder vielleicht sogar zu neuen eigenen Ideen.
Berlin, im Frühjahr 2017
Dieter B. Herrmann
KAPITEL 1
Harmonie in der Antike
Vorwissenschaftliche Zeiten
Den Leitbegriff »Harmonie« und seine verschiedenen Synonyme wie Symmetrie, Schönheit, Eleganz, Ordnung, Einfachheit hat es in den Zeiten unserer Vorväter, der Jäger und Sammler, sicher noch nicht gegeben. Ganz abgesehen davon, dass solche abstrakten Begriffe noch außerhalb des Denkens der damals lebenden Menschen gelegen haben dürften, war doch der Lebensalltag vor allem vom Kampf mit der Natur bestimmt. Das Überleben erforderte die körperliche und geistige Auseinandersetzung mit rätselhaften Mächten. Um die eigene Existenz zu sichern, bedurfte es der körperlichen Bezwingung von Tieren, die dem Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen waren. Das Sammeln wild wachsender Früchte zwang zum Nomadentum. Wenn dann eine nahrhafte Trophäe über dem Feuer brutzelte und die Sippe ihren Hunger gestillt hatte, kam sicher auch damals schon bei allen Beteiligten »Wohlbehagen« auf – man spürte »Harmonie«. Die Gegensätze hatten einen Ausgleich gefunden.
Doch auch Naturkatastrophen forderten ein ständiges Reagieren: Hitzewellen und Dürrezeiten, Gewitter, Kälteeinbrüche, Erdbeben oder Vulkanausbrüche demonstrierten die Ohnmacht des Menschen, der er mehr oder weniger intuitiv begegnen musste. Der Mensch schien einem von ihm unverstandenen und unbeeinflussbaren Schicksal höherer Mächte ausgeliefert zu sein. Dennoch – und vermutlich gerade deshalb – verbanden die Menschen bis in eine Zeit, die etwa 11 000 Jahre weit in der Vergangenheit liegt, bestimmte Vorstellungen mit der Welt, in der sie lebten. Sie hatten bereits ihre Weltbilder. Der Plural ist hier berechtigt, weil es viele solcher »Gesamtbilder« gab, je nach den Regionen, in denen diese Menschen lebten. Diese »Weltbilder« existierten gleichzeitig, aber auch zeitverschoben und unabhängig voneinander und wiesen bei aller Verwurzelung in den jeweiligen kulturellen und geografischen Realitäten und dadurch bedingten Unterschieden auch viele Gemeinsamkeiten auf.
Die Aboriginals zum Beispiel, die Zehntausende von Jahren unberührt von anderen Kulturen auf dem Inselkontinent Australien gelebt hatten und die wohl älteste indigene Kultur der Erde darstellen, verlegten die Entstehung der Welt in eine weit vor die Existenz der Menschen zurückreichende Epoche, die »Traumzeit« (Tjukurrpa). Da niemand von den Erfindern der »Traumzeit« dabei gewesen war, konnte man sie umso trefflicher ausmalen, und schließlich wurde sie zum Bestandteil eines Überzeugungssystems, das sich im Denken der Menschen fest verankerte. In der Traumzeit waren die Schöpferahnen aktiv, insbesondere die Regenbogenschlange, die bei den australischen Ureinwohnern eine zentrale Rolle einnimmt. Als weibliche Figur ist sie die Schöpferin der irdischen Landschaften, als männliche Erscheinung stellt sie die Sonne dar und erzaubert den Regenbogen. Ursprünglich männlich, verschlang sie einst zwei weibliche Wesen und verkörpert seitdem die Gegensätze der Geschlechter in sich. Durch den Regenbogen vermag sie auch Himmel und Erde miteinander zu verbinden.
Die zahlreichen mündlich überlieferten Geschichten über die »Traumzeit« mögen zwar poetisch sein, doch sie heute als »Weisheit« der Altvorderen auszugeben, mutet naiv an. Worin soll die Weisheit von Sätzen bestehen, für die es keine Beweise gibt oder die im Licht inzwischen gesicherter Erkenntnisse sogar falsch sind? Waren nicht die »Traumzeit-Geschichten« viel eher Ausdruck des Verlangens ihrer Erfinder, dem Anfang von allem auf die Spur zu kommen, und zugleich dies die damals einzig mögliche Art, dieses Bedürfnis zu stillen? Man könnte es auch positiv wenden und behaupten: Diese Geschichten waren die fantastische Vorwegnahme späterer Wissenschaft und enthalten in symbolisch-mystischer Sprache auch manches reale Erleben der Menschen wie beispielsweise die klimatischen Verhältnisse zwischen Trockenzeiten und heftigen Regengüssen. Der Wissenschaft nachfolgender Zeiten gleichen die Mythen in ihrem Bestreben, die Welt aus »Urbildern« oder »Grundprinzipien« heraus zu verstehen. Ähnliche Konstrukte finden wir auch in den meisten anderen alten Kulturkreisen indigener Völker.
Babylonische Beobachtungen
Wenn wir genau feststellen wollten, wann die Wissenschaft in das Leben der Menschen getreten ist, dann würden wohl streitbare Zeitgenossen zunächst nach der Definition von Wissenschaft fragen. Wie auch immer, eines ist sicher: Die Babylonier haben etwas begonnen, was deutlich hinausging über die Mythen ihrer Vorgänger.
Babylon, die an den Ufern des Euphrat gelegene Hauptstadt Babyloniens, war eines der bedeutendsten Zentren der Kultur des Altertums. Vor allem dem »Vater der Geschichtswissenschaft«, Herodot von Halikarnassos, verdanken wir Berichte über Babylon in seinen neunbändigen »Historien«, die er im 5. Jahrhundert vor Christus niedergeschrieben hat. Demnach war die Stadt überaus groß und prächtig und von einer 86 Kilometer langen Festungsmauer umgeben – eine ziemlich unverfrorene Übertreibung, wie Ausgrabungen später zeigten. Den berühmten, fast hundert Meter hohen »Turmbau zu Babel«, von dem Herodot ebenfalls spricht, der auch im Alten Testament der Bibel thematisiert wird und mit dem man dem Himmel näherkommen wollte, hat es aber tatsächlich gegeben, wie Ausgrabungsergebnisse im frühen 20. Jahrhundert bewiesen. Es handelt sich um eine sogenannte Zikkurat, einen gestuften Tempelturm, der erstmals bereits 689 v. Chr. erwähnt, danach aber zerstört wurde. Schließlich begann sein Wiederaufbau, der unter Nebukadnezar II. im 6. Jahrhundert vor Christus vollendet wurde.
So hat der echte Turm zu Babel bestimmt nicht ausgesehen. Bildende Künstler von Pieter Brueghel (ca. 1525–1569) bis René Magritte (1898–1967) haben den Turm immer wieder fantasievoll als Symbol der Selbstüberschätzung des Menschen dargestellt. Diese Abbildung zeigt den Turm zu Babel von Joos de Momper II. (1564–1635). Das Werk hängt in den Königlichen Museen der schönen Künste in Brüssel.© Joos de Momper II. (ca. 1600), Königliche Museen der Schönen Künste, Brüssel, Foto: Laura Maturana Jahn.
Die große Ausdehnung des babylonischen Reiches, die zahlreichen Bewässerungssysteme, die Notwendigkeit der Feldvermessung und andere praktische Bedürfnisse stimulierten die Entwicklung von Mathematik und Rechentechnik. Für das Kalendersystem waren auch astronomische Beobachtungen erforderlich. Doch ging es allein darum? Weshalb gaben sich die Babylonier eine solche Mühe? Weshalb haben sie über Jahrhunderte hinweg so sorgfältige Beobachtungen des Himmels durchgeführt?
Eine heute durchaus verbreitete Deutung verbindet diesen Beobachterfleiß mit dem Begriff der Neugier – einer der urtümlichsten Eigenschaften des Menschen, die Einstein gar »göttlich« genannt hat –, also von Anbeginn zum Wesen des Menschen gehörend, ihm gleichsam eingepflanzt. Neugier heißt: Wir wollen geradezu zwanghaft etwas wissen, von dem wir gar nicht sagen können, warum wir es eigentlich zu erfahren wünschen. Das mag eine Rolle gespielt haben. Doch hinter den babylonischen Himmelsbeobachtungen verbirgt sich noch etwas anderes: Die Babylonier glaubten, die Wandelsterne seien Götter oder zumindest so etwas wie Dolmetscher des göttlichen Willens. Der heute nach den Römern so genannte Planet Jupiter galt bei ihnen als »Stern des Marduk«, des höchsten ihrer Götter. Die römische Venus war der Liebesgöttin Ishtar zugeordnet, Mars dem Kriegsgott Nergil. Da lag es nahe, sich durch sorgfältige Beobachtungen des Willens der Götter zu vergewissern, nicht zuletzt, um das eigene Handeln danach auszurichten oder auf kommende Ereignisse vorbereitet zu sein.
Die ältesten Beobachtungen, die uns überliefert sind, entstammen der Zeit der Hammurapi-Dynastie, die nach neuen Ermittlungen die Periode von etwa 1800 v. Chr. bis 1595 v. Chr. umfasst. Besonders aussagekräftig ist ein altes, immer wieder abgeschriebenes und zitiertes Kompendium aus der Zeit um 2000 v. Chr. Es wurde in der Bibliothek des Assurbanipal gefunden und bestand aus etwa 7000 Tontafeln, darunter auch die Serie Enuma Anu Enlil (Als die Götter Anu und Enlil […]). Dort finden wir sorgfältig in Keilschrift notiert die astronomischen Beobachtungen der Priesterkaste des Zweistromlandes, und zwar eindeutig und engstens mit astrologischen und religiösen Auffassungen verbunden. Auch Sonne und Mond wurden als Götter verehrt. Mit Hilfe des Schattenstabes (Gnomon) wurde die Bewegung der Sonne verfolgt, Jahres- und Tageslängen bestimmt und die Erkenntnis gewonnen, dass sich die Sonne nicht auf dem Himmelsäquator bewegt. Vielmehr durchläuft sie eine gegen den Äquator geneigte Bahn, die heute so genannte Ekliptik. Die Babylonier stellten fest, dass sich die Sonne um den Frühlings- und Herbstanfang auf dem Anu-Weg aufhält (15 Grad nördlich bis 15 Grad südlich des Himmelsäquators), zu Sommerbeginn aber auf dem nördlich des Anu-Weges gelegenen Enlil-Weg und beim Winteranfang auf dem südlich gelegenen Ea-Weg.
Unsere Sonne bewegt sich während eines Jahres – nach babylonischen Erkenntnissen – auf den nach drei Göttern benannten Wegen Anu, Enlil und Ea. Zu Frühlings- und Herbstbeginn durchwandert sie den mittleren Weg des Anu, am Sommeranfang durchschreitet sie den nördlicher gelegenen Weg des Enlil und zu Winterbeginn befindet sie sich auf dem weiter südlich liegenden Weg des Ea.© Gerhard Weiland/Kosmos Verlag.
Während Sonnen- und Mondbeobachtungen für die Schaffung eines Kalenders erforderlich sind und tatsächlich dafür genutzt wurden, tragen aber Venusbeobachtungen zur Chronologie nichts bei. Sie sind offenbar einzig aus astrologischen und religiösen Gründen betrieben worden. Aus einer über 21 Jahre fortgesetzten Beobachtungsserie der Venus wurden die Periodizitäten ihrer Bewegung abgeleitet, womit auch der »Wille« dieser Göttin transparent wurde.
Dass aus alldem einst jenes Phänomen hervorgehen würde, das wir heute Wissenschaft nennen, das konnten die Priesterastronomen natürlich nicht ahnen. Aber ganz ohne Zweifel ist das von ihnen erarbeitete Wissensgut in der griechischen Antike nicht nur bekannt gewesen, sondern auch zur Grundlage der weiteren Entwicklung der Wissenschaft gemacht worden. So kann man durchaus von einer Kontinuität der Entwicklung sprechen. Jedoch unterscheiden sich die Griechen in ihrer Herangehensweise an die Phänomene ganz wesentlich von den Babyloniern, wie wir sogleich sehen werden.
An der Wiege der Wissenschaft
Unter Antike verstehen wir heute eine geschichtliche Epoche, die sich geografisch auf den Mittelmeerraum und zeitlich etwa auf die Spanne von 800 v. Chr. bis 600 n. Chr. bezieht. In dieser Region und dieser Zeit bildete sich eine eigenständige kulturelle Tradition heraus, die besonders für die Wissenschaftsentwicklung von großer Bedeutung gewesen ist. Zwei Großreiche prägten die antike Epoche, vor allem das hellenistische, aus dem später das römisch-byzantinische Reich hervorging, und das persische Machtzentrum. Insbesondere das antike Griechenland gilt – ungeachtet vieler kriegerischer Auseinandersetzungen mit benachbarten Mächten – bis heute und zu Recht als eine der entscheidenden Wurzeln der sogenannten abendländischen Kultur.
Anders als bei den Babyloniern oder Ägyptern ging es bei den Griechen nicht um die Suche nach »Rezepten« oder »Regeln« für das Funktionieren der Natur, vielmehr stand bei ihnen das Bemühen im Vordergrund, die bereits angehäuften Kenntnisse in einen Zusammenhang zu bringen und zu einem mehr oder weniger rational begründeten Weltbild zu verschmelzen. Der Kern antiker griechischer Wissenschaft war also die »Welterklärung« – und dies nicht nur in Bezug auf die Natur, sondern ebenso auf die Gesellschaft und den Menschen. Die astrologischen Aussagen der Chaldäer wurden daher von vielen griechischen Denkern mit kritischem Zweifel betrachtet. So warnte etwa Eudoxos von Knidos davor, den Weissagungen der Babylonier irgendwelchen Glauben zu schenken, und Theophrast, ein Schüler des Aristoteles, fand es »merkwürdig«, nicht nur gutes und schlechtes Wetter, sondern auch schicksalhafte Ereignisse prophezeien zu wollen.
Die Entwicklung von Ideen vollzog sich bei den Griechen über Generationen hinweg und wurde meist von Einzelnen und deren Schülern vorangetrieben. Vielleicht ist in dieser Art des Vorwärtsschreitens auch ein Grund dafür zu sehen, dass viele alte Originaltexte verloren gingen. Wenn sie durch neue Erkenntnisse als überholt galten, wurden sie des Aufbewahrens nicht mehr für wert befunden. Aristoteles sah die wissenschaftliche Erkenntnis schon zu seiner Zeit als einen Prozess an und setzte sich in seinen Werken deshalb auch stets mit den Ansichten früherer Gelehrter auseinander. Auf diese Weise sollte die Wahrheit herausgefunden werden.
Wissenschaften in unserem modernen Sinn existierten damals zwar noch nicht, aber die Anfänge wissenschaftlichen Denkens sind besonders seit den Zeiten der sogenannten Vorsokratiker (etwa 600–350 v. Chr.) deutlich zu erkennen. Den Beginn dieser Epoche markiert der Naturphilosoph Thales von Milet. An die Stelle von Mythen treten zunehmend rationale Argumente zur Erklärung der Welt. Zwar unterschied man bei der Beschäftigung mit der Natur durchaus schon zwischen geografischen, mathematischen, astronomischen, meteorologischen und sogar psychologischen Problemen, aber alle diese noch wenig streng gegliederten »Disziplinen« verband als übergeordnete Wissenschaft die Philosophie. Platon vertrat jedenfalls nachdrücklich die Ansicht, dass die obersten Grundsätze der Wissenschaften von der Philosophie kommen sollten – eine Meinung, die später auch Aristoteles formuliert hat, der den theoretischen Teil der Philosophie in Physik, Mathematik und Theologie gliederte.
So verwundert es auch nicht, dass die heute berühmten antiken Philosophen von Thales über Sokrates bis Platon und Aristoteles sich zu naturwissenschaftlichen Fragen äußerten, und dass andererseits deren philosophische Vorstellungen einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Naturwissenschaften ausübten. Interessant ist auch, dass von den Griechen erdachte Grundprinzipien, wie auch jenes der »Harmonie«, für alle diese Gebiete zu tragenden Säulen wurden, von der Astronomie über die Psychologie, Architektur und Rechtsprechung bis zur Politik. Nur indem wir diese enge Symbiose beachten, können wir die historische Entwicklung jener geistig außerordentlich fruchtbaren Epoche überhaupt verstehen. Es war eine Zeit, in der über Zusammenhänge nachgedacht wurde, die heute fast an den Rand intellektueller Auseinandersetzungen gedrängt sind – nicht immer zum Vorteil der modernen Wissenschaft.
In der Astronomie bestand die große rationale Leistung der Griechen darin, dass sie ein Modell entwickelten, mit dem die vielfältigen bereits bekannten Himmelserscheinungen aus wenigen Grundsätzen hergeleitet werden konnten. Die Basis dieses Weltbildes war selbstverständlich die Mittelpunktsstellung der Erde. Selbstverständlich, weil es dem entsprach, was jeder mit seinen eigenen Augen sehen konnte: Sonne, Mond und Sterne bewegen sich um die Erde. Und hier kommt nun auch der Gedanke der Harmonie ins Spiel. Wie ist die Natur beschaffen? Ist sie »harmonisch«, »einfach« oder auf »Prinzipien beruhend«? »Kosmos«, dieser von den Griechen (vermutlich von Pythagoras) für das Weltganze geschaffene Begriff, bedeutet neben »Schmuck« und »Glanz« auch »Ordnung«. Dahinter verbirgt sich die Überzeugung, dass eine solche »Ordnung« real vorhanden sei und es nur darauf ankäme, sie aufzuspüren und zu beschreiben.
Die Harmonie tritt in der griechischen Mythologie auch personifiziert als »Harmonia« auf, der Gattin des Kadmos und Göttin der Eintracht. Sie galt als Tochter eines sehr ungleichen Paares: Ares, des Kriegsgottes, und Aphrodite, der Göttin der Liebe. Die römischen Entsprechungen waren Mars und Venus.
Darstellung der Göttin Harmonia – Ausschnitt aus einem Gemälde von Evelyn De Morgan (1855–1919) aus dem Jahr 1877. Die Tochter des ungleichen Paares Ares und Aphrodite steht für vollkommene Harmonie, die laut Heraklit (ca. 520–460 v. Chr.) aus der Einheit von Gegensätzen hervorgeht.© Evelyn De Morgan (1877)/Wikimedia Commons.
Die Zeugung der Harmonia durch ein so gegensätzliches Paar ist durchaus sinnbildlich zu verstehen. Heraklit von Ephesos hat später die Wirklichkeit stets als eine Einheit von Gegensätzen beschrieben, die zu schönster Harmonie führe. Alles Werden vollziehe sich im Kampf der Gegensätze, die nicht nur eine logische, sondern auch eine physische Einheit bildeten. Als Beispiel zieht Heraklit unter anderem die Lyra (gr., Leier) heran: Der Korpus und die Saiten dieses Musikinstruments seien von entgegengesetzten Spannungen geprägt, die sowohl das Gleichgewicht als auch die Schwingungen der Saiten ermöglichten. Auch Tag und Nacht oder trocken und feucht seien ein und dasselbe, denn eines der gegensätzlichen Elemente wäre ohne das andere nicht vorhanden. Diese Harmonie werde jedoch nicht unmittelbar sichtbar, sondern liege in der Tiefe verborgen und müsse in den Gegensätzen durch das Denken des Menschen erst entdeckt werden. Diese Erkenntnis des Kampfes dürfe aber nicht blind machen für die Harmonie, die sich aus diesem Kampf ergebe.1 Heraklits Gedanken von der »Einheit der Gegensätze« wurden von Georg Wilhelm Friedrich Hegel als die Urwurzel der Dialektik erkannt: »Es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen.«2
Der rätselhafte Pythagoras
Die ersten Versuche, verborgene Harmonien zu finden und diese konkret zu formulieren, stammen wohl von Pythagoras von Samos, einer besonders nebulösen Gestalt der antiken Welt. Obwohl die Quellenlage zur Geschichte seines Lebens äußerst dürftig ist, fehlt es nicht an zahlreichen antiken Berichten über Episoden aus seiner Biografie, von denen viele, wenn nicht gar frei erfunden, so doch zumindest stark ausgeschmückt sind. Ob Pythagoras ein bedeutender Philosoph, Mathematiker und Astronom gewesen ist oder – im Gegenteil – ein an Wissenschaft kaum interessierter charismatischer Schamane, ist bis heute ein Streitpunkt der Forscher geblieben.
Denselben zwiespältigen Eindruck gewinnt man auch, wenn man die alten Aufzeichnungen über Pythagoras liest, wie sie zum Beispiel der bedeutende griechische Historiker Diogenes Laertius in seinem zehn Bände umfassenden Text Leben und Meinungen berühmter Philosophen vor fast 2000 Jahren hinterlassen hat. Ohne auf die verwirrenden Argumente der Vertreter der beiden so gegensätzlichen »Pythagoras-Bilder« hier näher einzugehen, wollen wir der natur-wissenschaftlichen Überlieferung folgen, weil gerade sie – selbst, wenn sie in vielen Einzelheiten nicht der historischen Wahrheit entsprechen sollte – doch eine erstaunliche Wirkungsgeschichte ausgelöst hat, die bis heute anhält. Das sogenannte pythagoreische Weltverständnis hat eine enorme und die Zeiten überdauernde Ausstrahlung erreicht, welche und wie viele verschiedene Personen auch immer als Miturheber daran beteiligt gewesen sein mögen.
Pythagoras von Samos (ca. 570–510 v. Chr.) war ein sagenumwobener Philosoph und Mathematiker, den manche bis heute für einen charismatischen Schamanen halten.© Unbekannt, Holzstich von 1867, vermutlich nach antiker Büste/Archiv Dieter B. Herrmann.
Pythagoras soll sich in seiner Jugend angeblich längere Zeit in Ägypten und Mesopotamien aufgehalten haben, wo er mit verschiedenen »Mysterienkulten« in Verbindung gekommen sei – Religionen, deren Inhalte und Riten vor Außenstehenden geheim gehalten wurden. Als Folge dieser Kontakte habe er dann selbst einen Geheimbund gegründet, der sich von zahlreichen anderen jedoch dadurch unterschied, dass er den Gesetzen der Zahlenwelt huldigte. Dadurch versuchten die Mitglieder dieses Bundes die Vereinigung mit dem Göttlichen herbeizuführen, denn – so meinten sie – das eigentliche Wesen der Welt bestünde in den Zahlen und ihren harmonischen Beziehungen. Der Geheimbund der Pythagoreer, eine Art »Bruderschaft« und geistige Bewegung mit einer Fülle strenger asketischer und vegetarischer Verhaltensregeln und dem Pentagramm als Erkennungszeichen, hat sogar eine beträchtliche politische Bedeutung erlangt, verband er sich doch gern mit der Aristokratie und wurde dadurch bei den Anhängern der Demokratie derart verhasst, dass es im 5. Jahrhundert vor Christus sogar zu antipythagoreischen Aufständen kam. Die Geheimbünde wurden aufgelöst und viele ihrer Anhänger aus Unteritalien nach Griechenland vertrieben, wo sie ihre Lehre weiter propagieren konnten.
Doch zurück zum Kern der geistigen Hinterlassenschaft des Pythagoras. »Und in der Tat«, schreibt er in einem Traktat, »hat ja alles, was man erkennen kann, eine Zahl. Denn ohne sie lässt sich nichts erfassen oder erkennen.«3 Wenn aber Pythagoras und seine Anhänger in der Zahl das eigentliche »Wesen der Dinge«, gleichsam eine mathematische Harmonie sahen, beschäftigten sie sich folgerichtig intensiv mit den Zusammenhängen zwischen Zahlen und begründeten somit das quantitative Studium der Welt – zweifellos ein großes Verdienst. Die Gesetzmäßigkeiten der Zahlen wurden abstrakt formuliert und mathematische Sätze mussten auf der Grundlage bestimmter Annahmen (Postulate) bewiesen werden. Ein bekanntes Beispiel ist der Satz des Pythagoras, nach dem die Summe der Quadrate der Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks gleich dem Quadrat der Hypothenuse ist. Ob dieser Satz tatsächlich von Pythagoras entdeckt und bewiesen wurde – darüber gibt es unter Historikern mit Blick auf die oben bereits erwähnte dürftige Quellenlange einen bis heute andauernden Streit.
Neben diesen rationalen Errungenschaften einer beweisenden Mathematik blühte bei den Pythagoreern auch die Zahlenmystik. Bestimmte Zahlen galten als »besonders«, so beispielsweise die Zehn, weil sie die Summe der ersten vier Zahlen ist, oder die Fünf als Symbol für die Ehe, weil sie die Summe der ersten geraden Zahl (Zwei) und der ersten ungeraden Zahl (Drei) darstellt. Pythagoras hat sich auch mit den sogenannten Dreieckszahlen befasst und damit eine erste Brücke zwischen symmetrischen geometrischen Formen und der Arithmetik geschaffen. Als Dreieckszahlen gelten alle Zahlen, aus denen sich Dreiecke durch »Auslegen« zusammensetzen lassen, also zum Beispiel die Drei, die Sechs und auch die »besondere« Zahl Zehn.
Die sogenannten Dreieckszahlen Drei, Sechs, Zehn und 15 lassen sich – durch eine entsprechende Anzahl von Kugeln dargestellt – zu Dreiecken formen.© Gerhard Weiland/Dieter B. Herrmann.
Die Geheimnisse der Welt lagen für Pythagoras letztlich in den Zahlen verborgen und vier Künste waren es daher vor allem, die nach seiner Ansicht zum Verständnis der Welt führen könnten: die Arithmetik oder Zahlenlehre, die Geometrie als Lehre von der Ordnung des Raumes in Zahlen, die Harmonik (Musik), die von Platon später als »Zahlen in der Zeit« bezeichnet wurde, und schließlich die Astronomie, deren Gegenstand Zahlen in Zeit und Raum sein sollten. Dieses »Quadrivium« (lat., vier Wege) beherrschte fortan alle Versuche, die Harmonie hinter den Dingen dieser Welt zu finden.
Wie der Harmoniegedanke bei Pythagoras aufgekeimt sein soll, darüber berichtet eine legendäre Überlieferung zum Besuch des Philosophen in einer Schmiede. Der Neupythagoreer Nikomachos von Gerasa erzählt davon rund 600 Jahre nach dem Tod des Pythagoras die folgende, sicher reichlich ausgeschmückte Geschichte: Eines Tages sei Pythagoras an einer Schmiede vorbeigekommen und habe dem Klang der auf die Ambosse schlagenden Hämmer gelauscht. Dabei sei ihm aufgefallen, dass sie »miteinander vermischt ganz harmonische Klänge von sich gaben, mit Ausnahme eines einzigen Paars. Er erkannte in ihnen den Zusammenklang der Oktave, der Quinte und der Quarte.«4 Daraufhin sei Pythagoras in die Schmiede gestürzt und habe durch Experimente herausgefunden, »dass der Klangunterschied von den Gewichten der Hämmer abhänge, nicht von der Kraft der Hämmernden oder der Form der Hämmer […]«.5 Zu Hause angekommen, habe er die Experimente in abgewandelter Form fortgesetzt, indem er an einem Pflock in der Wand vier gleich lange Saiten aus gleichem Material befestigte und am unteren Ende mit einem Gewicht versah. Als er nun jeweils zwei Saiten gleichzeitig anschlug, bemerkte er bei jedem Paar eine andere jener Konsonanzen, die ihm schon in der Schmiede aufgefallen waren. Die Saite mit dem größten Gewicht ließ im Verhältnis zu jener mit dem kleinsten eine Oktave erklingen. Die eine Saite war mit zwölf Gewichten gespannt, die andere mit sechs. »So wies er nach, dass die Oktave auf der Proportion 2 : 1 beruht.«6 Auf dieselbe Weise fand er für die Quinte das Zahlenverhältnis 3 : 2 und für die Quarte 4 : 3.
Ein Monochord ist ein instrumentenähnliches Werkzeug, das den zusammen wohlklingenden Intervallen Oktave, Quinte, Quarte und Terz ganzzahlige Verhältnisse der Saitenlängen zuordnet. Bei der Oktave ist es das Verhältnis 2 : 1 (eine volle Saitenlänge gegenüber zwei halben – oben im Bild dargestellt), bei der Quinte ist es das Verhältnis 3 : 2, bei der Quarte 4 : 3 und bei der Terz 5 : 4.© Gerhard Weiland/Dieter B. Herrmann.
Jedenfalls soll daraus eine Untersuchung hervorgegangen sein, die sich mit dem Monochord beschäftigte (angeblich sogar eine Erfindung des Pythagoras), einer Art Musikinstrument, bei dem über einen Resonanzkasten mehrere Saiten gespannt sind. Dabei zeigte sich, dass wohlklingende Harmonien bei Tönen entstanden, deren Saitenlängen das Verhältnis ganzer Zahlen aufwiesen. Pythagoras wurde so angeblich zum »Erfinder« der Musik und ihrer Gesetze.
Doch sein Gedankenflug wurde durch diese Entdeckung nur noch weiter inspiriert. Zahlenverhältnisse kannte man ja bereits von den Babyloniern zu den Bewegungen der Planeten. So entwickelte Pythagoras die Idee, dass durch die Bewegungen der Planeten und der durchsichtigen Sphären, an denen sie mutmaßlich befestigt waren, ebenfalls Töne entstünden, so dass sich im Zusammenspiel ihrer Bewegungen eine »Sphärenmusik« ergebe. Im Kosmos sollten dieselben Gesetze herrschen wie in der Musik: ein harmonischer Zusammenklang als Ausdruck einer Ordnung.
Bei Aristoteles wird später davon berichtet, dass dem eine durchaus physikalische Überlegung zugrunde lag. Da schnell bewegte Körper auf der Erde Geräusche verursachen, mussten das die viel schnelleren und größeren Himmelskörper erst recht tun. Jeder bewegte Planet sollte also einen Ton erzeugen. Dessen Höhe hänge von seiner Geschwindigkeit und seinem Abstand vom Mittelpunkt der Welt ab, also der Erde. Diese Größen sollten aber gerade so beschaffen sein, dass die erzeugten Töne eine Harmonie ergäben wie die Hämmer in der Schmiede oder die Saiten auf dem Monochord. Dass wir von dieser kosmischen Sphärenmusik nichts wahrnehmen, galt durchaus als erklärungsbedürftig. Die Pythagoreer meinten, der Grund liege darin, dass diese Klänge dauernd vorhanden seien, wir also keine Gelegenheit hätten, ihr Gegenteil, die absolute Stille, zu hören. Archytas von Tarent, ebenfalls ein Pythagoreer, hielt das menschliche Gehörorgan für zu eng, um diese gewaltigen Töne aufzunehmen. So hatte man seine Ruhe trotz der ständigen Sphärenmusik. Pythagoras freilich wurde die Fähigkeit zugeschrieben, sie hören zu können. Die Idee dieser Sphärenmusik breitete sich aus wie eine Religion. Ganz losgelöst von den tatsächlichen historischen Hintergründen, über die wir wenig wissen, wirkt sie bis in die Gegenwart.
Die Vorstellung einer an das Musikalische angelehnten Harmonie, eines »Wohlklangs« der Welt, fand einen ersten begeisterten Anhänger in dem Philosophen Platon, der davon auf einer Italienreise gehört hatte. Die Ideen der Pythagoreer fanden bei Platon einen solchen Anklang, dass er in älteren philosophischen Werken manchmal selbst zu den Pythagoreern gerechnet wurde. Doch er hat keineswegs nur übernommen, was er gehört hatte, sondern eine eigene Interpretation damit verbunden, die auf die Entwicklung der Astronomie große Auswirkungen haben sollte.
Die göttlichen Planeten und der Kreis
Der Kreis, das Dreieck – all dies waren für Platon vor allem »Ideen«. Niemand, so Platon, hat jemals einen idealen Kreis gezeichnet. Womit er zweifellos Recht hatte. Der Kreis als der geometrische Ort aller Punkte, die vom Mittelpunkt des Kreises den gleichen Abstand haben, existiert nirgends in der Wirklichkeit, sondern nur als Vorstellung. Er stelle ein Ideal dar, eben eine »Idee«, die wirklicher sei als jeder tatsächlich gezeichnete Kreis. In seiner Ideenlehre vertritt Platon den Standpunkt, dass man Wissen nicht durch Sinneserfahrung, sondern nur auf rein geistigem Wege erwerben könne. Die eine Erfahrung beziehe sich auf die wandelbare Welt des Scheins, jene andere aber auf unkörperliche ewige Gegebenheiten, die unseren Sinnen gar nicht zugänglich seien. Das »Schöne an sich«, die »Gerechtigkeit an sich«, all dies sind bei Platon das eigentlich Wirkliche.
Der griechische Gelehrte Platon (ca. 427–347 v. Chr.) war einer der einflussreichsten Philosophen der Antike, dessen Ideen bis heute lebendig sind. Es beschäftigte ihn auch die Frage, wie man an gesichertes Wissen gelangen und dieses von reinen Meinungen unterscheiden könne.© Archiv Dieter B. Herrmann.
Den nachhaltigsten Einfluss auf das philosophische und naturwissenschaftliche Denken übte ein Spätwerk von Platon aus, das unter dem Titel Timaios bekannt geworden ist. Dieses in Dialogform geschriebene Werk, in dem sich Platons Lehrer Sokrates und fünf weitere Gesprächsteilnehmer zu einem fiktiven Gespräch begegnen, enthält unter anderem auch eine lange Passage über Naturphilosophie, der wir Platons Auffassung über den Kosmos entnehmen können. Demnach habe ein gütiger Schöpfergott, der sogenannte Demiurg, die Welt aus Vernunft und Notwendigkeit erschaffen und zu diesem Zwecke die Weltseele gebildet, die den gesamten Kosmos zu einer Art gigantischer, lebendiger Wesenheit werden ließ. Der wichtigste Urgrund des Alls ist also nach Platon Gott. Er habe die gestaltlose und unbegrenzte Materie »in einen Raum zusammengeführt, überzeugt, dass Ordnung besser sei als Unordnung«.7 Dass die Welt kugelförmig sei, hat seinen Grund nach Platon darin, dass der Erzeuger selbst diese vollkommene Gestalt besitze. Immer wieder betont er die enge Verwobenheit des Schönsten mit dem Göttlichen: »[…] denn von dem Schönsten unter allem Erschaffenen kann nur das Beste unter allem Denkbaren die Ursache sein. Dieses aber ist nur Gott, und da das Himmelsgebäude dem Besten ähnlich ist, so kann es als Schönstes keinem der erschaffenen Dinge ähnlicher sein als die Gottheit.«8
Die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft haben in Platons Lehre mit geometrischen Formen zu tun. Es handelt sich um einige der aus regelmäßigen Flächen zusammengesetzten Platonischen Körper, von denen die ersten bereits den Pythagoreern bekannt gewesen sind. Platons Schüler und Freund Theaetetus hatte sich gründlicher mit diesen Körpern befasst und dabei erkannt, dass sich zweidimensionale symmetrische Vielecke wie Dreieck, Quadrat und Fünfeck zu symmetrischen Körpern zusammenfügen lassen. Gleiche Kantenlängen, gleiche Seitenflächen und gleiche Winkel zwischen benachbarten Flächen definierten die »Symmetria«, das Ebenmaß dieser Körper. Sie haben in der weiteren Geschichte der Astronomie und Physik eine große Rolle gespielt und spielen sie bis heute. Theaetetus fand nun heraus, dass es lediglich fünf solcher Körper geben könne. Diese fünf Körper werden heute als Platonische oder reguläre Körper bezeichnet. Gemeint sind das regelmäßige Tetraeder, ein Vierflächner aus vier Dreiecken, das Hexaeder (Würfel), bestehend aus sechs Quadraten als Seitenflächen, das Oktaeder mit acht Dreiecksflächen, das aus zwölf Fünfecken gebildete Dodekaeder sowie das Ikosaeder aus 20 Dreiecken. Diese symmetrischen Figuren werden von Platon im Timaios zu den eigentlichen Bausteinen der Welt erklärt. Das Tetraeder entspricht dem Element Feuer, das Ikosaeder wegen seiner runden und weichen Form dem Wasser, das Oktaeder der Luft und der Würfel schließlich der Erde. Das Dodekaeder wurde von Platon dem »fünften Element« zugeordnet, dem Kosmos.
Die fünf Platonischen oder regulären Körper sind aus regelmäßigen Vielecken zusammengesetzt. Es handelt sich jeweils um das Tetraeder mit vier Flächen, das Hexaeder (einen Würfel) mit sechs Flächen, das Oktaeder mit acht, das Dodekaeder mit zwölf und das Ikosaeder mit 20 Flächen.© Gerhard Weiland/Dieter B. Herrmann.