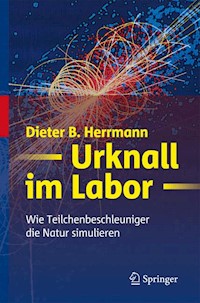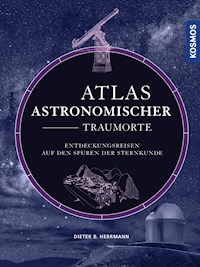14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Woher kommen die Kometen und warum hat der Saturn einen Ring? Was sind überhaupt Sterne und wie weit sind Galaxien entfernt? Wann fand der Urknall statt und wie wird das Universum enden? Spannend und leicht verständlich beantwortet Dieter B. Herrmann die wichtigsten Fragen der faszinierenden Welt der Astronomie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
PROLOG
Ein Streifzug durch die moderne Astronomie
Als Menschen sind wir es gewohnt, uns ein Bild von der Welt wesentlich durch das Auge zu verschaffen. Was wir mit eigenen Augen gesehen haben, hat für uns Vorrang vor allem, was uns berichtet wird. Doch wie verlässlich sind unsere Sinne?
Jeden Tag sehen wir „mit eigenen Augen“, dass die Sonne sich um die Erde bewegt und Jahrtausende waren die Menschen davon überzeugt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Heute wissen wir natürlich, dass die tägliche Bewegung der Sonne nur eine scheinbare ist und durch die Erdrotation hervorgerufen wird. Wohlgemerkt: Wir wissen es, aber wir sehen es nicht.
Wie trügerisch unsere Sinne sind, zeigt sich auch beim Betrachten des Sternhimmels. Wer wollte denn dabei auf die Idee kommen, dass die leuchtenden Pünktchen am Firmament ganz unterschiedlich weit von uns entfernt stehen? Der Augenschein legt vielmehr die Annahme nahe, dass wir von einer gewaltigen Kugelschale umgeben sind, an deren Innenseite die Sterne befestigt sein müssen.
Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn diese Vorstellung fest zum Weltbild unserer Ahnen gehörte.
Unser heutiges Wissen über die Himmelskörper, den Aufbau und die Entwicklung des Weltalls hat mit dem, was uns das Auge zeigt, wenig zu tun. Der Blick zum Himmel bietet nur oberflächlichen Schein. Erst die Forschung dringt in einem langwierigen Prozess zum Wesentlichen vor und dies geschieht sehr oft, indem sie sich vom Sichtbaren bewusst abwendet und mit raffinierten Methoden hinter die Kulissen der Natur blickt. Dabei kann es sich um Beobachtungsverfahren technischer Art handeln, die weit über das hinausreichen, was unsere naturgegebenen Sinne wahrzunehmen vermögen. Ebenso kommen aber auch unsere Fantasie und Intelligenz zum Einsatz, die zur Entstehung physikalischer und mathematischer Theorien führen. Bei ihnen handelt es sich aber nicht um leere Spekulationen, sondern stets wird an Beobachtungen oder Erfahrungen angeknüpft, die bei Experimenten in irdischen Labors oder im Weltraum gemacht wurden. Die Ergebnisse sind in unterschiedlichem Maße zuverlässig. Doch gerade darin besteht wohl die besondere Faszination der Astronomie: Dass es dem Menschen trotz seiner Winzigkeit im kosmischen Ganzen und wider das Trugbild der Sinne gelingt, immer weiter zur Wahrheit vorzudringen.
Dieses Buch nimmt Sie mit auf einen Streifzug durch die moderne Astronomie und stellt die wesentlichen Kenntnisse dar, die wir heute über das Weltall besitzen. Es startet mit den Beobachtungsmethoden der Astronomen und endet bei den großen ungeklärten Fragen, denen der Odem des Geheimnisvollen anhaftet. Das Buch kann je nach Belieben wie ein Roman vom Anfang bis zum Ende gelesen werden. Andererseits sind die Kapitel weitgehend in sich abgeschlossen, sodass es sich auch als Nachschlagewerk nutzen lässt. Der Umfang des Buches und die beabsichtigte Verständlichkeit setzen allerdings Grenzen, was die Tiefe der Darstellung anlangt. Deshalb sind im Anhang Hinweise auf weiterführende Literatur angegeben, auf die das Lesen Lust machen soll. Die Kosmos-Himmelskunde erschien zum ersten Mal im Jahre 1999 und hat seither bereits sieben Auflagen erlebt, die inzwischen vergriffen sind. Das hat Verlag und Autor erfreut veranlasst, diese inhaltlich völlig neu bearbeitete und aktualisierte Ausgabe vorzulegen, die hoffentlich ebenso viel Anklang findet wie ihre Vorgänger.
Erlebnisreiches Lesen wünscht
Dieter B. Herrmann, Berlin im Januar 2018
© ESO
KAPITEL 1
Wie Astronomen das Weltall erforschen
Der Bote ist das Licht
» Viele Menschen begegnen den Aussagen der modernen Astronomie über das Weltall mit Argwohn. Woher will man denn wissen, woraus sich die Sterne zusammensetzen? Wie soll man die Entfernungen der Sterne bestimmen, wenn man sie doch nicht erreichen kann? Und wer kann schon sagen, was im Universum vor Jahrmilliarden geschah, es gab ja schließlich keine Augenzeugen!
Diese Fragen sind durchaus verständlich, solange man die Methoden der astronomischen Forschung nicht kennt. Die Astronomie arbeitet in vielerlei Hinsicht tatsächlich anders als die übrigen Naturwissenschaften. Es ist uns zum Beispiel geläufig, dass ein Chemiker die Zusammensetzung einer Verbindung durch Experimente im Labor bestimmt. Wir wissen, dass man Längen und somit auch Distanzen durch das Anlegen eines Maßstabs an das zu vermessende Objekt feststellt. Und was vor 100 Jahren geschah, davon berichten uns überlieferte Zeugnisse der damals lebenden Menschen oder auch direkte materielle Funde, die wir untersuchen können. Das alles ist in der Himmelskunde anders. Wenn wir einmal von den erst seit jüngerer Vergangenheit möglichen Direkterkundungen einiger nahe gelegener Himmelskörper mit Hilfe der Raumfahrt absehen, ist uns das Weltall auch heute so unerreichbar fern wie seit jeher. Doch etwas verbindet uns auf dem kleinen Planeten Erde mit den fernsten Objekten des Universums: das Licht! Käme kein Licht von den Sternen zu uns, so könnten wir sie nicht sehen.
Das Licht aber ist ein Bote – es trägt Nachrichten über seine Absender mit sich. Je länger sich die Menschen mit den Gestirnen beschäftigen, desto besser haben sie gelernt, diese zunächst geheimnisvollen Botschaften zu verstehen.
Im Adlernebel (Sternbild Schlange) entstehen auch heute noch zahlreiche neue Sterne. Das Licht bringt uns Kunde davon.© ESO
Besonders seit dem 19. Jahrhundert wurde nach und nach immer deutlicher, dass wir es nicht nur mit Lichtstrahlung aus dem Kosmos zu tun haben, sondern ganz allgemein mit elektromagnetischen Wellen. Licht ist nur ein winziger Teil der elektromagnetischen Strahlung – jener Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum, für den unsere Augen empfänglich sind. Viel umfassender sind die Bereiche der Strahlung, die sich jenseits des sichtbaren Lichts anschließen: die Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) und der breite Bereich der Radiostrahlung sowie die Ultraviolettstrahlung bis zu der extrem kurzwelligen Röntgen- und Gammastrahlung. All diese Strahlungsarten bringen uns Kunde von den Vorgängen in unserem Universum. In der klassischen Astronomie waren es ausschließlich die optischen Beobachtungen, aus denen wir sämtliche Erkenntnisse über das Universum abgeleitet haben.
Positionen und Helligkeiten der Sterne
Die wichtigste Information, die wir dem Licht der Sterne zunächst entnehmen können, ist die Richtung, aus der es kommt. Damit können Unterscheidungen zwischen Fixsternen und Wandelsternen (Planeten) getroffen werden – somit also zwischen jenen Himmelskörpern, die sich binnen kurzer Zeit vor der Sternkulisse bewegen und der anderen viel größeren Gruppe, die scheinbar unverrückt feststehen. Bei den einen ändert sich die Herkunftsrichtung, bei den anderen nicht. Natürlich beruhen auch alle Informationen über die täglichen und jährlichen Veränderungen des Sternhimmels auf nichts anderem als dem Studium der Richtung des Lichts. Insofern gründen sich die ersten Weltbilder der Geschichte und ganz besonders das griechische Weltsystem, dessen Schöpfer die Erde im Zentrum sahen, auf Richtungsbeobachtungen. Selbst die große Revolution des astronomischen Weltbildes, die Nikolaus Kopernikus im Jahr 1543 herbeiführte, indem er die Sonne an die Stelle der Erde setzte und der Erde einen Platz unter den Planeten zuwies, kam aufgrund von Richtungsbeobachtungen zustande.
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb es dabei: Der Bote Licht berichtet über die Positionen der Sterne. Die Erkenntnisse, die man daraus abzuleiten verstand, waren jedoch erstaunlich vielgestaltig. Die Bewegungsgesetze der Planeten, die Johannes Kepler fand, und das Gesetz der universellen Massenanziehung von Isaac Newton sind letztlich Früchte reiner Positionsbeobachtungen. Mithilfe dieser Gesetze gelang und gelingt es bis heute, die Bewegungen der Gestirne mit jener sprichwörtlichen Genauigkeit zu berechnen, die man der Astronomie zuschreibt: Die Vorhersage von Sonnen- und Mondfinsternissen gehören ebenso dazu wie die Beschreibung der Bahnen von Doppelsternen oder die „Reiseroute“ unserer eigenen Sonne durch das Sternsystem der Milchstraße. Selbst die historisch erst spät gelungenen Bestimmungen von Sternentfernungen beruhen auf reinen Richtungsmessungen. Die Richtung des Lichts der Sterne verrät also sehr viel über das Universum. Dennoch wüssten wir wenig über das Weltall, wenn es nicht gelungen wäre, noch weitaus mehr an Informationen aus den Signalen der kosmischen Objekte herauszulesen.
Die zweite wichtige Information, die ein Lichtstrahl in sich birgt, besteht in den verschiedenen Helligkeiten der Objekte. Dass die Sonne ungleich viel heller strahlt als die Sterne, ist natürlich schon immer bekannt gewesen. Dass auch die Sterne unterschiedlich hell sind, konnte ebenfalls bei aufmerksamer Betrachtung des Himmels nicht verborgen bleiben. Schon die großen Astronomen des antiken Griechenlands haben die verschiedenen Sternhelligkeiten bestimmten Größenklassen zugeordnet – ein System, das bis heute verwendet wird. Demnach haben die hellsten Sterne des nächtlichen Himmels die Bezeichnung „nullte Größenklasse“ (einige wenige noch hellere Objekte bekommen sogar negative Zahlenwerte), die schwächsten, gerade noch mit dem bloßen Auge sichtbaren Sterne gehören zur „sechsten Größenklasse“. Gemeint sind damit die Helligkeitseindrücke, die die Objekte im menschlichen Auge hervorrufen. Obwohl man sich in der Antike gelegentlich Gedanken über die unterschiedlichen Helligkeiten der Himmelsobjekte gemacht hat, konnte man mit den Größenklassen noch recht wenig anfangen.
Im Sternbild Großer Hund befindet sich der hellste Fixstern des Himmels: Sirius mit einer scheinbaren Helligkeit von –1,5 Größenklassen.© Gerhard Weiland
Sie dienten mehr als Identifizierungshilfe von Sternen in den verschiedenen Sternbildern. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit der Entwicklung der Astrophysik eine völlig neue Ära der Forschung. Damals lernte man aufgrund fortgeschrittener physikalischer Erkenntnisse, aus den verschiedenen Sternhelligkeiten wesentliche Aussagen über die Natur der strahlenden Objekte selbst abzuleiten.
Zerlegtes Licht
Den größten Fortschritt auf dem Weg zur Erkenntnis des Wesens kosmischer Objekte brachte jedoch die Spektralanalyse. Dabei wird das von den Sternen kommende Licht über einen Eingangsspalt und ein Objektiv auf ein Glasprisma geführt, wobei ein Spektrum des Lichts entsteht. Die einzelnen Farben, aus denen sich das Sternlicht zusammensetzt, werden unterschiedlich stark gebrochen und bilden deshalb das prismatische Farbenband.
Ein Glasprisma zerlegt weißes Licht in seine Spektralfarben. Oben: ein typisches Sternspektrum mit dunklen Linien.© Gerhard Weiland
Das Spektrum eines leuchtenden Gases besteht aus farbigen hellen Linien, die, je nach Element des Gases, an unterschiedlichen Stellen und in verschiedener Anordnung auftreten. So eröffnet die Spektralanalyse die Möglichkeit, das Vorkommen bestimmter chemischer Elemente auch aus der Distanz zu bestimmen. Schon erste Untersuchungen an Sternspektren zeigten, dass diese bei verschiedenen Sternen unterschiedlich aussehen. Nachdem der italienische Forscher Angelo Secchi nach der Mitte des 19. Jahrhunderts die Spektren der Sterne nach ihrem Erscheinungsbild in drei Klassen einteilte, fand man bald heraus, dass diesen drei Arten von Spektren verschiedene Temperaturen der Sterne entsprachen, die eindeutig mit deren Farben zusammenhängen: Die roten Sterne sind die kühlsten, die gelben von mittlerer Temperatur, die bläulich-weißen Sterne hingegen die heißesten. Warum dies allerdings so ist und wie die Einzelheiten in den Sternspektren mit den physikalischen Vorgängen in den Atmosphären der Sterne zusammenhängen, aus denen das Licht stammt, das wusste man zunächst noch nicht.
Eine andere wichtige Größe, die durch die Spektralanalyse zugänglich wurde, war die chemische Zusammensetzung der Sterne. Was selbst bedeutende Forscher noch im 19. Jahrhundert für ganz ausgeschlossen hielten, wurde dadurch möglich: die chemische Analyse der Himmelskörper, ungeachtet der enormen Entfernungen, die zwischen den Forschern und dem Objekt liegen.
Bunsen und das Heidelberger Schloss
Im Sommer des Jahres 1860 weilte der Großherzog von Baden auf dem Heidelberger Schloss. Bei einem nächtlichen Fest zu Ehren des Gastes war das Schloss mit bengalischen Flammen weithin sichtbar illuminiert. An jenem Abend beobachteten die beiden Forscher Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen vom Dach ihres unweit gelegenen Labors aus das Spiel der farbigen Flammen. Bunsen betrachtete die Lichter mit seinem Spektralapparat und erkannte sofort die charakteristischen Linien des Bariums und die roten Linien des Strontiums. Zu Kirchhoff gewandt soll er bei dieser Gelegenheit gesagt haben: „Wenn wir aus dieser Entfernung erkennen können, welche Stoffe in jenen Flammen glühen, warum sollten wir nicht auch herausfinden können, aus welchen Substanzen die Sterne bestehen?“
In den Spektren der Sterne findet man nämlich dunkle Linien in ganz bestimmter Anordnung und Stärke. Die Lage dieser Linien hängt – wie die beiden deutschen Forscher Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen zeigten – mit der chemischen Zusammensetzung in den Hüllen der Sterne zusammen.
Doch auch dies war noch nicht alles. Die Spektren führten schließlich sogar zum Studium von Bewegungsabläufen, die sonst auf keine Weise zu ermitteln waren. Das Zauberwort dieser Entwicklung heißt: Doppler-Effekt. Um das Jahr 1842 hatte der Physiker Christian Doppler festgestellt, dass eine Schallquelle, die sich einem Beobachter nähert, einen scheinbar höheren Ton aussendet als in Wirklichkeit und bei Entfernung vom Beobachter einen etwas tieferen Ton. Dieser Effekt, den wir alle aus dem Alltag beim raschen Vorüberfahren eines Polizeiwagens mit Martinshorn kennen, existiert auch in der Optik: Eine weiße Lichtquelle erscheint uns etwas rötlicher, wenn sie sich mit genügend großer Geschwindigkeit von uns entfernt und etwas bläulicher, wenn sie auf den Beobachter zurast.
Die radiale (d. h. von uns weg oder auf uns zu gerichtete) Geschwindigkeit der Quelle lässt sich aus der Verschiebung der Spektrallinien zuverlässig bestimmen.
Der Doppler-Effekt. Entfernt sich ein Stern sehr schnell von uns, so erscheinen seine Spektrallinien zum Roten hin verschoben (oben).© Gerhard Weiland
Diese Information ist die Grundlage vieler Erkenntnisse der modernen Astrophysik. Auch Magnetfelder und das Rotationsverhalten von Himmelskörpern können mittels Spektralananlyse untersucht werden.
Christian Doppler und die Eisenbahn
In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts kam der österreichische Physiker Christian Doppler auf eine verrückte Idee: Der hörbare Ton einer Schallquelle müsse sich ändern, wenn sich diese direkt auf uns zu- oder von uns wegbewegt, obwohl der ausgesendete Ton doch immer derselbe bleibt. Viele wollten ihm nicht glauben. Doch glücklicherweise war gerade die Eisenbahn erfunden worden und die brachte es damals immerhin schon auf rund 50 Kilometer pro Stunde. Das ist zwar nur 1/25 der Schallgeschwindigkeit, sollte aber ausreichen, um solche geringfügigen Tonhöhenänderungen festzustellen, wie sie Doppler berechnet hatte. In Holland setzte daher der Physiker Christoph Buys- Ballot einige Trompeter auf einen fahrenden Zug, während am Bahndamm stehende Musiker die Tonänderungen beurteilen mussten. Das war der erste erfolgreiche Test für Dopplers Hypothese, die auch für Lichtquellen gilt. Das „Doppler-Prinzip“ ist heute in der Astronomie unentbehrlich, wenn Geschwindigkeiten von kosmischen Lichtquellen entlang des Sehstrahls – sogenannte Radialgeschwindigkeiten – studiert werden sollen.
Vom Schattenstab zum Riesenspiegel
» Das einfachste und wohl älteste astronomische Beobachtungsinstrument ist der Schattenstab, auch Gnomon genannt. In den frühesten Tagen himmelskundlicher Studien wurde zum Beispiel die tägliche Bewegung der Sonne mittels Gnomon verfolgt. Auch mit anderen, vergleichsweise einfachen Peilinstrumenten erzielten die Astronomen früher erstaunliche Ergebnisse. Heute ist die moderne Astronomie ohne Fernrohr jedoch nicht mehr denkbar.
Fast zur gleichen Zeit wurden zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Linsenfernrohr und das Spiegelteleskop erfunden und in die Astronomie eingeführt. Die Wirkungsweise eines Linsenfernrohrs (Refraktor) beruht auf der Lichtbrechung in einem speziell geformten Glaskörper (Linse). Dieser besitzt die Eigenschaft, parallel ankommende Lichtstrahlen von einem punktförmigen Objekt wieder in einen Punkt zusammenzuführen. Man spricht von den Abbildungseigenschaften der Linse. Beim Spiegelteleskop (Reflektor) entsteht das Bild des strahlenden Objektes hingegen durch Lichtspiegelung an einem speziell geformten Hohlspiegel.
Bei einem Linsenteleskop (oben) wird das Licht durch eine Sammellinse fokussiert, wodurch ein seitenverkehrtes und kopfstehendes Bild in der Brennebene entsteht. Dieses wird durch das Okular betrachtet. Bei einem Spiegelteleskop (unten) wird das Licht durch Reflexion am konkaven Hauptspiegel auf einen planen Fangspiegel und so zum Okular gelenkt.© Gerhard Weiland
Bereits mit den ersten Linsenfernrohren gelangen außerordentliche Entdeckungen. So fand Galileo Galilei in den Jahren 1609 und 1610, als er zum ersten Mal ein kleines Linsenfernrohr für astronomische Beobachtungen einsetzte, die gebirgige Struktur der Mondoberfläche, die vier größten Monde des Planeten Jupiter, die Lichtphasen der Venus, die Flecken auf der Sonne und das Sterngewimmel in der Milchstraße.
Was die Leistungsfähigkeit der beiden Fernrohrtypen anlangt, so entbrannte zwischen Refraktoren und Reflektoren in den folgenden Jahrhunderten ein förmlicher Wettlauf. Bald waren die Linsenfernrohre den Spiegelteleskopen überlegen, bald war es umgekehrt. Zunächst bestand der Hauptmangel der Linsenfernrohre in den Abbildungsfehlern, die durch die sphärischen Linsen, das heißt durch ihre gebogene Form, zustande kamen: Unscharfe Bilder mit Farbsäumen waren die Folge. Das Spiegelteleskop zeigte solche Nachteile nicht, da die Bilder ausschließlich durch Lichtspiegelung entstehen. Dabei erfolgt keine Farbzerlegung des Lichts. Doch dann wurden spezielle Linsenobjektive erfunden, die man als farbfehlerfrei (achromatisch) bezeichnet: Das Fernrohrobjektiv besteht aus zwei Einzelteilen, die aus Glas mit verschiedenen Brechungseigenschaften gefertigt sind. Die Farbfehler der einen Hälfte des Objektivs werden durch die der anderen Hälfte aufgehoben. Dadurch werden die störenden Abbildungsfehler beseitigt.
Galilei und das Teleskop
Zu den zahlreichen Legenden, die sich um den italienischen Naturforscher Galileo Galilei ranken, gehört auch die Mär, er habe das Fernrohr erfunden. Galilei selbst hat dies übrigens nie behauptet. Vielmehr wurde er mit dem in Holland erfundenen Sehgerät 1608 durch Erzählungen bekannt, die über dieses „Wunderding“ kursierten. Galilei erkannte allerdings rasch, wie man es verbessern könnte und entwickelte binnen kurzer Zeit deutlich leistungsstärkere Teleskope als jene, die sich bereits auf dem Markt befanden. Mit diesen Fernrohren, die er immer weiter entwickelte, fand er schließlich 1609 und 1610 die „Erdartigkeit“ des Mondes, die Phasen der Venus, die Jupitermonde, die Sonnenflecke, die Sterne im Milchstraßenband und begründete damit seinen Ruhm als Entdecker neuer Welten. Wenn Galilei also schon nicht der Vater des Teleskops gewesen ist, so war er doch jedenfalls dessen Ziehvater, der es zugleich höchst erfolgreich zu verwenden verstand
Immer weiter, immer besser
Die aus Metalllegierungen bestehenden Spiegel hingegen ärgerten die Astronomen nun durch ihre immer wieder blind werdenden Oberflächen. Dafür konnte man aber im Vergleich zu den Linsen wesentlich größere Spiegel herstellen. Das hatte zur Folge, dass Spiegelteleskope zu Anfang des 19. Jahrhunderts viel mehr Licht „aufsammelten“ als die Linsen. Sie verfügten über eine größere Reichweite, d. h. mit ihnen konnte man weiter schauen als mit Linsenfernrohren. So verfügte zum Beispiel der berühmte Astronom Friedrich Wilhelm Herschel für seine Beobachtungen über ein Spiegelteleskop mit 1,2 Metern Spiegeldurchmesser. Doch nun holten auch die Linsenfernrohre dank verbesserter Verfahren bei der Herstellung großer homogener Glasblöcke wieder auf und immer größere Linsen kamen zum Einsatz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand in den USA der Yerkes-Refraktor mit einem Objektiv von 1,02 Metern Durchmesser.
Der Yerkes-Refraktor (USA) ist mit seinem Objektivdurchmesser von 1,02 Metern das leistungsstärkste Linsenfernrohr der Welt. Das Bild zeigt Albert Einstein (mitte rechts) beim Besuch des Observatoriums am 6. Mai 1921.© Yerkes Observatory
Damit war jedoch eine prinzipielle Grenze erreicht, denn Linsen müssen stets am Rande eingefasst werden, damit das Licht ungehindert hindurchtreten kann. Je schwerer aber die Glasblöcke werden, umso stärker verbiegen sie sich auch, was wiederum zu Lasten der Abbildungsqualität geht. Solche Fragen spielten für die Spiegel keine Rolle. Da sie das Licht reflektieren, kann man sie von der Rückseite mechanisch vor Durchbiegung schützen. Als nun gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch die Technologie der Oberflächenversilberung von Glasflächen erfunden wurde, verschwand auch das störende Phänomen der immer wiederkehrenden Erblindung. Spiegelteleskope traten den endgültigen Siegeszug in der beobachtenden Astronomie an.
Viele weitere technische Fortschritte, vor allem der Einsatz von leichten Kunststoffen für die Spiegel, gestatteten den Bau immer größerer und damit weiter reichender Spiegelteleskope. Anfang der 1920er-Jahre entstand in den USA der Hooker-Spiegel mit 2,5 Metern Durchmesser, 1949 das große Fünf-Meter-Spiegelteleskop auf dem Mount Palomar (Kalifornien, USA). Allein mit diesen beiden Instrumenten wurden im vergangenen Jahrhundert bahnbrechende Entdeckungen gemacht, von denen wir in diesem Buch noch berichten werden.
Moderne Teleskope
Derzeit arbeiten viele multinational besetzte Sternwarten mit Refraktoren und Reflektoren in den klimatisch geeignetsten Gegenden der Welt, zumeist hoch über dem Meeresspiegel in den Bergregionen Spaniens, im Kaukasus, auf Hawaii oder in Chile. In der nordchilenischen Atacama Wüste hat auch die Europäische Südsternwarte (European Southern Observatory – ESO) in über 2000 Metern Höhe ihre Riesenteleskope aufgestellt, die von den Mitgliedsländern der Organisation, darunter auch Deutschland, betrieben werden. Viele klare, dunkle Nächte und eine ungewöhnlich saubere und durchsichtige trockene Luft bestimmen hier das „Astroklima“ – ganz im Gegensatz zu der bei uns üblichen Licht- und Luftverschmutzung. Das ehrgeizigste Projekt, das hier bislang realisiert wurde, ist das Very Large Telescope (VLT), das aus vier Einzelinstrumenten besteht, deren Spiegeldurchmesser bei über acht Metern liegen.
Das erste der vier Teleskope ist im Sommer 1998 in Betrieb gegangen, das letzte im Jahr 2000; heute sind sie zusammen so leistungsstark wie ein einzelnes 16-Meter-Teleskop.
Das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) auf dem Cerro Paranal in Chile besteht aus vier einzelnen Spiegelfernrohren mit je 8,2 Metern Öffnung. In dieser trockenen Wüstenregion sind die Beobachtungsbedingungen besonders günstig.© ESO
Im Sommer 2006 wurde in Arizona (USA) mit dem Large Binocular Telescope (LBT) der größte „Feldstecher“ der Welt eingeweiht – zwei riesige Teleskope mit Spiegeldurchmessern von je 8,4 Metern auf einer gemeinsamen Montierung. An dem multinationalen Projekt des LBT ist auch Deutschland beteiligt. Die Erfindung der „aktiven Optik“ hat dazu geführt, dass Verformungen der Riesenspiegel durch computergesteuerte mechanische Vorrichtungen ausgeglichen werden können. Noch verblüffender arbeiten die sogenannten „adaptiven Optiken“. Sie schalten praktisch weitgehend die störende Wirkung der Erdatmosphäre aus.
So funktioniert die adaptive Optik: Ein Wellenfrontsensor im Strahlengang analysiert in Echtzeit die wechselnden Störungen und sendet entsprechende Signale an die Aktuatoren des Spiegels, die ihn ständig so deformieren, dass die Störungen ausgeglichen werden.© Gerhard Weiland
Gelangt eine Wellenfront aus dem All in die Erdatmosphäre, kommt es zu diversen Verformungen, die sich zudem im Millisekundenbereich ändern. Aus diesem Grund wird die Wellenfront über einen halbdurchlässigen Spiegel einem Analysator zugeführt, der nun seinerseits in Echtzeit (d. h. bis zu 1000 Mal je Sekunde) Signale an die hinter dem Spiegel angebrachten Aktuatoren sendet. Diese „Stempel“ vermögen den dünnen Spiegel ständig so zu verformen, dass die Wellenfront wieder nahezu störungsfrei abgebildet wird.
Ein Vergleich, der überzeugt: Planet Neptun ohne (links) und mit (rechts) adaptiver Optik aufgenommen.© W. M. Keck Observatory
Alle modernen Teleskope sind heute mit solchen adaptiven Optiken ausgestattet – eine Innovation, die nur durch extrem schnelle Computer und neuartige Materialien für die inzwischen extrem dünnen und leichten Spiegel möglich wurde.
Beliebig groß kann man solche Spiegel dennoch nicht machen. Um noch größere Empfängerflächen zu erreichen, ging man deshalb zu den „Vielflächnern“ über. Hier werden sehr große Spiegel durch ein Mosaik aus vielen kleineren Spiegeln zusammengesetzt. Zwei Großteleskope auf Hawaii machten den Anfang: die Öffnung beträgt hier zehn Meter, die durch einzelne Segmente erreicht werden. Diese Bauweise wird auch bei drei geradezu gigantischen Großteleskopen genutzt, die gegenwärtig gebaut werden. Eine Übersicht zu den größten Spiegelteleskopen befindet sich im Anhang, Tabelle 1.
Das Giant Magellan Telescope (USA) wird aus sieben Spiegeln mit je 8,4 Metern Durchmesser bestehen und eine Gesamtempfängerfläche von 21 Metern aufweisen. Ein ebenfalls in den USA geplantes Thirty Meter Telescope (TMT) wird aus knapp 500 Segmenten von je 1,4 Metern Durchmesser bestehen. Doch den Vogel schießt das europäische Projekt Extremely Large Telescope (ELT) ab: Anfang der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts soll außerdem ein knapp 40 Meter messender Spiegel aus fast 800 sechseckigen Einzelspiegeln in unmittelbarerer Nähe zum Very Large Telescope in Chile für einen noch besseren Weitblick sorgen.
So wird das in Vorbereitung befindliche Extremely Large Telescope (ELT) der ESO mit einem Hauptspiegel von 39 Metern Durchmesser aussehen, das als weltgrößtes Fernrohr 2024 in Betrieb gehen soll.© ESO
Und auch Spiegel mit über 100 Metern Durchmesser werden bereits diskutiert. Ob diese aber jemals realisiert werden können, weiß derzeit niemand.
Wenn von der Himmelsforschung unserer Zeit die Rede ist, dann darf auch die Zusatztechnik nicht vergessen werden, ohne die heute kein Teleskop mehr denkbar ist. Dabei ist die einstmals so wichtige fotografische Platte gegenüber elektronenoptischen Bildwandlern mit digitaler Datenerfassung schon fast vollständig in den Hintergrund getreten. Der Astronom, der in einsamen Nächten hinter dem Okular eines Teleskops sitzt und die „Wunder des Himmels“ betrachtet, gehört der Vergangenheit an. Realistischer ist da schon der Physiker vor dem Bildschirm der deutschen ESO-Zentrale in Garching bei München, der gerade die Datenflut analysiert, die nach seinen Vorgaben in der vergangenen Nacht im fernen Chile gesammelt wurde, ohne dass er selbst dort anwesend sein musste.
Doch aus dem Universum kommt nicht nur die unseren Augen zugängliche Lichtstrahlung; die Objekte im Weltraum strahlen auch Radiowellen, Röntgenstrahlung, Wärmestrahlung und andere sogenannte elektromagnetische Wellen ab. Deshalb erhalten wir auch wichtige Informationen durch Instrumente, die diese für uns nicht sichtbaren Strahlungsarten zu empfangen vermögen. Der historisch früheste Typ solcher völlig neuartigen Fernrohre war das Radioteleskop. Heute sind die Ergebnisse der Radioastronomie, die sich speziell mit den kosmischen Signalen im mikrowellen- und radiofrequenten Bereich des elektromagnetischen Spektrums beschäftigt, aus dem Bild unseres Wissens über das Weltall nicht mehr wegzudenken. Hinzu kommen spezielle Empfänger im Bereich der Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) sowie der Gamma- und Röntgenstrahlung. Schließlich stammen wichtige Informationen auch aus der Untersuchung von elektrisch geladenen Teilchen aus dem Kosmos. Durch den erstmals 2016 gelungenen Nachweis der schon 100 Jahre zuvor von Einstein postulierten Gravitationswellen entsteht derzeit ein völlig neues Feld der Astronomie – die Gravitationswellenastronomie –, durch das sich ein bisher nur theoretisch bekanntes Fenster in das Universum öffnet.
Fernrohr im Orbit – das Hubble-Weltraumteleskop
Bereits zu Beginn der praktischen Raumfahrt war man sich darüber im Klaren, dass ein Teleskop außerhalb der Erdatmosphäre höchst wünschenswert wäre, selbst wenn es „nur“ im optischen Bereich des Spektrums arbeiten würde.
Einerseits entfallen dort alle atmosphärischen Beeinträchtigungen, andererseits spielt auch der Wechsel von Tag und Nacht keine nennenswerte Rolle mehr. Kurz: Ein solches Teleskop würde nicht nur weitaus bessere, sondern auch viel mehr Daten liefern können als irdische Fernrohre.
Nach etlichen kleineren Vorläufern wurde deshalb 1990 das Hubble-Weltraumteleskop (engl.: Hubble Space Telescope, HST) als gemeinsames Projekt der US-amerikanischen NASA und der europäischen Raumfahrtagentur ESA (European Space Agency) mithilfe eines Space Shuttle auf eine 600 Kilometer hohe kreisförmige Umlaufbahn gebracht. Das eigentliche Teleskop verfügt über einen Spiegel von 2,4 Metern Durchmesser. Außerdem befinden sich zahlreiche Kameras, Spektrografen und andere Zusatzinstrumente an Bord des mit Solarenergie betriebenen Instruments.
Das erfolgreiche Hubble Space Telescope (HST).© NASA/ESA/STScI
Das Hubble-Teleskop hat alle Erwartungen der Wissenschaftler bei weitem übertroffen. In der Zeit seines Einsatzes gelang eine Fülle von Entdeckungen, auch bei Objekten, die man bereits für gut erforscht gehalten hatte. So konnten zum Beispiel sogenannte Delta Cepheï-Sterne in weit entfernten Galaxien beobachtet werden, die exaktere Entfernungsbestimmungen ermöglichten und auf diesem Wege auch die Aussagen über die Expansion des Universums und das Weltalter präzisierten. Dem Hubble-Teleskop gelang auch die bisher am weitesten in die Tiefen des Kosmos hinausreichende Aufnahme eines Himmelsgebietes, die als „Hubble Ultra Deep Field“ bekannt geworden ist. Unter den rund 10 000 abgebildeten Sternsystemen befinden sich einige der jüngsten jemals beobachteten. Auch die Aufnahmen von Sterngeburten und die Entdeckung von Staubscheiben bei jungen Sternen erregten großes Aufsehen. Selbst im Sonnensystem entdeckte das Hubble-Teleskop zahlreiche neue Planetenmonde und sondierte erstmals die Oberfläche des Zwergplaneten Pluto.
Obwohl das Hubble-Teleskop noch immer in Betrieb ist – weitaus länger als geplant –, sind die Vorbereitungen für einen Nachfolger bereits in vollem Gange. Dieses Next Generation Space Telescope, das nach dem NASA-Administrator James Edwin Webb benannt ist, wird voraussichtlich nach über 20-jähriger Arbeit von NASA, ESA und der kanadischen Weltraumorganisation CSA 2019 in Betrieb gehen. Es wird allerdings in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde operieren und kann folglich auch nicht – wie das Hubble-Teleskop – von Astronauten gewartet werden. Dafür wird es mit seinem Hauptspiegel von 6,5 Metern Durchmesser, bestehend aus 18 Einzelstücken, dem Hubble-Teleskop an Leistungsfähigkeit aber weit überlegen sein.
Der geplante Nachfolger des HST, das James Webb Telescope.© NASA/ESA/STScI
Empfang auf allen Kanälen
» Jahrtausende hindurch haben unsere Vorfahren den Himmel nur mit den Augen betrachtet und alle Erkenntnisse über das Weltall daraus abgeleitet. Auch die Erfindung des Fernrohrs hat an dieser Tatsache nichts geändert, denn selbst mit den leistungsfähigsten Teleskopen war den Menschen das Universum nur in jenem Bereich der Strahlung zugänglich, für den das menschliche Auge empfänglich ist.
Seit wir durch die Forschungen der Physiker das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Wellen kennen, wissen wir jedoch, dass der sichtbare Bereich nur einen winzigen Ausschnitt daraus darstellt. Die Natur hat es so eingerichtet, dass unser Auge für diesen Teil der Strahlung empfindlich ist. Im Laufe der Evolution haben wir uns an die Strahlung der Sonne angepasst, denn so können wir uns auf unserem Planeten am besten zurechtfinden.
Doch wenn es um die Informationen geht, die kosmische Objekte in das Universum abstrahlen, dann gleicht die Astronomie der Lichtwellen einem Blick durchs Schlüsselloch, der bestenfalls eine Ahnung von der Wirklichkeit ermöglicht. Dass die Natur uns zu einer derart eingeengten Perspektive zwang, wurde erst nach und nach deutlich. Zunächst wurde im 19. Jahrhundert erkannt, dass unmittelbar im Anschluss an den Bereich der sichtbaren (optischen) Strahlung zu kürzeren Wellenlängen hin die ultraviolette und zu längeren Wellenlängen hin die infrarote Strahlung existiert. Erst die weitere physikalische Forschung machte deutlich, dass sich das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung auf der einen Seite bis zu extrem langen Radiowellen und auf der anderen Seite bis zu extrem kurzen Gammawellen erstreckt. Der Bereich der vorkommenden Wellenlängen beginnt bei einigen tausend Kilometern und er endet bei ungefähr 10–14 Metern. Und tatsächlich senden auch die kosmischen Objekte Strahlung der unterschiedlichsten Wellenlängen ab. Doch diese Erkenntnis bedeutete noch keineswegs, dass die in den verschiedenen Strahlungsarten verborgenen Informationen sowie die zugrundeliegenden Vorgänge für die Astronomie zugänglich waren.
Strahlung verschiedener Wellenlängen
Der größte Teil der elektromagnetischen Strahlung wird von der irdischen Atmosphäre zurückgehalten. Lediglich ein breites „Radiofenster“ lässt langwellige Strahlen bis zum Boden des Luftmeeres durchdringen; daneben existiert nur noch das schon erwähnte „optische Fenster“, dem wir Menschen den Anblick des Sternhimmels verdanken.
Die Durchlässigkeit der Erdatmosphäre für die Strahlung des elektromagnetischen Spektrums ist sehr unterschiedlich. Auf der Höhe des Meeresspiegels können wir nur das sichtbare Licht („optisches Fenster“) und einen Teil der Radiostrahlung („Radiofenster“) empfangen.© Gerhard Weiland
Es umfasst den Wellenlängenbereich von 400 bis 800 Nanometer, während durch das Radiofenster elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen von wenigen Millimetern (Mikrowellen) bis etwa 15 Metern auf die Erdoberfläche gelangen. Die kurzwellige Strahlung jenseits des blauen Lichts wird durch das Ozon der irdischen Atmosphäre verschluckt, während die Ausbreitung der längeren Wellen jenseits des roten Lichts vor allem durch die Moleküle von Wasserdampf und Kohlendioxid zurückgehalten werden.
Beginnen wir mit der Radioastronomie, dem ersten Zweig der nichtoptischen Sternkunde, der sich erfolgreich entwickelte. Sie begann mit dem erstmaligen Nachweis von Radiostrahlung aus dem Weltall durch Karl Guthe Jansky im Jahr 1932. Heute sind Radioteleskope mit ihren charakteristischen metallischen Parabolspiegeln weltweit verbreitet. Das zweitgrößte bewegliche Radioteleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 100 Metern befindet sich in Effelsberg (Eifel) in Deutschland.
Das Radioteleskop Effelsberg (Eifel) zählt mit 100 Meter Durchmesser zu den größten beweglichen Radioteleskopen der Welt.© MPIfR
Das ehemals größte feststehende Radioteleskop misst 300 Meter Spiegeldurchmesser. Es liegt in einem gewaltigen Talkessel in Puerto Rico. Seit dem Herbst 2016 ist jedoch ein chinesisches Radioteleskop mit 500 Metern Spiegeldurchmesser der Rekordhalter. Wir werden in diesem Buch immer wieder von den Erfolgen der Radioastronomie hören und so die Unentbehrlichkeit dieses Zweiges der modernen Forschung ermessen können.
Auch die Wellenlängenbereiche der kurzwelligen Strahlung werden heute lückenlos erfasst. Dazu waren jedoch besondere technische Voraussetzungen erforderlich. Bevor man nämlich in der Lage war, die Messgeräte (Detektoren) für Röntgen- und Gammastrahlung in große Höhen der Erdatmosphäre zu transportieren, konnte es keine Röntgen- und Gammaastronomie geben! Die Entwicklung der Raumfahrt war deshalb für die Ausschöpfung der Informationen im Bereich extrem kurzwelliger Strahlung von ausschlaggebender Bedeutung. Erste Anfänge der Röntgenastronomie sind allerdings schon durch hochfliegende Ballone und Raketen vor etwa 70 Jahren gelungen. Doch als das amerikanische Mondlandeprogramm Apollo vorbereitet wurde, stieß die Forschung 1962 rein zufällig auf die große Bedeutung einer künftigen speziellen Röntgen- und Gammaastronomie: Durch Versagen eines Lageregelungssystems streifte der in der Spitze einer Höhenrakete angebrachte Röntgenstrahlendetektor eine Quelle, die offensichtlich intensive Röntgenstrahlung aussendete. Da sie im Sternbild Skorpion lag, erhielt die Quelle die Bezeichnung „Sco X-1“. Jahre später gelang der Nachweis eines sehr lichtschwachen Sterns am Ort dieser Quelle. Dabei zeigte sich, dass Sco X-1 im Bereich der Röntgenstrahlung 1000-mal mehr Energie aussendet als im Bereich des sichtbaren Lichts. Das war eine erstaunliche Erkenntnis. Unsere Sonne sendet nämlich ebenfalls im Röntgenwellenbereich – nur beträgt der Energieanteil bei ihr lediglich ein Millionstel ihrer sonstigen Strahlung. Sco X-1 war offensichtlich der erste Vertreter einer neuen Objektklasse, der sogenannten Röntgensterne. Damit war ein neuer Zweig der nichtoptischen Beobachtung des Weltalls geboren, die Röntgenastronomie.
Zahlreiche Spezialsatelliten mit Nachweisgeräten für Röntgenstrahlung an Bord wurden ab 1970 gestartet. Eine der bisher erfolgreichsten Missionen war zweifellos ROSAT, der deutsch-britisch-amerikanische Satellit, der 1990 gestartet wurde, acht Jahre in Betrieb und mit einem Röntgenteleskop von 83 Zentimetern Öffnung ausgestattet war. Da die kurzwelligen Röntgenstrahlen von herkömmlichen Spiegeln absorbiert würden, wurde bei ROSAT auf einen Trick zurückgegriffen: Das 83-Zentimeter-Teleskop wurde mit den glattesten Spiegeln aller Zeiten ausgestattet und fokussiert die Strahlen durch streifende Reflexion. Der Satellit entdeckte insgesamt 150 000 neue Röntgenquellen im All. Inzwischen sind zahlreiche weitere Röntgensatelliten gestartet worden, u.a. von Indien, Japan, den USA, Italien und Europa. Sie werden meist so konzipiert, dass sie die Entdeckungen ihrer Vorgänger gezielter untersuchen können.
Kleine Ausschnitte des infraroten Teils des Spektrums können auch von der Erde aus beobachtet werden. Dies geschieht mit möglichst hoch gelegenen Instrumenten in extrem trockener Atmosphäre, z. B. in Chile oder auf Hawaii. Für den gesamten Infrarotbereich benötigt man jedoch Teleskope, die außerhalb der Erdatmosphäre operieren. Speziell dafür wurden u.a. das europäische Herschel-Teleskop (2009–2013 im Einsatz) und das Spitzer-Weltraumteleskop geschaffen, das seit 2003 erfolgreich im Erdorbit operiert.
Das 1999 in Betrieb genommene Chandra-Röntgenteleskop wurde nach dem indischen Astrophysiker Subrahmanyan Chandrasekhar benannt und ist eines der im Erdorbit operierenden Instrumente des „Great Observatory Program“ der NASA. © NASA/CXC/NGST
Das Spitzer-Weltraumteleskop wurde im Jahr 2003 gestartet und dient dem Nachweis von Infrarotstrahlung aus dem Universum. Es wurde nach dem Astrophysiker Lyman Spitzer benannt und ist ebenfalls Bestandteil des „Great Observatory Program“ der NASA. Seine Einsatzzeit nähert sich jedoch jetzt ihrem Ende, nachdem es länger aktiv war als erwartet.© NASA/JPL-Caltech
Das Ende der Mission ist allerdings nahe gerückt, weil die Kühlmittel verbraucht sind. Einen bedeutenden Schritt für die künftige Infrarotastronomie wird das James Webb Space Telescope (JWST) der NASA darstellen, das über einen Hauptspiegel mit 6,5 Metern Durchmesser verfügt und – nach mehreren Verzögerungen – im Jahr 2019 gestartet werden soll.
Teilchenstrahlen aus dem All
Seit dem Jahr 1913 wissen wir, dass uns aus dem Weltall auch winzige Teilchen erreichen, die wir unter dem Sammelbegriff „kosmische Höhenstrahlung“ zusammenfassen. Der Einsatz von Ballonen, Höhenraketen und Satelliten machte allerdings deutlich, dass die ursprünglichen Korpuskeln aus dem Universum in den Labors auf der Erde nicht nachgewiesen werden können, weil sie bei ihrem Weg durch die Erdatmosphäre mannigfache Veränderungen erfahren. Deshalb empfangen wir am Boden der Lufthülle nur noch die sogenannte Sekundärstrahlung. Die Primärstrahlung hingegen ist der direkte Bote von fernen Welten. Sie kann außerhalb unserer Atmosphäre mit Messapparaturen an Bord von Raketen oder Satelliten erfasst werden. Die Analyse solcher Messungen zeigt, dass es sich bei den gefundenen Teilchen der primären kosmischen Strahlung hauptsächlich um Wasserstoffatomkerne (Protonen) und Heliumatomkerne handelt. Das Verhältnis beider entspricht recht genau der allgemeinen kosmischen Elementhäufigkeit. Nur zwei Prozent der Teilchen sind schwereren Elementen zuzuordnen. Neben diesen Partikeln kommen auch die leichteren elektrisch negativ und positiv geladenen Elektronen bzw. Positronen vor, allerdings wesentlich seltener. Die Teilchen der kosmischen Primärstrahlung verfügen über erstaunliche Geschwindigkeiten. Kein irdischer Teilchenbeschleuniger vermag irgendwelchen Teilchen derartig hohe Energien zu verleihen, wie sie die Partikel der Höhenstrahlung mit sich tragen. Damit erhebt sich die Frage: Woher kommen diese Teilchen und auf welche Weise haben sie ihre hohen Energien erhalten? Welche Botschaften über das Universum vermögen sie uns zu übermitteln? Die kosmische Primärstrahlung ist damit eines der Informationsfenster ins Weltall.
Überraschung auf dem Eiffelturm
Nach der Entdeckung der natürlichen Radioaktivität im Jahr 1896 untersuchten viele Forscher die Phänomene dieser spontan entstehenden Strahlung bestimmter Elemente. Dazu wurden unter anderem auch Versuche mit Elektroskopen durchgeführt. Durch Aufladung stoßen sich darin zwei Metallplättchen ab und zeigen die Ladung an. Aber diese Elektrometer entluden sich immer wieder von selbst. Man vermutete, dass die Luft leitfähig sei. Doch warum? Schon um 1900 wurde angenommen, dass eine aus dem Kosmos kommende Strahlung dieses Phänomen verursachen könnte. Andere Forscher waren hingegen der Ansicht, die Spuren radioaktiver Elemente der Umgebung, zum Beispiel im Mauerwerk der Labore, könnten den Effekt auslösen. Je weiter man sich von der Erdoberfläche entfernt, umso langsamer müsste dann diese Entladung eintreten. So stiegen die Forscher mit ihren Geräten 1909 auf den 300 Meter hohen Eiffelturm in Paris. Zu ihrer großen Überraschung ging der Ausschlag des Elektroskops fast genauso schnell zurück wie am Erdboden. Später zeigte sich unter Einsatz von Ballonen sogar eine Zunahme mit wachsender Höhe. Ursache war die kosmische Strahlung, die auf diese Weise entdeckt wurde.