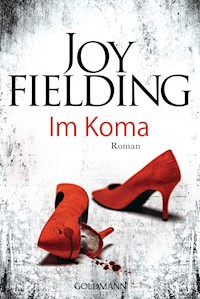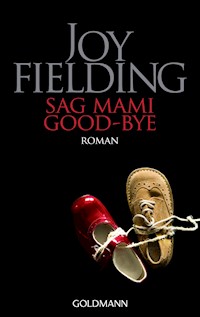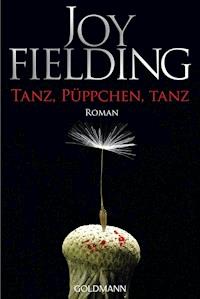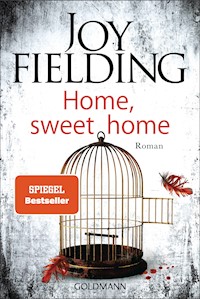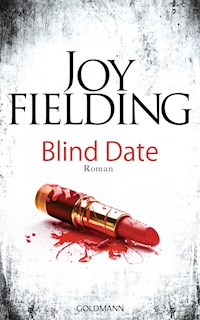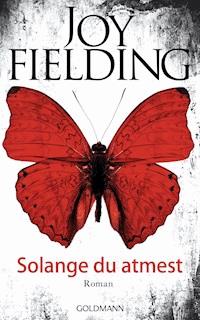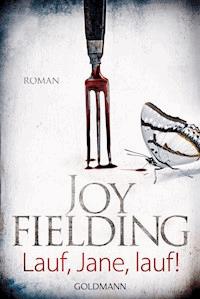10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Denn jedes Haus braucht eine gute Seele ...
Jodi Bishop ist erfolgreiche Maklerin und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Toronto. Da ihre Mutter an Parkinson erkrankt ist, beschließt sie, eine Haushälterin für ihre alternden Eltern einzustellen. Als sie die erfahrene Elyse trifft, ist sie begeistert von deren warmherziger, anpackender Art. Sogar Jodis skeptischer Vater scheint sie zu mögen. Aber schon nach kurzer Zeit nimmt Jodi beunruhigende Veränderungen wahr. Ihre Eltern verlassen kaum noch das Haus, ihre Mutter scheint sich regelrecht vor Elyse zu fürchten. Und als ihre Mutter unerwartet verstirbt, muss Jodi sich fragen: Wem hat sie da die Tür zum Leben ihrer Eltern geöffnet ...?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Jodi Bishop ist erfolgreiche Maklerin und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Toronto. Da ihre Mutter an Parkinson erkrankt ist, beschließt sie, eine Haushälterin für ihre alternden Eltern einzustellen. Als sie die erfahrene Elyse trifft, ist sie begeistert von deren warmherziger, anpackender Art. Sogar Jodis skeptischer Vater scheint sie zu mögen. Aber schon nach kurzer Zeit nimmt Jodi beunruhigende Veränderungen wahr. Ihre Eltern verlassen kaum noch das Haus, ihre Mutter scheint sich regelrecht vor Elyse zu fürchten. Und als ihre Mutter unerwartet verstirbt, muss Jodi sich fragen: Wem hat sie da die Tür zum Leben ihrer Eltern geöffnet …?
Weitere Informationen zu Joy Fielding und lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Joy Fielding
Die Haushälterin
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristian Lutze
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Housekeeper« bei Ballantine Books, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Joy Fielding
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulla Mothes
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotiv: Nic Skerten / Trevillion Images
LK · Herstellung: ast
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26280-8V004
www.goldmann-verlag.de
Für Warren, immer
KAPITEL EINS
Es ist meine Schuld.
Ich war diejenige, die die Idee als Erste aufgeworfen hat, die sich dafür eingesetzt hat, die den Ball ins Rollen gebracht und letztendlich darauf bestanden hat, die Frau anzustellen. Mein Vater war entschieden dagegen, meine Mutter bestenfalls zwiespältig. Nur mein Ehemann Harrison fand den Vorschlag gut, und das auch nur, weil er glaubte, es würde mich entlasten.
»Du machst zu viel«, sagte er, gefolgt von: »Es gibt Dinge, die man steuern kann, und Dinge, die man nicht steuern kann. Es ist unmöglich, für alle Menschen alles zu sein. Konzentriere dich auf deine Familie. Lass den Rest los.«
Er hatte natürlich recht. Aber es war nicht so leicht, den Rest einfach loszulassen. Und trotz allen Bemühens konnte ich nicht umhin, auch den unausgesprochenen Folgegedanken mit zu hören: Wenn du nur die Hälfte der Mühe und Kraft in unser Haus … unsere Kinder … unsere Ehe investieren würdest, die du in deine Eltern … deine Schwester … deine Karriere steckst …
Es hatte nur den Schönheitsfehler, dass genau diese Karriere dafür sorgte, dass nicht nur unsere Hypothek abgedeckt war, sondern auch alle anderen Rechnungen bezahlt wurden, weshalb mein Mann sich den Luxus leisten konnte, in Vollzeit ohne nennenswerte Vergütung an seinem neuesten Roman zu arbeiten.
Ich sage, seinem »neuesten«, obwohl es fast zehn Jahre her war, seit er seinen ersten Roman veröffentlich hatte. Unter großem Beifall, wie ich hinzufügen könnte. Aber trotzdem … Wenn ich nur alle zehn Jahre ein Haus verkaufen würde, würde ich vermutlich darüber nachdenken, etwas anderes zu probieren.
Darauf würde Harrison antworten, dass Schreiben mehr Berufung als Beruf sei, wie das Priesteramt, keinesfalls vergleichbar mit dem Verkauf von Immobilien auf einem überhitzten Markt. Worauf wahrscheinlich noch folgen würde: »Es ist nicht leicht, etwas von Wert zu schaffen, wenn ständig zwei kleine Kinder um einen herumspringen.«
Dieser letzte Einwand wäre womöglich gewichtiger, wenn unser achtjähriger Sohn Samuel nicht fast den ganzen Tag in der Schule wäre und unsere dreijährige Tochter Daphne in der Kindertagesstätte. Gewiss, manchmal muss Harrison die Kinder ins Bett bringen, wenn ich eine Besichtigung am Abend habe, und manchmal muss er sie an Wochenenden bespaßen, wenn ich Termine habe. Der Verkauf von Immobilien ist nun mal kein Beruf mit festen Bürozeiten. Ganz so wie das Schreiben, bin ich versucht zu sagen.
Aber das tue ich natürlich nicht, weil es wahrscheinlich zu einem Streit führen würde. Und ich hasse Streit.
»Das männliche Ego ist fragil«, hatte meine Mutter mir einmal erklärt. Und sie sollte es wissen. Sie war fast fünfzig Jahre lang mit meinem Vater verheiratet, der immer ein ziemlich schwieriger Mann gewesen ist.
Nicht, dass meine Mutter ein Mauerblümchen war. Sie konnte genauso gut austeilen wie einstecken, und die lautstarken Auseinandersetzungen meiner Eltern waren in ihrem exklusiven Wohnviertel Rosedale legendär. Einige meiner frühesten Erinnerungen handeln davon, wie ich in meinem Bett liege und mir die Ohren zuhalte, um die wütenden Vorwürfe und empörten Widerworte auszublenden, die die Treppe hinaufschallten und durch die Tür des Zimmers drangen, das ich mit meiner Schwester teilte, die wie immer ahnungslos in dem Bett neben meinem schlummerte. Wenn ich nicht einschlafen kann, höre ich bis heute die lauten Stimmen meiner Eltern, die die Stille der Nacht zerreißen und mir in den Ohren gellen.
Ein Therapeut könnte bestimmt erklären, weshalb diese Erinnerungen verantwortlich sind für meine Abneigung gegen jede Art von Konfrontation. Und wahrscheinlich hätte der Therapeut recht.
Wenn nur alle anderen Geschehnisse ebenso leicht zu erklären wären.
Die Stimme meiner Mutter war in den letzten Jahren fast verstummt, verloren an die unbarmherzigen Verheerungen der Parkinson-Krankheit. Und nachdem er seine Lieblings-Sparringpartnerin verloren hatte, blieb auch meinem Vater wenig anderes übrig, als entsprechend milder zu werden.
Oh, er konnte immer noch schwierig sein – das männliche Ego ist schließlich fragil –, aber auch fürsorglich und manchmal sogar zärtlich. Vor acht Jahren hat er seinen Posten als Chef der Makleragentur aufgegeben, die er gegründet hat – ja, dieselbe Agentur, für die ich arbeite –, um sich ausschließlich der Pflege meiner Mutter zu widmen.
Eine großherzige Entscheidung, gewiss.
Aber der Mann war neunundsiebzig Jahre alt, und selbst wenn er gesund und beneidenswert rüstig war – ganz zu schweigen davon, auf eine saloppe Art auch immer noch attraktiv –, war er kein junger Mann mehr. Und die Pflege einer Frau mit Parkinson im fortgeschrittenen Zustand ist in keinem Alter eine leichte Aufgabe.
Deshalb schlug ich vor, dass er eine Haushälterin anstellen sollte.
Eine Idee, die prompt und mit Nachdruck zurückgewiesen wurde. (»Wir sind durchaus in der Lage, allein zurechtzukommen, vielen Dank!«, brüllte er.)
Also versuchte ich, die Unterstützung meiner Schwester zu gewinnen. Tracy ist vier Jahre älter als ich und eine blonde, blauäugige Göttin. Sie ist etwas über eins achtzig groß und wiegt kaum mehr als fünfundfünfzig Kilo. (Fürs Protokoll, mein Haar und meine Augen sind von dem gleichen Braunton, ich messe weniger beeindruckende eins sechsundsiebzig, und zum letzten Mal fünfundfünfzig Kilo gewogen habe ich mit einundzwanzig, also vor gut zwei Jahrzehnten.)
Seit ich mich erinnern kann, fragte mein Vater mich bei jedem Besuch so ziemlich als Erstes: »Hast du ein bisschen zugelegt?« (Noch mal fürs Protokoll, mit meinem Gewicht ist alles in Ordnung. Tatsächlich halten mich alle meine Freundinnen für schlank.)
Jedenfalls lehnte Tracy es ab, sich einzumischen, was einer der Gründe dafür sein könnte, weshalb sie immer der Liebling meiner Eltern gewesen ist, obwohl sie sie nur selten besuchte, und auch nur dann, wenn sie Geld brauchte.
Die Idee, eine im Haus lebende Hilfe zu engagieren, wurde also auf die sprichwörtliche Sparflamme gesetzt.
Bis zu dem Tag, als meine Mutter aus dem Bett fiel und mein Vater ihr nicht allein hochhelfen konnte. Er versuchte, mich anzurufen, doch ich hatte eine Besichtigung und mein Handy abgeschaltet; Harrison war zu beschäftigt damit, auf seinen leeren Computerbildschirm zu starren, um abzunehmen, und Tracy blickte etwa eine halbe Sekunde lang unschlüssig auf die Anruferkennung auf ihrem Display, entschied, nicht dranzugehen, und steckte ihr Handy wieder ein. Mit dem Ergebnis, dass meine Mutter gut zwei Stunden auf dem kalten harten Holzboden lag, weil mein Vater sich sträubte, einen Krankenwagen zu rufen. »Wir kommen durchaus allein zurecht! Wir brauchen keine Fremden, die durch unser Haus marschieren und unsere Besitztümer begutachten!« Bis ich schließlich meine Nachrichten abrief und sofort zu ihnen eilte.
Das war der Punkt, an dem ich auf den Tisch haute und darauf bestand, dass mein Dad eine Haushälterin engagierte. Sie kamen ganz offensichtlich nicht mehr »allein zurecht«. Und die Putzfrau, die einmal die Woche kam – genau genommen eine Folge von Putzfrauen, weil keine je gut genug war, um es meinem Dad länger als ein paar Monate recht zu machen –, würde nicht mehr ausreichen. Sie bräuchten eine Hilfe, die im Haus lebte, argumentierte ich, die Dad bei der Pflege meiner Mutter unterstützen sowie kochen und das Haus sauber halten konnte. Geld war kein Thema. Meine Eltern hatten weiß Gott mehr als genug davon. Es war eine Frage ihres Wohlbefindens.
Widerwillig gab mein Vater nach und erlaubte mir, Gespräche mit Kandidatinnen zu führen. Er erteilte mir strikte Anweisungen: Sie müsse makellose Referenzen haben und kräftig genug sein, meiner Mutter ins und aus dem Bett zu helfen, sollte jedoch gleichzeitig schlank und attraktiv sein, beharrte er. Wenn er schon die Anwesenheit einer Fremden im Haus ertragen müsse, betonte er, dann sollte sie zumindest nett anzuschauen sein.
Auftritt Elyse Woodley.
Eine jung aussehende Frau von zweiundsechzig Jahren, schlank, mit erkennbar muskulösen Oberarmen, kurzem blondem Haar, einem einnehmenden Lächeln und einem ebenso einnehmenden Wesen, die beinahe zu gut schien, um wahr zu sein.
Und was sagt man über Dinge, die zu gut sind, um wahr zu sein?
Also hätte ich vielleicht argwöhnischer sein sollen. Oder zumindest aufmerksamer. Tracy behauptet, die Zeichen seien von Anfang an erkennbar gewesen, obwohl sie solche Bedenken damals nie geäußert hat. Sie sagt, was geschehen ist, verfüge über alle Elemente einer guten Kriminalgeschichte: das knarrende alte Haus, die betagte Invalidin und die scheinheilige Haushälterin, die für ihre Pflege engagiert worden war, die subtilen Indizien, falschen Fährten, die Leiche am Fuß der Treppe.
Aber ich eile meiner Erzählung voraus. Die Leiche kommt später.
Und wenn es irgendein Rätsel darüber gibt, was passiert ist, dann ist es die Frage, wie ich es geschehen lassen konnte.
Am Ende kann ich mir nur selbst die Schuld geben.
Ich bin diejenige, die sie hereingelassen hat.
KAPITEL ZWEI
»Was wissen Sie über Parkinson?«
Das war immer die erste Frage, die ich stellte. Ich wollte sichergehen, dass eine potenzielle Angestellte wusste, worauf sie sich einließ.
Elyse Woodley saß in einem der beiden elfenbeinfarbenen Sessel gegenüber dem lindgrünen Samtsofa in unserem selten benutzten Wohnzimmer. Sie trug eine kurzärmelige gelbe Bluse, eine dunkelblaue Baumwollhose und offene Sandalen. Unter den perfekt frisierten Wellen ihres kinnlangen blonden Haars lugten kleine goldene Perlohrringe hervor, neben ihrer schlichten goldenen Armbanduhr der einzige Schmuck, den sie trug. Auch keinen Ehering, und dafür war ich dankbar. Eine Komplikation weniger, erinnere ich mich gedacht zu haben.
Ich hatte mich entschieden, die Bewerbungsgespräche in unserem Wohnzimmer zu führen, nicht weil es der förmlichste Raum im Erdgeschoss war, sondern der am wenigsten unordentliche. In allen anderen Räumen – dem kleinen Esszimmer mit der permanent verschmierten gläsernen Tischplatte, der modernen offenen Küche inklusive großem Inseltresen mit Marmorplatte, dem angrenzende Familienzimmer mit Blick auf einen winzigen Streifen Garten – waren überall Spielsachen verteilt. Es war schwer, einen Schritt zu machen, ohne über eine Super-Mario-Figur oder einen Legostein zu stolpern. (Von den hartnäckigen und anscheinend unzerstörbaren Kneteklümpchen, die an praktisch jeder Oberfläche klebten, will ich gar nicht erst anfangen.)
»Ich weiß, dass es eine Störung des Nervensystems ist, die in erster Linie den Bewegungsapparat betrifft«, antwortete sie. »Sie wird fortschreitend schlimmer. Und es gibt keine Heilung«, fügte sie leise hinzu.
Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht gleich an Ort und Stelle zu rufen: »Sie sind engagiert!« Die meisten Frauen, die ich bis dahin interviewt hatte – insgesamt sechs – hatten schlicht den Kopf geschüttelt und in verschiedenen Varianten gestammelt: »Nicht viel.«
»Denken Sie, dass Sie sich um eine Person in einem späten Stadium kümmern könnten?«
»Ich glaube schon. Meine Mutter hat jahrelang unter MS gelitten, und mein letzter Arbeitgeber hatte Krebs und war in den letzten Jahren seines Lebens mehr oder weniger ans Bett gefesselt, sodass ich eine Menge Erfahrung mit degenerativen Erkrankungen habe.« Sie schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln. Grübchen wie große Kommas tauchten auf beiden Seiten ihres Mundes auf. »Außerdem bin ich tougher, als es den Anschein hat.«
Ich erläuterte die Situation meiner Mutter in breiterem und quälendem Detail: Nach der Diagnose zehn Jahre zuvor nahmen die Symptome den normalen und vorgezeichneten Weg. Es begann mit einem noch harmlosen Zittern ihrer kleinen Finger – »Ruhetremor« nannten die Ärzte es –, gefolgt von verlangsamten Bewegungen und zunehmender Muskelschwäche, die zu Steifheit, einer Veränderung ihrer früher perfekten Haltung und zuletzt einem starren Gang führte.
Meine Mutter war ihr Leben lang eine Tänzerin gewesen, und nun schien es, als würden ihre Füße am Boden kleben. Sie schleppte sich mehr dahin, als dass sie ging. Darüber hinaus war ihre Handschrift bis zur Unleserlichkeit geschrumpft, wegen Veränderungen der Gehirnpartien, die ihre motorischen Fähigkeiten steuerten und es ihr schwer bis unmöglich machten, die Bewegungen ihrer Finger und Hände zu kontrollieren.
Sie hatte Schlafprobleme, schwitzte heftig und litt häufig unter Verstopfung. »Man hat eine Menge am Hals«, musste ich zugeben, bemüht, nichts auszulassen, damit die Frau nicht kündigte, wenn das Ausmaß der Erkrankung meiner Mutter so offensichtlich wurde, dass man es nicht mehr abtun konnte, »auch wenn mein Vater darauf beharren wird, dass er ihr Hauptpfleger ist. Wahrscheinlich hätten Sie mehr mit Kochen und Haushaltsführung zu tun«, sagte ich hoffnungsvoll, »und damit, zur Stelle zu sein, falls …«
»Ihre Eltern mich brauchen«, beendete Elyse den Satz für mich. »Vielleicht sollten Sie weiteratmen«, riet sie mir und riss ihre dunklen Augen auf, während die Grübchen zurückkehrten und an ihren Mundwinkeln zupften.
Ich merkte, dass ich die Luft angehalten hatte, und lachte, obwohl das Geräusch eher so klang, als würde jemand nach Luft schnappen. Ich stellte mir einen alten Baum vor, verbogen und knorrig, und fragte mich, ob sie mich so sah. »Gibt es noch irgendetwas, das Sie wissen müssen?«, sagte ich und wappnete mich auf Nachfragen nach Gehalt und Urlaub, das Erste, wonach sich alle vorherigen sechs Bewerberinnen erkundigt hatten.
»Wann soll ich anfangen?«, fragte sie stattdessen und fügte dann hastig hinzu: »Oh herrje. Wie anmaßend von mir! Es tut mir leid. Ich wollte nicht vorschnell von irgendetwas ausgehen. Mein Sohn ermahnt mich ständig deswegen. Er sagt, ich neige zu voreiligen Schlüssen …«
»Sie haben einen Sohn?«
»Ja, Andrew. Er ist etwa in Ihrem Alter. Er lebt in Kalifornien. Los Angeles. Von dort komme ich ursprünglich.«
»Wie lange leben Sie schon in Toronto? Wenn ich fragen darf …«, fügte ich hinzu, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass angehende Arbeitgeber potenziellen Angestellten nicht zu viele persönliche Fragen stellen durften, wobei ich mir nicht sicher war, ob das auch für diese Art Position galt. Ich fand, wenn man eine Person einlud, in seinem Haus zu leben, sollte man das Recht haben, zumindest ein paar wesentliche Dinge über sie zu erfahren.
»Kein Problem«, erwiderte sie locker. »Ich bin vor neun Jahren hierhergekommen, kurz nach dem Tod meiner Mutter. Ich brauchte Urlaub, habe mir ein Ticket für eine Zugfahrt quer durch Kanada gekauft und mich einfach in das Land und die Leute verliebt. Vor allem in einen Mann, wenn ich ehrlich bin.« Sie hob ihre Hand vors Gesicht, um ihr Erröten zu verbergen. »Kurz nach meiner Ankunft in Toronto habe ich einen reizenden Mann kennengelernt, und drei Monate später waren wir verheiratet. Alles war perfekt. Bis es nicht mehr perfekt war.« Sie tat einen jener Riesenseufzer, die den ganzen Körper erschüttern. »Eines Abends – in diesem September ist es vier Jahre her – haben wir zusammen ferngesehen, und Charlie sagte, ihm sei ein wenig schwindelig, und ehe ich begriff, was geschah … war er tot. Gehirnaneurysma, sagten die Ärzte.« Sie hielt inne, und ihr Blick folgte ihren Gedanken in die Vergangenheit. »Damit war ich zum zweiten Mal Witwe. Mein erster Mann, Andrews Vater«, fuhr sie unaufgefordert fort, »ist ebenfalls gestorben. Ein schwerer Herzinfarkt, als er kaum älter war als Andrew jetzt.«
»Das tut mir sehr leid«, setzte ich an, unsicher, was ich sonst noch sagen konnte. In Wahrheit dachte ich, dass sie auf eine perverse Art Glück gehabt hatten. Hirnaneurysmen und schwere Herzinfarkte erschienen mir als Todesart dem langsamen, unbarmherzigen Fortschreiten einer Parkinson-Krankheit vorzuziehen.
»Tja, nun. Man kann nur nach vorne schauen. Als Charlie starb, hatten wir eine Wohnung in der Nähe der St. Claire-Avenue und der Yonge Street, und ich fing an, einer meiner älteren Nachbarinnen bei den Einkäufen zur Hand zu gehen. Schon bald brachte ich selbst gebackene Kekse vorbei – ich backe für mein Leben gern –, und schließlich stellte die Familie mich ein, um der alten Dame ihre Mahlzeiten zuzubereiten, mich um die Wohnung zu kümmern und ihr Gesellschaft zu leisten. Mein Sohn war natürlich entsetzt, dass seine Mutter sich zu solch niedrigen Arbeiten herabließ. Diesbezüglich ist er ein wenig snobistisch. Aber in Wahrheit kümmere ich mich gern um Menschen. Ich bin es gewohnt. Und ich bin gut darin. Außerdem wollte ich nicht nach L.A. zurückziehen und Andrew zur Last fallen.« Sie beugte sich verschwörerisch vor. »Ganz ehrlich … ich kann seine Frau nicht besonders gut leiden.«
Ich unterdrückte ein Lächeln. »Haben Sie Enkelkinder?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. Offensichtlich ein wunder Punkt.
Wie aufs Stichwort brach im selben Moment im ersten Stock ein lautstarkes Gekabbel aus. »Mom, Daphne klaut mir Sachen!« »Mommy, Sam ist gemein zu mir!«
»Daphne«, rief ich zurück, »hör auf, Sams Sachen zu nehmen. Sam, hör auf, gemein zu deiner Schwester zu sein.«
»Sie gibt mir meine Nintendo Switch nicht zurück!«
»Er hat gesagt, ich darf damit spielen!«
»Nein, hab ich nicht! Gib es zurück!«
»Mommy, er ist gemein!«
»Was ist eine Nintendo Switch?«, fragte Elyse.
»Jodi, Herrgott noch mal«, dröhnte eine männliche Stimme die Treppe herunter. »Kannst du bitte irgendwas machen? Ich versuche zu arbeiten.«
»Mein Mann«, erklärte ich Elyse. »Er ist Schriftsteller.«
»Wie wunderbar. Könnte ich seine Bücher kennen?«
Ich zuckte die Achseln. »Möglich. Er hat einen Roman mit dem Titel Der Weg des Träumers geschrieben.«
»Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne.«
»Na ja, es ist schon eine Weile her.«
»Mom!«, rief Sam.
»Mommy!«, ließ sich Daphne wie ein Echo vernehmen.
»Okay, Kids, das reicht. Kommt runter. Sofort.« Wenige Augenblicke später stürmten meine Kinder die Treppe herunter ins Zimmer: Sam, eine dünner Schlaks, und Daphne, ein moppeliges Energiebündel, beide mit meinem leicht widerspenstigen braunen Haar und den neugierigen blauen Augen ihres Vaters.
»Wer sind Sie?«, fragte Sam Elyse und beäugte sie misstrauisch.
»Das ist Mrs Woodley«, sagte ich.
»Elyse, bitte«, verbesserte sie mich. »Was für wunderbare Kinder. So ein attraktiver junger Mann«, sagte sie zu Sam und wandte ihre Aufmerksamkeit Daphne zu. »Und du bist einfach eine süße Zuckerschnecke, nicht wahr?«
Beide Kinder strahlten.
»Wenn ich groß bin, will ich in New York wohnen«, verkündete Sam, etwas, das er bis dahin noch nie erwähnt hatte.
»Wenn ich groß bin«, plapperte Daphne ihm nach, »will ich in New York wohnen. Dann arbeite ich in einer Buntstifte-Fabrik«, fügte sie noch hinzu.
Ich wusste nicht, ob ich amüsiert oder entsetzt sein sollte. Eine Buntstifte-Fabrik?
»Was für eine reizende Idee«, sagte Elyse. »Dann könntest du deine eigenen Buntstifte herstellen und den ganzen Tag malen.«
Daphne nickte begeistert.
»Ich hab Hunger«, sagte Sam.
Elyse stand sofort auf. Eine Sekunde lang dachte ich, sie würde in die Küche gehen und anfangen, das Abendessen zuzubereiten. Stattdessen griff sie in ihre Handtasche und überreichte mir einen lavendelfarbenen Bogen Papier. »Erkundigen Sie sich doch bei diesen Adressen und melden Sie sich bei mir, wenn Sie alle Vorstellungsgespräche geführt haben. Und falls Sie noch Fragen haben, können Sie mich jederzeit gerne anrufen.«
»Aber wir haben überhaupt noch nicht über die Bezahlung und Urlaubsregelungen gesprochen«, sagte ich, weil ich sie nicht gehen lassen wollte.
»Ich bin sicher, was Ihnen vorschwebt, wird mehr als fair sein«, erwiderte sie und streckte die Hand zu Sam aus. »Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Sam«, sagte sie, als er ihre Finger ergriff. »Und dich auch, Daphne. Ich hoffe, euch beide sehr bald wiederzusehen. Und ich werde mir sofort das Buch Ihres Mannes besorgen«, sagte sie, als wir die Haustür erreichten.
Ich sah sie die von Bäumen gesäumte Straße hinunter verschwinden und unterdrückte den Impuls, ihr nachzulaufen, sie im nächstbesten Vorgarten auf den Frühlingsblumen zu Boden zu ringen und ihr zu sagen, dass sie den Job hatte, dass es unnötig war, irgendwelche Referenzen zu überprüfen oder weitere Kandidatinnen zu interviewen, dass ich bereitwillig bezahlen würde, was sie verlangte, und ihr so viel Urlaub zugestehen würde, wie sie wünschte.
Es muss einen Haken geben, erinnere ich mich, gedacht zu haben. Niemand war derartig vollkommen. Aber der unangenehme Gedanke wurde schnell von den Stimmen meiner Kinder übertönt.
»Ich habe Hunger«, jammerte Sam hinter mir.
»Ich bin eine süße Zuckerschnecke«, sagte seine Schwester.
KAPITEL DREI
»Was soll das heißen, du hast sie angestellt?«, wollte meine Schwester wissen. »Ohne mich zurate zu ziehen? Ohne dass ich sie auch nur gesehen habe?«
»Ich hatte dich gebeten, anwesend zu sein«, erinnerte ich sie.
»Und ich habe dir gesagt, dass ich an dem Nachmittag einen Fitness-Kurs habe.«
»Du hast jeden Nachmittag einen Fitness-Kurs«, bemerkte ich und blickte auf ihre schwarzen Leggins und das bauchfreie weiße T-Shirt mit dem Goodlife-Logo. Unbehagen flatterte in meiner Brust wie ein gefangener Schmetterling. Ich wollte auf keinen Fall Streit. Ich fühlte mich optimistischer und weniger gestresst als seit Wochen und hatte Tracy zum Abendessen eingeladen – Lachs, eins der weniger Dinge, die sie aß –, um das große Glück zu feiern, dass wir uns Elyses Dienste gesichert hatten.
Tracy strich eine Strähne ihres langen, blonden, vollkommen glattgeföhnten Haares hinters Ohr und schüttelte dann den Kopf, sodass die Strähne wieder an ihren Ausgangspunkt fiel. Sie rückte das silberne Tiffany-Herz an der Kette um ihren Hals zurecht, hob ein wohlgeformtes Bein und legte ihren nackten Fuß auf das violette Wildleder-Ecksofa. »O Gott. Was ist das?«, fragte sie, kräuselte vor Abscheu ihre chirurgisch begradigte Nase und ihre aufgespritzten Lippen und kratzte einen kleinen Knubbel knallpinker Knete von ihrer Ferse.
»Tut mir leid.« Ich löste das Klümpchen von ihrem Finger, erhob mich von dem Sofa und warf es in den Abfalleimer unter dem Spülbecken in der Küche.
»Könntest mir ein Glas Wasser mitbringen, wo du gerade stehst?«, fragte Tracy. »Iiih«, sagte sie, als ich es überreichte. »Das ist ja lauwarm. Du hast kein Wasser aus Flaschen im Kühlschrank?«
»Tut mir leid.« Zwei Entschuldigungen in nicht einmal einer Minute, dachte ich. Möglicherweise ein neuer Rekord.
Sie stellte das Glas auf den Beistelltisch, ohne einen Schluck zu trinken. »Also, erzähl mir von dieser Elyse Woodley.«
»Sie ist perfekt«, sagte ich und nahm wieder auf der anderen Seite des Ecksofas Platz. Prompt spürte ich, wie ein kleiner Superheld aus Plastik sich in meine Seite bohrte. »Geduldig, freundlich, hat eine Menge Erfahrung mit Senioren und Menschen mit medizinischen Problemen …«
»Hast du ihre Referenzen überprüft?«
»Selbstverständlich. Sie hätten nicht glänzender sein können.« Ich hatte sowohl mit der Tochter von Elyses vormaliger Nachbarin als auch mit dem Sohn des Mannes gesprochen, der an Krebs gestorben war, und beide hatten geradezu von Elyse geschwärmt.
»Und was kostet uns diese Wonder Woman?«, fragte Tracy.
»Dad zahlt alles«, erinnerte ich sie.
»Von unserem Erbe.«
»Tracy, Herrgott.«
»Oh, nun sei nicht so scheinheilig. Stimmt doch.«
Ich wollte nicht über das Thema diskutieren, also sagte ich nichts.
Tracy zuckte die Schultern. »Du hast mir noch nicht erzählt, was Dad von ihr hält.«
Nun war es an mir, mit den Schultern zu zucken. »Er hat sie bisher noch nicht kennengelernt.«
»Du hast sie ohne Dads Zustimmung angestellt? Soll das ein Witz sein?«
»Das Angebot hängt offensichtlich daran, dass beide Seiten aneinander Gefallen finden. Ich treffe mich morgen mit ihr bei Mom und Dad. Du bist sehr herzlich eingeladen, auch zu kommen.«
»Warum verabredest du immer Zeiten, zu denen ich etwas anderes vorhabe?«, fragte Tracy. »Du könntest mich schon vorher fragen.«
»Vielleicht kannst du deine Verabredung verschieben«, schlug ich vor, ohne ihren vorwurfsvollen Ton zu beachten.
»Vielleicht.«
»Du hast sie schon eine Weile nicht mehr besucht«, wagte ich meinerseits einen leisen Vorwurf zu äußern. »Mom würde sich bestimmt riesig freuen …«
»Du weißt, dass es mir schwerfällt, sie in diesem Zustand zu sehen.«
»Es fällt uns allen schwer.«
»Du verstehst das nicht. Du bist besser in so was als ich. Ich bin zu sensibel …«
»Es geht nicht um dich«, erwiderte ich und erkannte sogleich die Nutzlosigkeit meiner Worte. Es ging immer um Tracy. Seltsamerweise war das ein Teil ihres Charmes.
Ein weiteres Achselzucken. Ein weiteres »Vielleicht«.
Ich stand erneut von meinem Platz auf und ging in die Küche, um nach dem Lachs und dem Gemüse zu sehen, das im Kühlschrank vor sich hin marinierte. Es war eigentlich nicht nötig. Aber ich konnte die Ichbezogenheit meiner Schwester nur begrenzt lange ertragen, bevor ich ihr irgendwas an den Kopf werfen wollte, und der kleine Superheld, der sich in meine Hüfte bohrte, war gefährlich griffbereit.
»Und wo sind alle?«, fragte Tracy und blickte sich um, als würde ihr erst jetzt auffallen, dass weder mein Mann noch meine Kinder irgendwo zu sehen waren. »Es ist so still.«
»Harrison holt Daphne in der Kindertagesstätte ab. Er hat Sam mitgenommen.«
»Er ist ein guter Vater«, bemerkte sie.
»Ja, das ist er.«
»Er unternimmt viel mit ihnen.«
»Er ist ihr Vater«, erinnerte ich sie.
»Trotzdem bringen sich nicht alle Väter so ein«, erwiderte sie und dachte womöglich an unseren eigenen. »Du hast Glück.«
»Ja, hab ich.«
»Harrison hat auch Glück. Du bist eine wirklich gute Mutter«, fügte sie hinzu und erwischte mich auf dem falschen Fuß. An Komplimente von meiner Schwester war ich nicht gewöhnt. An Komplimente von wem auch immer aus unserer Familie. Wir waren nicht gerade eine Familie, die dazu neigte, unsere eher positiven Gefühle auszusprechen. Ich konnte mich nicht erinnern, wann irgendjemand von uns zum letzten Mal gesagt hatte: »Ich liebe dich.« Hatten wir es je gesagt?, fragte ich mich. Und war das der Grund, warum ich darauf achtete, meinen Kindern jeden Tag zu versichern, wie sehr ich sie vergötterte, damit sie ihren eigenen Wert nie anzweifelten?
»Ich möchte gern glauben, dass ich eine gute Mutter bin«, sagte ich und hatte ein schlechtes Gewissen wegen meiner unfreundlichen Gedanken über Tracy vorhin. »Ich gebe mir Mühe.«
»Gibt Harrison im Sommer wieder diesen Kurs in Kreativem Schreiben?«
»Ja. Er freut sich darauf.«
»Vielleicht sollte ich mich anmelden.«
»Was?«
»Nun, ich hatte ein interessantes Leben, und ich habe eine lebhafte Fantasie. Wie schwierig kann es sein, einen Roman zu schreiben?«
Es gibt da eine Kleinigkeit namens Disziplin, dachte ich, behielt den Einwand jedoch für mich. »Ich glaube, es ist nicht so leicht, wie du dir das vorstellst«, sagte ich stattdessen.
»Du glaubst bloß nicht, dass ich es kann.«
»Das ist nicht wahr«, protestierte ich. »Ich glaube, du könntest toll in allem sein, was du dir ernsthaft vornimmst.« Das stimmte. Das Problem war bloß, dass Tracy sich nie ernsthaft etwas vornahm, zumindest nicht für länger. Sie war das, was Harrison eine »Universaldilettantin« nannte. Allein in den letzten paar Jahren hatte sie ein kleines Vermögen vom Geld unserer Eltern für eine Ausbildung als Pilates-Trainerin, als Yoga-Lehrerin, als Lehrerin für modernen Tanz, als Trainerin in den Arthur-Murray-Tanzstudios, als Barkeeperin, als Model sowie als Ernährungsberaterin ausgegeben, um jeden Kurs noch vor Ende des ersten Semesters wieder aufzugeben. Des Weiteren hatte sie Bridge-, Tennis- und Golfstunden genommen, wovon sie allerdings ebenfalls nichts durchgehalten hatte.
Das Gleiche galt für die Männer in ihrem Leben, eine in weiten Teilen abstoßende Palette von Verehrern, die in der Regel nach einem oder zwei Dates wieder in der Versenkung verschwunden waren.
»Ich wünschte, ich könnte mehr so sein wie du«, sagte sie, ein weiteres unerwartetes Kompliment, das noch einmal unterstrich, wie engherzig ich war. »Aber dieses ganze Fester-Job-Ehe-und-Kinder-Ding ist nichts für mich. Du bist so gut darin. Ich bin einfach zu kreativ, zu sehr Freigeist.«
Das wiederum war eines der zweifelhaften Komplimente, die ich gewöhnt, mit denen ich aufgewachsen war. Mein Vater war ein Meister darin. Ich lächelte. Ich konnte es meiner Schwester nicht verdenken, dass sie von dem Besten gelernt hatte.
In diesem Moment ging die Haustür auf, und Sam und Daphne stürmten herein.
»Das war’s mit der Ruhe«, sagte Tracy, als Harrison die Tür hinter sich schloss und die Kinder durch den Flur auf uns zu rannten.
»Schaut mal, wer hier ist«, sagte ich, als sie sich in meine Arme warfen. »Sagt Tante Tracy Hallo.«
»Hallo, Tante Tracy«, gehorchte Sam.
»Hallo, Tante Tracy«, sagte Daphne wie sein Echo.
»Wie war die Schule heute?«, fragte ich meinen Sohn.
»Gut«, antwortete er.
»Und wie war es in der Kita?«, fragte ich meine Tochter.
»Es gibt ein kleines Problem«, sagte Harrison.
»Ich will da nicht mehr hingehen«, erklärte Daphne.
»Was ist passiert, Zuckerschnecke?« Seit dem Vorstellungsgespräch mit Elyse hatte ich mir angewöhnt, sie so zu nennen.
»Da ist ein Junge. Joshua. Er sagt böse Sachen zu mir.«
»Was sagt er denn zu dir?«
Bei dem Ausmaß an Bestürzung in ihrer Miene bezweifelte ich, dass etwas Freundliches wie das Wort »Zuckerschnecke« darunter war.
Daphne straffte ihre Schultern und blies die Backen auf. »Er nennt mich Ficker und Schwanzlutscher«, verkündete sie.
Ich sah Tracy an; sie sah mich an. Wir brachen beide in lautes Gelächter aus.
»Sehr nett, Ladys«, tadelte Harrison. »Sehr erwachsen.«
»Kommst du morgen mit in die Kita und sagst ihm, dass er mich nicht Ficker und Schwanzlutscher nennen soll?«, fragte Daphne, offensichtlich ermutigt von meiner Reaktion.
»Ich glaube, das kannst du ganz allein regeln«, erklärte ich ihr, als ich meine Stimme wiederfand.
»Sag ihm einfach, er soll sich selbst ficken«, meinte Tracy.
»Also wirklich?«, fragte Harrison Tracy. »Sag ihm, er soll sich selbst ficken?«
Tracy zuckte die Achseln. »Komm, setz dich zu uns.« Sie klopfte neben sich auf das Polster. »Und vielleicht möchtest du dir den Stock aus dem Arsch ziehen, bevor du Platz nimmst.«
Ich musste auf meine Unterlippe beißen, um mir ein Grinsen zur Unzeit zu verkneifen. Zu spät. Harrison hatte es gesehen und war sichtlich verärgert.
»Ich denke, ich versuche vor dem Abendessen noch ein wenig zu arbeiten«, sagte er. »Vielleicht könntest du morgen mit der Leiterin der Kindertagesstätte sprechen, um die Sache zu klären.«
Wir sahen ihm nach, bis er auf der Treppe nach oben verschwunden war.
»War er früher nicht irgendwie viel lockerer?«, fragte Tracy.
KAPITEL VIER
Das große dreistöckige Haus in der Scarth Road 223 war 1932 erbaut worden, und von außen sah man ihm jedes seiner Jahre an. Wenn ich es potenziellen Käufern beschreiben müsste, würde ich ihnen raten, sich nicht von der dunkelroten Backsteinfassade und den altmodischen Fenstern abschrecken zu lassen, die das Haus »unheimlich« wirken ließen, um es mit einem Wort meines Sohnes zu sagen. Ich würde ihnen versichern, dass es von innen vollkommen anders war.
Und das stimmte größtenteils auch.
Seit dem Kauf des Hauses vor mehr als einem halben Jahrhundert hatten meine Eltern es mehrfach renovieren lassen. Kupferrohre und elektrische Leitungen waren verlegt, die schwere Brokattapete herausgerissen, allen Räumen war ein frischer weißer Anstrich verpasst, Küche und Bad nach den neuesten Trends modernisiert und die Kleiderschränke vergrößert worden. Im Untergeschoss waren sogar ein kleines Heimkino und ein voll ausgestatteter Fitnessraum eingerichtet worden. Hinter dem Haus erstreckte sich ein landschaftlich gestalteter Garten mit einem unregelmäßig geformten Swimmingpool.
Aber trotz aller Modernisierungen hatte das Haus selbst ein eigentümlich altmodisches Flair bewahrt. Vielleicht lag es an der imposanten Treppe mit dem kunstvollen Mahagonigeländer, die sich in der Mitte der riesigen Eingangshalle erhob, vielleicht an den breiten hölzernen Deckenbalken und der dunklen Täfelung in dem geräumigen Wohnzimmer und dem ebenso großen Esszimmer; vielleicht war es die Tatsache, dass das Haus keinen offenen Grundriss hatte, wie er von heutigen Käufern bevorzugt wird, sondern über zahlreiche verschiedene Zimmer verfügte.
Interessanterweise war es trotz seiner mehr als vierhundertfünfzig Quadratmeter Wohnfläche eines der kleineren Häuser in der Straße und würde in dieser extrem nachgefragten Toplage ungeachtet der langsam bröckelnden, »unheimlichen« Fassade ein kleines Vermögen einbringen, sobald es zum Verkauf angeboten werden würde.
Aber mein Vater hatte kein Interesse zu verkaufen.
Schon seit Jahren versuchte ich, meine Eltern zu überreden, in eine Eigentumswohnung umzuziehen, vor allem nach der Diagnose meiner Mutter. Oder in einen kleinen Bungalow. Irgendwas ohne Treppen. Etwas, das man leichter bewältigen konnte. Davon wollte mein Vater nichts hören. Dies sei ihr Zuhause, beharrte er. Sie würden nirgendwohin ziehen.
Das war jetzt natürlich ohnehin keine Option mehr. Einen Umzug würde meine Mutter höchstwahrscheinlich nicht überleben.
Die einzige Konzession, die mein Vater machte, war der Einbau eines kleinen Aufzugs rechts neben der Treppe. Anfangs war er häufig in Betrieb, doch im letzten Jahr hatte seine Benutzung stark abgenommen, weil meine Mutter zu zittrig war, um sich herauszuwagen, zu schwach, um länger im Garten zu sitzen, zu stolz, um sich in dem verhassten Rollstuhl durch die Straßen von Rosedale schieben zu lassen.
Sobald ich in die Scarth Road bog, sah ich Tracy am Ende der Straße hinter dem Steuer ihres sportlichen roten Audis sitzen. Ich stellte mein überaus unsportliches SUV in der Einfahrt unserer Eltern ab, stieg aus und ging die Straße hinunter bis zu dem geparkten Wagen meiner Schwester. »Wieso stehst du hier ganz am Ende?«, fragte ich und beugte mich zu dem offenen Fahrerfenster herunter.
»Du warst noch nicht da, und ich wollte nicht in der Einfahrt zugeparkt werden für den Fall, dass ich früher weg will«, erklärte sie und schwang ihre langen nackten Beine aus dem Wagen. Sie trug ein kurzes rosafarbenes Sommerkleid und passende flache Schuhe, ihr langes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden.
»Hübsch siehst du aus«, erklärte ich ihr in der Hoffnung, dass sie etwas Freundliches erwidern würde, aber was immer sie von meinem beigen Rock und der geblümten Bluse hielt, sie behielt es für sich. »Warum bist du nicht reingegangen?«
Sie verdrehte die Augen, als wäre das Antwort genug. »Und wo ist Mary Poppins?«
Ich blickte auf meine Uhr. »Sie sollte jeden Moment hier sein.«
»Kein gutes Zeichen, wenn sie zu spät kommt.«
»Sie hat immer noch zehn Minuten.«
Tracy verdrehte wieder die Augen und nahm eine verspiegelte pinke Sonnenbrille aus ihrer Handtasche.
»Schick«, sagte ich, als sie sie auf ihre Nase setzte. »Neu?«
»Tom Ford. Hat ein Vermögen gekostet.«
Etwas anderes hätte ich auch nicht erwartet, dachte ich, ohne es laut zu äußern. »Wahrscheinlich sollten wir reingehen«, sagte ich stattdessen.
»Muss das sein?«, jammerte sie.
»Nun, wir können ja schlecht hier draußen auf dem Bürgersteig rumstehen, bis Elyse kommt.«
»Wieso nicht?«
»Weil«, setzte ich an und entschied dann, dass es sinnlos war zu versuchen, eine vernünftige Antwort auf diese Frage zu geben. Also drehte ich mich um und ging zurück zum Haus, sodass Tracy mir wohl oder übel folgen musste.
»Warte.«
»Was?«
»Was, wenn Dad sie nicht ausstehen kann?«
»Dann finden wir jemand anderen.«
»Du findest jemand anderen«, korrigierte Tracy mich. »Ich mach das nicht alles noch mal durch.«
Was genau hast du bisher durchgemacht, fragte ich mich, ein weiterer Gedanke, den ich für mich behielt.
Tracy folgte mir über die Straße und den Betonweg zum Hauseingang meiner Eltern. »Warte«, sagte sie noch einmal und blieb auf der untersten Stufe stehen. »Ich brauche noch eine Minute.«
Allmählich ging mir die Geduld aus, und ich wollte gerade etwas sagen, was ich wahrscheinlich bereut hätte, als die Haustür geöffnet wurde.
Auf der Schwelle stand Elyse Woodley und lächelte. Sie trug eine weiße Hose und eine violette Bluse, die ihre schlanke Gestalt und ihre muskulösen Arme betonten. »Wir haben uns schon gefragt, was Sie hier draußen machen. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein.«
Herein, herein, sagte die Spinne zu der Fliege, denke ich heute.
Damals habe ich natürlich nichts dergleichen gedacht.
Und als mir der Gedanke kam, war es zu spät.
KAPITEL FÜNF
»Ihr seid zu spät«, sagte mein Vater und trat aus dem hinteren Teil des Hauses in die große Eingangshalle, als Tracy die Tür schloss. Er trug eine schwarze Baumwollhose und ein blaues Polohemd. Sein üppiges graues Haar war frisch gewaschen und ordentlich aus der Stirn gekämmt.
»Eigentlich sind sie genau pünktlich«, sagte Elyse mit einer so warmen und freundlichen Stimme, dass es jedem, sogar meinem Vater, schwergefallen wäre, Anstoß zu nehmen. »Ich war zu früh«, gestand sie. »Ich habe den Bus genommen und wusste nicht genau, wie lange ich brauchen würde, deshalb habe ich mehr als ausreichend Zeit eingeplant. Sie müssen Tracy sein.«
»Die bin ich«, bestätigte meine Schwester. »Freut mich, Sie kennenzulernen. Jodi hat in höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt.«
»Und Ihr Vater von Ihnen. Er ist sehr stolz. Auf Sie beide«, fügte Elyse eilig hinzu.
»Tatsächlich?« Tracy zog eine ihre anmutig gewölbten Brauen hoch. »Wie geht’s, Daddy?«
»Sehr gut, danke«, antwortete er. »Ist das ein neues Kleid?«
»Victoria Beckham«, nannte sie den Namen des ehemaligen Spice Girls, das eine der weltweit führenden Mode-Designerinnen geworden war, und drehte sich einmal um die eigene Achse.
Ich wollte nicht einmal darüber nachdenken, wie viel das Kleid gekostet hatte, schließlich war es Tracys Sache, wie sie ihr Geld ausgab. Das zu bewerten stand mir nicht zu.
Außer, dass es natürlich nicht ihr Geld war. Mein Vater kam für alle ihre Kreditkarteneinkäufe und Lebenshaltungskosten auf. Und auch wenn ich versuchte, mich nicht darüber aufzuregen, und mich regelmäßig daran erinnerte, dass ich in der glücklichen Lage war, ihn nicht um Geld bitten zu müssen, pikste es doch. »Hi, Dad«, sagte ich. »Du siehst ja ziemlich schmuck aus.« Als mein Kompliment nicht erwidert wurde, fragte ich: »Wie geht es Mom heute?«
»Genauso wie gestern und vorgestern.«
»Sie schien guter Dinge«, sagte Elyse.
»Sie haben sie gesehen?«
»Ihr Vater hat mir das Haus gezeigt und uns bekanntgemacht. So eine wundervolle Frau, trotz allem. Sollen wir in die Küche gehen und uns unterhalten?«, fragte sie. »Ich habe ein paar Brownies mitgebracht, die ich heute Vormittag gebacken habe, und Wasser für Tee aufgesetzt.«
»Klingt wunderbar«, sagte ich und warf Tracy einen Blick zu. Könnte sie noch fantastischer sein?
Wir folgten meinem Vater und Elyse in die komplett weiße Luxusküche mit Blick in den Garten, in dem die terrassierten Blumenbeete und Büsche in verschiedenen Rottönen von Koralle bis Pink in Blüte standen.
»Oh gut. Du hast den Pool eröffnet«, sagte Tracy und ließ sich auf einem der vier Korbstühle um den runden Tisch vor dem großen bodentiefen Fenster nieder. »Vielleicht komme ich Samstag zum Schwimmen vorbei.«
»Gute Idee«, sagte ich. »Ich bring die Kinder mit.«
»Wie geht es diesen entzückenden Kindern?«, fragte Elyse, bevor Tracy Einwände erheben konnte.
»Bestens, danke.«
Mein Vater musterte mich von unten bis oben und kniff die Augen zusammen. »Hast du ein wenig zugelegt?«
Ich stieß ein gezwungenes Lachen aus. »Nein, Dad. Alles wie immer.« Genauso wie gestern. Und vorgestern. »Kann ich Ihnen behilflich sein, Elyse?«, bot ich an, als sie das kochende Wasser in eine Porzellankanne goss. »Lassen Sie mich Ihnen etwas abnehmen.«
»Kommt nicht infrage. Setzen Sie sich. Alles ist fertig. Der Tee muss bloß noch ein paar Minuten ziehen.«
Ich blickte auf den Teller auf dem Tablett und spürte, wie mir das Wasser im Mund zusammenlief. »Die Brownies sehen fantastisch aus.«
»Hoffen wir, dass sie auch so gut schmecken, wie sie aussehen«, sagte Elyse. »Das ist eine sehr schöne Bluse«, erklärte sie mir. »Ich mag kräftige Muster.«
»Kräftig ist es«, murmelte Tracy, als ich ihr gegenüber Platz nahm.
»Gefällt es dir nicht?«, fragte ich.
»Nun, kräftige Muster sind nicht unbedingt mein Stil, aber es ist … ganz du.«
Ich nickte und entschied, dass diese Bemerkung das größtmögliche Kompliment war, das ich erwarten konnte.
»Bitte, bedienen Sie sich«, sagte Elyse und begann Tee in die gedeckten Porzellantassen auszuschenken.
»Für mich kein Kuchen, danke«, sagte Tracy.
»Tracy ist sehr gesundheitsbewusst«, erklärte mein Vater, während ich nach dem größten Stück griff.
»Im Gegensatz zu Jodi«, fügte er kopfschüttelnd hinzu. »Einmal haben Audrey und ich sie nachmittags in der Speisekammer entdeckt, wo sie eine ganze Packung Chocolate-Chip-Cookies verputzt hatte.«
»Damals war ich fünf«, erinnerte ich ihn.
Elyse lachte. »Hätte ich sein können. Ich könnte ehrlich gesagt den ganzen Tag Desserts essen.«
»Und trotzdem haben Sie es geschafft, schlank zu bleiben«, bemerkte mein Vater.
»Guter Stoffwechsel.« Elyse zuckte die Schultern. »Und Glück in der Lotterie. Und?«, fragte sie und blickte von mir zu meinem Vater. »Wie lautet das Urteil?«
»Köstlich«, sagten wir beide im Chor.
Immerhin etwas, worauf wir uns einigen können, dachte ich.
»Da bin ich aber froh. Dort stehen Milch und Zucker für den Tee.« Elyse wies mit ihren langen eleganten Fingern auf den Tisch.
»Für mich weder noch«, sagte Tracy, während ich beides nahm.
»Und«, begann Elyse, »Sie haben bestimmt einige Fragen. Wer will anfangen?«
In der nächsten halben Stunde besprachen wir die Anforderungen und Bedenken meines Vaters. Aber es war eigentlich nur Show. Wir wussten alle, dass es eine ausgemachte Sache war. Der unsichtbare Vertrag war in dem Moment unterschrieben worden, als Elyse zwanzig Minuten zuvor mit einem Teller selbst gebackener Brownies durch die Tür geschwebt war. Noch bevor Tracy und ich eingetroffen waren, hatte sie es geschafft, unseren Vater mit ihrem ungezwungenen Charme und ihrem adretten Äußeren zu entwaffnen.
Aber weil mein Vater mein Vater war, wollte er ihr das nicht zeigen.
»Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir alles noch einmal unter uns besprechen?«, fragte er sie, als sie den Küchentisch abräumte. »Jodi wird sich heute Abend bei Ihnen melden.«
»Klingt absolut vernünftig«, erwiderte Elyse. Wenn sie verärgert war, ließ sie es sich nicht anmerken. »Es war wirklich sehr nett, Sie beide kennenzulernen«, sagte sie beim Gehen zu Tracy und meinem Vater. »Und bitte sagen Sie Mrs Dundas auf Wiedersehen von mir.«
Wir blickten ihr nach, als sie den Weg zum Bürgersteig hinunterging, und wieder erforderte es all meine Selbstbeherrschung, ihr nicht nachzulaufen und sie zu Boden zu reißen.
»Soll das ein Witz sein?«, fragte ich meinen Vater, als er die Haustür geschlossen hatte. »Was gibt es da zu besprechen? Sie ist phänomenal!« Ich blickte zu Tracy, damit sie mir beipflichtete.
Tracy zuckte die Schultern. »Das ist Dads Sache.«
»Findest du sie nicht perfekt?«, drängte ich.
»Sie macht einen ganz netten Eindruck«, räumte Tracy ein. »Aber was ich denke, ist nicht von Belang.«
Unser Vater lächelte. »Du kannst Mrs Woodley heute Abend anrufen. Sag ihr, dass wir alles besprochen haben und bereit sind, es zu probieren.«
»Ich verstehe nicht, warum du ihr das nicht einfach gesagt hast, bevor sie gegangen ist.«
»Weil es nie eine gute Idee ist, einer Hausangestellten die Oberhand zu lassen«, sagte er und zwinkerte Tracy zu, als wäre das etwas, das ich nie begreifen würde.
»Okay. Gut. Wie auch immer«, sagte ich, stumm empört über seine herablassende Betonung des Wortes »Hausangestellte«, und dachte, dass wir von Glück reden konnten, wenn Elyse länger als eine Woche bleiben würde, bevor sie das Haus fluchtartig verließ.
»Ich sollte los«, sagte Tracy.
»Willst du Mom nicht Hallo sagen?«
»Natürlich sage ich Mom Hallo«, sagte Tracy, obwohl ihr wütend funkelnder Blick darauf schließen ließ, dass sie keineswegs die Absicht gehabt hatte.
Ich folgte ihr die breite Treppe hinauf. Im obersten Stockwerk gab es vier Schlafzimmer, zwei nach vorn und zwei nach hinten heraus, jedes mit einem eigenen Badezimmer. Als wir klein waren, hatten meine Schwester und ich uns ein größeres Zimmer mit Blick auf die Straße geteilt, und unser Vater hatte den Raum gegenüber als häusliches Arbeitszimmer benutzt.
»Vielleicht schläft sie«, sagte Tracy, als wir uns dem großen Elternschlafzimmer mit Blick in den Garten näherten. »Wir wollen sie nicht stören«, fügte sie hinzu, bemüht, ihre stille Hoffnung wie Besorgnis klingen zu lassen.
Die Tür stand offen, und ich spähte hinein. An einer Wand stand ein großes Himmelbett. Darin wirkte unsere Mutter bleich und winzig. Ihr schwindender Körper wurde von drei großen, gut gepolsterten Kissen in ihrem Rücken und drei weiteren für jeden Arm gestützt. Als ihr Zustand es vor zwei Jahren unmöglich gemacht hatte, dass meine Eltern weiter das Bett teilten, war mein Vater in das kleinere Schlafzimmer gegenüber gezogen.
»Hallo, Mom«, ich trat ans Bett und strich über ihr dünner werdendes, graues Haar, das einmal dicht und schwarz und auf das sie stolz gewesen war.
Sie drehte den Kopf langsam in meine Richtung. »Hallo, Liebes«, sagte sie und ließ ihren Blick suchend durchs Zimmer schweifen. »Ist Tracy auch da?«
»Ja, Mom, bin ich«, sagte Tracy von der Tür her. »Wie fühlst du dich heute?«
»Besser, jetzt wo du da bist. Komm näher. Ich will dich sehen.« Ein Arm schnellte vor, um Tracys Handgelenk zu packen. »Was für ein wunderschönes Kleid.«
»Von Victoria Beckham«, sagte Tracy und absolvierte die obligatorische Drehung um die eigene Achse. »Und was hältst du von Elyse Woodley?«
»Sie macht einen sehr netten Eindruck«, flüsterte unsere Mutter, jedes Wort mühsam hervorstoßend, während ihre erstarrten Gesichtszüge nichts preisgaben.
»Wir haben mit vielen Kandidatinnen gesprochen«, fuhr Tracy fort. »Sie war mit Abstand die Beste.«
»Wirklich lieb von dir, dir solche Mühe zu machen.«
Wenn Tracy Gewissensbisse hatte, den Ruhm für meine Arbeit zu ernten, wusste sie sie gut zu verbergen. Sie blieb noch ein paar Minuten und entschuldigte sich dann. »Ich komm dich am Wochenende besuchen«, sagte sie und gab unserer Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Stirn.
»Ich kann noch bisschen bleiben«, sagte ich und hockte mich neben sie auf die Bettkante.
Ich möchte glauben, dass ich sie lächeln gesehen habe.
KAPITEL SECHS
»Sie hat wirklich gesagt, dass wir viele Kandidatinnen befragt hätten«, beschwerte ich mich beim Abendessen bei meinem Mann. »Sie hat rein gar nichts gemacht.«
»Und warum noch gleich bist du überrascht …?«
»Und dann erklärt sie meiner Mutter, dass sie sie am Wochenende besuchen kommt«, fuhr ich fort, ohne auf Harrisons Frage einzugehen, weil ich sie für rhetorisch hielt, »obwohl sie eigentlich nur kommt, um den Pool zu benutzen.«
»Ich will schwimmen gehen«, unterbrach Sam mich.
»Ich auch«, rief Daphne. »Ich will schwimmen gehen.«
»Und das werden wir auch. Am Samstag«, versprach ich ihnen. Ich wusste, dass ich es ebenso sehr den Kindern zuliebe tat, wie um Tracy zu ärgern, deren Toleranz gegenüber Kindern – sogar meinen – bestenfalls begrenzt war, und hatte wegen meiner Kleinlichkeit sofort ein schlechtes Gewissen. »Lust mitzukommen?«, fragte ich Harrison.
»Ich verzichte, danke«, sagte er. »Mein Kurs beginnt in fünf Wochen, und ich muss noch eine Menge vorbereiten. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du die Kinder am Samstag nimmst. Das ist eine große Hilfe.«
»Apropos dein Kurs«, setzte ich an. »Habe ich dir erzählt, dass Tracy überlegt, sich dafür einzuschreiben?«
»Was?« Nichts konnte den Ausdruck des Entsetzens im Gesicht meines Mannes angemessen beschreiben.
»Ich glaube, wörtlich hat sie gesagt: ›Wie schwierig kann es sein, einen Roman zu schreiben?‹«
»Scheiße.«
Sam hielt erschrocken die Luft an. »Daddy hat ein böses Wort gesagt.«
»Scheiße«, sagte Daphne.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, wiederholte Sam lachend.
»Okay, Kinder. Das reicht«, fauchte Harrison. »Bitte«, sagte er zu mir. »Das darfst du nicht zulassen.«
»Ich wüsste nicht, was ich dagegen machen soll.«
»Sie ist deine Schwester.«
»Meine ältere Schwester, die Vorschläge meinerseits noch nie besonders gut aufgenommen hat«, erinnerte ich ihn. »Je öfter ich ›schwarz‹ sage, desto vehementer wird sie auf ›weiß‹ beharren. Je mehr ich ihr davon abrate, desto großartiger wird sie die Idee finden.«
»Scheiße«, sagte er noch einmal.
»Scheiße«, wiederholte Sam.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, sagte Daphne.
»Ich habe gesagt, das reicht, Kinder!«
»Du hast es selbst gesagt«, erwiderte Sam.
»Ja«, gab Harrison zu. »Und das hätte ich nicht tun sollen. Tut mir leid«, entschuldigte er sich mit einem gezwungenen Lächeln in seinem attraktiven Gesicht. »Tut mir leid«, sagte er noch einmal, diesmal zu mir, und wiederholte an niemand Bestimmten gerichtet: »Tut mir leid.«
»Tut mir leid«, sagte er ein weiteres Mal, diesmal im Bett, als er sanft meine Hand von seinem nackten Oberkörper schob. »Ich glaube, das wird heute Abend einfach nichts.«
»Alles in Ordnung mit dir?« Ich gab mir Mühe, nicht zu enttäuscht zu klingen. Harrison und ich hatten seit mehr als einer Woche nicht mehr miteinander geschlafen, und ich hatte gehofft, dass sich das heute Abend ändern würde. Ich hatte sogar den roten Spitzenbody angezogen, den Harrison so mochte, und dazu passende High Heels.
Mir fiel die Bemerkung meines Vaters wieder ein, und ich überlegte, ob ich wirklich ein paar Pfunde zugelegt hatte. Allerdings passte meine Kleidung wie immer, und ich ermahnte mich, Harrisons Zurückweisung nicht persönlich zu nehmen. Er war einfach müde und beschäftigt wie jedes Mal, wenn er sich für den Kurs vorbereitete, den er im Sommer gab. Ich wusste, dass es ihm zu schaffen machte, dass er etwas unterrichtete, was er selbst anscheinend nicht mehr zustande brachte.
»Mir geht es gut«, antwortete er. »Ich bin bloß … ich weiß nicht …«
»Mit den Gedanken woanders?«
»Ja, vermutlich. Die Vorstellung, dass deine Schwester meinen Kurs belegen will, hat mich ein bisschen umgehauen.«
»Entspann dich. Wahrscheinlich macht sie es doch nicht.«
»Ich rufe gleich morgen bei der Verwaltung an. Hoffentlich ist mein Kurs schon voll.«
Ich nickte, schwang meine Beine aus dem Bett, streifte die High Heels ab und kuschelte mich wieder an meinen Mann. Harrison gab im Rahmen des Sommerprogramms für Erwachsenenbildung seit vier Jahren einen Kurs in Kreativem Schreiben an der University of Toronto. Angeboten wurden Schreibkurse für Lyrik, Drehbücher, Autofiktion, Sachbücher und Romane, literarische und populäre. Pro Kurs waren nur jeweils zwölf Studierende zugelassen, und das Programm war äußerst beliebt, sodass es durchaus möglich war, dass Tracy mit ihrer Anmeldung schon zu spät dran war. Das hoffte ich sehr, sonst würde Harrison womöglich den ganzen Sommer lang »mit den Gedanken woanders« sein.
»Wenigstens ist die Situation mit der Haushälterin geklärt«, sagte er aufmunternd.
»Ja«, stimmte ich zu. »Sie fängt Montag an.«
»Das ist großartig. Dann kannst du aufhören, alle zwei Sekunden rüberzufahren, und stattdessen mehr Zeit zu Hause verbringen …«
»Ich verbringe jede Menge Zeit zu Hause.«
»Das meine ich nicht.«
»Was meinst du denn?«
»Nur dass du zu viel machst, und jetzt, da die Situation mit der Haushälterin geklärt ist, kannst du dich ein bisschen entspannen«, schloss er, gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Nasenspitze und drehte sich auf seine rechte Seite.
Ich lag da, in meinem roten Body, starrte auf seinen nackten Rücken und hörte ihn, die Berührung seiner Lippen noch auf der Haut, leise atmen, während er einschlief.
Sobald wir im Garten meiner Eltern eingetroffen waren, klingelte mein Handy. Ich blickte zu meiner Schwester, die sich in ihrem knallorangefarbenen Bikini auf einem Liegestuhl neben dem Pool sonnte. Sie hätte den Anruf ignoriert. Leider war ich nicht so gestrickt.
»Hier ist Linda Francis«, meldete sich eine Stimme, sobald ich den Anruf angenommen hatte. »Ich hoffe, ich bereite Ihnen keine zu großen Unannehmlichkeiten, aber könnten wir unseren Termin vielleicht von morgen auf heute verlegen?«
»Heute?«, wiederholte ich, während meine Kinder zum Pool rannten.
»Genau genommen so bald wie möglich. Wir sind eben für ein paar Tage in das Ferienhaus von Freunden eingeladen worden, und mein Mann möchte heute Nachmittag aufbrechen.«
Meine Schwester warf Sam einen missmutigen Blick zu, als er in das tiefe Ende des Beckens sprang und einen Schwall Wasser in ihre Richtung spritzte. »Herrgott noch mal, Sam«, rief sie. »Pass auf!«
»Worauf?«, fragte er.
»Mommy«, drängte Daphne. »Komm mit mir schwimmen.«
»Kann ich Sie gleich zurückrufen, Mrs Francis?«, fragte ich. »Ich werde sehen, was ich machen kann.«
»Du wirst sehen, was du was machen kannst?«, fragte Tracy und kniff die Augen zusammen.
»Es geht um eine neue Kundin«, erklärte ich die Situation.
»Du brauchst gar nicht erst mich anzusehen«, sagte Tracy, meine Bitte vorausahnend.
»Ich wäre höchstens eine Stunde weg.«
»Kommt nicht infrage«, sagte Tracy. »Das ist mein Nachmittag zum Entspannen.«
Im Gegensatz zu jedem anderen Nachmittag?, dachte ich, sagte es jedoch nicht laut. Eine Diskussion war zwecklos. Ich wollte nicht betteln, und eine andere Möglichkeit gab es nicht. Mein Vater hatte beide Hände voll zu tun mit meiner Mutter, und Harrison wäre bestimmt nicht begeistert, wenn seine Pläne durchkreuzt würden. Ich würde Linda Francis zurückrufen müssen, um ihr zu erklären, dass ich es nicht schaffte.
In diesem Moment hörte ich, wie die Schiebetür aufgeschoben wurde, drehte mich um und sah Elyse Woodley die Stufen zum Pool hinaufkommen, in den Händen ein Tablett mit einem Krug Limonade, einem Teller Kekse und einem Stapel Plastikbecher. Sie trug weiße Shorts sowie ein ärmelloses blaues T-Shirt und hatte ein breites Lächeln im Gesicht.
Ich träume, dachte ich.
»Wer möchte Kekse und Limonade?«, fragte sie.
»Ich!«, rief Daphne.
»Ich auch«, sagte Sam und kletterte eilig aus dem Becken, um vor seiner Schwester einen Becher zu ergattern.
»Sam! Pass auf!«, quiekte meine Schwester. »Du machst mich ganz nass.« Sie strich ein paar Wassertropfen vom Oberteil ihres Bikinis. Ich staunte, dass irgendjemand einen derart flachen Bauch haben konnte, und zog meinen eigenen ein.
»Was machen Sie hier?«, fragte ich Elyse. »Ich dachte, Sie fangen erst am Montag an.«
»Ich habe beschlossen, heute schon ein paar von meinen Sachen rüberzubringen«, sagte sie. »Und als ich Ihren Wagen vor dem Haus gehört habe, dachte ich, dass Sie vielleicht gern etwas Kaltes trinken würden. Gibt es ein Problem?«
»Oh nein. Nicht mit Ihnen«, erklärte ich rasch. »Ich hatte gerade einen Anruf von einer Kundin, die ihren Termin von morgen auf heute Nachmittag verlegen will.«
»Dann sausen Sie los«, erwiderte Elyse locker. »Ich pass auf die Kinder auf, bis Sie zurück sind.«
»Nein! Darum kann ich Sie nicht bitten.«
»Das haben Sie auch nicht. Ich habe mich freiwillig angeboten.«
»Aber …«
»Kein Aber. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich bin eine ausgezeichnete Schwimmerin. Ich passe gut auf sie auf.«
»Wirklich?«
»Ich würde lieber fahren, ehe sie es sich anders überlegt«, riet Tracy mir.
»Ich versuche, mich zu beeilen.«
»Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.«
»Danke. Vielen, vielen Dank. Ich bin bald zurück«, erklärte ich den Kindern. »Benehmt euch und hört auf Mrs Woodley.«
»Machen wir«, rief Sam und spuckte Kekskrümel um sich wie Granatsplitter.
»Sam, Herrgott noch mal«, sagte Tracy und schlug nach den Krümeln wie nach Fliegen.
»Tschüss, Mommy«, rief Daphne.
Am hinteren Gartentor drehte ich mich noch einmal um und sah Elyse Woodley in ihren Shorts und dem T-Shirt bis zur Hüfte im Wasser stehen, in einem Arm Sam, im anderen Daphne.
KAPITEL SIEBEN
Linda und Dean Francis wohnten in Lawrence Park, einer weiteren gehobenen Wohngegend, mit dem Auto nur eine gute Viertelstunde von Rosedale entfernt, insbesondere im Samstagsnachmittagsverkehr. Ich parkte den Wagen in einer sonnenüberfluteten Straße und nahm mir eine Minute Zeit, das große zweistöckige Haus im georgianischen Stil von außen zu betrachten. Die Nachbarin war eine Freundin von mir und hatte mich empfohlen, als sie gehört hatte, dass das Ehepaar Francis Interesse hatte, das Haus zu verkaufen. »Sie sind ein wenig exzentrisch«, hatte sie mich gewarnt.
Ich atmete ein paarmal tief durch, zog meine Lippen nach und bauschte mein Haar auf, bevor ich ausstieg. An dem geblümten formlosen Hemdkleid, das ich über meinem dazu passenden Badeanzug trug, und den knallpinken Flipflops an meinen Füßen konnte ich nichts mehr ändern. Linda Francis hatte betont, dass ich möglichst schnell kommen sollte, deshalb hatte ich beschlossen, keine wertvolle Zeit damit zu verschwenden, mich zu Hause umzuziehen. Das könnte ein Fehler gewesen sein, dachte ich, als ich klingelte. Nur weil meine Kunden »exzentrisch« sein mochten, bedeutete das nicht, dass sie diese Eigenschaft auch bei anderen schätzten.
Wie sich herausstellte, war »exzentrisch« eine Untertreibung.
»Mrs Francis?«, fragte ich und gab mir Mühe, die kleine hühnerbrüstige Frau, die die Tür öffnete, nicht anzustarren. Sie war etwa zehn Jahre älter als ich und ganz in Schwarz gekleidet. Ihr dunkles, von einer breiten weißen Strähne durchzogenes Haar war zu einer hohen Beehive-Frisur hochgesteckt, die an Morticia Addams von der Addams-Family erinnerte. Die Kontur um ihre breiten rosafarbenen Lippen war von demselben Dunkelrot wie die unverblendeten Streifen auf ihren Wangen, und ihre Lider hingen von dick aufgetragener Mascara beinahe auf Halbmast. An ihren Ohren baumelten große Strassohrringe, um ihren Hals mehrere Schichten bunter Glasperlen. An jedem ihrer zehn pummeligen Finger steckte ein Ring, und ihre Handgelenke waren von Armbändern eingefasst wie von Handschellen.
»Vielen Dank, dass Sie so flexibel waren«, sagte sie und führte mich in den Flur, wo ihr Gatte wartete. »Das ist mein Mann Dean.«
Dean Francis war ein nicht minder spektakulärer Anblick. Er war mindestens zwei Meter groß und trug grüne Bermudashorts, schwarze Kniestrümpfe und einen dunkelblauen Blazer. Sein schütteres Haupthaar war in einem unvorteilhaften Burgunderrot gefärbt und von einem zum anderen Ohr quer über den kahlen Kopf gelegt, was seine spitzen, vogelartigen Gesichtszüge betonte.
»Soll ich Sie herumführen?«, fragte er anstelle einer Begrüßung.
Leider erwies sich das Haus als noch schockierender als seine Besitzer. Die Francises waren Sammler. Was immer sich anbot, sie sammelten es, obwohl offenbar nichts von echtem Wert darunter war. Stapel von alten Zeitungen und Zeitschriften rankten an den Wänden nach oben wie Efeu, auf jedem Regal reihten sich gruselige alte Puppen und billige Plastikfiguren. Die Wände waren mit ungerahmten Familienfotos tapeziert. Im Wohnzimmer standen genug alte Stühle und Sofas herum, um damit mehrere Hotellobbys zu möblieren. Die Schlafzimmer waren ein Albtraum aus nicht zueinander passenden Stilen und Stoffen.
»Stimmt irgendwas nicht?«, fragte Linda Francis, als wir am Ende des Rundgangs auf Holzstühlen mit hohen Lehnen Platz nahmen, die sich um den Küchentisch drängten.
Ich versuchte, die vier Sets von Salz- und Pfefferstreuern zu übersehen. »Es ist eine Menge«, hörte ich mich sagen.
»Wir wissen, dass unser Geschmack nicht jedermanns Sache ist«, begann Dean Francis.
»Aber es braucht nur einen Menschen, der das Haus liebt«, fügte seine Frau hinzu.
»Es ist nicht das Haus«, sagte ich und stellte mir die Räume mit frischem Anstrich und schlanken minimalistischen Möbeln vor. »Das Haus ist nicht das Problem.«
»Was denn?«, fragten sie im Chor.
Ich biss mir auf die Zunge, um nicht zu sagen: »Sie! Sie sind das Problem!« Stattdessen erklärte ich ihnen: »Es ist einfach zu viel von … allem. Das Haus ist wirklich wundervoll. Aber alles, was jemand sieht, der hereinkommt, ist … Krempel.«