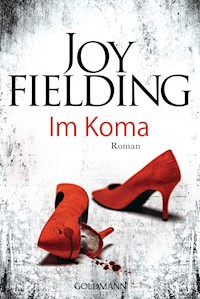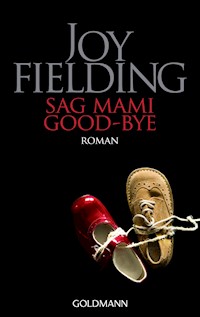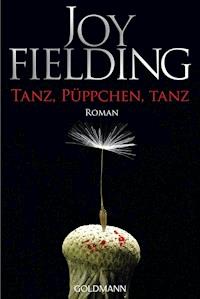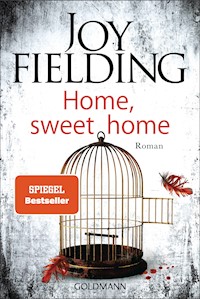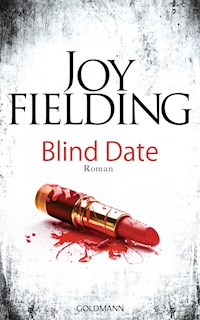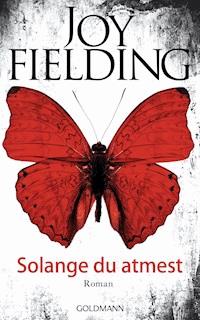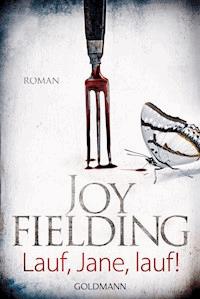9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein ermordetes Mädchen. Eine Hütte im Wald. Eine Stadt in Angst.
Als die Lehrerin Sandy Crosbie gemeinsam mit ihrem Mann Ian und ihren Kindern nach Torrance in South Florida zieht, kann sie nicht ahnen, welch verhängnisvolle Ereignisse ihr bevorstehen. Denn kurz nach ihrer Ankunft verschwindet an der örtlichen High School ein Mädchen spurlos – und wird nach Tagen verzweifelter Suche tot aufgefunden. Doch während die Polizei sich noch bemüht, eine erste Spur ausfindig zu machen, hat der Täter sein nächstes Opfer bereits im Visier – und er ist entschlossen, sein grausames Werk so lange zu verrichten, bis sein Blutdurst gestillt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joy Fielding
Nur der Tod kann dich retten
Roman
Deutsch von Kristian Lutze
Buch
Eigentlich ist Torrance in South Florida mit seinen gerade einmal viertausend Einwohnern eine sympathische Kleinstadt. Nichts stört hier den ruhigen Gang der Dinge, und niemand käme auf die Idee, von seinem Nächsten etwas Böses zu vermuten. Der Schock ist umso größer, als an der örtlichen High School eines Tages ein Mädchen verschwindet – und man die Leiche der bildhübschen Liana Martin nach Tagen banger Suche in einer entlegenen Gegend auffindet. Vor allem Sandy Crosbie, die erst seit kurzer Zeit als Lehrerin an der Schule arbeitet, ist entsetzt: Muss sie befürchten, dass auch ihre eigene heranwachsende Tochter Megan in Gefahr ist? Sheriff John Weber übernimmt die Ermittlungen, aber trotz intensiver Bemühungen tappt die Polizei im Dunklen. Noch ahnt Weber nicht, dass sich seine schrecklichste Vermutung bald bewahrheiten wird: Denn der Mord an Liana war nur der erste Streich eines psychopathischen Serienmörders, der sein nächstes Opfer bereits im Visier hat – und mit perfider Lust alle Vorbereitungen trifft, aus dem Hinterhalt erneut zuzuschlagen …
Autorin
Joy Fielding, 1945 in Kanada geboren, gehört zu den absoluten Spitzenautorinnen Amerikas. Mit ihrem Psychothriller »Lauf, Jane, lauf!« gelang ihr 1991 der große internationale Durchbruch, seither waren alle ihre Bücher Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto / Kanada und in Palm Beach / Florida.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Heartstopper« bei Atria Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Taschenbuchausgabe August 2009 Copyright © der Originalausgabe 2007 by Joy Fielding, Inc. Copyright © der deutschsprachigen Originalausgabe 2007 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur München Umschlagmotiv: FinePic, München CN · Herstellung: Str.
eISBN 978-3-641-21631-3V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Für Shannon Micol, deren Musik mich inspiriert
Inhaltsverzeichnis
1
TOTENBUCH
Das Mädchen wacht auf.
Sie rührt sich, die mascaraverklebten Lider flattern verführerisch, bevor sie die großen blauen Augen aufschlägt, wieder schließt und erneut öffnet, länger diesmal, um beiläufig die unvertraute Umgebung zu registrieren. Dass sie an einem fremden Ort ist, ohne sich daran zu erinnern, wie sie hierhergekommen ist, wird ihr erst in einigen Sekunden dämmern. Dass ihr Leben in Gefahr ist, wird sie unvermittelt mit der Wucht einer riesigen Sturzwelle treffen und sie wieder auf die schmale Pritsche zurückwerfen, die ich vorausschauend bereitgestellt habe.
Das ist das Beste, beinahe noch besser als alles, was später kommt.
Ich war nie ein großer Fan von Blut und Eingeweiden. Diese neuen Fernsehserien, die jetzt so beliebt sind, mit Top-Pathologen in hautengen Hosen und Push-up-BHs, lassen mich mehr oder weniger kalt. All die Leichen bringen es einfach nicht – all die Pechvögel, die mit einer exotischen Vielfalt immer blutrünstigerer Methoden ins Jenseits befördert worden sind und die nun in ultramodernen Pathologiesälen auf kalten Stahlplatten liegen, um von behandschuhten Fingern leidenschaftslos geöffnet und begrapscht zu werden. Selbst wenn die Leichen nicht so offensichtlich künstlich wären, würden sie mich nicht anmachen – wobei die künstlichsten Gummileiber immer noch echter aussehen als die allgegenwärtigen Brustimplantate, die von den tapferen Push-up-BHs im Zaum gehalten werden. Gewalt an sich war nie mein Ding. Ich fand den Spannungsaufbau vor der Tat immer interessanter als die Tat selbst.
Genauso wie mir die nie ganz perfekte, natürliche Form echter Brüste immer lieber war als die künstlich aufgeblasenen – und absolut schrecklichen – Ungetüme, die heutzutage allseits so beliebt sind. Und das nicht nur im Fernsehen. Man sieht sie überall. Selbst hier an der Alligator Alley, mitten in Florida.
Am Arsch der Welt.
Ich glaube, es war Alfred Hitchcock, der den Unterschied zwischen Schock und Thrill definiert hat. Ein Schock war seiner Ansicht nach eine stoßartige Attacke auf alle Sinne, die kaum eine Sekunde dauert, während Thrill eher ein langsames Reizen ist. Ungefähr so wie der Unterschied zwischen einem ausgedehnten Vorspiel und einem verfrühten Samenerguss, möchte ich hinzufügen und stelle mir vor, dass der alte Alfred schmunzelnd zustimmen würde. Er hat den Thrill dem Schock immer vorgezogen, weil es aufregender und letztendlich befriedigender war. Da bin ich ganz seiner Meinung, obwohl ich wie Hitch auch einem gelegentlichen Schock nicht abgeneigt bin. Es soll schließlich spannend bleiben.
Wie dieses Mädchen bald herausfinden wird.
Sie sitzt jetzt aufrecht auf ihrer Pritsche, die Hände ängstlich zu Fäusten geballt, während sie ihre schwach beleuchtete Umgebung mustert. Der verwirrte Ausdruck in ihrem hübschen Gesicht – zum Sterben schön, wie mein Großvater immer sagte – verrät mir, dass sie sich anstrengt, ruhig zu bleiben, nachzudenken und zu begreifen, was geschehen ist, während sie sich weiter an die Hoffnung klammert, dass das Ganze vielleicht doch nur ein böser Traum ist. Denn eigentlich kann das alles doch nicht wahr sein. Sie kann nicht tatsächlich auf der Kante einer winzigen Pritsche in einem Raum sitzen, der aussieht wie ein Keller, wenn Häuser in Florida denn Keller hätten, was jedoch in der Regel nicht der Fall ist, weil der Staat Florida fast ausschließlich auf Sumpfland gebaut ist.
Gleich wird die Panik einsetzen. Sobald ihr klar wird, dass sie nicht träumt, dass ihre Lage vielmehr real und ziemlich verzweifelt ist, dass sie in einem verschlossenen Raum eingesperrt ist, dessen einzige Lichtquelle eine Lampe auf einem Sims weit jenseits ihrer Reichweite ist, selbst wenn es ihr gelänge, die Pritsche aufzurichten und hochzuklettern. Das hatte das letzte Mädchen versucht und war dabei auf den Lehmboden gestürzt. Dort saß sie, hielt ihr gebrochenes Handgelenk und weinte. Und dann fing sie an zu schreien.
Das war ganz spaßig – eine Zeit lang.
Gerade hat sie die Tür entdeckt, aber im Gegensatz zu dem letzten Mädchen geht sie nicht direkt darauf zu. Stattdessen sitzt sie einfach da, beißt sich auf die Unterlippe und blickt sich ängstlich um. Sie atmet laut und sichtbar, ihr pochendes Herz droht ihre Brust zu sprengen, ihre großen hängenden Brüste – die wenigstens echt sind – beben wie die einer hyperventilierenden Kandidatin bei Der Preis ist heiß. Soll sie sich für Tür Nummer eins, zwei oder drei entscheiden? Nur dass es hier bloß eine Tür gibt, und wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Die Dame oder der Tiger? Rettung oder Vernichtung? Meine Lippen kräuseln sich zu einem Lächeln. Sie wird gar nichts finden. Zumindest noch nicht. Nicht, bevor ich so weit bin.
Sie hat sich von der Pritsche erhoben, ihre Neugier treibt sie an, die Füße voreinander zu setzen und zur Tür zu gehen, selbst wenn eine bohrende Stimme ihr warnend ins Ohr wispert, dass Neugier der Katze Tod ist. Verlässt sie sich auf das alte Ammenmärchen, dass eine Katze neun Leben hat? Glaubt sie, ein paar nutzlose alte Weiberweisheiten könnten sie retten?
Mit zitternder Hand greift sie nach dem Türknauf. »Hallo?«, ruft sie, leise zunächst, die Stimme ebenso zittrig wie ihre Finger. »Hallo?«, wiederholt sie kräftiger. »Ist da jemand?«
Ich bin versucht, ihr zu antworten, aber ich weiß, dass das keine gute Idee ist. Zunächst einmal würde es ihr verraten, dass ich sie beobachte. Im Augenblick ist ihr der Gedanke, dass sie observiert werden könnte, noch nicht gekommen, und wenn das geschieht, vielleicht in ein oder zwei Minuten, wird sie panisch die Augen aufreißen und den Raum absuchen. Vergeblich. Sie kann mich nicht sehen. Das Guckloch, das ich in die Wand gebohrt habe, ist zu klein und viel zu weit oben, als dass sie es entdecken könnte, vor allem in dem schwachen Licht. Außerdem würde der Klang meiner Stimme ihr nicht nur eine Ahnung von meiner Anwesenheit und meinem Aufenthaltsort geben, er könnte ihr auch helfen, mich zu identifizieren, was ihr einen unnötigen Vorsprung in der anstehenden Psycho-Schlacht verschaffen würde. Nein, ich werde mich schon früh genug zu erkennen geben. Es hat keinen Sinn, dem Spiel vorauszueilen. Das Timing wäre einfach nicht richtig. Und Timing ist, wie man so sagt, alles.
»Hallo? Irgendjemand da?«
Ihre Stimme klingt jetzt drängender, verliert ihr mädchenhaftes Timbre und wird schrill, beinahe feindselig. Das ist eines der interessanten Phänomene, die ich über weibliche Stimmen herausgefunden habe – wie schnell sie von herzlich in herrisch umschlagen, von tröstend in enervierend, wie schamlos sie alles enthüllen wollen, wie kühn sie ihre angstvollen Worte in die ahnungslose Luft schleudern. Die sanfte Flöte wird von einem wilden Dudelsack übertönt, das Kammerorchester von einer Marschkapelle niedergetrampelt.
»Hallo?« Das Mädchen packt den Türknauf und versucht, die Tür in ihre Richtung aufzuziehen. Aber die Tür gibt nicht nach. Schnell verkommen ihre Bewegungen zu einer Folge unbeholfener Posen, die immer unüberlegter und hektischer werden. Sie zieht an der Tür, drückt und rammt ihre Schulter dagegen, was sie mehrmals wiederholt, bevor sie aufgibt und in Tränen ausbricht. Das ist das Andere, was ich an Frauen beobachtet habe – sie heulen ständig. Es ist der einzige Punkt, an dem sie einen nie enttäuschen, das Einzige, worauf man sich verlassen kann.
»Wo bin ich? Was geht hier vor?« Zunehmend frustriert hämmert das Mädchen mit den Fäusten gegen die Tür. Sie ist jetzt nicht mehr nur verängstigt, sondern auch wütend. Sie weiß vielleicht nicht, wo sie ist, aber sie weiß, dass sie nicht freiwillig hierhergekommen ist. In ihrem Kopf beginnt es von immer grausameren Bildern zu wimmeln – Zeitungsschlagzeilen aus jüngerer Zeit über vermisste Mädchen, Fernsehberichte über Leichen, die man notdürftig in der Erde verscharrt gefunden hatte, Bilder von Messern und anderen Folterinstrumenten aus Versandhauskatalogen, Filmausschnitte von hilflosen Frauen, die vergewaltigt und erwürgt werden, bevor man ihre Leichen in schleimbedeckten Sümpfen versenkt. »Hilfe!«, fängt sie an zu schreien. »Bitte helft mir!« Aber auch ihre Klagerufe treffen nur auf die abgestandene Luft, und ich nehme an, dass sie weiß, dass sie völlig nutzlos sind, weil kein Mensch sie hören kann.
Kein Mensch außer mir.
Ihr Kopf schnellt hoch, ihre Augen richten sich wie Suchscheinwerfer auf mich, sodass ich von der Wand zurückzucke und im Rückwärtstaumeln beinahe über meine eigenen Füße stolpere. Als ich mich wieder gesammelt habe und zu Atem gekommen bin, geht sie in dem kleinen Raum im Kreis und blickt sich hektisch in alle Richtungen um, während sie mit flachen Händen die blanken Betonmauern nach einer weichen Stelle abtastet. »Wo bin ich? Ist da draußen jemand? Warum hat man mich hierhergebracht?«, ruft sie, als ob sie auf die richtige Frage eine beruhigende Antwort bekommen würde. Schließlich gibt sie auf, sinkt auf der Pritsche in sich zusammen und weint noch eine Runde. Als sie den Kopf wieder hebt und mich zum zweiten Mal direkt ansieht, sind ihre großen blauen Augen tränenverquollen und unvorteilhaft rot gerändert. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, und mein Wunsch ist Vater des Gedanken.
Sie richtet sich wieder auf und atmet mehrmals tief durch. Sie versucht offenkundig, sich zu beruhigen, während sie ihre Lage analysiert. Sie betrachtet ihre Kleidung – ein blassgelbes T-Shirt mit dem knallgrünen Schriftzug MOVE, BITCH auf der Brust, tief und eng auf ihren schmalen Hüften sitzende Jeans. Dieselbe Garderobe, die sie … wann noch gleich getragen hat? Gestern tagsüber? Gestern Abend? Heute Morgen?
Wie lange ist sie schon hier?
Sie streicht sich durch ihr langes, rotblondes Haar und kratzt sich am rechten Knöchel, bevor sie sich an die Wand lehnt. Irgendein Verrückter hat sie entführt und hält sie als Geisel, denkt sie und überlegt vielleicht schon, wie sie diese Geschichte nach ihrer Flucht möglichst effektvoll erzählen kann. Vielleicht meldet sich das People-Magazin. Vielleicht sogar Hollywood. Wer wird ihren Part spielen? Das Mädchen aus Spider-Man oder vielleicht doch besser die andere, die dieser Tage ständig auf den Titelseiten der Boulevardpresse zu sehen ist. Lindsay Lohan? Heißt sie so? Oder war es Tara Reid? Cameron Diaz wäre gut, obwohl Cameron mehr als zehn Jahre älter ist als sie. Es ist im Grunde egal. Sie sind alle mehr oder weniger austauschbar. Alle zum Sterben schön.
Und da komme ich ins Spiel. Dabei kann ich helfen.
Die Miene des Mädchens verdüstert sich. Ein weiteres Mal dringt die Realität in ihre Gedanken ein. Was mache ich hier, fragt sie sich. Wie bin ich hierhergekommen? Warum kann ich mich nicht daran erinnern?
Vermutlich kann sie sich daran erinnern, in der Schule gewesen zu sein, obwohl ich bezweifle, dass ihr viel von dem Unterrichtsstoff im Gedächtnis geblieben ist, wenn überhaupt etwas. Sie war mit anderen Dingen beschäftigt- starrte aus dem Fenster, flirtete mit den Neandertalern in der letzten Reihe und machte den Lehrern das Leben schwer. Immer hatte sie einen schlauen Spruch drauf, eine sarkastische Bemerkung parat oder eine ungefragte Meinung beizusteuern. An die Schulglocke zum Ende des Unterrichts, die sie aus dem Gefängnis ihrer zwölften Klasse befreit hat, wird sie sich garantiert erinnern, wahrscheinlich auch noch daran, auf den Schulhof gerannt und von irgendwem in der Nähe eine Zigarette geschnorrt zu haben. Vielleicht weiß sie noch, wie sie einer Klassenkameradin eine Dose Cola aus der Hand gerissen und sie ohne ein Dankeschön oder eine Entschuldigung heruntergestürzt hatte. Vielleicht erinnert sie sich sogar daran, sich auf den Heimweg gemacht zu haben – etliche Zigaretten und schnippische Kommentare später. Ich beobachte sie, während sie ihren eigenen Weg zurückverfolgt, bis zu der Ecke der ruhigen Nebenstraße, in der sie wohnt. Ich sehe, wie sie den Kopf hebt, als sie hört wie der Wind leise ihren Namen flüstert.
Irgendjemand ruft sie.
Das Mädchen beugt sich auf der Pritsche vor und öffnet den Mund. Die Erinnerung ist da, sie muss nur darauf zugreifen. Ihre Sinne spielen verrückt, die Erinnerung foppt sie wie die unterste Zeile einer augenärztlichen Tafel, in der die Buchstaben einem direkt vor Augen stehen, jedoch, egal wie sehr man sich anstrengt, verschwommen bleiben, sodass man sie nicht erkennen kann. Die Erinnerung liegt ihr auf der Zungenspitze wie ein exotisches Gewürz, das sie schmecken, aber nicht benennen kann. Sie weht ihr mit einem schwachen Hauch quälender Düfte um die Nase und schwappt durch ihren Mund wie ein Schluck teurer Rotwein. Wenn sie sie nur greifen und in Worte fassen könnte.
Sie erinnert sich daran, sich umgedreht und gelauscht zu haben, ob sie im warmen Wind ein weiteres Mal ihren Namen hörte, bevor sie auf eine Reihe überwucherter Büsche in einem ungepflegten Vorgarten in der Nachbarschaft zugegangen ist. Die Büsche locken sie, die Blätter rascheln, als wollten sie sie willkommen heißen.
Und dann nichts mehr.
Resigniert lässt das Mädchen die Schultern sinken. Sie hat keine Erinnerung daran, was als Nächstes geschehen ist. Die Büsche versperren ihr die Sicht, verwehren ihr den Eintritt. Sie muss das Bewusstsein verloren haben. Vielleicht wurde sie betäubt, vielleicht hat sie einen Schlag auf den Kopf bekommen. Welchen Unterschied macht das? Entscheidend ist nicht, was vorher geschehen ist, sondern was als Nächstes geschieht. Ich spüre, wie sie zu dem Schluss kommt, dass es unwichtig ist, wie sie hierhergekommen ist. Wichtig ist, wie sie wieder herauskommt.
Ich unterdrücke ein Lachen. Soll sie sich an die Illusion klammern, sie hätte eine Chance zu fliehen, so brüchig und unbegründet sie auch sein mag. Soll sie tapfer Pläne schmieden. Das ist schließlich auch Teil des Spaßes.
Ich kriege Hunger. Sie wahrscheinlich auch, obwohl sie im Augenblick noch zu viel Angst hat, um es zu merken. In ein oder zwei Stunden wird es sie treffen. Der menschliche Appetit ist wirklich erstaunlich. Er ist ungeachtet der Umstände ziemlich hartnäckig. Ich kann mich noch an den Tod meines Onkels Al erinnern. Es ist schon lange her, und meine Erinnerung ist wie die des Mädchens ein wenig verschwommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal mehr genau, woran er gestorben ist. An Krebs oder einem Herzinfarkt. Ein ziemlich gewöhnlicher Tod, was immer es war. Wir standen uns nie besonders nahe, sodass ich nicht behaupten kann, schwer erschüttert gewesen zu sein. Aber ich erinnere mich, dass meine Tante geweint und geklagt hat, während ihre Freundinnen ihr Beileid und Trost bekundeten und erklärten, was für ein großartiger Mann mein Onkel gewesen sei, dessen Tod sie zutiefst bedauerten, um im nächsten Atemzug den wundervollen Kuchen zu loben, den meine Tante gebacken hatte. »Können wir das Rezept haben?«, fragten sie und ermahnten sie: »Du musst etwas essen. Es ist wichtig, bei Kräften zu bleiben. Al hätte das auch gewollt.« Und schon bald aß sie und lachte wenig später auch wieder. So viel zur Macht von Gebäck.
Ich habe keinen Kuchen für das Mädchen, obwohl ich ihr in ein paar Stunden vielleicht ein Sandwich mitbringe, nachdem ich selber gegessen habe. Ich weiß es noch nicht. Ein guter Gastgeber würde für seine Gäste sorgen. Andererseits hat niemand gesagt, dass ich ein guter Gastgeber bin. Keine fünf Sterne für mich.
Trotzdem ist die Unterkunft alles in allem nicht übel. Ich habe das Mädchen nicht in einem Sarg unter der Erde vergraben oder es in ein von Schlangen und Ratten verpestetes Dreckloch geworfen. Sie ist nicht in irgendeinen Schrank gesperrt ohne Luft zum Atmen oder über einem Nest von Feuerameisen angekettet. Ihre Arme sind nicht hinter dem Rücken gefesselt, sie ist nicht geknebelt und kann sich frei im Raum bewegen. Wenn es ein bisschen wärmer ist, als ihr behagt, kann sie sich damit trösten, dass wir April und nicht Juli haben, es für die Jahreszeit eher ein wenig zu kühl und außerdem Abend und nicht heller Nachmittag ist. Hätte ich die Wahl, auch ich würde für eine Klimaanlage plädieren wie jeder halbwegs vernünftige Mensch, aber man muss nehmen, was man kriegen kann, und in diesem Fall war das ein verfallenes altes Haus am Rand eines seit langem brachliegenden Feldes an der Alligator Alley, mitten in Florida.
Am Arsch der Welt.
Manchmal kann es auch ein verkannter Segen sein, am Arsch der Welt festzusitzen, obwohl ich mindestens zwei Mädchen kenne, die widersprechen würden.
Entdeckt habe ich das Haus vor fünf Jahren. Die Leute, die es gebaut haben, wohnten schon seit langem nicht mehr dort, und es war mehr oder weniger den Termiten und dem Verfall preisgegeben. Soweit ich weiß, hat nie jemand Anspruch auf das Grundstück erhoben oder vorgehabt, die Bruchbude abzureißen. Schließlich kostet es Geld, etwas abzureißen, und noch mehr Geld, etwas Neues an seiner Stelle zu errichten, und ich bezweifle ernsthaft, dass hier irgendetwas wächst, was den Anbau lohnt. Wozu also? Wie dem auch sei, ich bin eher zufällig darauf gestoßen, als ich eines Morgens herumgelaufen bin, um einen klaren Kopf zu kriegen. Ich hatte zu Hause ein paar Probleme und das Gefühl, alles würde gleichzeitig auf mich einstürzen, deshalb hatte ich beschlossen, dass es das Beste wäre, mich für eine Weile einfach ganz aus der Schusslinie zu nehmen. So war ich schon immer – eher ein Einzelgänger. Auseinandersetzungen sind mir unangenehm, und ich mag es auch nicht besonders, über meine Gefühle zu reden. Nicht, dass sich irgendjemand je besonders für meine Gefühle interessiert hätte.
Aber das ist der sprichwörtliche Schnee von gestern. Zwecklos, sich damit aufzuhalten und in der Vergangenheit zu leben. Lebe für den Tag – das ist mein Motto. Oder sterbe dafür. Je nachdem.
Sterben für heute.
Das klingt gut.
Okay, das ist jetzt also fünf Jahre her, und ich laufe draußen herum. Es ist heiß, Sommer, glaube ich, also sehr schwül. Die Mücken summen um meinen Kopf und fangen an, mir auf die Nerven zu gehen, als ich auf dieses alte hässliche Feld stoße. Eigentlich mehr ein Sumpf. In dem hohen Gras verbergen sich wahrscheinlich zahlreiche Schlangen und Alligatoren, aber vor Reptilien habe ich mich nie gefürchtet. Eigentlich finde ich sie sogar ziemlich toll, und ich habe festgestellt, dass sie einen für gewöhnlich in Ruhe lassen, wenn man sie auch in Ruhe lässt. Trotzdem bin ich vorsichtig, wenn ich herkomme. Ich habe einen Pfad platt getrampelt, an den ich mich zu halten versuche, vor allem im Dunkeln. Natürlich habe ich immer meine Pistole und ein paar scharfe Messer dabei für den Fall, dass etwas Unerwartetes passiert.
Man sollte immer gegen das Unerwartete gewappnet sein.
Das hätte auch irgendjemand diesem Mädchen erklären sollen.
Der Hauptteil des Hauses macht nicht viel her – ein paar kleine Zimmer, leer natürlich. Ich musste die Pritsche selbst herschaffen, was ziemlich kompliziert war, aber ich will jetzt nicht in die Details gehen. Am Ende habe ich es jedenfalls ganz alleine geschafft, so wie immer. Es gibt eine winzige Küche ohne Geräte oder fließendes Wasser. Gleiches gilt für das Bad mit seiner verdreckten Toilette, deren vormals weißer Sitz in der Mitte zerbrochen ist. Sitzen will man darauf jedenfalls bestimmt nicht.
Dem Mädchen habe ich aufmerksamerweise einen Plastikeimer hingestellt, falls sie sich erleichtern muss. Er steht in der Ecke links neben der Tür. Sie hat vorhin dagegengetreten, als sie wütend um sich geschlagen hat, sodass er jetzt auf der anderen Seite des Raumes liegt. Vielleicht hat sie noch nicht begriffen, wozu er da ist.
Das erste Mädchen hat ihn komplett ignoriert. Sie hat einfach den Rock gehoben und sich gleich auf den Boden gehockt. Nicht, dass sie den Rock weit hätte heben müssen. Er war so lächerlich kurz, dass er als Gürtel durchgegangen wäre, was vermutlich genau die Sorte Nutten-Look war, die sie beabsichtigt hatte. Und natürlich trug sie kein Höschen, was ziemlich widerlich war. Manche sagen jetzt vielleicht, sie war nicht besser als ein Tier, aber ich nicht. Das würde ich nie sagen. Warum nicht? Weil es mangelnden Respekt gegenüber Tieren ausdrücken würde. Zu behaupten, das Mädchen war ein Schwein, wäre eine Beleidigung für Schweine. Natürlich habe ich sie deshalb ausgewählt. Ich wusste, dass keiner um sie trauern würde. Ich wusste, dass niemand sie suchen würde.
Sie war erst achtzehn, hatte aber bereits diesen wissenden Blick, der sie viel älter wirken ließ. Ihre Lippen waren zu einem zynischen Schmollen erstarrt, eher ein Grinsen als ein Lächeln, selbst wenn sie lachte, und die Venen auf der Innenseite ihrer dürren Arme waren mit alten Einstichen übersät. Die Frisur war ein krauser Abklatsch von blonden Locken mit schwarzen Haarwurzeln, und wenn sie den Mund aufmachte, um etwas zu sagen, konnte man die Zigaretten in ihrem Atem förmlich schmecken.
Sie hieß Candy – sie trug sogar ein Armkettchen mit Bonbon-Anhängern –, und man könnte wohl sagen, dass sie mein Pilotprojekt war. Ich mache nicht gern halbe Sachen, es muss schon perfekt sein, deshalb war mir klar, dass ich alles sorgfältig planen musste. Im Gegensatz zu vielen Tätern, über die man in der Zeitung liest, habe ich nämlich keine Lust, geschnappt zu werden. Wenn dieses Projekt erledigt ist, plane ich, mich zur Ruhe zu setzen und wenn schon nicht immer glücklich so doch friedlich bis ans Ende meiner Tage zu leben. Daher ist es wichtig, dass ich alles richtig mache.
Deshalb Candy.
Ich habe sie in einem Burger King kennen gelernt. Sie hing vor dem Eingang herum und ließ sich von mir bereitwillig zu einem Hamburger einladen. Wir haben geredet, obwohl sie nicht viel zu sagen hatte und komplett dichtgemacht hat, als meine Fragen zu persönlich wurden. Das ist okay. Ich verstehe das. Ich bin selbst auch kein großer Fan von persönlichen Fragen.
Aber ein paar Dinge fand ich trotzdem heraus: Sie war mit vierzehn von zu Hause weggelaufen und lebte seitdem auf der Straße. Sie hatte einen Typen kennen gelernt, der sie auf Drogen gebracht hatte, wodurch sie wiederum auf dem Strich gelandet war. Nach einer Weile hatte er sich verpisst, und sie war wieder allein. Im vergangenen Jahr war sie von einer Stadt zur nächsten gezogen und war hin und wieder in einem fremden Krankenhauszimmer oder einer Arrestzelle aufgewacht. Eins sah aus wie das andere, meinte sie.
Ich frage mich, ob sie das auch gedacht hat, als sie in dem unterirdischen Zimmer dieses alten verlassenen Hauses aufgewacht ist.
Habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Raum unter der Erde liegt? Wie konnte ich … – es ist das, was dieses Haus so speziell macht, gewissermaßen sein Prunkstück.
Wie bereits gesagt haben die meisten Häuser in Florida keinen Keller. Das liegt daran, dass sie im Grunde auf Treibsand gebaut sind. Es kann sehr wohl passieren, dass man eines Morgens aufwacht und unversehens bis zu den Augen in Schlick steckt. Komplette Häuser sind schon verschluckt worden, und nicht nur ältere, weniger stabile. Ganz in der Nähe wurde eine neue Siedlung hochgezogen, die fast vollständig auf einer zugeschütteten Müllkippe errichtet wurde, was meiner bescheidenen und ungefragten Meinung nach eine unkluge Entscheidung war. Eines Tages war eines der Häuser einfach verschwunden. Die Bauunternehmer mussten natürlich nicht lange danach suchen. Sie standen darauf. Geschieht ihnen recht. Die Natur lässt sich eben nur begrenzt herausfordern.
Wenn ich vorhätte, ein Haus zu bauen, würde ich den Architekten nehmen, der dieses geplant hat. Zugegeben, das Haus hat bessere Tage gesehen, aber wer immer es entworfen hat, war ein Genie. Unter dem Hauptgeschoss hat er ein ganzes Labyrinth kleiner Räume angelegt, vermutlich zu Lagerzwecken.
Mir schwebt allerdings etwas ganz anderes vor.
Candy war ziemlich unbeeindruckt, nachdem sie festgestellt hatte, dass es sich nicht um die Art Arrestzelle handelte, die sie gewöhnt war. Nachdem ich mich schließlich blicken ließ und ihr der Ernst ihrer Lage bewusst wurde, probierte sie alle Tricks, die sie in petto hatte. Sie sagte, wenn es um Sex ginge, würde sie keinesfalls irgendwas auf dieser dreckigen alten Pritsche machen. Sie würde all meine perversen Gelüste befriedigen, aber nicht hier. Die Vorstellung, mit dieser Person Sex zu haben, war so widerwärtig, dass ich versucht war, sie auf der Stelle umzubringen, aber das Spiel war noch lange nicht vorbei.
Am Ende habe ich sie mit einem einzigen Schuss in den Kopf erledigt. Anschließend habe ich ihre Leiche in einem ein paar Meilen entfernten Sumpf versenkt. Wenn irgendjemand sie findet – was ich bezweifle –, wird nichts mehr auf meine Person hinweisen. Man wird den genauen Todeszeitpunkt nicht mehr bestimmen, nicht mehr feststellen können, wann genau ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Und selbst wenn man sie sofort und intakt gefunden hätte, wusste ich dank all der gelifteten Pathologinnen aus dem Fernsehen genug über DNA und dergleichen, um garantiert keine Spuren zu hinterlassen.
So wie Candy keine Trauernden hinterlassen hatte.
Aber das wird bei diesem Mädchen – zum Sterben schön mit ihren riesigen blauen Augen und den großen natürlichen Brüsten – anders sein.
Nicht nur, dass mehr Menschen nach ihr suchen werden – oder vielleicht schon in diesem Moment nach ihr suchen –, sie stellt ganz allgemein eine größere Herausforderung dar. Candy war ein bisschen zu beschränkt, um wirklich Spaß mit ihr zu haben. Dieses Mädchen ist stärker, sowohl mental als auch körperlich, also muss ich einen Gang hochschalten, wie man so sagt – mich schneller bewegen, fixer denken und härter zuschlagen.
2
»Okay, Leute, Hefte raus!«
Sandy Crosbie lehnte sich an ihr Pult im Klassenraum der 12. Klasse und beobachtete, wie ihre dreiundzwanzig Schüler – es hätten fünfundzwanzig sein sollen, aber sowohl Peter Arlington als auch Liana Martin fehlten – widerwillig ihre Hefte zwischen den Schulbüchern hervorzogen und sie in unterschiedlichem Maße gelangweilt oder entsetzt auf die Tische knallten. Desinteressierte, glasige Blicke wandten sich langsam wieder in ihre Richtung. Teilnahmslos lungerten träge Leiber auf ihren Stühlen, die langen Beine in Jeans faul von sich gestreckt. Bleistiftspitzen tippten abwesend die sich überlappenden Rhythmen nicht zu erkennender Melodien mit. Offensichtlich wünschten sich alle einschließlich Sandy Crosbie, irgendwo anders zu sein.
Und warum auch nicht? Welcher halbwegs normale Mensch wollte in einem stickigen Container hocken, wenn man stattdessen draußen in der Sonne herumtollen könnte? (Würde irgendeiner ihrer Schüler überhaupt wissen, was »herumtollen« bedeutete? Und fehlten die beiden angeblich verliebten Peter Arlington und Liana Martin vielleicht, um genau das zu tun?) Sandy ließ den Blick über die fünf Reihen widerwilliger Schüler hinweg zu der breiten Fensterfront des Containers schweifen. Es war ein wunderschöner Apriltag, wenngleich viel kühler als in dieser Jahreszeit üblich. Zumindest erklärten ihr das alle ständig. »Da hätten Sie im letzten April hier sein müssen«, sagten sie immer wieder. »Im Moment ist es zehn Grad kälter als sonst.« Aber Sandy hatte nichts gegen die kühlen Temperaturen, sie waren ihr eigentlich sogar lieber. Die Kühle erinnerte sie an Rochester im Staat New York, wo sie geboren und aufgewachsen war. Jeder – vor allem Ian – hatte ständig über den brutalen Winter geklagt, aber Sandy war eines der raren Geschöpfe, das den Schnee und die oft eisigen Temperaturen tatsächlich genoss. Sie mochte es, sich einzumummeln. Dann fühlte sie sich sicher.
Was zum Teufel machte sie in Torrance, wo die Durchschnittstemperatur feuchtheiße 29,5 Grad betrug?
Der Umzug im vergangenen Sommer war Ians Idee gewesen. Zwei Jahre lang hatte er dafür geworben, aus der Großstadt im Norden in die Kleinstadt im Süden zu ziehen. »Es ist bestimmt gut für meine Praxis, für unsere Kinder und für unsere Ehe«, hatte er versprochen, gebettelt und zuletzt gedrängelt. »Ich habe mich erkundigt, du findest problemlos eine Anstellung als Lehrerin. Los, komm. Wo bleibt deine Abenteuerlust? Wir können es doch wenigstens probieren. Maximal zwei Jahre. Ich schwöre, wenn du nicht glücklich bist, bleiben wir nicht.«
Das hatte er zumindest gesagt. Was er meinte, war: Ich habe mich Hals über Kopf in eine Frau verliebt, die ich in einem Internet-Chat kennen gelernt habe, deshalb bin ich wild entschlossen, meine Praxis zu verkaufen, dich und die Kinder zu entwurzeln und nach Florida in diese kleine Stadt zu ziehen, um die Affäre persönlich fortzusetzen. Wenn es nicht klappt, können wir wieder gehen.
Und er war gegangen. Auf den Tag genau vor sieben Wochen, wie Sandy stumm nachrechnete, während sie den Blick auf das Plakat einer Alphabetisierungskampagne an der Rückwand des Klassenzimmers richtete, um nicht in Tränen auszubrechen. Auch wenn sie bezweifelte, dass dies seine erste Affäre war –Verdacht hatte sie im Laufe der Jahre mehrfach geschöpft –, kam die Nachricht, dass er sie verlassen wollte, trotzdem völlig überraschend. Sie hatte sogar vermutet, dass er so dringend aus Rochester fortwollte, um einer schal gewordenen Romanze zu entkommen. Der Gedanke, dass er sich hier in eine neue stürzen wollte, war ihr indes nie gekommen.
Deshalb hatte sie schockiert und schweigend zugesehen, wie er seinen alten Koffer und die neue Arzttasche gepackt hatte, die sie ihm zur Eröffnung seiner hiesigen Praxis geschenkt hatte, und in ein geräumiges Ein-Zimmer-Apartment auf der anderen Seite der Stadt gezogen war. Zufälligerweise lag es gleich um die Ecke von Kerri Franklin – ihres Zeichens Barbie-Klon und Internet-Geliebte par excellence. Das Einzige, was ihn davon abgehalten hatte, direkt bei der geschiedenen Blondine mit den üppigen Lippen und der noch üppigeren Frisur einzuziehen, war die Tatsache, dass ihre Mutter ihm zuvorgekommen war und es sich nach dem Scheitern von Kerris dritter Ehe bei ihrer Tochter bequem gemacht hatte, ohne die geringste Neigung zu zeigen, wieder auszuziehen. Da der hiesige Klatsch wissen wollte, dass die jüngste – und, wie einige meinten, höchst besorgniserregende – Vergrößerung von Kerris Busen mit Rose Cruikshanks Geld bezahlt worden war, zögerte Kerri natürlich, ihre Mutter an die frische Luft zu setzen. Zumal es in diesem Jahr zehn Grad frischer war als sonst im April.
Außerdem war da noch Kerris Tochter Delilah. Sandy warf einen Blick zu dem ersten Platz in der dritten Reihe, wo das Mädchen mit dem unglücklich gewählten Namen nervös an seinem schwarzen Kugelschreiber kaute und zu Boden starrte, offensichtlich in der Hoffnung, nicht aufgerufen zu werden.
Weil Torrance nur knapp viertausend Einwohner hatte – laut einem Schild am Ortseingang lag die offizielle Zahl bei 4160 –, gab es auch nur eine Highschool in der Stadt. Die meisten Leute lebten weiter draußen – in den »Vororten«, wie es die Einheimischen nannten, wenngleich Sandy die Bezeichnung »Sümpfe« weitaus zutreffender fand. Die Torrance High hatte fast vierhundert Schüler, und die Fluktuation innerhalb des Lehrkörpers war beinahe so hoch wie die tägliche Fehlquote der Schüler, weshalb Sandy auch keine Schwierigkeiten gehabt hatte, eine Anstellung zu finden. Die Schule selbst bestand aus einem weiträumigen eingeschossigen Gebäude, das in einer nicht unhässlichen, wenngleich fantasielosen Mischung aus modernen und traditionellen Elementen aus Holz und Stein errichtet worden war. Ausgelegt war es für maximal dreihundert Schüler. Da aber viel mehr Jungen und Mädchen unterrichtet werden mussten, waren unlängst vier weitere Klassenräume in Containern auf der Rückseite des Parkplatzes eingerichtet worden. Weil sie die Neue war, hatte Sandy das letzte dieser Mini-Gefängnisse zugeteilt bekommen, um dort die Söhne und Töchter der rechtschaffenen Bürger von Torrance in Englischer Literatur und schriftlichem Ausdruck zu unterrichten. Darunter auch Kerri Franklins Tochter Delilah.
Der Name Delilah war insofern unglücklich gewählt, als Kerri Franklins achtzehnjährige Tochter im Gegensatz zu der berüchtigten biblischen Sirene zwar durchaus hübsch, aber auch recht stämmig war. In nachsichtigeren Momenten dachte Sandy, dass Delilah vermutlich ihrem Vater ähnelte, Kerris erstem Mann, der aus dem Leben seiner Tochter verschwunden war, als das Kind zwei Jahre alt war. Wenn sie sich weniger großmütig fühlte, vermutete sie, dass Delilah ihrer Mutter bestimmt bis aufs Haar geähnelt hatte, bevor diese sich mit Hilfe der kosmetischen Chirurgie in eine Kleinstadt-Version von Pamela Anderson verwandelt hatte. Wenn Sandy richtig schlecht gelaunt war, stellte sie sich gern vor, wie Kerri Franklins zahlreiche plastische Verschönerungen gleichzeitig in sich zusammensackten – die winzige Knopfnase fiel ihr einfach aus dem Gesicht, Wangen- und Brustimplantate leckten, bevor sie implodierten, die vollen Lippen fielen in sich zusammen, die faltenfreie Stirn verschrumpelte, und die Unmengen von Botox in ihrem Körper setzten ihre bösartigen Gifte frei, sodass Kerris Haut sich verfärbte, abblätterte und schuppig wurde.
Sandy seufzte lauter als beabsichtigt. Ihr verirrter Seufzer ließ Greg Watt aufhorchen, einen muskelbepackten Unruhestifter, den sie aus der letzten in die erste Reihe versetzt hatte, um zumindest einen Anschein von Kontrolle über die rastlose Horde zu wahren. Greg war groß und auf eine nichtssagende Art gutaussehend mit kurzen blonden Haaren und kleinen dunklen Augen. Er starrte sie an, als wollte er sich jeden Moment auf sie stürzen. Wenn er ein Tier wäre, wäre er ein Pitbull, dachte Sandy.
Und sie wäre ein kleiner Spielzeugpudel, dem er jedes Bein einzeln ausreißen würde, dachte sie weiter, strich ihr lockiges, kinnlanges, braunes Haar hinter ihr rechtes Ohr und fühlte sich verwundbar, ohne recht zu wissen, warum.
»Irgendwas nicht in Ordnung, Mrs. Crosbie?«, fragte er.
»Alles bestens, Greg«, sagte sie.
»Freut mich zu hören, Mrs. Crosbie.«
Bildete sie sich das nur ein oder hatte er das Mrs. übertrieben betont? Es war ganz bestimmt kein Geheimnis in Torrance, dass ihr Mann sie nach fast zwanzig Jahren Ehe kürzlich verlassen hatte. Genauso wenig wie die Tatsache, für wen er sie verlassen hatte. Sandy hatte vielmehr rasch erfahren müssen, dass es in einer Kleinstadt wie Torrance nur wenige Geheimnisse gibt. Und es hatte nicht viel länger gedauert, bis sie begriffen hatte, dass trotzdem jeder eins zu haben schien.
»Okay. Wer möchte seinen letzten Eintrag vorlesen?«, fragte Sandy und wappnete sich gegen das nachfolgende Schweigen. »Irgendwelche Freiwilligen?« Warum überrascht mich das bloß nicht, dachte sie, als sich keine begierige Hand reckte. Sie ließ ihren Blick über die vorderen Reihen schweifen und entschied sich für Victor Drummond auf dem vorletzten Platz in der zweiten Reihe. Der Junge war komplett schwarz gekleidet, sein gebräuntes Gesicht von einer Schicht weißem Puder bedeckt. Seine blassblauen Augen waren schwarz umrandet, sein natürlicher Schmollmund wurde von einem Marilyn-Manson-roten Lippenstift betont. »Victor«, sagte sie so aufmunternd, wie sie konnte. »Wie wär’s mit dir?«
»Sind Sie sicher, dass Sie das vertragen?«, fragte Victor grinsend. Er warf einen Blick zu der ähnlich gekleideten Diva auf dem Platz neben ihm. Das Mädchen hieß Nancy und trug drei Sicherheitsnadeln in der fein gezupften linken Augenbraue. Sie streckte die Zunge heraus.
Sandy zuckte zusammen. Sie konnte den Anblick des Metallknopfes, der aus Nancys Zunge ragte, nur mit Mühe ertragen. Es sah einfach zu schmerzhaft aus. Machte sich das Mädchen denn keine Sorgen wegen einer Entzündung? Oder ihre Eltern? Sandy unterdrückte einen weiteren Seufzer. Glücklicherweise war keines ihrer Kinder auf die Idee verfallen, sich mit Piercings oder Tattoos zu verunstalten. Zumindest bisher nicht.
»Ich riskiere es einfach mal«, erklärte sie Victor. »Du hast bestimmt einiges Interessantes zu erzählen.« Wenn er vorhatte, in der Schule Amok zu laufen, würde sie so zumindest vorher gewarnt. Sie ging um das Lehrerpult, ließ sich auf ihren Stuhl sinken und fragte sich, wann diese ganze Goth-Mode sich endlich erledigt hatte. Gab es die nicht schon ewig lange? In Rochester hatte sie auf jeden Fall mehr als genug davon gesehen, und auch wenn sie erkannte, dass diese Art, sich zu kleiden, vor allem eine Rebellion des Stils gegen den Inhalt darstellte, beunruhigte es sie trotzdem. Aber Victor war ihr ungeachtet seiner makabren Aufmachung durchaus sympathisch. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Schüler verfügte er über eine rege Einbildungskraft, und man konnte sich in der Regel darauf verlassen, dass seine häufig von bizarren und exotischen Bildern wimmelnden Aufsätze einigermaßen interessant waren, wenngleich auch nicht so provokant, wie er gern gewollt hätte.
»Soll ich aufstehen?« Victor hatte sich schon ein paar Zentimeter von seinem Stuhl erhoben.
»Nicht nötig.«
Sofort ließ er seinen knochigen Hintern wieder auf den Sitz sinken, räusperte sich und hielt kurz inne. »Es ist Vollmond«, begann er dann ausdruckslos seinen Text vorzulesen. »Ich liege in meinem Bett und lausche dem Heulen der Wölfe.«
»In Florida gibt es keine Wölfe, du Hirni«, rief Joey Balfour aus der hinteren Reihe. Joey war neunzehn, Kapitän des Football-Teams und wiederholte das letzte Schuljahr. Er war ein selbstgefälliger Angeber – groß, kräftig und hirnlos – und alles in allem auch noch stolz darauf.
Der Rest der Klasse lachte. Ein Papierflugzeug segelte durch den Raum.
»Hirni«, wiederholte Victor leise, aber verächtlich genug, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. »Das war metaphorisch gemeint.«
Joey lachte und hielt sich die Hände vors Gesicht, als wollte er sich vor etwas schützen. »Boah – ey. Das hatte ich nicht kapiert. Das war me-ta-pho-risch.«
»Das ist aber ein ziemlich großes Wort für einen Pimpf wie dich«, sagte Greg Watt mit einem gerinnenden Lächeln und einem finsteren Unterton.
»Möchte vielleicht irgendjemand erklären, was es bedeutet?«, ging Sandy dazwischen, um eine Konfrontation zu vermeiden. Sie hatte zu Beginn des Jahres eine komplette Unterrichtsstunde auf Metaphern verwendet, und es wäre schön, wenn irgendjemand tatsächlich etwas mitbekommen hätte.
Delilah hob die Hand.
Hätte man es sich nicht denken können, sinnierte Sandy. Nicht nur, dass diese übergewichtige Erinnerung an die Untreue ihres Mannes ihr jeden Morgen direkt ins Gesicht starrte, nun drängte es die junge Frau auch noch, etwas zu ihrem Unterricht beizutragen. Wusste sie nicht, dass es Sandy jedes Mal wie ein Stich ins Herz traf, wenn sie auch nur den Mund aufmachte? Womit wir wieder bei Metaphern wären, dachte sie kopfschüttelnd, wodurch sich die Strähne, die sie eben hinter ihr Ohr gestrichen hatte, wieder löste. Oder streng genommen bei einem Vergleich. »Ja, bitte, Dee«, sagte sie.
»Dee?«, wiederholte Greg ungläubig. »Dee?! Wenn Sie ihr schon einen Spitznamen geben wollen, wie wär’s dann mit Deli? Ja, das ist passender. Sie könnte auf jeden Fall eins leer fressen.«
Wieder brach die ganze Klasse in lautes Gelächter aus. Aber im Gegensatz zu Victor hatte Delilah keine flinke Erwiderung, keinen cleveren Konter parat.
»Das reicht«, warnte Sandy ihre Schüler.
»Sagen Sie das Deli«, rief Joey Balfour aus der letzten Reihe, was eine weitere Lachsalve auslöste.
»Oder wie wär’s mit Big D.?«, fuhr Greg fort. »Wie in dem Song, wissen Sie –«
»Ich sagte, das reicht.«
Delilah senkte den Kopf, was ihr Doppelkinn noch betonte. Sandy fühlte sich sofort schuldig. Das arme Mädchen hatte schon genug Probleme. Sie musste nicht noch irgendwelche Spitznamen angehängt bekommen, die weitaus schlimmer waren als ihr richtiger Name. Was hatte sie getan? Es war schließlich nicht die Schuld dieses Teenagers, dass ihre Mutter Sandys Mann in einem intimen Internet-Chat verführt hatte. Es war nicht ihre Schuld, dass Ian nicht mehr damit zufrieden gewesen war, der sprichwörtliche kleine Fisch in dem großen Teich zu sein, und sich danach gesehnt hatte, ein größerer Fisch in einem kleineren Teich zu werden.
Der dickste Fisch, korrigierte Sandy sich. Im kleinsten Teich.
Oder besser noch ein Frosch, dachte sie. In einem Sumpf.
»Okay, Schluss jetzt. Es sei denn, ihr wollt alle nachsitzen.« Sofort verstummte die Klasse. Wenn man Macht besaß, brauchte man keine cleveren Erwiderungen.
»Also gut … Dee. Sag uns, was eine Metapher ist.«
»Es ist ein Symbol«, begann Delilah. »Ein Vergleich. Wenn man ein Wort oder einen Satz, der normalerweise etwas Bestimmtes bedeutet, so benutzt, dass er etwas anderes bedeutet.«
»Wovon zum Teufel redet sie?«, fragte Greg.
»Das bedeutet, das Victor nicht wirklich im Bett gelegen und dem Heulen der Wölfe gelauscht hat«, antwortete Brian Hensen, ohne von seinem Pult aufzublicken. Brian war der kränkliche Sohn der Schulkrankenschwester und von Natur aus so blass wie Victor nach einem halben Tiegel Puder.
»Was meint er dann damit, Schlaumeier?«
»Er horcht auf die Geräusche der Nacht«, antwortete Brian nüchtern. »Die Gefahr.« Er hob den Blick und sah Sandy an. »Den Tod.«
»Wow«, sagte Victor.
»Cool«, meinte Greg.
Dann sagte ein paar Sekunden niemand etwas. »Danke, Brian«, brachte Sandy schließlich flüsternd hervor und unterdrückte den Impuls, Victor und Brian herzlich zu umarmen. Vielleicht leistete sie doch einen kleinen Beitrag. Vielleicht waren die Monate hier doch nicht völlig vergeudet gewesen, wie sie mehr als einmal geklagt hatte. Vielleicht lernte ja irgendjemand tatsächlich etwas.
Victor räusperte sich erneut und legte eine dramatische Pause ein. »Ich weiß natürlich, dass es in Florida keine Wölfe gibt«, las er höhnisch grinsend mit einem Seitenblick zu Joey. »Aber das hält mich nicht davon ab, mir vorzustellen, wie sie sich vor meinem Zimmer versammeln. Werden sie später immer noch da sein, frage ich mich. Warten sie auf mich, wenn ich aus meinem warmen Bett in die kühle Dunkelheit hinausgehe? Werden sie mir in den Wald folgen, wo ich mich häute wie die schmale Schlange, die im Mondlicht über meine nackten Füße gleitet?«
»Welcher Wald denn, du Penner?«
»Joey …«, warnte Sandy.
»Nein, sagen Sie es nicht. Das ist wieder eine Metapher.«
»Ich finde ein ruhiges Fleckchen feuchter Erde«, fährt Victor unaufgefordert fort, »zücke das Küchenmesser aus meinem Gürtel, ziehe die gezackte Klinge über die Innenseite meines Armes und beobachte, wie das Blut an die Oberfläche blubbert wie Lava aus einem Vulkan. Ich senke den Kopf, schmecke meine Sünden und trinke mein unreines Verlangen.«
»Du bist ein Vollspinner«, erklärte Joey.
Dieses Mal war Sandy ungeachtet der literarischen Qualität des eben Gehörten durchaus geneigt, Joey zuzustimmen. »Okay, Victor. Ich denke, wir haben genug gehört. So sehr ich die Wortgewandtheit zu schätzen weiß, mit der du deine Fantasien ausdrückst, ging es bei dieser Hausaufgabe doch eher darum festzuhalten, was du gestern Nacht tatsächlich gemacht hast.«
Statt zu antworten, streckte Victor den linken Arm aus, krempelte den Ärmel seines schwarzen Hemds auf und entblößte eine lange gezackte Linie auf seinem Unterarm.
»Cool«, sagte Nancy.
»Verdammte Scheiße«, sagte Greg.
»Ich denke, das solltest du besser der Krankenschwester zeigen«, sagte Sandy und verschloss die Augen vor dem Anblick.
Victor lachte. »Wozu? Mir geht es gut.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, entgegnete Sandy. »Bitte geh zu Mrs. Hensen. Auf der Stelle.« Sie nahm sich vor, nach der Schule Victors Eltern anzurufen, um sie auf die nächtlichen Aktivitäten ihres Sohnes aufmerksam zu machen. War es vorstellbar, dass sie ihnen etwas erzählte, was sie nicht längst wussten?
Kümmer dich um deinen Kram, hörte sie Ian tadeln. Er hatte immer gesagt, dass sie sich zu sehr auf ihre Schüler einließ. Sorge dich um dein eigenes Leben, hatte er gesagt.
Nur dass sie, als er das gesagt hatte, keine Ahnung hatte, dass sie sich um irgendwas sorgen musste.
»Verrückte Schwuchtel«, murmelte Greg, als Victor die Tür des Containers öffnete und die drei Stufen hinuntereilte.
»Okay, Greg«, sagte Sandy und sprang so unvermittelt auf, dass sie um ein Haar ihren Stuhl umgeworfen hätte. »Das reicht jetzt wirklich.« Sie hockte sich wieder auf die Tischkante. »Und da du offenbar so viel zu sagen hast, würden wir jetzt gern hören, was du geschrieben hast.«
»Das ist, ähm, ziemlich persönlich, Mrs. Crosbie. Ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen.«
»Das ist schon in Ordnung. So leicht bringt man mich nicht in Verlegenheit.«
Greg blickte verschlagen in Delilahs Richtung. »Wohl nicht.«
Joey lachte, und der Rest der Klasse mit Ausnahme von Delilah stimmte ein, obwohl einige der Mädchen zunächst erschrocken nach Luft schnappten. »Kann ich bitte mal dein Heft sehen, Greg?«, fragte Sandy in einem Ton, der deutlich machte, dass es sich keineswegs um eine Bitte handelte.
Zögernd gab Greg ihr das Heft. Sandy schlug es auf und überflog die zumeist leeren linierten Seiten. Sie blätterte bis zur letzten Seite, die zu ihrer Überraschung mit einer Reihe erstaunlich guter, Comic-artiger Porträts übersät war. Die Personen waren sofort erkennbar: Da war Lenny Fromm, der Direktor der Torrance High, lässig bis zur Nachlässigkeit, entspannt bis zur Lethargie, mit seinem Glatzenscheitel, der seine schläfrigen Gesichtszüge fast völlig verdeckte; Avery Peterson, der Physiklehrer, der mit achtunddreißig Jahren genauso alt war wie Sandy, aber wegen seiner Vollglatze doppelt so alt aussah, und in den Zeichnungen als riesige Bowlingkugel auf winzigen, spinnenartigen Beinen dargestellt war; Gordon Lipsman, der Theaterlehrer, der als eckiger kastenartiger Kopf mit einer Knollennase und leicht schielenden Augen karikiert war.
Sandy war gleichermaßen entsetzt und geschmeichelt, auch sich in der Galerie wiederzufinden. Sie erkannte sich sofort an den widerspenstigen Locken ihrer Karikatur, dem übertrieben spitzen Kinn und dem ausgeprägten Muttermal über der vollen Oberlippe. Der strichmännchenhaft dargestellte Körper war von einem langen formlosen Kleid bedeckt und wedelte mit dünnen Armen und knochigen Fingern in der Luft. Ist das ihr Bild von mir, fragte sie sich und musterte die neugierigen Gesichter ihrer Schüler. Eine hagere zerzauste Vettel?
Und sieht Ian mich auch so?
Ihr Blick wanderte auf die nächste Seite, wo die zerzauste Vettel mit einer Amazone kämpfte, deren riesige Brüste, wehendes Blondhaar und hochhackige Schuhe sie unverkennbar als Kerri Franklin identifizierten. Im Hintergrund stand ein Mädchen von monströsen Ausmaßen, aus deren hervortretenden Augen Tränen quollen, während sie versuchte, sich ein ganzes Hühnchen in den offenen Mund zu stopfen. Eine zweite Zeichnung zeigte die triumphierende Amazone, die einen Mann mit einer gewaltigen Erektion über ihre blonde Mähne reckte, während ihre hohen Absätze sich in die formlosen Umrisse der erlegten Vettel bohrten und das unförmige Mädchen nach einem weiteren noch lebenden und gackernden Hühnchen griff.
Sandy klappte das Heft zu und gab es Greg kommentarlos zurück. Ihr Herz pochte wie wild. Aber sie durfte sich auf keinen Fall etwas anmerken lassen, dachte sie, obwohl in ihrer Kehle ein Schrei aufstieg. »Tanya«, sagte sie, sowohl den Schrei als auch die Tränen unterdrückend, und wandte sich einem der hübschesten Mädchen der Torrance High zu. »Könnten wir bitte hören, was du geschrieben hast?« Sandy zwang sich zu einem Lächeln und stellte dankbar fest, dass sie ziemlich unbeeindruckt klang.
Tanya McGovern stand auf. Sie, Ginger Perchak, zwei Reihen links hinter ihr, und die fehlende Liana Martin, die normalerweise direkt hinter ihr saß, bildeten die beliebteste Clique der Schule. Die Jungen buhlten um ihre Aufmerksamkeit, die anderen Mädchen kopierten ihre Frisuren, ihre Kleidung und ihre Posen. Sogar Sandys ansonsten durchaus vernünftige Tochter Megan war ihrem Bann seit kurzem verfallen. Zu Hause hieß es ständig, Tanya dies und Ginger das. Sandy schauderte innerlich bei dem Gedanken, wie lange es dauern würde, bevor auch Megan ein MOVE, BITCH-T-Shirt haben wollte, wie es Liana gestern angehabt hatte. Wo waren eigentlich ihre Eltern, fragte sie sich wieder.
»Ich fürchte, ich hab es nicht richtig geschafft, etwas in mein Tagebuch zu schreiben, Mrs. Crosbie.«
Nickend resignierte Sandy. »Okay, Tanya. Du kannst dich setzen.«
Das Mädchen gehorchte eilig.
»Also gut. Sieht so aus, als hättet ihr alle einen anstrengenden Abend vor euch«, erklärte Sandy. »Zusätzlich zu den beiden Tagebucheinträgen, die morgen vor Unterrichtsbeginn schriftlich eingereicht werden müssen, schreiben wir einen Test über das erste Kapitel von Cry, the Beloved Country. Wer seine Hausaufgabe nicht abgibt oder den Test versäumt, bekommt eine Sechs.«
Sandy schlug ein allgemeines Stöhnen entgegen. »Und was ist, wenn wir krank sind?«, fragte irgendjemand von hinten.
»Werdet eben nicht krank.«
»Und wenn wir ein Attest von Dr. Crosbie bekommen?«, fragte Joey Balfour. Wieder klang das folgende Gelächter ein wenig erschrocken.
Zum Glück klingelte es in diesem Moment, und die Schüler sprangen unverzüglich auf und drängten zur Tür. Sandy blieb, wo sie war, und hoffte, dass ihre Füße sie tragen würden, bis alle den Raum verlassen hatten. »Tanya«, stieß sie hervor, als das Mädchen an ihr vorbeihastete.
»Ja, Mrs. Crosbie?«
»Kannst du vielleicht Liana wegen der Hausaufgabe für morgen Bescheid sagen?«
»Klar doch, Mrs. Crosbie.«
»Und Greg«, fügte Sandy hinzu, bevor er aus der Tür geschlüpft war. »Könnte ich dich bitte einen Moment sprechen?«
Greg wandte sich von der Tür ab und kam langsam zurück.
»Bis später, Alter«, sagte Joey Balfour auf dem Weg nach draußen und zwinkerte Sandy zu. »Seien Sie nicht zu streng mit ihm.«
»Das mit den Zeichnungen tut mir leid«, begann Greg. »Ich wollte ganz bestimmt nicht, dass Sie sie zu sehen bekommen.«
»Dann lässt du sie vielleicht einfach zu Hause, wenn du das nächste Mal zur Schule kommst.«
»Jawohl, Ma’am.«
»Außerdem solltest du darüber nachdenken, dich an einem Kunst-College zu bewerben«, fuhr sie fort, und spürte, wie Greg sie anstarrte. »Du hast Talent. Echtes Talent. Das solltest du weiterentwickeln.«
»Wir sind eine Familie von Gemüsebauern, Mrs. Crosbie«, sagte Greg, der rot geworden war und seine Verlegenheit jetzt zu überspielen suchte. »Ich glaube nicht, dass mein Vater besonders begeistert wäre, wenn sein Sohn seinen Lebensunterhalt mit Comics zeichnen verdienen will.«
»Nun … du solltest trotzdem mal drüber nachdenken.«
3
Deputy Sheriff John Weber saß hinter dem massiven Eichenschreibtisch in seinem kleinen Büro und lehnte sich auf seinem unbequemen jagdgrünen Lederstuhl zurück. Der Stuhl war aus zwei Gründen unbequem: Erstens war das zarte italienische Design, das seine Frau womöglich nach einem Glas Wein zu viel ausgesucht hatte, inkompatibel mit seinem massigen amerikanischen Körperbau. (Er war 1,92 Meter groß und wog weit über 90 Kilo, und auch wenn er früher gern behauptet hatte, dass es 90 Kilo purer Muskeln waren, lag das inzwischen auch schon drei Jahre und gut zwanzig Pfund zurück.) Zweitens klebte das Leder immer irgendwie an seinem Rücken, trotz der brandneuen Klimaanlage, die die Temperatur in seinem Büro knapp über dem Gefrierpunkt hielt. Jedes Mal, wenn er seine Position veränderte, riss das Leder von seinem Hemd wie ein hartnäckig klebendes Pflaster und hinterließ Falten in dem vormals glatten beigefarbenen Stoff. Deshalb sah John Weber immer leicht ungepflegt aus, weshalb seine Frau Pauline sich beschwerte, dass die Leute seine schlampige Erscheinung bestimmt ihrer mangelnden Bügelkunst zuschreiben würden. »Sie denken garantiert, dass ich den ganzen Tag vor dem Fernseher liegen und trinken würde«, hatte sie einmal geklagt, was möglicherweise witzig hätte sein können, wenn es der Wahrheit nicht gefährlich nahegekommen wäre. Denn soweit John Weber das beurteilen konnte, verbrachte seine Frau ihre Tage in der Tat genau so: Sie lag im Bett, trank und sah fern.
John starrte aus dem breiten Fenster in der Westwand seines Büros und fragte sich, wie lange er es noch aufschieben konnte, nach Hause zu gehen. Fast alle anderen waren schon gegangen. Nur eine Notbesetzung blieb zurück, weil in Torrance nach Einbruch der Dunkelheit kaum mehr passierte als ein gelegentlicher Autounfall oder eine Kneipenschlägerei. Es war fast sechs, und wenn er noch ungefähr eine Stunde blieb, bestand eine gute Chance, dass die Enttäuschungen des Tages von einem herrlichen Sonnenuntergang wettgemacht wurden. John liebte den Sonnenuntergang. Nicht nur, weil die Palette strahlender Orange-, Rosa- und Gelbtöne vor dem türkisfarbenen Himmel von so atemberaubender Schönheit waren, dass sein Herz jubeln wollte, sondern auch weil der gesamte Vorgang so wunderbar ordentlich vonstattenging. Und nachdem er einen Gutteil der letzten zwanzig Jahre damit zugebracht hatte, das Chaos anderer Leute zu beseitigen, hatte John Weber eine tiefe Wertschätzung für alles Ordentliche entwickelt.
Wenn er bis nach Sonnenuntergang im Büro blieb, würde er sich natürlich Paulines altvertraute Tirade anhören müssen, dass er nie zu Hause sei und immer nur arbeite, und ob er nicht mit ihr zusammen sein und keine Zeit mit seiner Tochter verbringen wolle.
Die Antwort auf die erste Frage war leicht: Nein, er wollte nicht mit ihr zusammen sein. Die Antwort auf die zweite Frage lautete ebenfalls nein, wenngleich nicht ganz so einfach. Aber so ungern John Weber es zugab, waren ihm sowohl seine Frau als auch sein einziges Kind seltsam gleichgültig. Und während es noch einigermaßen akzeptabel war, die Frau nicht zu mögen, die man geheiratet hatte, weil man zu betrunken oder zu unvorsichtig gewesen war, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es haben könnte, kein Kondom zu benutzen, war es eine vollkommen andere Sache, sein eigen Fleisch und Blut nicht zu mögen. Ihre Tochter Amber, benannt nach der Farbe des Weins, den sie in der Nacht ihrer Empfängnis getrunken hatten, war jetzt sechzehn und schon knapp 1,80 Meter groß. Sie hätte eine imposante Erscheinung sein können, wenn sie nicht so verdammt dünn gewesen wäre, und zwar nicht nur normal und alltäglich dünn, sondern so hager und knochig, dass einen schon ihr bloßer Anblick nervös machte. Deswegen versuchte er auch, sie nicht anzusehen. In letzter Zeit hatte er selbst flüchtigen Blickkontakt gemieden und sie nur angeguckt, wenn es absolut unumgänglich war, wobei er sich alle Mühe gegeben hatte, nicht zusammenzuzucken. Einmal hatte er sich allerdings nicht beherrschen können, und sie hatte seinen entsetzten Blick gesehen und war weinend aus dem Zimmer gerannt. Das war schon Monate her, aber er hatte noch immer ein schlechtes Gewissen.
Schließlich war das Ganze seine Schuld.
Er hatte mit Pauline gestritten, weil sie vergessen hatte, wegen des leckenden Wasserhahns im Bad den Klempner anzurufen, obwohl das verdammte Tropfen ihn die halbe Nacht wach gehalten hatte. Sie hatte versprochen, es am Morgen gleich als Erstes zu tun, und natürlich nicht mehr drangedacht. Also musste er die chinesische Wasserfolter eine weitere Nacht ertragen und am Morgen selbst auf den Klempner warten. Er war noch immer wütend – verdammt, er war auch heute, fast acht Monate später, noch wütend –, als er Amber das letzte Stück Pfirsichkuchen aus dem Kühlschrank holen sah, das er sich aufgespart hatte. Er hatte eine blöde Bemerkung gemacht, dass sie aufpassen müsse, wenn sie nicht irgendwann aussehen wollte wie Kerri Franklins Tochter – ein klassischer Fall von Glashaus und Steinen –, und ehe er sich versah, war der Rest Pfirsichkuchen im Müll gelandet, Amber hatte Pfunde verloren wie nichts und wog jetzt vielleicht noch gut 55 Kilo. 1,80 Meter groß und 55 Kilo! Und alles war seine Schuld. Er war ein schrecklicher Ehemann und ein noch schlechterer Vater. Wie sollte er nach Hause gehen, wenn er jedes Mal, wenn er den unaufgeräumten Bungalow betrat, von seinem eigenen Versagen begrüßt und rasch in die ausgebreiteten Arme der Verzweiflung getrieben wurde?
Er hatte versucht, mit Pauline über ihre Tochter zu reden, aber sie hatte seine Sorgen beiseitegewischt. »Pas de problème«, hatte sie in ihrer ärgerlichen Angewohnheit, französische Sätze in ihre Unterhaltung zu streuen, genäselt. Heutzutage wäre es modisch, superschlank zu sein. Sie zählte eine Reihe Fernsehschauspielerinnen auf, von denen er nie gehört hatte, und wies auf das Cover von einem Dutzend Modezeitschriften, die wie Flicken eines Überwurfs auf dem Bett verstreut lagen. Auf allen posierten junge Frauen ohne Figur mit riesigen Köpfen auf einem Strichkörper. Was war aus Arsch und Titten geworden, hatte er sich gefragt.
Wobei man sich, wenn man nach Arsch und Titten suchte, natürlich immer an Terri Franklin halten konnte.
John schüttelte den Kopf und versuchte, das Bild der üppigen Blondine zu verdrängen, die sich unter ihm wand und mit ihren obszön vollen Lippen seinen Namen rief. Ihre Affäre, eingeschoben zwischen Ehemann Nummer zwei und drei, hatte nur ein paar Monate gedauert, obwohl sie nach dem Abgang von Ehemann Nummer drei kurz wieder aufgelebt war. Das war nach ihrer Augenoperation, aber noch vor der jüngsten Runde von Implantaten und auf jeden Fall, bevor Ian Crosbie auf der Bildfläche erschienen war. John fragte sich, ob es eine weitere leidenschaftliche Wiedervereinigung geben würde, wenn der gute Doktor zur Vernunft kommen und zu seiner Frau zurückkehren würde. Er fragte sich, wie es sich anfühlte, Silikon-Brüste und aufgespritzte Lippen zu haben. Er fragte sich, warum Frauen sich solche schrecklichen Dinge antaten, warum sie bereit, ja beinahe erpicht darauf waren, sich in lebende Karikaturen zu verwandeln.
Skelette und Karikaturen, dachte John, als das Telefon klingelte. »Weber«, sagte er ohne ein Hallo.
»Gut, dass du noch da bist«, sagte seine Frau.
John lächelte. Endlich, dachte er, etwas, worin sie sich einig waren. »Was gibt’s?«
»Ich wollte fragen, was du zu Abend essen möchtest.«
John hatte sofort Schuldgefühle – weil er schlecht über seine Frau gedacht hatte, wegen seiner Affäre mit Kerri Franklin und der Vorwände, die er sich ausdachte, um nicht nach Hause zu kommen. »Ich weiß nicht. Vielleicht –«
»Ich dachte, du könntest vielleicht was von McDonald’s mitbringen. Sie haben den ganzen Nachmittag die Werbung für die McChicken-Sandwiches gezeigt, und das hat mir richtig Lust darauf gemacht.«
John rieb sich die Nase, kratzte seinen lichter werdenden Haaransatz und atmete tief aus. »Ich weiß noch nicht genau, wann ich nach Hause komme«, begann er und beobachtete dankbar, wie ein weißer Cadillac, neueres Modell, auf den Parkplatz fuhr. Heraus stiegen mit einem Ausdruck grimmiger Entschlossenheit Howard und Judy Martin. Irgendwas war offensichtlich nicht in Ordnung. Deshalb würde er ebenso offensichtlich noch bleiben und herausfinden müssen, worum es sich handelte. »Sieht so aus, als könnte ich hier noch eine Zeit lang aufgehalten werden –«
Die Verbindung war beendet worden.
»Vielen Dank für dein Verständnis«, fuhr John fort und winkte die Martins in sein Büro. »Howard … Judy«, sagte er, stand auf und wies auf die beiden braunen Stühle mit den hohen Lehnen vor seinem Schreibtisch. »Gibt es ein Problem?« Er erkannte, dass das ein dumme Frage war, nahm wieder Platz und bemerkte Howards steife Pose, das nervöse Rascheln des Taschentuchs in Judy Martins manikürten Fingern und die Angst in ihren blauen Augen. Sie waren das attraktive Traumpaar der Highschool gewesen und zwei Mal zum König und zur Königin des Schulballs gewählt worden, eine bis heute einmalige Ehre. Judy hatte anschließend noch eine Reihe lokaler Schönheitswettbewerbe gewonnen – Miss Broward County, Miss Zitrusfrucht, Dritte bei der Wahl zur Miss Florida –, bevor sie Howard geheiratet hatte. Ihr hochgestecktes braunes Haar hatte immer ausgesehen, als warte es auf ein Diadem. Aber auch mit zu viel Make-up – John versuchte sich zu erinnern, ob er sie je ohne gesehen hatte – war sie eine schöne Frau.
Howard, groß, schlank und immer noch auf eine jungenhafte Art attraktiv, ergriff die Hand seiner Frau und umklammerte ihre zitternden Finger. »Es geht um Liana. Sie ist verschwunden.«
»Verschwunden. Seit wann?«
»Seit gestern.«
»Seit gestern?«
»Offenbar ist sie nach der Schule nicht heimgekommen.«
»Offenbar?«, wiederholte John in der Annahme, dass es sich um ein Missverständnis handelte. Howard und Judy Martin waren engagierte und treu sorgende Eltern. Warum hatten sie bis jetzt gewartet, wenn eins ihrer Kinder tags zuvor nicht aus der Schule nach Hause gekommen war?
»Wir waren in Tampa«, erklärte Judy leise, als könnte sie seine Gedanken lesen. »Howard hatte geschäftlich dort zu tun, und Meredith hat an einem Junioren-Schönheitswettbewerb teilgenommen. Wir dachten, wir könnten es miteinander verbinden …« Ihre Stimme verlor sich. Sie starrte aus dem Fenster hinter Johns Kopf.