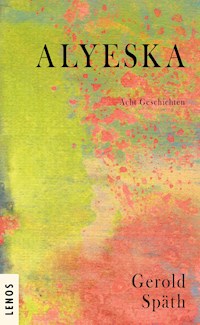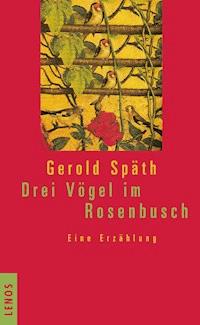18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Roman beschreibt Gerold Späth eine Familienhölle. Vier in sich geschlossene Kapitel schildern jeweils einen Tag aus dem Leben eines Mitglieds derselben Familie, der anders verläuft als alle übrigen Tage. Der Vater begeht einen sexuell motivierten Affektmord, die Mutter besinnt sich ihrer lange unterdrückten lesbischen Neigung, die Schwiegertochter gibt sich einem Callboy hin, der Sohn begeht Selbstmord. Mit der ihm eigenen sprachlichen Präzision deckt Späth den Abgrund unter der Oberfläche eines scheinbar geordneten bürgerlichen Lebens auf, die verborgenen Ängste, die uneingestandenen Wünsche und Begierden. Indem er die Einheit von Ort, Zeit und Person zu wahren versteht, vermag er am Modell dieser Familie die bis ins Tragische gesteigerte Entfremdung in den zwischenmenschlichen Beziehungen sichtbar zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Autor
Gerold Späth wurde 1939 als Spross einer Orgelbauerdynastie in Rapperswil am oberen Zürichsee geboren. 1968 begann er mit dem Schreiben, arbeitete allerdings noch bis 1975 im väterlichen Orgelbaubetrieb mit. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und erhielt u.a. den Alfred-Döblin-Preis (1979), den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung (1992) und den Gottfried-Keller-Preis (2010).
Sein Werk umfasst Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Im Lenos Verlag erschienen Unschlecht (2006), Aufzeichnungen eines Fischers (das erste Jahr) (2006), Mein Lac de Triomphe (2007), Mich lockte die Welt (2009), Das Spiel des Sommers neunundneunzig (2009), Die heile Hölle (2010) und Drei Vögel im Rosenbusch
Erstmals erschienen 1974
E-Book-Ausgabe 2016
Copyright ©2010 by Lenos Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich,
unter Verwendung eines pompejanischen Graffitos
ISBN 978 3 85787 950 0
www.lenos.ch
Das ist ein Klopfen! Wahrhaftig, wenn einer Höllenpförtner wäre, da hätte er was zu schliessen. William Shakespeare
DER VATER
Ich habe im wirklichen Leben Leute gekannt,
denen so ungefähr alles zum Menschen fehlte,
sie waren ohne Mitleid, ohne Erbarmen, voller
Feigheit und Selbstsucht,
sie waren unmenschlich – dennoch waren es
Menschen.
William Faulkner
Im Bett in seinem von vier Generationen um- und umgebauten Haus im Grünen erwachte der Vater nach einer Weile wohligen Halbschlafs vor Sonnenaufgang und blieb reglos liegen.
Draussen lärmten die Vögel: fast unwirklich laut das starktönige Gepfeife einiger Amseln in der Nähe vor dem steten Hintergrund fernerer Vogelstimmen.
In einem Buch über die Südsee und ihre Insulaner, wahrscheinlich vom Stamm der Maori, hatte der Vater gelesen, dort sei es Brauch, dass Erwachende mit geschlossenen Augen in der Hängematte oder am Boden auf den Bastteppichen stillhielten, dann langsam Finger und Arme bewegten und ihre nackte Haut streichelten, auch behutsam hier und dort kniffen und zupften, alles zu dem Zweck, die bei Nacht im Schlaf aus dem Leib gefahrene, frei umherstreifende Seele sanft zurückzuholen; wer zu hastig aufstand, riskierte, sie auszusperren und seelenlos durch den blühenden Tag zu staken.
Dies wollte der Vater vermeiden. Und wiewohl er – entgegen dem polynesischen Brauch – die Augen beim Erwachen sogleich auftat und an die fahle Decke hinaufblinzelte, nahm er sich viel Zeit fürs Streicheln und Zupfen; denn er wollte seine Seele ganz und heil einschlüpfen lassen, war sie doch, dachte er, eine grosse und noble und also ruhig und gemessen in ihren Bewegungen – allerdings keinesfalls zu verwechseln mit der landläufigen müden Seele; ganz unähnlich aber sei sie dem, was zum Beispiel Sportler, besonders Kurzstreckenflitzer, insgeheim unter Seele, einer lauffreudig wettkampflustigen natürlich, verstehen mögen, wenn sie ihre Nervosität am Startplatz nicht wahrhaben wollen. Nicht einmal weit draussen verwandt mit solch zappeligem Ding sei seine ruhige Seele, dachte der Vater.
An seinem Bauch, seinen Hüften, einigen Härchen an seiner Brust, an Oberschenkeln und Unterarmen zupfend, zweimal gähnend, gliederstreckend, fand er in den weit hinten leicht rötlich verfärbten Morgen, und als er, noch eine gute Viertelstunde vor der Sonne, aufstand, tat er es im Vollbesitz seines zurückgekehrten Innenlebens und ebenso betulich, wie er seine Seele herbeigestreichelt hatte, und so sanft, wie sie wieder in ihn eingezogen war nach dieser Nacht tiefen Schlafs.
Die Nächte des Vaters waren immer Tiefschlafnächte. Selten erinnerte er sich am Morgen, etwa beim ruhigen Gang durch die morgengraue Halbhelligkeit des Schlafzimmers in den gedämpft neonlichten Toilettenraum oder später unter der Brause, an irgendwelche Träume, weder an böse, die ihn geplagt, noch an andere, die ihm den Schlaf versüsst hätten.
Beim Duschen pflegte er die Temperatur jenes Wassers, das ihn von oben besprinkelte, auf die Wärmegrade jenes Wässerchens abzustimmen, das er bei dieser Gelegenheit allmorgendlich abliess; er achtete in seinem Leben auf den Einklang oft unbedeutend erscheinender Dinge: Er war ein harmonischer Mensch. Und wenn ihm sein Morgenwässerchen bronzegolden geriet, ehe es, sich mit dem Brausewasser mischend, dünngelblich abfloss, war er jedesmal erfreut und brachte dann jeweils nach einem engkehligen Räuspern die ersten Laute des Tages hervor–«Hmmhmm. Goldig, goldig.»
Diese Feststellung schien ihm passender als die alte Behauptung von der Morgenstunde mit dem Gold im Munde.
Es kam selten vor, dass der Vater die Hähne ohne Bedauern wieder zudrehte. Er genoss die Schwemme von oben, obwohl er dabei nie zu summen begann noch ins Trällern kam oder sich gar dazu hinreissen liess, die Badezimmerakustik mit lauten Gesängen zu erschrecken.
Bronzebrunzwarm brauste das Wasser in die goldige Frühe dieses Tages, belebend über Vaters hin und wieder luftschnappendes Gesicht: Ein stilles, behagliches Auskosten.
Aber dann liess er doch abtropfen. Er freute sich schon aufs nächste: Der Augenblick der Begrüssung stand an. Noch bevor er sich aber Haar und Haut mit flauschigen Tüchern trocken ribbelte, um hierauf mit Rasierschaum und Klinge über Kinn und Wangen zu gehen und sich dann einen dicken Bademantel umzutun, gönnte er auch seiner Zahnprothese morgendliche Erfrischung, nämlich ein sauerstoffperlendes Wasserglasbad. Hernach fand er, fast ohne hinzublicken, im linken Winkel der Etagere die Tube mit der Haftcreme; er achtete auf Ordnung, nie hätte er jene Tube rechterhand hingelegt, und so legte er sie auch an diesem Morgen wieder in denselben linken Winkel zurück.
Alsbald gestriegelt und geschniegelt – und auch die elfenbeinweissen Zähne bereits dort, wo sie tagsüber hingehörten – wandte er sich dem grossen Spiegel zu.
Er tat seinen zweiten Morgenräusperer, ehe er den kristallblanken Spiegelbildvater aus angemessener Distanz anstrahlte–«Hahaaa!»–und eine kleine Verbeugung machte. Kein Morgen, an dem er dann nicht den Bademantel für eine freundliche Weile auseinandergeklaftert hätte. Er zog Bauch- und Beinmuskeln an, überzeugte sich, dass noch alles – wenn auch spiegelverkehrt – da oder dort, jedenfalls vorhanden, und sah, dass es also gut war.
So begrüsste er sich jeden Morgen; so stellte er immer wieder froh fest, wie frisch, wie straff sich ihm seine Leibhaftigkeit über Jahrzehnte von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang erhalten hatte bis auf diesen Tag. Dem Spiegelbild, dazu konnte er sich täglich leicht überreden, sah man wirklich nicht an, dass der Vater ein Grossvater hätte sein können, war doch sein dreiunddreissigjähriger Sohn seit vier Jahren verheiratet.
Zufrieden gürtete er den Bademantel und zog Wollsocken an, lange braune, und langte sein Stöcklein des Tages, eines aus Buchsbaum mit leicht gebogenem Elfenbeinknauf, aus dem dreihundertsechsundsechzigfach besteckten Stockrechen; dabei las er die in ein Messingschildchen gravierte Tageszahl, sagte «Aha! Der hundertvierundfünfzigste heute!» und hob mit der Linken seine Schirmmütze vom Haken draussen im Korridor.
Mützen hatte der Vater drei Stück: Eine wasserdichte für Regenwetter, eine leichtere für Schönwetter, eine fürs Autofahren.
Die wasserdichte hatte Entlüftungsösen und war dunkelblau, die fürs Autofahren braun kariert und die andere rohleinenfarben. Mützen zog er den Hüten vor, Mützen fand er praktischer; deshalb blieb sein einziger Hut, ein Panama, selbst an Heisswettertagen meist am Huthaken neben dem Stockrechen hängen.
In Socken und Bademantel, mit Stöcklein und Schönwettermütze durchquerte er sein geräumiges Schlafzimmer und trat, in die nun hinter dem Horizont heraufschiessende Sonne zwinkernd, auf die ebenerdige Veranda hinaus. Die Luft war frisch, fast kühl; lautes Vogelgepfeife, aber sonst noch kein geschäftiges Geräusch. Wach geworden waren erst der Vater und die Vögel im grossen Park rings ums Haus; er atmete tief, er war zufrieden.
Einen Meter rechts von der Verandatür standen seine am Abend zuvor bereitgestellten blauen Gummistiefel; sohlentief versenkte er seine braunen Socken, zuerst rechts, dann links, fasste hernach die Sonne wieder ins Schlitzauge, atmete wiederum tief ein und aus, dreimal diesmal, während er die Sonnenbrille dort fand, wo sie sein musste: in der aufgenähten Brusttasche.
Auf der Veranda hielt er inne und schaute: Im aufhellenden Morgengrau grauweisslich ein dichter Tauschleier über dem von schmalen Mähmaschinenbahnen geriffelten Rasengrün. Schliesslich tat er den ersten Schritt dieses hundertvierundfünfzigsten Tages jenes Jahres und legte dann, wie an jedem schönen Sommermorgen, seine Sonnenaufgangspur ohne Hast in den strichweis schon aufgleissenden Tau, quer über den weiten Rasen vom Haus auf den Teich zu. «Schön», sagte er vor sich hin, und die Vögel in Bäumen und Büschen verzwitscherten die Morgenstille.
Eins nach dem ändern, dachte er.
Irgendwo hatte der Vater gelesen – wahrscheinlich in einer Zeitung, nicht in einem Buch–, dass die Singvögel irgendwann im Sommer mit Pfeifen aufhörten, fast alle an demselben Tag. Er wusste aber das Datum nicht mehr. Vielleicht im Juli, dachte er und sagte wieder: «Schön.»
Er sagte es noch fünfmal, bis er zu den Eiben kam und zu den dunklen, von drei Buchen und sieben Fichten überragten Buchsbaumbüschen und Zephirsträuchern, die den Teich dicht umstanden; ein schmaler, unebener Streifen festgetretener, schütter kiesiger und fleckweise unkrautbewachsener Erde säumte den Teich.
Über Tag und Nacht, von Morgen zu Morgenfrühe, das wusste der Vater, pflegten die Spinnen ihre Fäden zu spannen; deshalb fuchtelte und stocherte er mit dem Stock des hundertvierundfünfzigsten Tages heftig in der Luft herum, als er vom nassen Rasen auf den Pfad durch die Sträucher wechselte. Mit klebrigem Spinnweb im frisch rasierten Gesicht mochte er sich nicht übers stille Wasser zu seinem zweiten Spiegelbild des Morgens hinabbeugen. Überhaupt: Spinnen, Spinnweb … Fische, das war’s! Saubere Tiere, die Fischchen!
Der Teich war kreisrund, von Ufer zu Ufer über die Mitte gepeilt waren es an die zwanzig Meter; am Rand stand das Wasser einen knappen Meter tief, weiter draussen sank der Betongrund ins Dunkle ab bis zur Mitte hinaus; dort ragte ein ausgewaschener, vermooster Kalkstein über einen Meter hoch steil heraus, und oben auf dem Stein stand Vaters marmorweisse Diana, mitten im Jagdlauf gebannt auf einem Bein. Bogen und Pfeil aus allmonatlich blitzblank gescheuertem Messing; nur an versteckten Stellen grünspanbefleckt. Am Teichgrund der verschlammte Buchenblätter- und Windfall dreier Jahre.
Der Vater wusste, dass mindestens tausend Fische die weisse Göttin umschwammen: Alet, Barben, Karpfen. Schöne, saubere Fische, keiner kleiner als zwanzig Zentimeter, die ältesten Karpfen dick und gelbbauchig, einige fast meterlang; vor Gewittern im Hochsommer, wenn der Unterwind gegen Abend auf einmal stillstand und es in den Buchenwipfeln flirrte und die Tannen ihre Äste hoch oben wiegten, lagen diese grossen feisten Fische in Rudeln knapp unter der Oberfläche: dort sieben, dort zwölf, dort sechzehn dunkle Karpfen im düsteren Wasser, reglos, unmerklich treibende wasserschwere Sterscheiter. Erst wenn die Grundböen dem Regen voran aus West oder Südwest daherfächerten, auch die stärkeren Zweige zerzausten und stossweise durch die Büsche fuhren und den Wasserspiegel verscherbelten, sanken diese grossen Fische jeweils ab, einer nach dem andern, sanken schräg gegen die Teichmitte, gingen in Nähe der Diana auf Grund.
Aus Büchern wusste der Vater, dass alles eine Seele hat, die Sträucher und die Bäume, Fische und Vögel und Blumen und Gräser: Kein Steinchen, kein Stäubchen, nichts ohne Seele.
Schon oft hatte er versucht, beispielsweise die Bäume als seinesgleichen zu begrüssen am frühen Morgen. Ein freundlicher Morgengruss von Seele zu Seele schien ihm angebracht. Es war aber jedesmal eine erstens den Morgen störende und zweitens ins Uferlose absegelnde, endlich leis und leiser serbelnde Rede daraus geworden, so viele Bücher hatte der Vater gelesen, so viel hatte er geglaubt sagen zu müssen – der Schnauf war ihm knapp geworden und schliesslich fast ausgegangen, und der anfänglich sprühend stiebende Speichel auch. Denn beim Begrüssen, hatte ihn gedünkt, sei Umsicht geboten; begrüsse ich das eine Gräslein, sollte ich auch alle andern Hälmchen, sonst könnten ihre Seelchen beleidigt sein und mir übel an meine Seele wollen.
Schliesslich war er, und zwar vor etwa drei Jahren, auf einen allerdings unbefriedigenden Ausweg und diese Formel gekommen: «Seelen, ich und meine Seele grüssen euch!»
Er hatte schon damals zuviel gelesen, um nicht zu wissen, dass dieser kurze Gruss, gemessen an der unwahrscheinlichen Seelenvielzahl um ihn herum, eine faule Ausrede war. Napoleon hat aber mit einem Federstrich fast eine halbe Million Soldaten in Marsch gesetzt, Alexander seine Heerscharen vielleicht nur mit einem siegesgewissen Wink – die Bücher sagen hierüber nichts Genaues, die grosse Bibliothek zu Alexandrien, der Vater wusste es, ist ganz und gar aus- und abgebrannt.
Sieben Wörter sind immerhin mehr als Strich oder Wink, dachte er, ausserdem schicke ich damit nicht die kleinste Seele in die Schlacht; dieser und ähnliche Gedanken – auch an Hitler, Stalin, Nixon und andere erinnerte sich der Vater bisweilen – waren ihm mit der Zeit genügend Morgentrost, wenn ihm die Einsicht in seine Unfähigkeit, Seelen sachgemäss zu begrüssen, die Morgenstimmung hin und wieder verderben wollte. Es geschah nun wie an jedem, ja selbst an Schlechtwettertagen, die Sache mit dem langen roten Schlauch.
Seit sein Sohn die umfangreichen und traditionell einträglichen Geschäfte führte, hatte der Vater rings um sein Haus allerlei Arbeiten entdeckt, die zu tun waren, einige immer wieder – worüber er besonders froh war. Zwar hatten nach seinem Rückzug aus dem Chefzimmer seiner Firma die täglichen Morgenspaziergänge und ausgiebiges Bücherlesen die Tage gefüllt; es war ihm aber bald aufgefallen, dass weitläufige Spaziergänge ebenso wie nachmittaglanges Lesen Leib und Seele zuweilen ermüdeten.
Abwechslung! hatte er eines Tages gedacht. Und so war er auf das Mähen des Rasens gekommen, aufs Rechen des gekiesten Vorplatzes auf der andern Seite des Hauses und auch auf das Zurückschneiden der Rosenstauden: Lauter Arbeiten, mit denen man, selbst wenn sie für einmal getan waren, eigentlich nie fertig wurde. Deshalb waren sie ihm am liebsten. Es vergnügte ihn, im Gegensatz zu früher, nun Geschäfte zu erledigen, die nie zu einem endgültigen Abschluss kommen konnten. Und bei anderen Arbeiten, die, einmal getan, auch abgetan waren, versuchte er hernach mindestens die eine oder andere Verbesserung herauszutüfteln.
So hatte er beispielsweise kürzlich am Rande des Rasens, nah bei den Bäumen, eine etwa zehn Quadratmeter grosse, fast ovale Fläche abgesteckt, hatte die wurzeldurchsetzte Erde bis in eine Tiefe von gut siebzig Zentimeter eigenhändig ausgehoben und den Aushub ebenso eigenhändig während mehr als vier Wochen umsichtig an vielen Stellen seines Grundstücks ausgestreut, den grössten Teil der weiten Umfassungsmauer entlang.
Das ovale, feuchte, flache Loch im Rasen, sein Werk, hatte er mit einer Plastikfolie ausgelegt und hernach mit Torf und frischem Rossmist – in abwechselnden Schichten – eingeebnet.
Dann waren zwölf Rosenstöcke hineingekommen, zwei vom Gärtner empfohlene langlebige Sorten: Sieben Sissinghurst Castle, dunkelrot, und fünfmal die rotblätterige Mère Victoria, eine rosa Züchtung von achtzehnhundertzweiundsiebzig. Und damit war die Arbeit getan gewesen. Gerade dies war eben das Unbefriedigende.
Weil der Gärtner gesagt hatte, die Sorten seien langlebig und widerstandsfreudig, hatte der Vater «Widerstandsfreudig, ha!» gemurmelt.
Aber dann hatte er doch nur sechs Tage gebraucht, um wieder froh zu werden: Im Herbst oder spätestens im nächsten Jahr, war ihm eingefallen, wird es nicht schaden, wenn ich neben den Rosen ein paar Löcher bis auf die Plastikbahnen hinabgrabe und neuen Mist hineingebe.
Da hatte er gewusst, dass sein ovales Rosenbeet ihn und seine Arbeit auf viele Jahre hinaus brauchen würde. Nicht «Schön! Schön!», sondern «Erfreulich! Erfreulich!», hat er damals gemurmelt.
Es gab aber Arbeiten, die eines Tages tatsächlich ein für allemal getan waren. Da blieb trotz aller Tüftelei nichts anderes zu tun, als allenfalls darumherumzutigern. Ein an der richtigen Stelle eingeschlagener Pfahl, zum Beispiel, ist ein eingeschlagener Pfahl, und damit hat sich’s, basta – jedenfalls bis er fault, morsch wird, ersetzt werden muss, ein neuer eingeschlagen werden kann. Ebenso hat sich’s mit einer vor Zeiten vom Haus des Vaters bis zum Rand des Teiches in den Boden verlegten Wasserröhre. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie auszugraben, zu erneuern sein wird. Verstopft ist sie auch nie, und die anfänglich erregende Idee der Sabotage an der eigenen Wasserleitung kam dann doch nicht recht zum Keimen.
Aber, hatte der Vater schliesslich herausgegrübelt: Mit dem Wässerchen, das aus der Röhre sprudelt, halte ich nicht nur den Teichpegel konstant, mit dem Wasser lässt sich auch sonst allerhand machen.
Machen liess sich die Sache mit dem langen roten Schlauch.
Eine dankbare, täglich machbare Sache, eine, wenn’s dem Vater darauf ankam, sogar mehrmals täglich machbare Sache, so oft es ihn eben ankam. Am frühen Morgen immer.
Säuberlich aufgerollt harrte der rote Schlauch, im Gebüsch versteckt, auf Vaters Hände, die zuerst eine Drahtschlaufe lösten und ihn dann geschickt abrollten und mit schnellen Drehgriffen an die Röhre anschlossen.
Einige Vögel huschten zwischen den Sträuchern über die nadel- und blätterbedeckte Erde davon, einige schwirrten kirrend ab; eine Amsel setzte sich draussen auf Dianas Kopf und starrte blöd zum Vater hinüber.
Noch einige Drehgriffe, und das Wasser schoss in den Schlauch, sang, gluckste, trieb die pfeifende Luft aus, sprang ein paarmal in kleinen Spritzern aus der Düse, zischte endlich vollstrahlig hinaus.
Die schwarzstarre Amsel mit dem blöden Blick flügelte lärmend davon.
Man kann sagen, der Vater habe die Gewohnheit gehabt, die Göttin Diana auf dem Stein in der Teichmitte allmorgendlich von Kopf bis Fuss kalt abzuspritzen, wobei er stets darauf achtete, selbst geheimste Stellen in den Strahl zu bekommen. Ja, auf jene göttlichen Heimlichkeiten hatte er es eigentlich besonders abgesehen. Denn dort, wusste er, war die Marmorweisse am ehesten gefährdet. Der rote Schlauch war deshalb genügend lang bemessen; mit seiner Fünfunddreissigmeterlänge reichte er dem Ufer entlang bis zum gegenüberliegenden Teichrand – der Vater konnte seine Diana auch von hinten mit direktem Strahl treffen; eine, wenn auch nur heimlich, schmutzige, mit der Zeit vielleicht gar bemooste Diana wäre ihm ein unschöner Anblick gewesen.
Ausserdem genoss er das leichte Vibrieren des wasserspeienden Schlauchs in seinen Händen; ein wohliges Gefühl am Ufer, es kroch ihm jedesmal unter den Bademantel und bewegte seinen Unterleib. Diese Diana, weiss und unberührt, welch göttliches Weib! Und wie der scharfe Strahl spritzte! Wie er an ihrem Leib zerplatzte! Wie es plätscherte! Wie die Göttin hüpfte unterm aufklatschenden Wasser! Eine Lust war’s.
Aber auch dieses Morgenvergnügen musste ein Ende haben; es stand nämlich schon das nächste bevor: Der Vater drehte den Wasserhahn zu, das Geplätscher fiel zusammen. Morgenstille. Die lauten Vögel weit weg. Reine Luft.
Er rollte den Schlauch sorgfältig auf; eine ziemlich beschwerliche Arbeit, bis der Draht die dicke Rolle wieder zusammenhielt. Geriet er aber dabei in leichten Gesichtsschweiss und kleine Achselhöhlenhitze, so war’s alsbald ein doppelter Genuss, der Stiefel, Socken und des Bademantels ledig, behutsam ins Wasser zu steigen, von unten nach oben von prickelnden Wellchen sanften Schauderns angenehm gebeutelt.
Nicht dass es je Vaters Absicht gewesen war, den Morgen mit Geschnaube zu erschrecken. Er ging vielmehr mit angehaltenem Atem in die Knie, und sobald ihm das Wasser an den Hals reichte, stiess er sehr sachte ab, sagte leise «Fort, Fisch!» und schwamm etwa drei Meter vom Ufer ruhig und ohne Geplätscher hinter den tausend Fischen her, zwei-, manchmal dreimal ringsum. So unauffällig wie möglich schwamm der Vater. Und dabei war er stets darauf bedacht, Kinn und Kopf hochgereckt über Wasser zu halten und vor allem nicht direkt vor sich hin, sondern einige Meter voraus aufs Wasser zu schauen. Solange er im Teich schwamm, vermied er es, die Fische sehen zu wollen; es würde ihm gruseln, das wusste er, und gar ein Fischschwanzschlag, etwa an sein Bein, würde ihm den Atem abstellen, wie gepeitscht würde er aus dem stillen Teich hinausschnellen.
Fort, Fisch, fort! dachte er auch an diesem Morgen; aber kaum gedacht hatte er’s, als einer jener Karpfen, die schon seit Jahren im Teich schwammen, direkt vor seinem Gesicht übers Wasser hinausstiess und nach einem trägen Wälzer zurückplatschte, dass es spritzte.
Es kam zwar vor, dass die Karpfen sprangen, aber selten war einer so nah vor Vaters Gesicht hochgeschossen; es erschreckte ihn, er schluckte Wasser, hustete, wusste einen Augenblick lang nicht, ob er vorwärts zur Diana oder doch lieber ans Ufer zurückschwimmen sollte. Aber mit einigen schnellen Armzügen war er beim Stein, hielt sich fest.
Der Vater hat Dianas Kalkfelsen nie bestiegen; er legte allenfalls hin und wieder kurz an, mit einer Hand nur – unten seine leis strampelnden Beine – und sah hinauf zur Göttin und verweilte dann doch über Gebühr, so schien es ihm nachher jedesmal. Richtig vergessen konnte er sich; es war schon vorgekommen, und darin mochte irgendeine Gefahr liegen, er ahnte es. Ein Geräusch musste ihn dann zurückholen, zum Beispiel ein früher Automotor, weit weg und doch nah, wenn das Morgenlüftchen danach stand.
Kam es aber vor, allerdings selten, dass gar erste flache Sonnenstrahlen das Wassertröpfchen an Dianas göttlicher Marmornase aufblitzen liessen, schwaderte er, ein Ertappter, in unvorsichtiger Eile weg vom Stein und fühlte dann, wie starr ihm das Genick geworden war in verzauberter Anschauung der steinweiss ragenden Jägerin.
An diesem Morgen passierte es ihm, dass er, wieder am Teichrand nach einer Weile, beim Hinaussteigen den Halt verlor und ausrutschte und ins Wasser zurückfiel. Abermals, zum zweiten Male schon, schluckte er Wasser und hustete und erschreckte sich und die Morgenstille.
Was ist denn nur los heute, dachte er beim vorsichtigen zweiten Versuch, aus dem Wasser zu steigen.
Schnaufend, in jedem Fall schnaufend, erledigte er jeweils nach dem Morgenschwimmen die letzte Arbeit am Teich: Er tauchte den aufgerollten langen roten Schlauch ins Wasser, schwenkte, wusch ihn, kletterte dann wieder heraus und versteckte ihn im Gebüsch.
Dabei überlegte er manchmal, ob ausser ihm nicht vielleicht noch jemand – seine Frau, sein Sohn – wusste, dass da eine Schlauchrolle verborgen lag.
Vielleicht wissen sie’s, dachte er, aber sie sagen nichts, sie haben Taktgefühl, sie respektieren mich, sie wundern sich nicht einmal. Aber wahrscheinlich wissen sie gar nichts.
Allerdings wäre ein schwarzer Schlauch leichter zu tarnen; auch dies dachte er.
Zu sagen ist noch, dass die zwei oder drei Runden im Teich an regnerischen Tagen zuweilen und an kühlen immer ausfielen. Dann begnügte sich der Vater mit dem Abspritzen der Göttin, hatte sich auch jeweils Ölzeug umgetan, und wenn es gar zu heftig schüttete, wenn der Wettersturz zum Landregen geworden, kam seine Diana nur von vorn in den Wasserstrahl.
Aber dieser hundertvierundfünfzigste Tag des Jahres, Freitag und zweiter Juni war’s, liess sich sonnig an.
Befriedigt stiefelte der Vater in seinem Bademantel mit Stock und Mütze auf seiner Morgenspur quer über den inzwischen flächig taufunkelnden Rasen zum Haus zurück. Fleck- und streifenweise Müllerblümchen, weisse, rotgeränderte, noch kaum halb geöffnete Blütenblättlein.
Auf der Veranda stieg er aus den blauen Gummistiefeln. Im Schlafzimmer warf er Mütze und Mantel ab, strupfte die Strümpfe von den Füssen und sah sich nach dem Stuhl um, den er früh am Abend zuvor mit Wäsche, Kleidern, Krawatte belegt hatte; war alles noch da. Der Vater kleidete sich an, nicht umständlicher als andere Väter seines Alters, eher schneller: die Leibwäsche unter Hemd und Hose, Krawattenschlaufe unter den Kragen, Knöpfchen zu, halb- oder wadenhohe feine Wollsocken, Hausschuhe. Dann ohne Blick in den Spiegel, aber mit dem Stöcklein dieses hundertvierundfünfzigsten Tages, leise in die Küche, leis den Kühlschrank aufgemacht, Milch und Butter herausgenommen, Zucker, Brot und Honig aus dem Brotschrank, drei Pfännchen auf den Herd; Milch und zweimal Wasser; aus dem Kühlschrank ein Ei und ins hintere Wasserpfännchen damit, aus der Schublade Messer und Löffelchen, vom Geschirrbord einen Teller, Tasse und Untertasse. Die Milch konnte warm werden, die Kaffeepulverbüchse stand auch schon bereit. Vaters Frau schlief noch, er hantierte so geräuschlos wie möglich, die heraufkommende Sonne war ja erst drauf und dran, die ersten Frühaufsteher nach und nach aus dem Schlaf herauszufingern.
Vaters Frühstück: ausgiebig war es, und schmecken liess er sich’s.
An Tagen mit ungerader Zahl und an jedem Sonntag pflegte er mit spitzem Messer ein Trinkei an Gupf und Spitze anzubohren und Dotter und Eiweiss herauszusaugen, und zwar ehe er sich an den Tisch setzte, oft sogar noch vor dem Aufsetzen der Milch und des Kaffeewassers.
Beim Morgenessen dachte er selten über Dinge nach, die er sich für den Tag vorgenommen hatte, mit Ausnahme einer Sache, die – wenn überhaupt – sofort nach dem Frühstück zu erledigen war. Meist wälzte er beim Kauen und Schlürfen ein Problem besonderer Art, sein Lieblings-Morgenproblem sozusagen, nämlich die Frage der Selbstversorgung.
Der Vater war ein wohlhabender Mann; wenn Wohlstand einem Haus, weitläufigen Liegenschaften oder dem Besitzer selber angesehen werden kann: dem Vater, wenn er auf der Veranda seines grossen Hauses im weiten Park stand, hätte man’s ansehen können, Und weil nun das freie Grundstück rings ums Haus so gross war, dass es sich durchaus in landwirtschaftlicher Manier hätte beackern und bebauen und ausserdem in Wies- und Weideland einteilen lassen, konnte er seine Selbstversorgungsfrage in vier Worte fassen:
Soll ich Bauer werden?
Zuerst hatte er an Kaninchen gedacht.
Kleiner Stall mit fünf, sechs Boxen für fünf, sechs Stück irgendwelcher Rasse, Belgische Riesen zum Beispiel, hatte er gedacht, Belgische Riesen waren ihm dem Namen nach bekannt, und gerade dieser Name, schien ihm, bürgte für viel Fleisch.
Vom Kaninchenstall in den Hühnerhof ist es nur ein Sprung über den ungefähr zwei Meter hohen Maschendraht. Drei Hähne und ein Schock Hennen, macht zusammen dreiundsechzig Stück Federvieh im Pferch.
Er hatte auch an Gänse und Enten, schliesslich noch an Truthähne gedacht. Die Frage der Selbstversorgung wurde, einmal angezupft, immer bedenkenswerter, wurde vor allem tierreich. Über Kartoffeln, Mais, Rüben, Obst, stellte sich heraus, konnte später noch während vieler Frühstückshappen nachgedacht werden. Vorerst ging es dem Vater, und zwar schon seit gut zwei Jahren, ums Lebendige.
Als er die Fische in den Teich eingesetzt hatte, war das Selbstversorgungsproblem noch nicht auf dem Frühstückstisch gewesen. Schon zu Vaters Vater Zeiten waren Fische im Teich geschwommen, wenn auch weder Barbe noch Alet, sondern Goldfischchen, insgesamt kaum drei Dutzend. Dass nun im Teich tausend Fische jener Arten schwammen, die dem menschlichen Speisezettel näher sind als Goldfische, änderte – was Selbstversorgung betraf – überhaupt nichts. Der Vater hat den Teich nie befischt, Teich und Fische waren, im Zusammenhang mit Küche und Kochtopf, tabu. Die Fische gehörten der Diana; ein scheuer Gedanke, den er nie aussprach, nicht einmal im Selbstgespräch, den er auch kaum je in buchstabengenauen Wörtern dachte. «Vielleicht sind’s auch schon elfhundert», murmelte er an diesem Morgen vor sich hin und befasste sich dann zum sechsundzwanzigsten Mal mit einem Schweinekoben, der möglicherweise hinter dem Geflügelpferch plaziert werden konnte.
Aber er schweifte bald ab, auch dies kam vor; er dachte an eine zweite grosse Kühltruhe, an fachmännisch zerstückelte Schweinehälften, an Enten in Plastik, Poulets, an steinhart gefrorene Gänse. Hühnerhof- und Karnickelstallprobleme, überhaupt die ganze Bauernfrage hätte er einfach auf minus zwanzig Grad einfrieren, aber – auch dies wusste er – trotzdem nicht endgültig abtun können. Also dachte er doch wieder daran, dass mit zwei Sauen ein Versuch, ein Anfang zu machen wäre.
Er wurde aber bald fertig mit dem Frühstück, ausserdem wartete die dringende Sache, jedenfalls stellte er Besteck und Geschirr zusammen und Brot, Butter, Honig, Zucker- und Kaffeedose an ihren Platz zurück, ohne für dieses weitere Mal in Sachen Selbstversorgung und besonders in der Schweinefrage vorwärtsgekommen zu sein.
Nur noch das weichgekochte Ei jetzt; fast hätte er’s vergessen, obwohl ihm, bevor er es mit dem Löffelchen am Kopf aufschlug, scheinen wollte, so ein weisses Ei sei eigentlich nicht zu übersehen.
Absolut reine Form, vollkommen, dachte er und war wie an jedem zweiten Morgen gespannt, ob es zu weich oder zu hart geraten oder ob es ihm diesmal wohlgelungen sei. Es war aber, und das ist in den letzten Jahren überhaupt nie vorgekommen, ein faules Ei und stank zum Verwundern grässlich in Vaters verblüfft schnuppernde Nase. Er hob es mit spitzen Fingern aus dem Eikelch, hielt den Atem an und warf es in den Kehrichtkübel. Dann griff er schnell zu seinem Stock und stieg leise über drei Treppen in den Estrich hinauf. Stinkt ja grauenhaft, so ein faules Ei, man sieht’s ihm überhaupt nicht an, hätte nie geglaubt, dass faule Eier so grauenhaft stinken.
Es kam ihm in den Sinn, dass man mit dem Gestank fauler Eier jede geschlossene Gesellschaft sprengen könne; so hatte er’s jedenfalls irgendwo gelesen.
Kunststück, dachte er auf den obersten Treppenstufen, so ein Ei jagt alle auseinander, aber jetzt die dringende Sache.
Im Estrich hatte er einen alten Holzverschlag, der als Abstellkammer gebraucht worden war, ausgeräumt und in monatelanger Arbeit dergestalt umgebaut und eingerichtet, dass ein gemütliches, nur auf einer Seite leicht schrägwandiges Zimmer mit zwei in die Dachschräge eingepassten Klappfenstern draus geworden war. Die beiden Wände gegen den Estrich wurden vom Holzboden bis zur Holzdecke von Bücherborden verdeckt: Dicht an dicht Vaters Dachkammerbibliothek, alle Bücher gelesen, manche zwei- oder drei- oder sechsmal. Ein selten benutzter Schaukelstuhl stand in der Ecke neben der Tür, ausserdem hatte er ein kurzes Sofa, einen Tisch, eine Biedermeierkommode heraufgeschleppt. Stand alles da, wie er’s haben wollte. Ein Voltaire-Sessel, gobelinbezogen, zwischen Tisch und Sofa eine alte Ständerlampe, unter dem Sofa ein elektrischer Ofen – wurde nur an kalten Tagen hervorgezogen–, dann eine kleine Kredenz, Oberteil verglast und voll Gläser und Gläschen, unten hinter den Holztürchen an die zwanzig Flaschen: Zwetsch, Kirsch, Korn, Pflaume, Gravensteiner, Himbeer, Vermouth, Gin, im hintersten Glied sogar ein paar Deziliter Absinth. Aber der Vater schnapste nicht; zweimal in der Woche ein Gläschen, vielleicht – es hing immer davon ab, was die Morgenstunde und vor allem die dringende Sache ergaben.
Um dies festzustellen, kletterte er auf dem Estrich über eine Bockleiter in die spitzwinklige Enge zwischen Dachkammerdecke und Ziegeldach des Hauses hinauf.
Drei Generationen, daran ist zu erinnern, hatten ihre Vorstellungen von Architektur und Wohnkultur an Vaters Haus ausgelassen. Der Musikzimmeranbau der ersten war das Herrenzimmer der zweiten und das zusätzliche Gästezimmer der dritten gewesen, als der Vater vor über fünfunddreissig Jahren eingezogen war. Im zweiten Jahrzehnt seiner Hausherrschaft hatte auch er, vielmehr eher seine Frau, sich nicht länger des Eindrucks erwehren können, wenn noch einmal an- und umgebaut werden solle, dann besser gleich, später würden einem die unaufhörlich steigenden Baukosten den Spass verderben. So war der Salon vergrössert und ein viertes Mal etwas Neues angebaut worden: Ein Damenzimmer, könnte man es nennen; da am Ende selbst Vaters Frau nicht gewusst hatte, wozu der neue Wohnraum gut sein sollte, hatte sie einige Zeit nach der Hochzeit ihres Sohnes ein breites Bett bestellt und sich in ihrem Anbau eingerichtet. Getrennte Schlafzimmer seien Mode; davon war sie so sehr überzeugt, dass sich der Vater sein Stück von dieser Überzeugung abschneiden und sich hinfort seinem gesunden Tiefschlaf im ungeteilten Bett hingeben konnte.
In jener Zeit der anhebenden neuen Hausordnung ergaben sich drei Dinge: Der Vater wurde gewissermassen Heimwerker, er zimmerte sich sein Estrichzimmer;
der Vater begann in der Abgeschiedenheit dieses Zimmers vermehrt Bücher zu lesen und kam dabei darauf, dass es gut sei, seiner Seele die allmorgendliche Heimkehr auf polynesische Art zu erleichtern;
und drittens entdeckte er auf der Suche nach dem Ursprung ständiger, seine Dachkammerlektüre störender Zugluft, der bei kühlem Wetter nur mit dem elektrischen Ofen, im Winter aber überhaupt nicht beizukommen war, direkt über seinem Voltaire-Sessel eine Ritze in der Riemendecke. Und noch vor dem Abdichten jener Fuge fiel ihm eine wohl aus Versehen spaltweit offenstehende Dachluke auf.
Diese Luke befand sich über der Decke seines Zimmerchens; er musste sie früher übersehen oder zwar bemerkt, aber wieder vergessen haben: er erinnerte sich nicht. Jedenfalls zogen dort die kalten Winde ein. Und von dort, auch dies ergab sich, ging der schräg nach unten gerichtete Blick ungestört über vier Ziegelreihen zum neuen Anbau und durchs Fenster aufs neue breite Bett seiner Frau. Das war eine Entdeckung gewesen, aus der sich die dringende Sache sozusagen von selbst ergeben hatte.
Sah der Vater fortan von seinem Dachzimmer aus, dass der Vorhang die Sicht nicht behindern würde, bestieg er die Bockleiter, kletterte auf die Riemendecke und duckte sich zur Luke vor.
Richtig, da lag sie, und zwar hatte sie seit der Zeit der neuen Schlafordnung eine Gewohnheit angenommen, die er früher an seiner Frau nie wahrgenommen hatte: Sie schlief nackt. Sie trug nur ihrer seit jeher empfindlichen Kehle wegen einen schmalen Schal um den Hals. Interessant, hatte der damals wenn möglich noch wacher gewordene Vater gedacht und einen leeren Harass vom Estrich heraufgeholt, um bequem in Stellung gehen zu können.
Interessant, dachte er; denn während der Jahre des ehelichen Doppelbetts war er immer für das gesunde Schlafen an frischer Luft bei geöffnetem, sie aber für das gesunde Warmluftschlafen bei geschlossenem Fenster gewesen.
Daraus hatte sich nach unerspriesslichem Hin und Her ergeben, dass ein Schlafzimmerfenster wenigstens im Sommer einen Spalt weit offengeblieben war und dass Vaters Frau ständig über einen rauhen Hals geklagt hatte. Sobald aber der Herbst und die Kühle gekommen waren, hatte es keine frische Nachtluft mehr gegeben, nicht einen einzigen Hauch, und der Vater hatte jeden Morgen wenigstens halblaut über seinen brummenden Kopf geflucht. Und nun, auf einmal, war sie offenbar zu seiner Meinung, zu frischer Luft, zu klarem Kopf, zu offenem Fenster bekehrt.
Interessant.
Seit der Entdeckung der Dachluke und der Aussicht, die sie bot, beschränkte sich der Vater nicht nur am frühen Morgen, sondern bei allen seinen gelegentlichen Betrachtungen über An- und Umbauten auf diesen einen Blickwinkel. Zwar war seine Frau keine sehr schöne Frau, zwar wusste er aus nächster Ehenähe, wie nackt seine nackte Frau aussah – aber auf Distanz war’s etwas ganz anderes. Als Geschäftsmann war er gewohnt, aus jeder Situation das beste herauszuholen, aus jedem Geschäft das meiste herauszuschlagen; und diese Sache mit der Dachluke war so eine Situation, die schon etwas hergeben konnte. Das einzige Risiko war der Vorhang. Ob vorgezogen oder nicht – das war so etwas wie Baisse oder Hausse; der Vater blieb jedenfalls in einer Art Geschäft, er kam sich nicht so ruheständig vor wie einige seiner Bekannten. Die schliefen schlecht und wussten den lieben langen Tag nichts Gescheites anzufangen mit sich und der abstreichenden Zeit und gingen einem auf die Nerven mit ihrem Geklön und wurden langsam eigenartig; einige machten gar auf jung und hatten doch den Schnauf nicht mehr, andere reisten mit ihren Weibern um die halbe oder ganze Welt und rannten dann mit ihren fünftausend Kilometer Schmalspurfilm herum und wollten nicht wahrhaben, dass zum Beispiel das Tadsch Mahal in ihrer Version mit lachender Ehefrau im Vordergrund nicht nur deswegen aus den Proportionen fiel, weil da eine nachwechseljährige Visage feuchtigkeitscremefreundlich grinste, ach ja … – aber der Vorhang war an diesem Morgen zurückgezogen.
«Steigen wir», sagte der Vater und legte Hand an die Bockleiter; er stieg, wie bereits vermerkt, auf die Dachkammerdecke und duckte sich oben im Halbdunkel zur Luke hin, unterwegs die Hose aufknöpfend, die er mitsamt der Unterhose auf die Oberschenkel hinabstrupfte. Er rückte den Harass zurecht, um bequem hinausspähen zu können und spreizte die Beine und zog das Unterhemd hoch, um ebenso bequem an seine Männlichkeit zu kommen.
«Schön», sagte er.
Die Sicht war frei, und seine Frau lag da, und sie war nackt, lag mit leicht angezogenen Beinen auf der rechten Seite, zeigte Schenkelspeck, ihr Gesicht war halb vom linken Unterarm verdeckt.
Der Vater fingerte ein wenig. Er brauchte jeweils, und so auch an diesem Tag, nur kurze Zeit, um sich etwas herbeizuzupfen, für das er schon früher – nicht ohne Erstaunen damals – das Wort «Gesichte» gefunden hatte.
Vor dem ersten Gesicht dieses Morgens dachte er, die Frauen seien den Männern gegenüber im Vorteil, Frauen brauchten wenig zu tun, um jederzeit zu einem Mann zu kommen, ein Mann hingegen müsse sich umtun. Allerdings, räumte er ein, könne es sein, dass er eine andere Meinung hätte, wenn er kein Mann, sondern eine Frau … – aber da hatte er schon das erste Gesicht:
Er lag auf dem Rücken. Über ihm ein dickliches Mädchen mit schweren, dickwarzigen Brüsten. Das Mädchen hockte auf seinem Bauch, rutschte mählich über seinen Magen, über seine Brust herauf, Hals und Kopf nach hinten gebogen; immer höher, näher wellte der gewölbte Mädchenbauch. Nabel, Härchen, getrimmtes Pelzchen. Vaters Fingerspitzen beutelten seine Hoden, derweil seine Hände dicke Mädchenbrüste drückten. Er stierte aus der Dachluke, bleckte sein Gebiss, züngelte hinaus, atmete schneller, biss endlich zu, heftig zwei-, dreimal, bis das gesichtlose Mädchen zerfloss.
Drunten im Schlafzimmer auf dem breiten Bett: seine Frau mit angezogenen Beinen.
Zwecklos war’s, das wusste er, dasselbe Gesicht zweimal hintereinander schauen zu wollen. Seine Gesichte kamen und gingen oder kamen nicht; sie liessen sich nicht zwingen.
Der Vater sah hinaus, tastete rechts tiefer, fingerte links höher, hätte gern eine prallschlanke Athletin heraufgeholt, eine Fünfkämpferin oder Sprinterin, etwas Biegsames, Bewegliches mit kräftigen Muskeln, die strafften sich schon unter ihm und bebten; er rutschte vom Harass, kniete gespreizt und hechelte und sah diese Hürden- oder Hundertmeterläuferin mit den schwellenden Muskeln; im Fernsehen hatte sie ihre langen Beine geschüttelt vor dem Start.