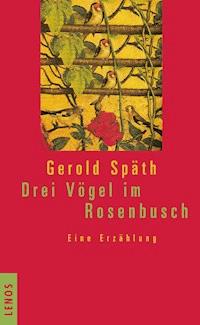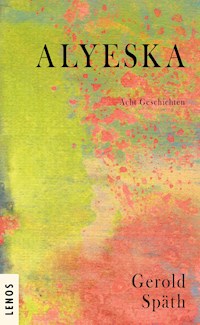
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band versammelt eine Auswahl teilweise unveröffentlichter Erzählungen des sprachgewaltigen und vielfach ausgezeichneten Schweizer Schriftstellers. Auf den ersten Blick scheint die Welt in Gerold Späths Geschichten in Ordnung, doch hinter den idyllischen Fassaden öffnen sich bald die Abgründe, treten Tragödien offen zutage. Kunstvoll legt der Autor die Fallstricke aus. Ob in Venedig, auf dem Zürichsee, in Alaska oder in Mexiko - die Lebensläufe und Familiengeschichten driften ab ins Groteske und führen oftmals ins Verderben. Gerold Späth entfaltet einen Erzählkosmos, der Leser und Leserinnen unweigerlich in seinen Bann zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
www.lenos.ch
Gerold Späth
AlyeskaAcht Geschichten
Der Autor
Gerold Späth, geboren 1939 als Spross einer Orgelbauerdynastie in Rapperswil am oberen Zürichsee, schrieb zahlreiche Romane (Unschlecht, Die heile Hölle u. a.), Hörspiele und Theaterstücke. Für sein Werk erhielt er u. a. den Alfred-Döblin-Preis (1979), den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung (1992) und den Gottfried-Keller-Preis (2010). Gerold Späth ist Mitglied des DeutschSchweizer PEN Zentrums und korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
E-Book-Ausgabe 2019
Copyright © 2019 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lenos Verlag, Basel
Coverbild: Veit Späth
eISBN 978 3 85787 977 7
www.lenos.ch
»… in der that aber sein Sie gestimbt und intonirtwan man Bößere findet in heurope wüll ich nour hänßle haißen …«
Karl Joseph Riepp (1710–1775), Facteur d’Orgues, 1766 aus Ottobeuren an Abt Anselm II. in Salem am Bodensee. Riepp, genialer Orgelbauer, von Ottobeuren früh nach Dijon in Burgund ausgewandert, hat seinerzeit, ausser inzwischen weltberühmten Orgeln, nicht minder berühmte Burgunderweine in seine süddeutsche Heimat geliefert.
»Nun muss ich gleich bey den Steinischen Pianoforte anfangen.Ehe ich noch von Stein seiner Arbeit etwas gesehen habe, waren mirdie Spättischen Claviere die liebsten …«
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791),1777 aus Augsburg an seinen Vater in Salzburg.
Als Emo starb
Verschwinden in Venedig
Familienpapiere
Midlife Reise
La pistola
Eis und Wasser
Orgelwind, weiss
Alyeska
Textnachweis
Als Emo starb
An jenem Tag, an Emos Todestag, waren alle Stunden gleich lang wie vorher und gleich lang wie nachher. Alle Stunden waren gleich jung und gleich alt, als Emo starb.
I
Der Tag, Emos Todestag, war heiss.
Schon um halb vier dämmerte es hellgrau über den Bergen. Die Nacht fiel in die Täler und verkroch sich. Es tagte, schnell wurde es hell, und es wurde warm, als die Sonne stieg. Neun Uhr war der Anfang mörderischer Hitze: Feuer sirrte herab, raste in die Steine, frass alle Schatten auf.
Emo lag in seiner Hütte.
Verschlossene Fensterläden. Schrägstabiges Licht, wie Pfeile von oben durch die Ritzen.
Emo trank abgestandenes Wasser, ein paar Schlücke nur, kleine, dünne Schlücke, und hustete, keuchte, beruhigte sich nach einer Weile, hechelte, atmete mühsam, wollte ganz ruhig, ganz behutsam atmen, ganz gleichmässig.
Staub strich durch die Spalten. Und Stimmen, auch Geräusche von Wagenrädern und Hufen im Wegstaub. Fliegengesumm, wenn es wieder ruhig wurde vor der Hütte. Dann Kinderlärm und Hundegekläff.
Ruhig atmen, dachte Emo und liess sein Wasser. Er regte sich nicht, lag still in der Nässe. Nur keine Bewegung, keine Aufregung, ganz ruhig liegen, keine Anstrengung, nichts tun, einfach nichts tun. Warten. Am besten wartest du. Du bist ein alter Knabe, und deine Jahre haben dich das Warten gelehrt.
Emos Lippen brandeten. Er hatte Durst. Scharfer Schweiss brach plötzlich aus seinem Gesicht und verbiss sich in seine Lider. Emo liess die Arme über den Pritschenrand baumeln. Der Schweiss ätzte ihm die Augen aus.
Du musst ruhig bleiben und warten, dachte er.
Die Fliegen schwirrten in engen Kreisen.
Emo stemmte sich noch einmal hoch. Aber am Mittag erschlug ihn die Hitze.
Staub flirrte im Licht, das flach hereinstiess und die Hütte mit gleissenden Wänden unterteilte, als die Sonne endlich im Westen herabrollte.
Die Fliegen schwärmten; sie tanzten über Emos stinkender Pritsche.
II
Oder an einem andern Tag, als der Wind unerwartet auffrischte, als zuerst feines Eis herabstäubte, und als dann die fauchende Kälte kam und Schnee brachte, als die Scheiterbeige neben dem Drahtverhau unter die Schneewehen geriet.
Emo rieb Hände und Gesicht. Er war krank, er fror. Der kleine Eisenblechherd war kalt. Emo hustete und spürte das Stechen in der Brust, dieses heisse Stechen, dieses rasende Reissen!
In einer Konservenbüchse schmolz er ein wenig Schnee. In den Winkeln hockte der Frost. Emo knüllte noch mehr Zeitungen zusammen, und noch eine, bald die letzte. Er stopfte dem kleinen Ofen das Maul; es war gefrässig: das Feuer schlug hoch und verschlang alles und gab nichts her.
Emo fand zwei Scheiter im Bratofenloch. Er versplitterte sie, schnitzelte Späne, legte zuerst eine Zeitung hinein, schob zitternd drei Handvoll drauf. Der kleine Herd schlang alles hinab. Eine Zeitlang blieb der Rauch im Rohr, drückte herab, schwallte zurück und quoll stickig aus den Löchern; dann plötzlich jaulende Windstösse, die das kleine Feuer mit Gewalt aus dem Ofen in den Kamin hinaufrissen und die dünne Wärme aufsogen, hinauszerrten wie nichts.
Es gab nur zwei, drei Maulvoll lauwarmes Wasser.
Der Wind stiess überall herein, überall bleckte die Kälte scharfbissig durch die Fugen. Noch am Vormittag begann das Fieber einen höllischen Trommeltanz. Emos Herz hastete, wollte Schritt halten mit dem heissen Leben.
Der Ofen war so kalt wie zuvor. Es wurde Nachmittag; die Eisböen liessen nicht nach, sie schrien von weit her und sprangen die Hütte an, verkrallten sich.
Kurz vor Mitternacht fisperte Emo etwas Unhörbares in den Sturm. Dann schwieg er, und alles fror, wurde stocksteif.
III
Als Emo starb, schlugen die Gewitterwellen über ihm zusammen. Er wurde in die Strömung geschleudert, das Wasser sog ihn hinab; es verrenkte ihm die Arme, riss den Schuh von seinem linken Fuss.
Ein paar Männer in knalligen Schwimmwesten, mit straff ums Kinn gezurrten Südwesterriemen wagten sich mit einem schweren Kahn hinaus. Sie warfen Leichenhaken über Bord, um Emo anzuschrenzen und herauszufischen.
In vier Schüben rasten schwere schwarze Wolkensäcke seeaufwärts. Der ganze Zeltplatz flügelte bauschig in die Böen hinauf.
Am andern Morgen fand man Emos linken Schuh zwischen den Wellenbrechersteinen draussen vor der Mole. Mehr wurde nie gefunden.
IV
Emo wurde seines Alters oder seiner Jugend wegen aussortiert und neben dem Ausladplatz dorthin getrieben, wo eine Kinderschar verstört wimmerte und nicht wusste, wohin. Grosse Augen. Gekeuch. Gehuste. Bärte und beruhigendes Gemurmel der Greise.
Dann eine Menschenherde auf dem Marsch.
Uniformen. Befehle. Glänzendes Lederzeug. Und endlich Luft nach der beklemmenden Enge, frische Luft und Bewegung. Kein Uringestank mehr, kein Angstschweissgeruch, kein Gestank mehr von faulem, nassem, verhocktem Stroh. Frische frostige Luft. Emo atmete tief. Als er seine Lungen füllte, sah er mit geschlossenen Augen während eines kurzen Augenblicks ein sonngleissendes Schneefeld.
Die Kleider waren sorgfältig gebündelt auf die lange Wandbank zu legen: alle fünfzig Zentimeter ein sauberes Bündel. Es wurde streng auf Ordnung geachtet. Die Schuhe mussten links mit rechts vernestelt werden. Jeder Haken an der Holzwand eine Nummer. Die Nummer sechsundneunzig tilgte Emos Namen.
Aber der Winter ist vorbei, die Sonne fächert über die morastigen Tümpel, und der Wegstaub trocknet schon fleckweis. Wieder atmet Emo tief und schliesst seine Augen.
Da werden die eisernen Tore zugeschlagen; sie scheppern krachend ins Schloss.
Und jetzt Gerede, was so geredet wird, aber hastiger, plötzlich aufgeregt, plötzlich furchtsam. Was soll man glauben? Man wird sehen, gewiss, man wird sehen, aber was ist das?
Jemand schreit, und eine Frau ruft es laut: »Sie wollen uns umbringen!« Und viele schreien, viele schlagen jetzt um sich, viele brüllen, einige erbrechen sich, einige klappen schon zusammen, krümmen sich, werden käsig, sacken ächzend ein.
Die Luft, es ist die verbrauchte Luft! Gift in der Luft! Gift!
Emo schnaufte mit aufgerissenem Mund. Er reckte sich an der Säule empor, wollte steigen; hinauf, hoch über alle hinauf, hinaus wollte er, hinaus aus der Gasfalle.
Es fuhr wie Stahl glatt in seine Kehle, und seine Brust barst.
Nach zwanzig Minuten lagen alle nackt übereinander: ein Schwarm erstickter Fische in einem ausgelaufenen Trog.
V
Oder sie schlugen ihn. Seine Hände krümmten sich oben in den Strickschlaufen und verkrampften, verfärbten, schwollen blau an. Emo stand auf den Zehenspitzen. Fusstritte brachten ihm das Baumeln bei. Sie traten in seinen Bauch und schlugen mit Ziemern. Emos Blut drang durch den Hosenstoff. Er wusste nicht, was sie von ihm wollten. Er wusste nichts.
Er hörte Gelächter und gehässiges Geschrei. Er wollte schlafen. Striemen rissen quer über sein verschwollenes Gesicht. Der Schmerz über und über peitschte sein Herz in einen rasenden Totentanz. Seine klumpige Zunge flatterte sinnlos.
Zuunterst am Boden hatte Emo zuerst gefroren. Wer zuunterst lag, fror und konnte nicht schlafen vor Kälte; das wusste jeder. Zuunterst waren die Neuen, die Anfänger, zuunterst lagen nur Leute mit Hoffnung auf irgend etwas. Emo war aufgestiegen, weil über ihm gestorben wurde. Es starben viele. Jeden Tag starben mindestens anderthalb oder zwei Dutzend oder mehr. Nach sechs Tagen hatte Emo seinen Platz zuoberst auf der dreistöckigen Pritsche. Er musste sich wehren. Jeder wollte zuoberst in der stinkigen Wärme schlafen.
Sie schnitten Emo vor dem Abendappell ab. Er schlug plump auf den Steinboden. Einer zielte und schoss schräg vor sich hin. Emo warf den Kopf herum. Seine geplatzten Augen waren halb geöffnet. Er wurde an den Beinen hinausgeschleift. Über seinen linken Mundwinkel quoll traniges Blut hervor.
VI
Emo war guter Laune. Ein wenig müde, das schon, aber fröhlich am warmen Abend. Es waren schöne Frauen da, eine gepflegte Gesellschaft mit blanken Zähnen und feinen Manieren. Das kalte Buffet: Lachs, Schinken, Kaviar, Gambas, Hummer, Oliven, Artischocken, geräucherte Forellen, Gänseleberpastetchen, Austern, Roastbeef und so weiter, Mayonnaise und andere Saucen, dazwischen allerlei Salate.
Der Mond ging auf, Lampions leuchteten. Musik. Eiswürfelgeklirr in beschlagenen Gläsern. Geplauder, Scherze, fröhliches Lachen, Erinnerungen, Pläne.
»Sehen Sie, jener Stern dort, das ist die Venus, der Abendstern, sehen Sie? Luzifer ist sein anderer Name. Und vor Sonnenaufgang ist’s der Morgenstern.«
»Es ist so schwül, finden Sie nicht?«
»Ja, ein wenig schwül, aber das macht nichts, nicht wahr?«
Emo spürte, wie ihm flau wurde. Er fixierte einen gelben, sonngesichtigen Lampion und schluckte heftig. Dann erbrach er sich abseits in der Dunkelheit hinter den Oleanderbüschen. Seine Augen tränten. Er schwankte; der Parkmauer entlang wollte er zum Teich, um sein Gesicht zu waschen. Er tappte ein paar Schritte im Zwielicht der wechselnden Beleuchtung der Wasserspiele.
Dann schrie eine Frau.
Dann sah er nackte Schultern über sich und lange rote Haare und eine weisse Blume im roten Haar.
Dann würgte es knollig in ihm hoch; er bäumte sich und sah grelles Licht.
Dann sah er nichts mehr.
Jemand riss das Hemd über Emos Brust auf.
Jemand brachte ein nasses Tuch.
Jemand zerstäubte Parfum.
Jemand brachte eine Serviette voll Eiswürfel und ein Glas Cognac.
Jemand sagte, er sei Arzt.
Zu viert beugten sie sich über Emo. Eine Frau schlug die Hände vor ihr Gesicht und weinte.
Jemand rief: »Emo! Emo!« – aber da war er schon tot.
VII
Als Emo starb, schauten viele Leute zu, die dafür bezahlt hatten, ein schnelles Rennen zu sehen.
Emo sah den rauchenden Wagen quer in der Piste liegen. Schaumlöscherstrahlen fauchten in die Stichflammen. Ein Rad trudelte ihm entgegen. Ein Strekkenwart winkte. Emo wollte ausweichen. Er bremste, die Pneus jaulten.
Die Bremsen winselten, als Emo in die Flammen raste und die überrundete Startnummer zwölf rammte. Fotografen rannten herbei.
VIII
Als Emo starb, fielen Bomben. Sie kreischten vrillend herab, schrammten auf, barsten, versprühten Feuergarben, und glühende Stahlsplitter sirrten durchs Bambusröhricht.
Die Druckwelle schlug wie ein schwerer, plumper Keil ins Erdloch. Emo verkrampfte die Arme um seinen Kopf. Er biss die Zähne aufeinander und drückte seine Augen zu. Der Druck klang langsam ab.
Aber nach einer Weile kam ein neues Geschwader. Wieder Gekreisch und Gesirr, böses, giftiges Gesirr.
Emos Ohren platzten. Es sprudelte öliges Feuer herab und verbrannte die Luft im engen Loch.
IX
Als Emo geboren wurde, gab es kein grosses Palaver. Es gab nicht einmal einen Namen. Es gab nur Hunger. Man wusste, dass Emo bald sterben würde, und verzichtete darauf, ihm seinen Namen zu geben. Emo starb namenlos. Niemand weinte.
Ein Mann grub ein Erdloch, legte ihn hinein, deckte zu, warf ein paar Steine drauf, damit die Hunde nicht an ihn herankonnten.
Die Hunde waren hungrig; ihre Rippen standen scharf unterm räudigen Fell hervor. Die Hunde hatten Hunger und Durst und Menschenaugen.
X
Als Emo starb, war keine Sterbenszeit. Es war früh im Herbst, und Emo liebte den Herbst. Er wollte am Fluss hocken, tagelang im munteren Strudelgeräusch, wollte nichts anderes hören als das Wasser; und fischen wollte er in den Quirlwirbeln.
Die Kinder assen gern Fisch, oder er brachte ihnen einen lebendigen Fisch, und sie schauten am Abend lange Zeit in den Holzzuber. Da stand der Fisch und bewegte kaum seine Fächerflossen; er kräuselte sie nur, und die Kinder rundum glotzten hinein, sahen den Fisch ruhig am dunklen Boden stehen; seine Schleierflossen bewegten sich sacht, und die Kiemenklappen glänzten und gingen langsam auf und zu.
Emo strupfte einen frischen Köder an den Angelhaken, stand auf, balancierte auf den Steinen, warf, glitt aus, schlug längslang hart auf. Das plappernde Wasser zwischen den Ufersteinen färbte sich.
Als die Kinder Emo fanden, verstoben sie verschreckt.
Das Wasser war schon wieder durchsichtig und klar, nur leicht gewellt am Ufer, glucksend über dem feinen Schwemmsand zwischen den Steinen, und frisch und lebendig wie ein jagender Raubfisch.
XI
Als Emo starb, war niemand zuhause. Niemand kannte ihn. Niemand kümmerte sich um ihn. Emo starb, und man fand ihn erst nach Wochen und erst, nachdem man die Türe zu seiner engen Dachwohnung eingeschlagen hatte.
Emo lag in der Küche, lag halb auf den Steinfliesen, halb auf einem fleckigen Kokosteppich. Die Polizisten rissen das Fenster auf und hielten Nastücher vor Mund und Nase.
Als Emo starb, vermisste ihn kein Mensch in der grossen Stadt.
XII
Oder als der Arzt freundlich war. Und als auch Emo sich freundlich gab, weil er es wusste und nichts mehr wollte. Weil es beide wussten und nichts zu wollen war. Nur freundlich sein, diese Anstrengung noch: freundlich sein.
Emos Bauch war dick, war voll Gas und Brand. Es wurde Lavendelwasser versprüht, damit man den Tod nicht hätte riechen sollen. Aber er roch ihn, er schmeckte ihn auf der Zunge. Er wusste es und lächelte freundlich.
Ein paar bekannte Gesichter schwammen von weit her und lächelten verkrampft. Die Gesichter hatten seltsam trübglasige Augen.
Der Arzt sagte nicht viel. Es war nichts zu machen, nichts mehr zu sagen. Es war schon so viel gesagt worden; reden, reden, ein Leben lang reden!
Die Verbände spannten und hielten doch nicht dicht. Wozu die verkrusteten Verbände wechseln?
Emos Bauch schwoll an, quoll auf, wölbte sich grässlich unter den Tüchern. Aber als Emo starb, war er mager, und sein Bauch war eine dunkle Höhle; nur noch Knochen unter faltiger Haut, und schon zerfallen.
XIII
An jenem Tag, an Emos Todestag, waren alle Stunden gleich lang wie vorher und gleich lang wie nachher. Alle Stunden waren gleich jung und gleich alt, als Emo starb.
Am Morgen drängte er durch die City. Die Krise lärmte in fetten schwarzen Schlagzeilen von den Zeitungsständern. Die Leute machten besorgte Gesichter.
Wie befürchtet, brachte die Post neue Schwierigkeiten. Emo las, dass es schlecht gehe, las dann am Fernschreiber, dass auch die Konkurrenz schlecht stehe. Er telefonierte.
Dann rief er die Sekretärin herein, schickte sie wieder hinaus, nahm zwei Pillen, zwei von den hellblauen. Er sah auf die Strasse hinab. Es regnete. Bunte Schirme hüpften auf den Trottoirs, hüpften über den schwarzen Asphalt, über die gelben Fussgängerstreifen.
Emo telefonierte wieder; es sah bös aus. Die Konferenz wurde auf mittags ein Uhr angesetzt. Der Mann an der Börse liess anfragen, was er tun solle, es gehe alles drunter und drüber – »Die einen fressen wie wild, die andern spucken alles aus!« hörte Emo. Blue chips und Glamour, dachte er und sagte nervös: »Woher soll ich das wissen?«
Er liess sich einen Kaffee bringen, nachher wollte er selber an die Börse. Er nahm zwei kleine Schlücke und rief, der Kaffee sei viel zu heiss. »Ekelhafte heisse Brühe!« rief er, nahm Mantel und Hut. Der Boy riss die Lifttüre auf.
Emos Fahrer wartete im Auto. Die allerneuesten Radiomeldungen waren schlecht; auch das Wetter, hiess es, werde schlecht bleiben, Regen und Nebel, strichweise frostige Schauer oder gar Schnee. Viel zu kalt für diese Jahreszeit, dachte der Chauffeur. Er nahm sich vor, am Nachmittag Frostschutz einfüllen zu lassen. Da rief ihn der Portier; er solle schnell hereinkommen und helfen, Emo sei im Lift zusammengebrochen.
»Schlimm?«
»Was heisst schlimm! Aus, Mann! Schluss!«
Verschwinden in Venedig
Inzwischen sind sechzehn Jahre vergangen, aber wir wissen immer noch nicht, wie uns geschah. Es gibt uns nicht mehr. Das ist das eine. Und unsere Kinder sind verschwunden. Das ist das Entsetzliche. Dauernd denken wir dran. Wir erzählen es vor uns hin am Tag, bei Nacht, im Traum und wach: so war es, so war’s, so und so und so.
Wir besassen ein Haus an bevorzugter Lage, besitzen es noch und wohnen darin, obwohl es heisst, das Haus stehe leer. Es steht nicht leer! Wir bewohnen es! Hier! Wir!
Unsere Kinder sind verschwunden, ja, das stimmt. Wir wissen nicht, wohin. Als wir damals atemlos zurückkamen, waren sie nicht mehr dagewesen. Waren wirklich weg, und uns packte eigentlich erst dann der richtige bodenlose Schreck.
Kinder, wo seid ihr, wo?
Oma heulte die ganze Zeit, gab keine Antwort, wusste nichts. Und da merkten wir’s wieder, merkten wir plötzlich wieder, dass wir verschwunden waren. Verschwunden, und konnten nicht mehr auftauchen. – Die Kinder! Unsere Kinder! fragten wir. Wir drangen auf Oma ein, aber sie weinte nur lautlos und sah uns nicht und hörte uns nicht. Es gab uns nicht mehr. Seit dem Tag, an dem wir nach dem Mittagessen in bester Stimmung beschlossen hatten zu verschwinden, eigentlich mehr zum Spass als im Ernst.
An jenem Tag sind auch unsere Kinder verschwunden. Alle drei.
Wir hatten nur das Hotel gewechselt, hatten nur die schon Wochen vor Reisebeginn bekannte Adresse aufgegeben, wir waren einfach umgezogen und ein paar Tage drauf noch einmal, sonst nichts. Es hatte genügt. Man wechselt das Hotel, schon ist man verschwunden. Wir fingierten keinen Unfall, wir liessen nichts zurück, im Hotel kein Gepäck, draussen am Lido keine Badetasche, nichts. Man glaubt nicht, wie leicht das Verschwinden in Venedig ist.