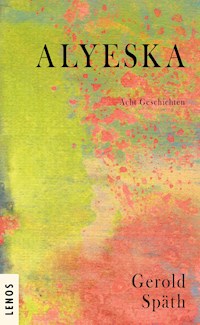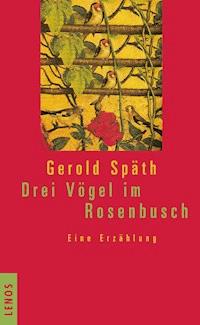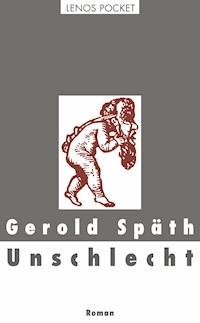
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Unschlecht ist der Pflegesohn des Rapperswiler Friedensrichters. Unschlecht wächst natürlich und darum unaufhaltsam heran, zur Volljährigkeit. Das Mündel wird mündig und bekommt einen amtlichen Brief. Unschlecht wird ›sehr geehrter Herr Unschlecht‹. Aus einem Nachtrag zum Brief erfährt er, dass auf der ›Wirklichen und Redlichen Sankt Gallischen Kantonalbank‹ einiges für ihn liegt, für ihn, Johann Ferdinand Unschlecht, Alleinerbe. Im Pass, über den er jetzt auch verfügt, steht unter ›Besondere Kennzeichen‹: Keine. Unschlecht korrigiert eigenhändig: ›Grosse Füsse schöne Augen graugrün gesunde Zähne stark und noch alle. Inselbesitzer der Insel mit Nutzrecht zum Fischen und allem ausser Kormoranvögel und unter über zwanzig Zentimeter grossen Egli und anderen Raub--fischen. Lange Beine.‹" Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Gerold Späth wurde 1939 als Spross einer Orgelbauerdynastie in Rapperswil am oberen Zürichsee geboren. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann reiste er weit herum. 1968 begann er mit dem Schreiben, arbeitete allerdings noch bis 1975 im väterlichen Orgelbaubetrieb mit. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und erhielt u.a. den Alfred-Döblin-Preis (1979), den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung (1992) und den Gottfried-Keller-Preis (2010). Heute lebt er mit seiner Familie in Italien, Irland und Rapperswil.
Im Lenos Verlag erschienen: Aufzeichnungen eines Fischers (das erste Jahr), Mein Lac de Triomphe, Mich lockte die Welt, Das Spiel des Sommers neunundneunzig, Die heile Hölle und Drei Vögel im Rosenbusch.
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © 2006 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Erstmals erschienen 1970
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 925 8
Für Anita Späth
ERSTES BUCH
DAS ERSTE KAPITEL
berichtet vom Städtlein, der Schule und Schulwundern, von Unschlechts Erbschaft und einem Traum, der mich dermaßen in Hitze gebracht, daß ich laut fluchte.
Nicht ich, Zünd übertreibt, wenn er schreibt, die Stadt habe insgesamt zwanzigtausend Einwohner, und die Hälfte, zehntausend, befände sich im Städtischen Irrenhaus. Er macht gern eingängige Sprüche, kommt sich gern schlau vor, mein Freund Zünd.
Dreifach übertreibt er:
Erstens ist unsere Stadt keine richtige Stadt, nur eine kleine Stadt, ein übriggebliebenes Habsburger Städtlein. Alte Urkunden prahlen zwar von einer ,Festen Freien Hehren Stat’, aber schon früher ist viel geschriftet worden, und diese alten Urkunden sind meist voll Fliegendreck.
Zweitens übertreibt er die Einwohnerzahl. Wie viele es ohne die Fremden und andern Wandervögel sind, steht vielleicht an einem weit hergeholten Stichtag, sonst aber nie genau fest. In unserer Gegend wird unplanmäßig gestorben und geboren, der See bringt Unruhe in die Statistik: da ersäuft der eine im Sommer sang- und klanglos, möchte zwar schreien, strengt sich an, will Laut geben, kann aber nicht, japst nur, schluckt, verliert dabei sich und seine galoppierenden Sinne. Säuft ab; das ist eine Art Tradition: einer mehr geht unter die Fische, derweil ein anderer sich und seine Strandbadnixe im Schatten unterm Gebüsch zehn Schritt vom Ufer beglückt.
Mein Freund hat dreimal übertrieben, denn drittens hat unser Städtlein kein Städtisches Irrenhaus, nichts dergleichen. Braucht es nicht. Haben wir nicht nötig.
Zum Spaß von Zünds schiefer Rechnung ausgehend, kämen Sie und ich zum gleichen Schluß: daß nämlich die eine Hälfte unserer Einwohnerschaft, die irre, nur mangels geeigneter Behausung frei herumlaufe, sich gleicher Freizügigkeit erfreue wie die andere, die nicht irre Abteilung. Aber, sehen Sie, jetzt irren auch wir, und zwar weil eben Verrückte und Nichtverrückte nie gesondert wurden. Man sieht es den Häusern nicht an, in welchen Topf ihre Bewohner gehören; darum hält jeder die andern für das, was sie seiner Meinung nach sind: Löli, Galöri, Spinner, beschissen und verteufelt. Alle haben viel Spielraum für ihre freie Meinung, und das Patente dabei ist, daß jeder getrost verrückt sein kann, es gibt sicher noch Verrücktere. Bei uns ist sozusagen alles möglich, allein schon die Lage und das Wetter machen ziemlich viel aus. Wenn einer verhunzt werden soll – ich rede aus Erfahrung, möchte mich auch heute noch oder erst recht als Rapperswiler bezeichnen –, sind immer ein paar Aufmöbler zur Hand.
Wenn hingegen Unschlecht urteilt, tut er es unbelastet wie selten einer und erst, nachdem er lange nachgedacht hat. Die andern reden von oben herab mit der Nase im Unterwind, und jeder hat recht. Solche Rechthaberei erklärt eigentlich alles. Zum Beispiel eben auch, warum es in Rapperswil kein Irrenhaus gibt. Man konnte sich nie zum Bau entschließen. Es wäre zwar eine Erstklaßattraktion geworden, ganz bestimmt, und sicher nicht nur für die Zürcher Oberländer, die unsere Gastfreundschaft an Sonn- und Allgemeinen Feiertagen ziemlich teuer bezahlen müssen. Woher aber nimmst du heutzutage hierzulande den weisen Richter, der da spricht: Du bist verrückt! Du bist es nicht! – und es selbst nicht ist?
Da hängt der Haken, und an diesem Haken hängt alles.
Man wäre, angenommen, man hätte eine Städtische Idiotenburg zu bauen begonnen, mitten aus der Arbeit davongelaufen, zu einer Zeit, da sich das gemeinnützige Werk kaum im ersten Abschnitt des Rohbaues einigermaßen eindrücklich präsentiert hätte; weggelaufen wäre man, leicht verlegen vorerst, aber alle wären abgeschlichen, jeder hätte sich verdrückt; denn, schlau wie jeder ist, baut keiner einen Zwinger, in den ihn die andern, wer weiß, stecken könnten. Irgendwie hätte das Haus ja gefüllt werden müssen, wenn möglich, ohne die Verrückten von weither oder gar ennet der Grenze zusammenzulesen.
Wahrscheinlich scheint mir also, daß wir das angefangene Gemeinschaftswerk nach einstimmig geschlossener Gemeindeversammlung sich selbst überlassen und einszwei drauf getrunken hätten. Auf unsere Einstimmigkeit.
Aus nicht allzu großer Ferne, innig mit meinem Städtlein verbunden, kann ich mich einer gewissen Übersicht rühmen, darf es also heute aussprechen: Falsch, verdreht, verbogen! Aus, aus Zünds Traum vom großen Städtischen Rapperswiler Narrenhaus!
Die Sache liegt anders.
Hier der Lageplan: Das Städtlein wurde auf einer Halbinsel nach und nach über gut siebenhundert Jahre hin mehr oder weniger gleichmäßig erbaut, der wechselnden Witterung und andern veränderlichen oder unbeweglichen Gegebenheiten entsprechend, und zwar mit Fleiß, geschäftsklugem Verstand, mäßigem Schönheitssinn und allem, was dazugehört. Es gibt Schloß, Kirche, Kloster, Schifflände, Schulhäuser, Ringmauer, Schattenwinkel und Seichgäßchen, Türme, Rathaus, Herrenhäuser, Schlachthaus, Kerker, Bürgerhäuser, heimliche Freudenhäuschen, Spital, Totenhaus. Ferner: Schreinereien, Wurstereien, Druckereien, Metzgereien, Schlossereien, Schuhmachereien, Ziegeleien, kleine und große reihenweis. Und Läden und Lädelchen: Hutläden, Gemüseläden, Kleiderläden, Spezereiläden, Blumenläden, Käseläden, Schuhläden, auch Shopping Centers und Discount Läden, und nicht zu vergessen: Kioske; vor allem der Hauptplatzkiosk, dem auch wir nicht ausweichen können, mit dem mich angenehme Erinnerungen verbinden.
Außerdem gibt es allerlei Handlungen: Eisenhandlungen, Glashandlungen, Arzneihandlungen, Weinhandlungen, Samenhandlungen, Tabak- und Kolonialwarenhandlungen, Tuchhandlungen, Kurzwarenhandlungen, Eierhandlungen, Holzhandlungen, Devotionalien- und Heiligenbildchenhandlungen, Öl- und Kohlehandlungen.
Rapperswil ist stolz auf seine Handlungen, Werkstätten, Fabriken und Läden. Noch größer aber ist der Stolz auf die Wirtschaften. Wir haben am Hauptplatz den Freihof, die Falkenburg, das Rößli und die Rathausstube. An der Halsgasse, die vom Engelplatz zum Hauptplatz führt und sich unterwegs zur Kluggasse mausert, weil dem kurzen Hals der Schnauf ausgeht, steht die fröhliche Wirtschaft zum Paragraph Elf, in die zurückzukommen ist; dann die Wirtshäuser zum Schaf, in dem seit Jahren mehr gemetzget als getrunken wird, die Spanische Weinhalle und grad gegenüber die andere, die Tonhalle. Die Traube macht den Abschluß der Kluggasse und vieler Saufnächte älterer Knaben. Am Fischmarktplatz und in der Nähe des Hafens gibt es den Hirschen, das Schiff, den Hecht, den Bären, das Bellevue, den Anker, das National, den Schwanen – scheint’s das beste Haus am Platz –, das Schwert, den Speer, das Du Lac, den Steinbock. In den Gassen stößt der Durstige auf den versteckten Sternen, den Löwen, den Quellenhof, die Schmiedstube, und weiter landeinwärts auf den Rosengarten und den Scheidweg, aufs Kreuz und die Zeughauswirtschaft. Hotels, Gasthöfe, Beizen, Spunten – alles vorhanden!
Die Serviertöchter werden fast überall jährlich gewechselt. Der Stammgast liebt die Abwechslung.
Es kann vorkommen, daß der Durstige ein armer Teufel oder kurzfristig dem Blauen Kreuz verschrieben ist. Dann plagt er sich ohne Schnaps. Gequält meidet er die scharfen Schenken, er geht ins alkoholfreie Volksheim, wo alles billig und frisch aus dem Wasser gezogen ist. Oder aber, und dies wäre unsere allerletzte Rettung von Durst und Drang: er klingelt fromm den Bruder Pförtner des Kapuzinerklosters heraus, er hüstelt die übliche Nachfrage durchs Gitter, ob ein Süppchen, ob Brot und vielleicht sogar etwas Flüssiges vorrätig seien. Die Kerben und Zinken an der Klostertür nimmst du als Vorspeise, sie sagen dir: Bescheidenheit und ein braves Vaterunser holen hier alles aus dem Keller.
Sollte sich jedoch herausstellen, es sei leider nichts Nahrhaftes vorhanden, dann frag nicht, warum die braunen Brüder Rotnasen haben. Es ist wahrscheinlich Fastenzeit. Komm an Ostern wieder. Dann ist großes Fastenbrechen, dann ißt und trinkt man nicht länger mit den Gemalten.
Aber vielleicht fällt dir auf Ostern etwas Ergiebigeres ein, vielleicht hast du lang vor der Karwoche einen anderen Hahnen angezapft und kannst ohne frommes Braun heidenmäßig fröhlich sein.
Im Gasthaus zum Elften Paragraphen obliegt der uns nahestehende Teil der Lehrerschaft dem Kartenspiel. Man hat es nicht mit den Welschen, man spielt mit deutschen Karten nach Schweizer Reglement: mit Schellen, Schilten, Rosen und Eicheln: As, König, Ober, Unter, Banner, Neun, das bei Trumpf zum Nell wird und dann an zweiter Stelle hinter dem Trumpfbauer sticht, ferner mit Acht, Sieben, Sechs. Und zwar beachtet der kartenspielende Lehrkörper folgende Jaßregel: Stöck, Stich, Wys, Obenab, Untenauf, Schellen und Schilten doppelt, Schellensechs macht Trumpf und gibt aus, Süffel und Gaffer maulhalten!
Diese Übung, von miesen Gemütern ohne mathematische Begabung als blödes Gemischel abgetan, verbindet alt und jung gern mit Trunk und Tabak. Hauptsache ist aber das Spiel, der Jaß, den man jassend auf jedwede Unterlage, meist auf den Jaßteppich auf dem Jaßtisch klopft, so man kann.
Unschlechts ehemalige Lehrer Meil und Ramseier können. Es kann auch der Pfarrer Ochs. Und die siebente und achte Hand hat der vierte Mann im Spiel, Ignaz Silberstein, Zahnarzt von Beruf, Antiquitätensammler aus Leidenschaft, ein Mann, der in den dreißiger Jahren vom Schwabenland herkam und sich mit seinem widerwärtigen Weibsstück samt zwölfbeinigem Kindsgekrabbel bei uns einquartiert hat. Er lebt nicht schlecht. Er zehrt an jedem Goldzahn in anderer Leute Gebiß mindestens zweihundertprozentig. Viel Geschwätz. Bier. Wein, roter Veltliner oder ein Halbliter Valpolicella. Stumpen. Dürre Brissagostengel. Kalauer. Kartenausgabe. Nochmals Kalauer. Fertig Kalauer. Kopfrechnen im stillen. Abschätzen. Jetzt ein pfäffischer Betrugsversuch, Ochssches Gemurmel von Rosenkränzen und, so Gott will, schütterem Eichenlaub, völlig aus der verrauchten Luft gegriffen. Sofort heftiger Einspruch, denn Ignaz Silberstein ist zwar schnellgebleicht getauft, pflegt aber ohne pfarrherrliches Relais auszukommen, stellt zahnärztlich erregt fest: ,Hochwirde habe ez sozesage nix ze sage als die Gosch zhalte!’ Es folgt hochwürdig rotköpfiges Schweigen, Trumpf wird geworfen, jetzt den Trumpfbauer drauf, gestochen, das Nell kommt geflogen, sticht eine Sau, ein König will auch, wird an- und abgestochen, vierter Stich, kurz: ,Bock!’, und nochmals: ,Bock!’, aufgebockt, Stich auf Stich, zum letztenmal: ,Bock und Stich!’ Sonst kein Wort. Abgebockt. Ausgeklopft. Geschwätz. Zusammenzählen: ,… zwanzig, zwanzig, Montag, einunddreißig, Dienstag, Mittwoch, neununddreißig, fünfzig, Donnerstag, vierundsechzig, fünfundsiebzig, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, dreiundachtzig, vierundneunzig, Dienstag, Mittwoch, achtundneunzig, Donnerstag …’, Ergebnis, Gemurmel, Kreidestriche gereiht und übers Kreuz, Reihen und Kreuze abgezählt, kreuzweis, rechts am Rand Gutschriften und Schulden, es steht gut, schlecht, nicht so schlecht, nicht so gut, beide gleich, Kopf an Kopf, Bock auf Bock, Stich gegen Stich, auf Spitz. Witz. Kalauer. Rotwein. Zündholzgezisch. Rauch. Paaren der Böcke und Sauen. Abhub. Mischen der Eicheln und Schellen. Noch zwei drei Schlücke. Stirnrunzelgerunzel. Ausgabe der Untern und Obern. Schnaufendes Schweigen. Aufnehmen der Sechser und Achter. Enttäuschung. Hundsmiserables Blatt. Aber das nächste Mal wollen wir dem Meil und dem Silberstein zeigen, wo der Bartli den Most holt mit Schilten und Rosen! Den Stuhl könnte man auch wechseln. Stuhlwechsel bringt Glück, das weiß jeder Jasser.
Der Lehrer Hugo Ramseier regelt den nächsten Schieber: Untenauf. Will hoch hinaus. Ist klein und kahl und rund und speckig und rötlich. Unterm Hemd auf warmer Brust trägt er ein Aluminiummedaillon der unbefleckt Empfangenen. An seinen Lippen hängt feuchtgeschwärzt ein schwach glimmend Kraut.
,Guten Abend, Herr Lehrer Ramseier.’
Er läßt sich nicht stören. Grunzt nur kurz. Es geht ihm jetzt um einen halben Liter Roten. Da hat er zwischen Eichelas und Rosenchüng zu wählen. Das strengt an, das treibt Schweiß auf die Nase, das will überlegt sein; und der Pfarrer Ochs macht Schlitzaugen und wartet.
Ramseiers Schüler, auch ehemalige wie Unschlecht, kennen ihn rundum ziemlich genau, auch von der redsamen, oft singenden Seite. Vielfältig sind Hugo Ramseiers Begabungen. Unschlecht müßte eigentlich das Naturhistorische und Geographische an ihm besonders gut kennen; denn daß der See zwischen schieferigen, nagelfluhsteinigen und bemoosten, einst dicht, später spärlich, endlich nur noch dünn und dünner bewaldeten Moränen im ausgewetzten, breiten Bett einer mächtig geflammten Eiszunge zurückgeblieben ist, nachdem die Gletscher irgendeiner Eiszeit, wahrscheinlich der letzten, vor Jahrtausenden geschmolzen und geschrumpft sind, Schutt abwerfend, Geschiebe und Gesteinsbrocken, die heute als Findlinge ausgegraben werden und ihren Platz in den Rasenplätzen der Außenquartiere finden: solch aufschlußreich gestopfte Erkenntnis, die ganze untergründige Verkeilung der Gegend narbig verschweißt und verschraubt in einem Satz, hat auch mir eben dieser, mein ehemaliger Schulmeister Ramseier schuljahrelang beizubringen versucht, damit ich einen möglichst klaren Begriff von den Tiefen und der Weite der näheren Erdenläufte erhalte. Und zwar, obwohl sich Unschlecht nie einen Dreck um Eiszungen, ob geflammt oder nicht, gekümmert hat. Ramseier hat es oft mit ihm versucht. Aber Unschlecht war widerstandsfähig; schon damals so robust wie heute, ließ ich mich ums Verrecken nicht in irdische Tiefen hinablotsen; auch nicht von der Schule, in deren kalkgrauweißen Zimmern ich wahrend acht frühen Jahren meines Lebens gebröselt habe, zuerst ziemlich verdrossen, später eher unbekümmert. Mein Achtrundenkampf gegen allerlei Buchstaben, Bücher, Hefte, Aufgaben und insgesamt zwei Lehrer und den Pfarrer Ochs. Man hat sich durchgerüffelt. Ich wurde kaum beachtet. Ich schoß im stillen in die Höhe und blieb während Wochen oder sogar Monaten unbehelligt, kam, blieb, ging, von Ferienzeit zu Ferienzeit sozusagen. Einfach dagewesen, dortgehockt, widerborstig, dumpf und stumpf: Unschlecht, der dumme Unschlecht.
Nicht beachtet haben mich nicht nur die beiden Magister, die aufschnauften, als ich endlich abging und ihnen nicht länger mit unerschütterlicher Präsenz – ein Mißverständnis, wenn ich es mir heute überlege – aufs Gemüt schlug. Der erste: Ramseier, wie erwähnt klein, fast kahl, rund, speckig, ferkelrot und unbeweibten Standes, Hugo Ramseier mit den kurzen Beinen, der Lehrer, der immerzu schwitzt und mit Vorliebe sanfte Kopfnüsse und unerhebliche Rippenstöße austeilt oder den kleinen schreienden Mädchen vor verlegen kichernder Klasse die Höschen hinabläßt, angeblich um sie zu verhauen; Ramseier heißt er. Und dann tätschelte er sie nur, patschig und ungelenk; Hugo Ramseiers kleines Schulzimmervergnügen – er ist oft gerügt worden, aber man hat ihn behalten: der Herr Lehrer Ramseier singt so schön.
Der andere: August Meil. Mager, hager, vornübergebeugt, nicht übergroß und doch hochaufgeschossen. Bohnenstickel mit Hakennase. Die Drahtbrille. Die bekannte feuchte Aussprache, sooft sich Meil ereifert.
Meil und Ramseier lehrten ungefähr dasselbe: Rechnen, Geschichte, Heimatkunde, Deutsch, Naturkunde, Geographie, Zeichnen. Meil machte auch Sprünge, gab Turnstunden, er war der Vorturner, der Oberturner aller katholischen Klassen. Aber nicht bei seinen Sprüngen, sondern nur während der Heimatkunde kamm er jeweils dermaßen in Schwung, daß es bis in die vierte Bankreihe feuchtete. Meil war sonst ein ruhiger Typ.
Der dritte nun, der mich nicht beachtete, war Pfarrer Ochs. Groß, eine feste Burg, schwarz, ein gewaltiger Seelenfänger mit viel Pomade auf dem Schädel; Ochs, ein Klotz von Mann! Er hatte eine Stimme wie Posaunengeröhre, wenn er von Samson oder Moses oder Abrahams Schoß sprach; und hohler Wind schralte durch die Gießkanne, wenn Ochs mit spitzen Lippen biblische Wunder beschwor, das Brunnenwasser aus Kana etwa, das scheint’s im Handumdrehn zu Erstklaßwein verzaubert wurde. Erstklaßweine verzauberten auch unsern Pfarrer Ochs.
Der Lehrer Hugo Ramseier war ein Sänger von hohen Graden, ist es wahrscheinlich heute noch. Er trug stets eine Fliege, eine fein blaugetüpfelte auf Rot oder fein rotgetüpfelt auf Blau. Seine hoch aufsteigende Stimme hob sich immer ab, vor allem an großen Beerdigungen. Ramseier liebte große Beerdigungen. Da war er immer dabei, immer besonders feierlich, immer besonders laut und hoch oben vibrierend.
Es war der andere, Meil, der die angehenden Erstkläßler jeweils alle Jahre wieder auf Eignung zu prüfen hatte, feinfühlig, mit Sanftmut und auf gewaltlose Art. Er war es, der entschied, wer taugte oder erst im nächsten Frühling taugen würde, so Gott wollte und Gottes Wille dem Lehrer Meil im Lenz übers Jahr wohlgefällig war.
Eines Tages wird ein Knirps vorgeführt, der beim Friedensrichter Xaverius Rickenmann Obhut und Unterschlupf gefunden hat. Dieser Kleine empfiehlt sich dem Meil folgendermaßen: ,Eins und eins macht zwei. Zwei und zwei ist vier. Vier und vier ist acht. Acht und acht macht sechzehn. Sechzehn und sechzehn ist zweiunddreißig. Zweiunddreißig mal zweiunddreißig ist tausendnullhundertundvierundzwanzig. Tausendnullhundertundvierundzwanzig geteilt durch zweiunddreißig gibt zweiunddreißig. Zweiunddreißig weniger zweiunddreißig macht nix!’
Daß sich der kleine Unschlecht streng an die sittsamen Zahlen gehalten und nicht irgendeinen verfänglichen Abzählreim vorgetragen hat, war kluge Berechnung. Er wollte es mit der katholischen Primarschule nicht von Anfang an verderben.
Meil hingegen hatte eher an ein kleines Wunder gedacht und sich bieder gegeben. Ich war als Mündel des Friedensrichters ohnehin gesetzlich geschützt und fraglos tauglich. Also blieb ihm nichts, als den Spruch beifällig zu benicken, große Augen zu machen, die Stirn zu runzeln, die dünnen Lippen zu spitzen und zum Schluß, lächelnd ins großgütige Angesicht der Frau Friedensrichterin Frieda Rickenmann, seine kleine Meinung kundzutun: ,Hervorragend! Springen lassen, den aufgeweckten Knaben! Springen lassen!’ Denn, so wahr zweiunddreißig weniger zweiunddreißig gleich null ist: Des Rapperswiler Friedensrichters Pflegsohn mußte ein Wunderkind sein.
Und wahrhaftig! Man erlebte Wunder über Wunder mit mir, und nicht nur kleine.
Als ich zum Beispiel während Wochen täglich ergiebig unter die Schulbank brunzelte, dann plötzlich austrocknete und versiegte, ich weiß nicht wie und warum, und zwei Tage vor den Sommerferien keinen Tropfen, gar nichts mehr auslaufen ließ – war das ein Wunder oder war’s keins? War es ein großes Wunder oder war das Wunder klein?
Man könnte die Frau des Schulhausabwarts fragen.
Oder als ich im dritten Winter – abermals weiß ich nicht wieso – die jeweils morgens um zehn Uhr in der Pause ausgeteilte warme Schulmilch flüssig und ungebrochen, nur leicht gräulich verfärbt, blurrend hintenaus fahren ließ. Oder als der dünne Brei, wiederum ohne augenfälligen Anlaß, plötzlich im Jahr darauf als eine Art Niederschlag von damals bereits siebeneinhalb Semestern katholischer Primarschule Unschlechts Fassungsvermögen überstieg, als die Hochflut am Pegel hinaufsprang und dick und schwarz über den Damm quoll, geradezu peinlich schwarz, nämlich so schwarz, daß es Nacht wurde im unteren Korridor, und dickschwarz stank und schwarz und dick dampfte; als der Gestank den Fuchs sprengte und Ramseier und Meil mitsamt milchgesättigter Schülerschar aus der schwelenden Schwärze in die Kälte, in die kalte Weiße des verschneiten Schulhausplatzes hinaustrieb, als sie drängelnd hinausstoben, mich fliehend, mich allein zurücklassend in der Finsternis, als Unschlecht klein und einsam wurde neben dem dampfenden Schwarzmus – war’s ein Wunder oder war es keins?
Man könnte den Schulhausabwart Bürgi fragen. Für dicke Sachen war nicht seine Frau, da war er persönlich zuständig. Kein Zweifel: wunderlich sind diese Begebenheiten, wenngleich sich aus derart Mirakeln kein Pilgergeld schlagen läßt.
Am schönsten aber offenbarte sich meine Wundertätigkeit erst später, an Schlußexamen jeweils, vorab dann, wenn wie immer versucht wurde, die Sache, was mich betraf, mündlich zu regeln und schnell abzutun.
Meil zum Beispiel hatte die löbliche Absicht, die Schüler der hinteren drei Bankreihen, unter denen ich eine überragende Stellung in der linken Ecke einnahm, je einen Satz aus dem berühmten Lesestück ,Der Wald’ auswendig hersagen zu lassen. Meil war ehrgeizig. Die erste Behauptung unter dem Titel auf der sechzehnten Seite des Lesebuches, nämlich: «Der Wald ist ein Revier», war die Unschlecht zugeteilte Sentenz. Er übte lange. Wochenlang hatte er ,Der Wald ist ein Revier’ herzusagen, jeden Morgen vor dem eigentlichen Schulbeginn: ,Der Wald ist ein Revier, der Wald ist ein Revier’. Er plärrte, der Wald sei ein Revier, bis Meil davon überzeugt war, der Wald sei ein Revier und auch der kleine Unschlecht wisse nun auswendig, daß der Wald ein Revier sei. Was ich am Examentag laut in das von Eltern und Schulräten überfüllte Klassenzimmer hinausließ, muß mir irgendwie in die Quere gekommen sein; es war leider kein Revier, es war ein böses Biest, eine Wildkatze oder ein tollwütiger Fuchs, denn aus Unschlechts Ecke kam es laut: ,Der Wald ist ein Raubtier!’
Männiglich begrüßte die Bestie mit grobem Gelächter. Ich kann mich erinnern, daß sich Unschlecht verwirrt setzte und dann zaghaft mitlachte. Meil stand auf und schoß mit der Kreide knirschend über die Wandtafel.
Auch der Pfarrer Ochs ist ehrgeizig gewesen, mehr noch als Meil. Auf Unschlechts bekannte, frühzeitig bewiesene mathematische Begabung zählend, fragt er mich zuversichtlich – die Firmung stand bevor, der Bischof war über die Berge gekommen und saß rotbetucht vor versammelter Kinderschar – fragt mich Ochs freundlich: ,Wie viele göttliche Personen gibt es, Johannes?’
Ich kalkulierte, konnte aber mit den Einheiten nicht ganz zurechtkommen, beschloß daher, die Mischrechnung aufzuteilen, stellte einen kleinen Dreisatz auf, rechnete, prüfte das Ergebnis und verkündete: ,Es gibt drei Götter!’
Der Sankt Galler Bischof zupfte ein Nastuch aus seinem linken Ärmel und schneuzte sich. Ochs gab nicht auf. Allerdings, gebrannt wie er war, wechselte er das Thema, blätterte flink im Katechismus, fragte, schon weniger freundlich, ziemlich eindringlich: ,Was soll jeder Katholik mindestens zweimal im Jahr bei einem örtlichen Pfarrer tun?’
Ich nehme an, daß auch die bischöflichen Ohren auf meine Auskunft warteten, gespannt auf die Worte eines Unbefleckten, der den Heiligen Geist noch nicht in sich hatte, dem er erst noch mit bischöflich sanfter Ohrfeige zu applizieren war. So vernahm, wer Ohren hatte, ein neues Kirchengebot: ,Jeder Katholik soll mindestens zweimal im Jahr bei einem ordentlichen Pfarrer zur Beichte gehn!’
,Örtlich, örtlich!’ rief Ochs, und sein Ehrgeiz hatte einen Knacks. Hingegen erstarkte sein Arm, und mit pfarrherrlichen Ohrfeigen maßte er sich bischöfliche Gnadengewalt an, firmte Unschlecht links und rechts um einen Tag zu früh.
Einmal ochsenmäßig links, zweimal rechts, davon wiederum einmal ochsenstark, und einen Tag später bischöflich sanft: dreimal also wurde Unschlecht gefirmt. Und da geschah es, jenes Firmwunder, das es unbestritten war: des Johann dreifach beschlagen Haupt blieb heiliggeistlos. Trotz dreimaliger Anrufung sträubte sich der Geist, hinfort Wohnung zu nehmen oder auch nur für kurze Zeit einzuziehen im dreibeklopften Kopf. Schlau und vorsichtig wie dieser dritte Gott ist, wollte er sich offenbar auf nichts Unschlechtes einlassen. Hat wahrscheinlich über geheime, nicht sehr einladende Offenbarungen verfügt und darum die Finger von mir gelassen.
Versehen mit einem ergötzlichen Abschlußzeugnis der dritten Klasse, über die hinaus ich es trotz achtjährigen Kleinkriegs nicht geschafft habe, brachte ich die Schule hinter mich.
Mein Zeugnis war voll schulmeisterlicher Kapitulationserklärungen. An Unterschriften fehlte es nicht. Es kapitulierte des öftern Hugo Ramseier, schräggestellt und scharfgestochen, von feinen Schnörkelgirlanden umrankt. Auch August Meil gab sich geschlagen. Hinter seiner Unterschrift, die quer und klobig stand, hätte niemand den nervösesten Paukisten vermutet, der je im Orchester der Bruderschaft zu Ehren Sancta Caeciliae und Sancta Catherinae vulgo der Musikanten die Kessel erstens immer um etwa Eineinhalbton zu tief oder zu hoch gestimmt und zweitens meistens zu spät oder zu früh und erst noch zu heftig geschlagen hat, damit bevorderst die Ehre Gottes möglichst befördert würde.
Jedoch nicht unter dem Namenszug ,August Meil’ stand der eindrucksvolle Titel ,Schulpräsident’. ,Schulpräsident’ war unter dem klein hingezeichneten Vermerk ,Ochs, Pfr.’ zu lesen, davor ein kleines Kreuzchen, das schwächlich zitterte; erstaunliches Signet der Präsidialgewalt eines Mannes von der kraftstrotzenden Leibesfülle unseres Stadtpfarrers.
An seinem schönen, autogrammgespickten Abgangszeugnis hatte der schulentlassene Drittkläßler große Freude. Und in diese Freude hinein hatte er im Bellevue unten am See ein großes Bier gegossen, das erste große Bier seines Lebens.
Das Bellevue ist eine anständige Wirtschaft, jedermann mit Geld im Sack kann sich dort mit Bier abfüllen. Mit Stammgästen wird am Monatsletzten abgerechnet und auf neue Schulden angestoßen.
Dann, nach jenem ersten Großen, war Unschlecht in seinen Kahn gestiegen und zur Insel hinübergerudert, knappe sechzehnhundert Meter, von der Sturmwarnlaterne am Ende der Mole an gerechnet.
Was ich vom Fischerhandwerk nicht schon wußte, hat mir in der nachfolgenden Zeit der alte Pankraz Buchser von der Halbinsel Au in seinem Kahn beigebracht. Von Ende Februar Anfang März bis in den späten November hinein hat er mir alles, was zur Fischerei gehört, vorgemacht und erklärt, frühmorgens, wenn wir die Netze einholten und schon vor den ersten Schichtwechselsirenen der Fabriken an den Ufern die gröbste Arbeit hinter uns hatten. Ich bin fünfzehn Jahre alt geworden, sechzehn, siebzehn. Ich rauchte Pfeife und Stumpen und Zigaretten, kaute auch schönen schwarzbraunen Tabak, der nur bei Hochs Erben zu haben und deshalb billig und stark und schwarzbraun und saftig war. Manchmal, wenn der Fang den Fischkasten schier wölbte und die mindere Ware, meist Schwalen und Brachsmen, den Auslad am Inselsteg nicht mehr erlebte und zehnkiloweise unter dem Druck der schweren Hechte, unter der Masse von Egli, Schleien, Karpfen und Barben einging, wenn der Morgen so einträglich war, hat der Pankraz jedesmal eine lange Zigarre aus einem Segeltuchetui gezogen und zerschnitten; wir haben sie zu gleichen Teilen von der Mitte her abgeraucht, ich dem Ende, Buchser der Spitze zu. Mit einem Gransen voll Raubfischen kann man Geschäfte machen, vierzig, fünfzig Kilo Egli werfen einen schönen Schübel Geld ab, da mag es schon eine Zigarre leiden. Lohn für den Beimann mußte Pan nicht einkalkulieren; Unschlecht war noch gratis zu haben.
Als ich eines Tages plötzlich volljährig wurde – damals hätte man es mir vielleicht verschweigen können –, erhielt ich einen gelben prallen Brief. Als erstes stach mir das saubere Gelb in die Augen; und als ich ihn in der Hand hielt, spürte ich sein Gewicht.
Die Post wurde nicht auf die Insel hinübergeschifft. Wenn es aber des Absenders oder des Umschlags oder sonst eines hervorstechenden Merkmals wegen den Anschein machte, die Botschaft sei wichtig und dringend, oder wenn, was nicht oft vorkam, ein Expreßzettel rotschwarz neben den Briefmarken auf größte Eile drängte, nahm sich der alte Scherer, Hafenmeister, die Mühe, dreimal lang auf seinem Floß ins Nebelhorn zu blasen, worauf Unschlecht, falls in Hörweite, durch die Hornstöße neugierig geworden, entweder den Kurs änderte oder sofort seinen Kahn losmachte, nachsprang und abstieß, auch wenn es sich traf, daß er auf seiner Insel war und die Signale bis dorthin trugen.
An jenem Morgen traf es sich gut: ich hocke am Hafen. Scherer muß mich übersehen haben. Beim dritten Nebelhorngetute klatscht Unschlecht dem rundbuckligen Bläser – ,Bumms die Lerche, was gibt’s?’ – auf die Schulter; der hafenmeisterliche Hornruf fällt kurz und steil aus und kommt nicht mehr ganz aus der gekrümmten Grünspanröhre.
Unschlecht nahm den Brief – ein großer, gelber, schwerer, seltener Brief war es – und ging in sein Boot. Außerhalb des Wellenbrechers ließ er sich mit der Strömung treiben und machte den Umschlag sorgfältig auf. Er las langsam Wort für Wort vor sich hin; nichts ließ er außer acht; und da erfuhr ich, daß der sehr geehrte Herr Unschlecht nicht länger Mündel des sehr geehrten Herrn Friedensrichters Rickenmann, wohl aber von Stund an ein erwachsener Mensch mit allen Rechten und Pflichten eines freien Bürgers dieses freien Landes sei. Und Gott mit ihm. Man zähle auf ihn. Man wünsche viel Glück. Hochachtungsvoll – Der Stadtammann: Bürgerm. der Stadt Rapperswil, Jos. Schott.
Schott kenne ich. Schott, das ist ein bauchiger Mann mit einem Schnauz.
Post scriptum: Es sei da ein Kontoauszug, erstellt von der Wirklichen und Redlichen Sankt Gallischen Kantonalbank, ferner ein Verzeichnis all meiner beweglichen und unbeweglichen Habe, und des weiteren liege dies und das bei, unter anderem auch ein gültiger nigelnagelneuer Paß, darin nichts fehle, außer des sehr geehrten Herrn Unschlecht Unterschrift, die er, wo mit einem Sternchen angezeichnet, hinzusetzen beliebe, und zwar mit Tinte. Nochmals: Hochachtungsvoll – doch diesmal nicht: Bürgerm. der Stadt Rapperswil, Jos. Schott, sondern: Albert Schönbächler, Stadtschreiber.
Den kannte ich nicht.
Der gelbe Umschlag gab sein Gewicht her. Unschlecht fand eine großflächige Grundeigentumsurkunde aus hartem Papier nebst einem andern Papier, einem befristet gültigen, jeweils zehnjährig kündbaren oder von der Ortsbürgergemeinde zu bestätigenden Fischereirecht, das ihm unbesteuerten Fischfang für das gesamte Gebiet außerhalb eines gedachten Zirkels von eintausend Meter Radius, vom Stein in der Inselmitte aus gemessen, freigab. Innerhalb dieses Kreises von zweitausend Meter Durchmesser solle ich mich nunmehro, wie vormals mein sehr geehrter Herr Vater selig, eines unantastbaren, erblichen Jagd- und Nutzrechts erfreuen, gültig für Land und Wasser, durchgehend, ganzjährig. Als einzige Einschränkung legt mir die Ortsverwaltung nahe, der Pirsch auf Dommeln, Schnepfen und Wachteln sowie der Erlegung des hierzulande seltenen Vogels Kormoran im allgemeinen und zu jeder Jahreszeit zu entsagen; ferner beziehe man sich auf gültiges Fischerei- und Jagdrecht, Gesetz vom zwölften zwölften des Jahres vierundzwanzig, wenn man mir den Fang von untermäßigen Edelfischen aller Art, zum Beispiel Seeforellen oder Barsche unter der Maul-Schwanzende-Länge von zweiunddreißig, beziehungsweise sechsundzwanzig Zentimeter, verbiete. Auch Drahtschlingen und Tellereisen zur allfälligen Einbringung von Wildenten oder des raren Reihers dulde man von Amtes wegen nicht, wie übrigens auch vergiftete Köder oder andere weidungerechte Praktiken.
Unschlecht las und hob den linken Arm über den Kopf gegen die Sonne. Auf den weißen Blättern lag seine Hand als schräger Schatten. Bis er aber zu Ende kam mit seinem mühsamen halb Lesen halb Buchstabieren all des Unerhörten, das ihm sein guter Onkel Xaver und auch der Pan Buchser in letzter Zeit oft angekündigt hatten, war der Kahn vom Wind und der Strömung abgetrudelt und gedreht worden. Da nahm er seinen Arm herunter; sein Rücken stand gekrümmt wie ein Schild gegen die grellichten Strahlen.
Ich sagte nichts und dachte nicht viel. Da war nicht viel zu denken bei der Hitze auf dem Wasser. Da stand alles in den Papieren, schwarz auf weiß, Satz für Satz. Alles verbrieft, bestätigt und unterzeichnet, alles buchstabengenau. Mein Name steht auch da, säuberlich schwarz und fremd: Johann Ferdinand Unschlecht.
Unschlecht sagt: ,Johann Ferdinand Unschlecht’, sagt es zuerst halblaut, dann vollaut vor sich hin, sagt es nochmals: ,Unschlecht’, und verstummt wieder. Johann Ferdinand Unschlecht, das bin ich. Ich bin nicht einfach der Inselhans, nicht dieser Kerl, den jeder, wo man mich kennt oder auch nicht kennt und unbekannterweise von mir redet, seeauf und seeab, Inselhans nennt, nur weil ich auf der Insel wohne, seit ich als Beimann im Buchserboot bin. Du, du bist Johann Ferdinand Unschlecht!
Ich drehte das Boot in geraden Kurs auf den Hafen, und als ich die Pfähle erreichte, sprang ich auf die Ufermauer, ging ins Bellevue und kam mit einer Bierkiste voll rasselnder Flaschen heraus. Auf der Überfahrt trieb Unschlecht die Stehruder ruckweise durchs Wasser, stemmte sich gegen den Unterwind, kam ins Schnaufen und schwitzte.
Jener gelbe Brief, ich gebe es zu, hat mich aus meiner jahrelangen Ruhe gebracht.
Vor der Insel nahm Johann die Riemen herein und holte ein rostiges Ankerlein hervor, warf es zwischen die Zweige eines überhängenden Busches und zog am Tau, bis der Kahn am Ufer auflief; dann gab er ein wenig Tau dazu und machte fest. Seine Schuhe warf er voraus an Land. Mit der Kiste auf der rechten Schulter watete er durch das Strandwasser. Ein paar Schritt vom See, im Gras, setzte er ab und machte schnell zwei Flaschen leer, dann nahm er die dritte, dann, schon gemächlicher, die vierte, trank langsam, sog kräftig.
Es war Mittag. Er lag unter steiler Sonne und schlief, lag auf dem großen gelben Umschlag mit den Urkunden und Auszügen und Aufstellungen und Briefen und Unterschriften und seiner fehlenden Unterschrift im nigelnagelneuen Paß; er träumte von zwei oder drei neuen Lägeln und von neuen engmaschigen Setznetzen und feinen, starken Schwebnetzen, von einem großen Kahn mit einem glänzenden Fischkasten aus Kupfer; er sah den Fischkasten, die blitzenden Lötzinnähte, sah die dichtgesetzten Messingnieten, denn doppelt gedichtet hält besser dicht und schadet nicht. Fliegen und Mücken umschwärmten seinen heißen Kopf und summten ihm schwirrende Träume in die Ohren. Es kam ein nacktes Mädchen in seinen Traum.
Das nackte Mädchen taucht auf, schwimmt herbei, steigt aus dem Glast und winkt dir, lockt dich, ist wunderschön nackt und prallbrüstig. Du beginnst im Schlaf zu strampeln. Wie wild versuchst du die Nackte weiter in deinen Traum hereinzuziehen, näher zu dir. Du streckst deine langen Arme aus, aber die sind nie lang genug, sind immer ein wenig zu kurz, um eine Fingerspitzenlänge zu kurz. Nicht ums Verrecken kannst du die Schöne haschen; weiß der Teufel, warum du’s nicht kannst!
Und dann erwachst du, und da ist kein nacktes Mädchen mehr da.
Ich stand langsam auf. Unschlechts kleiner Kopf war dick und schwer, und er hatte Durst, machte schnell eine Flasche leer, in einem Zug und mit geschlossenen Augen, ohne richtig zu schlucken, spülte das warme Bier hinab; nur ein bißchen weißer Schaum blieb in der grünen Flasche.
Er rülpste laut, glotzte, ließ die leere Flasche neben die Kiste plumpsen, scheuchte Fliegen und Mücken, rieb die Augen aus, vergewisserte sich nochmals: kein Mädchen, nichts Nacktes. Nichts reizte. Nur Bäume, Gras, Schilf, glucksendes Wasser, Vogelgezwitscher, Möwen, Bläßhühner, Haubensteißfüße, manchmal nah, dann weiter weg gegen Hurden zu. Ein dunstiger Hitzehimmel über Unschlecht und eine große Hitze in ihm und fast kein Windchen auf der Insel. Er und sein Scheit warteten umsonst.
Nach einer langen, stummen, gedankenlosen Weile – das Unschlechtsche Unding regte sich ab, war bald entschärft und schon abgekühlt, hatte sich schrumpfend verkrochen – begann es in seinem Kopf zu denken. Er sah über den See, über das flache, gesprenkelte, blinkspiegelnde Wasser, ohne wirklich zu schauen, ohne das Städtchen, den Hafen zu sehen, oder den Kapuzinerzipfel, die Türme, den Schloßhügel mit dem Lindenhof. Er dachte nach. Ein konzentriertes, in sich gekehrtes, lang anhaltendes Nachdenken. Dann rief er plötzlich, indem er sich streckte und sein Maul groß auftat: ,Weiber können mich alle am Arsch lecken!’
Sie können Gift drauf nehmen, daß ich es schlicht und ehrlich gemeint habe und gar nicht voreilig. Ich überstürze nie etwas, bei mir wird nur in ganz seltenen Fällen gehastet.
Unschlecht bestätigt sich’s: Jawohl, können mich alle am Arsch lecken. Ich bin kein Friedensrichtermündel mehr. Ich bin ein freier Mensch. Ich besitze eine Insel und viel Geld und verbriefte Rechte. Und der Meil und der Ramseier und der Pfarrer Ochs und der Stadtammann Jos. Schott, Bürgerm. der Stadt Rapperswil, der mit dem hochpolitischen Schnauz im Gesicht, kann auch, können mich alle am Arsch kratzen, wenn ihnen das leichter von der Hand geht. Ich bin jetzt ein sehr geehrtes großes Tier, verstanden! Hochachtungsvoll: Johann Ferdinand Unschlecht, Alleinerbe.
DAS ZWEITE KAPITEL
preist mein Einzelstück und berichtet von der Auffindung des erträumten Mädchens, das Unschlecht tief hineinschauen ließ und ihm einen Kugelschreiber mit Herz allein verkaufte.
Unschlecht hockte auf der Bierkiste und kramte seinen Paß aus dem gelben Umschlag.
Weiß Gott, wo die Kanzlisten sein Foto auftrieben; er kann sich nicht erinnern, jemals für ein Paßbildchen posiert zu haben. Für Schulklassenaufnahmen zur traditionellen Verewigung zufälliger Kindskopfgemeinschaften ist er früher alljährlich vor dem großen Portal auf der Schulhaustreppe in Stellung gegangen, als unumgängliches, achtmal wiederkehrendes Leitmotiv sozusagen; die Lehrer wechselten, nach den fünf ersten Jahren trat Meil für Ramseier auf, Unschlecht aber blieb im Bild. Ich fiel auf, sooft ich dabei war, und ich war immer dabei: dreimal mit der sich dreimal neu präsentierenden ersten Klasse, zweimal mit der zweiten und dann, sämtliche Mitschüler mehr als zwei Kopf hoch überragend und schon in gleiche Höhe gestiegen wie August Meils Hakennase, noch dreimal mit der dritten, meiner glücklicherweise letzten Klasse.
Aber im Paß war nur ich, Unschlecht, ohne Kameradenbegleitung. Mein kleines Konterfei sah mich stieläugig und kleinköpfig, großohrig und fischmaulig, haarsträhnig und nicht sehr schlau an. Diese Nichtigkeiten beachtete ich natürlich nicht über Gebühr; man soll sich kritisch betrachten, das schon, aber man sollte nicht an jeder Kleinigkeit hängenbleiben. Unschlecht besah sich unbefangen, er sah sich als Ganzes, den ganz unbefangenen Johann Ferdinand Unschlecht.
Daß er dumm sei und nicht ganz schlau, und daß diese Eigenschaften gerade auf dem Paßfoto besonders schön zur Geltung kämen, das hätte man ihm erst beweisen müssen. Richtig ist: so hell auf der Platte zu sein wie die meisten im Städtlein Rapperswil, erkühnte sich Johann selten, höchstens dann, wenn er mit seinem Kahn abseits war und ihm keiner beim Fischen quer in die vollen Netze kreuzte. Unschlecht wußte, daß weder Gekicher noch faule Sprüche auf die Fischpreise drücken.
Er riß seinen Blick von sich los und las: Besondere Kennzeichen – Keine. Und dachte wiederum lange nach, dachte, schaute so lange, bis sich der Gedanke breit machte, da sei er auf einen Fehler gestoßen, da werde Unschlecht Unrecht getan. Denn, dachte er, Kennzeichen, ganz besondere Kennzeichen habe er eigentlich doch mehrere, wenn es, wie in einem Paß, drauf ankomme. Aber da las ich es wieder: Besondere Kennzeichen – Keine.
Wenn nun aber je einer, von dem man sich in der Gegend vom Oberen Zürichsee grinsend weiß Gott was erzählte, besondere Kennzeichen hatte, dann war es ich. Keiner meiner Kollegen war, wenn ich mich recht erinnere, so oft besonders gekennzeichnet wie ich. Konnte einer von ihnen so spielend wie Unschlecht mit seinen schönen großen Ohren so schön wackeln und Wind machen? Nein! Hat beispielsweise der Pfändler so lange und so kräftige Beine wie ich? Oder der Päuli, hat der Päuli meinen Hals? Und des Johann Maul, nehmen Sie nur dieses Maul, diesen Gummischranz, dehnbar, elastisch wie warmgeknatschter Kaugummi. Oder Johanns strotzende Gestalt. Seine Füße, diese beiden Riesenflossen. Und seine Brust! Welch herrliche Windlade! Auf Unschlechts breiter Brust kräuselt sich pelziges Haar von tief unten herauf bis fast zum Adamsapfel und übers Kreuz quer von einer Brustwarze zur andern, mittendrin ein stolzer Knopfbauchnabel. Ist das mit irgend etwas Alltäglichem zu vergleichen?
Schon wenn Unschlecht daran dachte, wie ebenmäßig seine Kollegen ihre Posturen durchs Städtlein schoben, so ebenmäßig, daß mir ihr Ebenmaß fast wie Schaustellergehabe vorkam, und erst recht, wenn ich sie sah, diese geschniegelt Gewachsenen, kam mich eine Art Mitleid mit Schadenfreude an, und der, wie es heute noch heißt, größte Tropf am Platz erbarmte sich der Tröpfe.
Dieses ,größter Tropf am Platz’ habe ich mir schon während der Schulzeit gut gemerkt. Ich bin nicht nachtragend, ich kann es mir heute leisten, über vieles hinwegzugehen, aber das ist mir geblieben: größter Tropf am Platz. Völlig überflüssige Redeweise!
Unschlecht hätte auch sein größtes, im Grunde genommen einziges, ganz besonderes Kennzeichen nicht nötig. Er kommt aber nicht drum herum, kann sich dafür die beschwerliche Suche nach allerlei schamhaften oder ähnlichen Ausflüchten ersparen. Packt also den Stier an den Hörnern und den Johann am Schwanz: Bei uns wird behauptet, der Teufel sei dazu verdammt, dort auszufahren, wo er eingeschloffen ist. Dasselbe wird vom Bier gesagt, wenn es in den falschen Schluck gerät, wenn schwachbäuchige Trinker mit ungeeichtem Magen über ihren kleinen Durst saufen. Unschlecht hat aber – auch dies ein besonderes, beinah geheimes Kennzeichen – einen überaus großen Magen und einen ebenso großen Durst gehabt, im Sommer wie im Winter, und von Leichtfertigkeit konnte bei ihm nicht die Rede sein. Von schwacher Blase vielleicht, ja, aber leichtfertig, das steht fest, wurde Unschlecht, wird kein Unschlecht großjährig.
Also: Der Inhalt von fünf Flaschen Bier drückt bei ihm bald auf die Blase. Darum schau jetzt hin, sieh zu, seien Sie Zeuge. Sicher sehen Sie es auch? Sogar zurückgezogen, nur halb herausgelassen, verheißt der Unschlechtsche Fisel, was vom französischen ,fils’ – ,Sohn’ abgeleitet sein könnte, Ungewöhnliches, Außerordentliches, indem er seinem Geschäft mit mächtigem Geräusch nachkommt und seine Arbeit nicht notdürftig, sondern dickstrahlig erledigt. Ohne Hast, in aller Unschlechtruhe läßt er auslaufen, was zuviel ist.
Derweil Johann, ebenso unbekümmert wie seine beschäftigte Rauschpfeife, eine saftige Ladung ausspuckt, machst du kleine Augen. Und jetzt die Frage: Gibt es auf dieser Erde eine Zweitausgabe der Unschlechtschen Mannsheimlichkeit?
Johann muß zugeben: In unserer Gegend nicht.
Ja, ich kann es heute erneut bestätigen: Soviel ich weiß, ist das besonderste meiner Merkmale eine sehr große, wenn nicht die größte aller Raritäten. Es scheint nämlich, daß der Schöpfer in jener Zeit, als er Unschlecht plante, nicht nach seinem Bild arbeitete, daß er vielmehr den Peilstock und sämtliche alten Maße fallen ließ und kühn über alle bisher üblichen Spannrahmen hinausstieß, neue Grenzen setzte, eine Bresche schlug, daß er Raum schaffte und Neuland eroberte. Kühne Tat und Voraussetzung zu unsterblichem Ruhm zugleich!
Da war ihm doch endlich der große Unschlecht gelungen! Das mußte gefeiert werden mit Pauken, Zimbeln und Trompeten, und seine Heerscharen mochten ihn preisen, die Himmel rühmen den Schöpfer aller möglichen und der unmöglichsten Dinge. Es war ihm zu gönnen! Der Gigel des Johann Ferdinand Unschlecht war eine gelungene Sonderausgabe, ein GT Super, vor dem sich die Konkurrenz ins finsterste Loch hinab verkrümelte. Mit einem Wort: Meine feste Burg ist ein ragender Glockenturm, ist dem erwartungsvoll kühnen Einhorn ähnlich, aller Keuschheit Sinnbild; Johann Unschlecht hat einen Riesenfisch, einen Prachtsbrunzer: Ferdinand der Unermüdliche! Mein einsamer Rekord, gottgewollt, unschlagbar!
Unschlecht hat sein Wasser abgeschlagen. Er geht durchs Gras, das schon hoch steht, denn Pfingsten, das liebliche Fest, ist bereits gekommen und gegangen, es grünen und blühen Feld und Wald, Fronleichnam naht; ging also quer über die Insel auf mein Haus zu, wo ich mich in der Kühle des zwielichtigen Ganges zu erinnern suchte, in welche Schublade Unschlecht vor Jahren seine Griffelschachtel eingelagert hat. Ist sie unten oder ist sie oben? überlege ich, denn mein Haus ist doppelbödig und tief unterkellert. Da fällt mir ein, daß ich in der Griffelschachtel, angenommen ich entdecke sie endlich in der zuletzt durchstöberten Staubecke, nicht jene Art Schreibzeug finden würde, die uns der im Gegensatz zu Schott unbekannte Stadtschreiber Schönbächler als Werkzeug für Eintragungen in neue Pässe empfiehlt. Einverstanden; zur Niederschrift besonderer Kennzeichen taugt in Unschlechts Fall wirklich nur Tinte.
Gerade solcher Saft aber war schwerlich in seinem Haus oder sonstwo auf der Insel, hingegen mühelos im Städtchen auf der Halbinsel drüben zu finden. Weshalb Johann Ferdinand, Weltrekordhalter von Gottes Gnaden, nach kurzer Überfahrt alsbald wieder im Rapperswiler Hafen festmacht.
Er geht die Seegasse hinauf zum Rathausplatz und steht eine Weile unschlüssig im Laden des Papeteriebesitzers Traber herum, dreht die Ansichtskartensäule, ist beeindruckt von Vogelschauaufnahmen und einer schönen Abendstimmung beim Heilighüsli, dreht weiter, läßt keinen Blickwinkel, keine Brennweite aus, dreht so lange, bis man ihm sagt, wenn er jetzt schon wieder, und zwar zum zweiten Male innert acht Tagen gekommen sei, um wie üblich nichts zu kaufen, wenn er wie immer nur aus lauter Lebensfreude Abfallpapierstreifen betteln wolle, solle er machen, daß er weiterkomme.
Die Tochter des Hauses ist offensichtlich gereizt. Wahrscheinlich hat sie ihre schlechten Tage, Gertrud ist gar nicht gut im Strumpf.
Unschlecht errötete und sagte, nein, nicht Streifen, Tinte möchte er gern haben.
,Was! Tinte! Wir verschenken keine Tinte! Wenn wir Tinte verschenken wollten, könnten wir gleich den ganzen Kram in die Luft werfen und den Laden zumachen! Hans, du spinnst!’
Ich begriff und begriff die Aufregung doch nicht ganz. Ich wollte mich erklären. Ohne Hast begann Unschlecht. ,Gertrud’, sagte er – die Trabertochter ist mir im ersten Jahr meiner Drittkläßlerkarriere als lustiges Eichhörnchen mit langen Zöpfen über den Schulweg gelaufen, ein zutrauliches Tierchen, mit dem man am schulfreien Mittwochnachmittag oder während der Sommerferien beim Hügeli am Strandweg blutt baden konnte, ein spritziges Mädchen, das mit seinen Händchen zwischen den mageren Oberschenkelchen fast nichts versteckt gehalten, das auch, ohne allzu rot zu werden, im Schilf oder, wenn’s regnete, auf den Stellagen in Rickenmanns Keller oder hinter den Bretterbeigen am Güterschuppen oder auf einem schmalen Bänklein in einem feuchtdunklen Schrebergartenhäuschen in der Garnhänke immer wieder gern Fräulein Doktor Traber gespielt und den fiebrigen Patienten Unschlecht von einem Übel ins andere hinüberhantiert und manchmal stundenlang, bis es dunkelte, verarztet und beinah kuriert hat – ,Gertrud’, sage ich, ,Gertrud’, aber es kommen plötzlich wieder jene hitzigen Gefühle auf, die schon meinen mittäglichen Nacktmädchentraum verbittert haben, sie mischen sich ein, drängen vor; Johann bekommt einen roten Kopf, einen dicken Hals, es hilft nichts, ich muß es ablassen, dieses eklige Gefühl –: ,Trudeli, leck mich am Arsch!’
Dann schleunigst hinaus!
Meine allgegenwärtige Zugriffigkeit, die ich mir bis heute einigermaßen zu bewahren wußte, mag Ihnen der Umstand vor Augen führen, daß Unschlecht trotz Zorn und berechtigter Hast jene kleine Sekunde fand, die er brauchte, um einen seiner bemerkenswert schönen, bei ihm damals allzeit bereiten, immer schön geballten Fürze hintenausknattern zu lassen.
,Unverschämter Sauhund!’ – Das war eine Bezeichnung, mit der eine Kundin die Unschlechtsche Gattung auf freie Wildbahn verwies. Der Kracher erschreckte die Witwe Stollberg, deren abgestorbene Ehehälfte während des Kriegs die Rationierungskarten ausgegeben hatte und deshalb am vierzehnten August vierundvierzig von einer wütenden Gemüsehändlerin namens Stettler, die glaubte übervorteilt worden zu sein, auf offenem Platz beim Brunnen vor dem Aufstieg zum Schloß geohrfeigt worden war, sehr zum Ergötzen aller durch die jahrelange Rationierung reduziert haftbaren Rapperswiler. Jenes Markenausgebers Witwe trug, nachdem ihm Gram und allgemeiner Spott über die Stettlerschläge ein kühles Grab gebracht – siebenundzwanzigster Mai neunzehnhundertfünfundvierzig – nur noch Tiefschwarz, höchstenfalls im höchsten Hochsommer Dunkelgrau. Tiefschwarz damals, hob die Witwe Stollberg in Trabers Papeterie ihren Busen, schnaufte und – in Erinnerung an meinen Furz jenes zwanzigsten Mai schreibe ich es nochmals auf – entrüstete sich: ,Unverschämter Sauhund!’
Da beging Gertrud Traber einen Fehler. Sie wollte nämlich in Geschäftspolitik machen und doppelte kreischend nach: ,Stinkiger Affenarsch! Gorilla Blauarsch!’ Aber gerade zu solch ungehörigem Geschrei hätte sie sich nicht hergeben sollen; denn die tiefschwarze Gramverflossenenwitwe, der ein einziger Arsch genügte, sah sich zu einer entschlossenen, meines Wissens nie mehr rückgängig gemachten Rückwärtsbewegung veranlaßt.
Auf diese Weise hat die Papeterie Traber und Faber durch die Ungeschicktheit der Ladentochter Gertrud eine gute Kundin verloren. Stollbergs Witwe pflegte nämlich jährlich mindestens vierzig großformatige Trauerweidenbeileidkarten zu kaufen. Seit dem Trauerfall in ihrer Familie, also seit dem siebenundzwanzigsten Mai fünfundvierzig, brachte sie außer für Patisserie nur noch für Todesanzeigen, Kremationen und Beerdigungen eine gewisse Wärme auf. Der Abgang ihres Gatten drängte sie ab ins ungewärmte Einzelbett; aber sie machte gute Geschäfte mit einer Wohnung voll Untermieter – schwacher Trost einer Frau, die gewohnt war, darüber zu befinden, ob sie sich ihren kleinen Ehemann, besser gesagt: dessen kleineres Angetrautes, heute oder erst morgen nacht bei vielleicht gesteigertem Appetit einverleiben solle. Kein Wunder also, daß die Witwe Stollberg damals längst ein neues Spielchen entdeckt hatte: tiefschwarz lauerte sie auf Leichen!
Das war nun freilich auf die alten Tage hin kein schlechter Sport, das hielt sie bei gutem Appetit. Sie war scharf auf ältere Jahrgänge. Sie sah es den Leuten an, ihr Blick tötete. Sie spielte auf Leben und Tod, und ihren ausgewählten Opfern schickte sie Kartengrüße nach: ,Ruhe sanft’ oder ,Allzufrüh’, schwarzgerandet, damals einssechzig das Stück oder im Dutzend für Franken siebzehn bei Traber und Faber zu haben.
Beim Hauptplatzkiosk hielt Kilian Schratt sein Velo an. Er glitt vom Sattel auf die Querstange und verlangte drei Zigaretten; ,Uno, due, tre’, sagte er, denn Italienisch erleichterte die Verständigung. Drei einzelne Zigaretten wollte er haben. Schratt war Lehrbub bei H. Müller & Co., Gießerei. H. Müller & Co. hielten ihre Lehrlinge ziemlich knapp.
Unschlecht kam herzu und schlug dem Kilian folgenden Handel vor: ,Du gehst zum Traber und kaufst ein Fläschchen Tinte. Die Tinte ist für mich. Ich kaufe am Kiosk ein ganzes Päckchen Zigaretten. Die Zigaretten sind für dich.’
Aber Schratt, der nie mein Freund war, rief: ,Typisch blöder Unschlechtseich!’ und verzog sich mit seinen drei Zigaretten. Da sagt die Cremonesin im Kiosk: ,Kauf Kugelschreib’, und Unschlecht stellt fest, daß man bei ihr auch ohne Italienisch auskommt. – ,Kauf Kugelschreib bei mir, schöne Kugelschreib mit Schloß, Kugelschreib mit Wappen von Stadt und mit Weißschwan, ganz weiß, Kugelschreib alle Farb, auch mit Herz allein oder mit zwei Herz.’
Johann mochte nicht widerstehen. Er warf schnell einen Blick in die rund ausgeschnittene Blumenmusterbluse und sah keinen Büstenhalter und erschauderte süß beim Anblick von zwei Herz, zwei großbesternten, prallen. Errötend klaubte ich ein paar Zwanziger und einen Fünfziger hervor, wagte nochmals einen Blick, konnte mich nicht satttun an zwei Herz, an der saftig blühenden Busenweide mit den quellenden Sternblumen. Sie verwirrten, sie betörten mich.
,Will du Kugelschreib mit Herz oder will du kein Kugelschreib?’ sagt die Schöne mit dem roten Mund, die Großbraunäugige hinter der Zeitungslade.
Unschlecht kommt wieder zu Atem; ,Ja, mit Herz’, sagt er und schluckt heftig leer, ohne das üppige Brustbild aus den Augen zu lassen, denn, verdammt nochmal!, diese Oberpartie ist mir erst kürzlich vorgekommen. Haben nicht diese nackten Brüste mein Mittagsschläfchen gestört?
,Diese Blaue mit Herz allein oder mit zwei Herz und andere Farb?’ höre ich.
,Den Blauen mit Herz allein.’
Gegen das plötzliche Erblühen meines Baumes, gegen dieses unvermeidliche genierliche Vom-Leder-Ziehen meines Säbels half nur eins: Abhauen!, und zwar sofort!
Der alte Scherer, auf der Bellevueterrasse wie immer an trägen Sommertagen, wenn die Luft nach See riecht und voll Mücken und Spinnfäden ist und nur vereinzelte Touristen so lange müd im Schatten herumschleichen, bis sie vom Pfeifsignal – dreimal lang – zur Retourfahrt den See hinab aufs Dampfschiff zurückgetutet werden, saß in der Sonne, der alte Scherer, und sparte seinen Durst auf den Abend; da sah er Unschlecht kommen und stand auf. Vorgebeugt übers Balkongeländer rief er mir heiser zu, ich solle meinen Kahn in Zukunft nicht mehr an der Gästeboje festmachen, meine lecke Kiste könne ich anderswo anbinden, er habe es mir nun schon oft gesagt, jetzt sage er’s zum allerletzten Mal. ,Kapiert!’ kläffte er von oben herab.
DAS DRITTE KAPITEL
berichtet von Unschlechts Küche, einigen minder wichtigen und einigen besonderen Kennzeichen und von einem andern Namen.
Um der Wahrheit willen, die auch Sie nie umbiegen sollten, müssen Sie gestehen, daß Sie zu bequem gewesen sind, mit Unschlecht in die Stadt hinüber und wieder zurückzurudern; auf der Insel ist es nämlich viel zu gemütlich. Zwar gibt es Wolken von Mücken, auch Bremsen und Fliegen in Schwärmen, aber du liegst wie ich gern faul im lichtbefleckten Schatten, halb in der Sonne; ein Stück Treibholz am Ufer, warm und reglos.
Da er südseits angelegt hat, schnauft Unschlecht den geraden Weg hinauf. Er sieht besorgt aus, also denkt er. Sie sehen den besorgten Denker in seinem Haus verschwinden. Er geht in die Küche.
Diese Küche war einst schön gleichmäßig kalkweiß getüncht, ist jetzt weniger gleichmäßig gelbbräunlich bis schwarzgräulich verrußt, und wenn du es genau nehmen willst, ist Johanns Küche verfettet, ölverdampft, dampfverfleckt, verfärbt und bis in die Ecken hinein verspritzt: eine verluderte Dreckküche. Unschlechts Küche macht tatsächlich den Eindruck einer oft und immer umständlich und noch nie fachmännisch benützten Küche.
Da gibt es einen Holzfeuerherd. Viereckig, klobig, schwer, schwarzschillernd, schmutzig. Fast so breit wie lang: hundertvierzig Zentimeter tief und bei hundertfünfzig Zentimeter Länge einszwanzig hoch. Oben vorn eine Stange und an der rechten Breitseite noch eine Stange. Von der Verchromung dieser Stangen sind nur ein paar nicht abgeschabte, nicht abgeschlagene, nicht abgesprungene, zäh haftende, eher blindblinkende als blankblitzende Splitter übriggeblieben. Ein größeres Eisentürchen hält den Backofen dicht; kleine, mit rund vorstehenden Belüftungstellern an schwarzen Gewindedornen, versuchen anderswo, zum Beispiel im kleinen Bratofen, allfällige Wärme zusammenzuhalten, andere verschließen ein geräumiges Warmhaltefach und die unterteilte Feuerstelle, deren Ziegel taub und aschfahl ausgeglüht aufs nächste Holzkohlefeuerlein bangen. Sie versperren einen verklemmten Spezialluftabzug und ein dunkles Loch links unten: Unschlechts Geheimfach, in dem er seine Socken im Schnellverfahren zu trocknen pflegt, wenn es hin und wieder vorkommt, daß er einen Schuhvoll herauszieht und die wasserziehende Sonne nicht recht scheinen will. Ein durchgerostetes Schiebblech zwängt sich vor eine überquellende Aschtruhe. Daneben ein schmales Wasserfaß aus verzinntem Kupfer unter verhockter rauher Kalkschicht; es senkt sich in dunkelste Herdtiefen hinab und ist stets leer. Im Sommer wird der Herd kaum je gebraucht, bleibt wochenlang außer Betrieb, faucht nicht, dampft nicht, knattert nicht, kesselt und böllert nicht, setzt nur Rost an, und das läßt ihn so kalt wie er ist.
Die Schlachtbank. Rechts von diesem gewaltigen Ofen, der nicht umzubringen ist, steht Unschlechts Schlachtbank. Eine überaus solide Konstruktion, kreuzweis verkeilte Harthölzer, dreimal von breiten Eisenreifen eng umringt. Dieses Stirnholz des Todes hat jeden Fischtod, jede Hinrichtung und jeden Hackbeilschlag ausgehalten, seit in Unschlechts Küche mit Hackbeilen knapp hinter fischäugigen Fischköpfen und hellroten Kiemen durchgehackt wurde – ein an dieser Stätte von altersher geübtes Handwerk, durchaus ehrsam und reell.
Die am Rande des Holzes klebenden, mit den Jahrringen verwachsenen harten Fischschuppenkrusten ersetzen mir, wenn ich an jene Zeit zurückdenke, den Geschichtskalender in ungefähr gleicher Weise wie etwa die jährlich erneuerten Anstriche bei alten Kähnen: Da kommt zuerst eine Gift- oder Grundfarbe aufs Holz oder aufs Eisenblech. Dann Mennig. Dann Blau auf Mennig. Rot im nächsten Jahr auf Blau. Im Trockendock wird Grün gemischt. Grün kommt auf Rot. Übers Jahr Weiß auf Grün. Übers Weiß nochmals Weiß. Dann zweimal Rot, einmal purpurn und einmal, als man anno dreiunddreißig einen Landstreicher fürs Anstreichen anheuerte, Scharlach, was man gar nicht wollte, was Ihnen mißfiel, weil Scharlach keine Farbe ist oder zumindest ungesund; damit fängt man keine Fische, mit Scharlach geht man nicht zu Wasser. Darum schnell einheitlich darüber und seither mit nur kurzen Unterbrüchen bis vor zwei Jahren mehr oder weniger im gleichen Ton: Weiß.
Zuerst also Weiß auf Scharlach. Und Schicht über Schicht fortan Weiß, Weiß, Weiß. Neunundzwanzig Jahre lang Weißweißweiß. Anno sechsunddreißig Olympisch Weiß. Neununddreißig immer noch Weiß – man wußte noch nichts von der Sauerei an der Polengrenze, anno vierzig wußte man’s und blieb trotzdem bei Weiß. Weiß war am billigsten. Es war, habe ich mir sagen lassen, die Zeit der sangesfreudigen Deutschbündler und die starke Zeit des eher schweigsamen Käsers Emil Moser von Jona. Moser und seine paar Spießgesellen sprengten sämtliche zwar verbotenen, aber aus Rücksicht auf den nahen Schnudernasenschnauzsieger geduldeten Sieg-Heil-Versammlungen; mit Stuhlbeinen und Munifiseln wurde ,Deutschland Deutschland über alles!’ grob und ohne lange zu fackeln abgeklemmt und an die frische Luft gestellt. Vorsichtige Leute kauften dem Moser Migg keinen Schnefel Käse mehr ab.
Einundvierzig Weiß, während die Feldgrauen braun wurden und es braun in die nigelgenagelten vaterländischen Nagelschuhe trielte. Hellweiß. Gelblichweiß. Sehr siegesgewiß Weiß, dann leicht Rosaweiß, und dann – Stalingrad eingekesselt, im Eimer – ein weniger aggressives Weiß, aber immer noch Endsiegweiß anno vierundvierzig. Schließlich Dunkelweiß. Dann mit wiederum sauber ausgewaschenem Pinsel reinstes Weißweiß übers Dunkelweiß, so unbescholten Weißwestenweiß. Das nächste Mal konnte man sich schon weniger Weiß aufs Weißweiß leisten. Aber trotzdem: vor Farbschwere machte der Kahn nur noch halb soviel Fahrt wie an jenem ersten blauen Jungfernfahrtsfrühling anno sieben oder acht.
Die Schlachtbank in Unschlechts Küche, nähme ich mir die Mühe, wüßte noch mehr auszusagen als nur Farbgeschichtliches. Da wären magere und fette Jahre festzustellen:
Zum Beispiel gute Barschfänge, wahre Egliorgien, wahrhaftige Rehlingüberschwemmungen anno zweiundvierzig; dann die schmalen Ergebnisse jenes ewiglangen flauen achtundvierziger Sommers, der die Fischschwärme in kühle, beinah unerreichbare Tiefen absinken ließ. Ferner die großen Felchenfänge vom Herbst des folgenden Jahres; die Ware war kaum loszubringen.
Und dann das gräßliche fünfundfünfziger Fischsterben, das am Stirnholz in meiner Küche nur wenig auftrug: es ist getreulich vermerkt und, obwohl nur schwach, dennoch deutlich abzulesen.
Ein Jahr drauf, die Scharte quantitativ auswetzend, was hingegen Qualität anbelangt, ohne große Wellen zu machen in die Bresche springend, vielmehr in die Netze schwimmend: Schwalen. Riesige Schwärme Schwalen. Erstaunlicherweise seit dreiundvierzig sich langsam, aber ständig wunderbar vermehrend. Als ob es nach der Schrift ginge. Schwalen ohne Zahl. Kähne voller Schwalen. Zum Zerreißen gefüllte Netze. Überdrüssig viel Schwalen. Zum Kotzen viele.
Fast keine Forellen anno sechsundfünfzig. Im nächsten Lenz ein Schwarzbrachsmenfang, daß darob die älteren Netze rissen. Zwei Jahre später ein denkwürdiger Aletzug, schwalendurchsetzt natürlich. Dann wieder nichts als Schwalen. Und nochmals Schwalen im Alleinfang.
Dann endlich wieder eine gefräßige Egligeneration. Sie räumte auf. Sie fraß alles, sie fraß die trüben Strömungen sauber. Die Hechte kamen wieder. Schwalenplage wurde zur Schwalennot.
Immer Schuppen, Schuppen, Schuppen. Stiebende, harte, weiße, bläuliche, gelbliche, durchsichtige, kleine, große, festsitzende, klebende, angewachsene, trocken haftende. Schuppen und nochmals Schuppen. Die guten und die ganz guten und die mieseren Jahre kamen und gingen, gaben viel Vokabular zu Fischerlatein her: schlau gewesen, gewußt wo Fisch und wann wo Fisch und wie Fisch fangen!
Der See ist tief.
Vom rotgraublauweißschwarzgesprenkelten Schüttstein in der Küche nimmt Johann einen Holzteller, und mit einem dünngeschliffenen Metzgermesser säbelt er zu gleichen Teilen Brot vom Laib und Scheiben von der Wurst. Sein Hunger ist so groß wie sein Maul. Ein gehäufter Holzteller ist schnell kahlgefressen. Unschlecht stopft, schmatzt, kaut, mahlt; er stiert hierhin und dorthin, meist auf den blauen Kugelschreiber mit Herz allein. Stößt auf. Rülpst. Mahlt weiter. Unschlecht arbeitet konzentriert.
Mit beiden Händen und allen zehn Fingern aß ich, denn Erben macht hungrig, und nur wer Hunger hat, frißt sich ohne Scheu durchs Leben. So schlau bin ich, daß ich mir derlei Rezepte merken kann.
Es ist ein kühler Trunk gewesen, ein frischer Schluck ab der Wasserleitung, der meine Atzung abschloß; denn das Bier fehlte leider, mußte fehlen, da es, inzwischen sonnenwarm geworden, am Westufer im Gras lag und wahrscheinlich fast die Flaschen sprengte.
Ein dröhnender Rülpser markiert das Ende der breit angelegten Unschlechtmahlzeit, worauf sich Johann Ferdinand erhebt und, jetzt erleuchtet lächelnd, zum blauen Kugelschreiber greift, die Küche verläßt und über den Gang zur nächsten Türe hinein in die Stube trampelt.
Sie sehen ihn zum Paß greifen. Sehen, wie er blättert und sich jetzt erneut auf dem Foto besichtigt. Jetzt sehen Sie ihn den alleinherzigen Blaukugelschreiber bereitmachen. Jetzt hören Sie einen Räusper. Unschlecht setzt sich zurecht. Er hat Großes im Sinn.
Die Striche kommen wie Hiebe. Einmal! Zweimal!
Wo soeben noch von Amtes wegen zu lesen war: Besondere Kennzeichen – Keine, liest du jetzt: Besondere Kennzeichen – Strich Strich. Die Unschlechtsche Zunge züngelt unter den geweiteten Löchern der Unschlechtnase. Johann schreibt.
Unter die abriegelnden Doppelstriche, die einen unverkennbaren Zug ins Große haben, setzt er mit Nachdruck: Siehe hinten.
Und hinten, auf der letzten Seite schrieb er – ich möchte heute nicht mehr allzu nah auf meine damalige, ziemlich eigenständige Rechtschreibung eingehen – schrieb ich, der ich auch kein Analphabet war, mit kräftig verklemmtem Alleinherzblaukugelschreiber: Besondere Kennzeichen – Folgende.
Dahinter setzt Unschlecht zwei dicke Punkte grad übereinander: Doppelpunkt! –:
Große Füße schöne Augen graugrün gesunde Zähne stark und noch alle. Inselbesitzer der Insel mit Nutzrecht zum Fischen und allem außer Kormoranvögel und unter überzwanzig Zentimeter großen Egli und anderen Raubfischen. Lange Beine.
Drauf zieht er die Papiere aus dem gelben Umschlag zu Rate und schreibt, nachdem er sich eingehend informiert hat:
Zirkel von eintausend Meter Radius von der Inselmitte aus gemessen. Einschränkung von Dommeln Schnepfen Wachteln. Von Stund an ein erwachsener Mensch.
Damit sind die hinterste und zweithinterste Seite meines Passes vollständig besonders gekennzeichnet. Unschlecht findet es mager. Er weiß noch mehr Besonderes und blättert um, schreibt, nun wieder sozusagen freihändig, ohne Blick in irgendwelche Dokumente:
Sehr stark kennt See und jeden Fisch. Kann tauchen auch schielen mit beiden Augen oder nur mit einem und singt hoch und tief. Sehr guter Fischer mit Netz oder Köder. Auch mit Rute. Guter Kalfatermann ohne Teer nur Werg sonst nichts. Kann mit Finger pfeifen kann weit spucken trifft immer kennt Wetter und den Wind. Kann furzen wenn er will laut und tief tauchen auch ohne Luft. Mit den Ohren wackeln mit beiden oder nur mit einem Ohr. Erstklassiger Schiffer kennt jede Strömung.
Johann wurde munter und besann sich auf seine Talente: Kann gut klettern Dächer oder Bäume spielt keine Rolle. Breite rote Narbe hinten unten links von früher.
Er dachte nach. Es war an ihm, das nachzuholen, was andere in ihren Kanzlistenbüros übersehen oder unterschlagen hatten.
Kann gut fluchen, schreibe ich. Und untenhin setze ich für Sie gleich fünf einschlägige Beweise: Huereseich! Schofseckel! Tumme Siech! Pfyffeteckel! Herrgottschternechaib!
Ans Ende der Liste aber hängt Johann Ferdinand sein großes Unschlechtsiegel: Leck mich am Arsch!
Ich hatte Pech. Der Kugelschreiber, blau und mit Herz allein, wollte trotz Lippenlecken und Nasenbohren keine besonderen Unschlechtkennzeichen mehr hergeben. Ihr Johann gibt auf, wenigstens für heute. Was er morgen oder übermorgen Besonderes an sich entdeckt, wird er eintragen, und wenn dabei ein zweiter Kugelschreiber, ob einherzig oder mit zwei Herz, dranglauben muß.
Ziemlich stolz, ich muß es gestehen, las ich von hinten nach vorn über mehr als viereinhalb Seiten, was des alten Unschlecht Sprößling alles war, was er konnte, was er wußte und was er hatte. Und da bemerkte ich, daß ich beinahe das Wichtigste vergessen hätte.
Befolgte also noch schnell vor dem Eindunkeln den guten Rat unseres Stadtschreibers Schönbächler – gewußt wo Fisch und wann wo Fisch und wie Fisch fangen – und beliebte, wo mit einem feinen Sternchen angedeutet, meine Unterschrift in den Paß zu setzen, nämlich: HANS JOHANN UNSCHLECHT.
Weder Sie noch ich, kein Mensch, niemand weiß, wo Unschlecht seinen einmaligen Ferdinand gelassen hat, warum er gerade ihm nicht den gebührenden Raum in seinem neuen Paß gab.
DAS VIERTE KAPITEL
weissagt Unschlecht Ungutes.
Es hat gedunkelt, ist Abend geworden. Draußen im See: die Insel.
Und als Hans Johann Ferdinand Unschlecht im Dämmer die Schifflände anlief und seinen schwerfälligen Kahn vertäute, saßen, wie an jedem lauen Sommerabend nach einem heißen Tag, unsere alten weisen Männer auf den roten Bänken des Verkehrsvereins, saßen unter den Roßkastanienbäumen am Hafen und beobachteten mich, seit ich hinter dem Dampfschiffsteg hervor in Sicht gekommen war.
Und zwar beobachteten sie mich, den sonst kaum jemand beachtet hat, weil es sich innert ein paar Stunden auch in ihren weisen Kreisen herumgesprochen hat, daß ich ab heute nicht länger nur Buchsers Beimann bin. Heut ist Unschlechttag, ab heute bin ich Unschlecht!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!