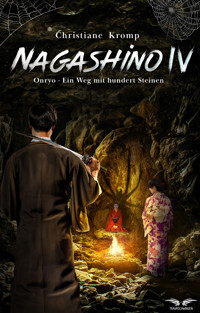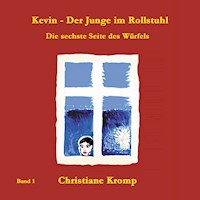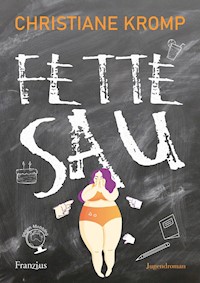12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franzius Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Tennessee, 1817. Den wohlhabenden Farmer John Bell suchen Geistererscheinungen heim: Ein unheimliches Wesen treibt sich auf seinen Feldern herum, eine Frau löst sich vor Johns Augen in Luft auf, es klopft des Nachts an Fensterläden und Wänden des Farmhauses – ohne, dass ein Verursacher zu finden wäre. Über Wochen wird die ganze Familie immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Schließlich vertraut sich John seinem besten Freund James Johnston an. Aber sowohl Johns eigene Versuche, den ungebetenen Gast loszuwerden, als auch die von James scheitern. Immer mehr Familienmitglieder leiden unter dem Poltergeist. Und schließlich wird Bell krank. Doch liegt das wirklich an übernatürlichen Manifestationen? John beginnt zu zweifeln … Laut der „Legende der Bellhexe“ wird der siebzigjährige John Bell 1820 im heutigen Tennessee durch einen Poltergeist vergiftet. Der Roman ist die Anatomie dieses Mordes: So nah wie möglich an den echten Ereignissen, jedoch fast ohne Einbeziehung übernatürlicher Kräfte, versucht die Autorin, den Mordfall zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Ähnliche
CHRISTIANE KROMP
DIE
HEIMSUCHUNGEN
DER FAMILIE BELL
Ein Buch aus dem FRANZIUS VERLAG
Cover: Jacqueline Spieweg
Bildlizenzen: shutterstock
Korrektorat/Lektorat: Petra Liermann
Verantwortlich für den Inhalt des Textes ist die Autorin Christiane Kromp
Satz, Herstellung und Verlag: Franzius Verlag GmbH
ISBN 978-3-96050-175-6
Alle Rechte liegen bei der Franzius Verlag GmbH
Hollerallee 8, 28209 Bremen
Copyright © 2020 Franzius Verlag GmbH, Bremen
www.franzius-verlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie zum Beispiel manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Daten-speicherung. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
INHALT
Prolog: Unerklärliche Vorkommnisse
1: Exorzisten
2: Hexenwerk
3: Die Frau im Baum
4: Terror
5: Das Jahr ohne Sommer
6: »Sie« spricht
7: Vom Gespenst, das seine Zähne suchte
8: Sündenfeuer
9: John Black
10: »Mein Name ist Kate«
11: Kate Batts
12: Apokalypse
13: Kate aus Upper Town Creek
14: »Gestatten, Mr. Mize, Magier«
15: Von North Carolina nach Tennessee
16: Gift?
17: Eheanbahnung
18: Lucy
19: Das Buch Tobis
20: John verliert seine Schuhe
21: Ankunft und Neuanfang in Tennessee 1805
22: Der Besuch der Cherokee
23: Höllenqualen
24: Banditen
25: Schatzsuche
26: Feinde
27: Benjamin
28: Joel
29: Verdacht
30: Erinnerungslücken
Epilog
Anmerkungen der Autorin
Anhang
Stammbaum der Familie Bell
Historischer Überblick in Stichworten
Prolog: Unerklärliche Vorkommnisse
Tennessee, Red River, im September 1817
»Wie kommt ihr mit der Ernte voran, Higgens?«, fragte John Bell seinen Vorarbeiter.
»Wir sind dem Plan voraus, Sir!«, meldete dieser. »Es sind nur noch zwei Felder abzuernten – und dieses hier ist das größte.«
John nickte. Eine Weile noch stand er am Rande seines Baumwollfeldes, den Hut unter dem Arm. Er strich sich die Haare und den Schweiß aus der Stirn. Die Septembersonne brannte erbarmungslos auf sein lichter werdendes Haar und er drückte sich den schweißgetränkten Hut wieder auf den Kopf. Ihm stand der Sinn nicht nach einem Sonnenstich. Das Gesumme zahlreicher Insekten erfüllte die Luft, ebenso der monotone Arbeitsgesang seiner Sklaven, die schwere Kiepen auf die dunkel glänzenden Schultern luden – Kiepen mit geernteter Baumwolle. Die Stimmung war so fröhlich, wie die schwere Arbeit das eben zuließ.
Bell wippte in den weichen Lederstiefeln auf die Fußspitzen und wieder zurück auf die Sohle. Er liebte es, in die Weite zu lauschen, seine Gedanken treiben zu lassen.
Dies alles hatte er alleine aufgebaut. Dreizehn harte Jahre hatte es ihn gekostet, seit er mit seiner Frau und seinen sieben ältesten Kindern hier in Tennessee das Land mit dem ersten Blockhaus gekauft, dieses ausgebaut, die ersten Felder neu bepflanzt hatte. Heute hatte er Bedienstete, er besaß über fünfzig Sklaven und die reiche Ernte seiner Felder gab ihm und seiner Arbeitsweise recht: Gott war auf seiner Seite.
Wohlgefällig blickte er auf die Baumwollbüschel an den Sträuchern und auf die Baumwollwolken am Himmel, die ein abendliches Gewitter ankündigten. Sein Blick schweifte über seinen Besitz und eine tiefe Zufriedenheit erfüllte ihn. Ja, Gott hatte es wahrlich gut mit ihm gemeint.
Leise vor sich hin pfeifend machte er sich zu Fuß auf den Weg zur Nordgrenze seines Besitzes, wo ein Zaun repariert werden musste. Gestern hatte er Higgens daran erinnert. Langsam wanderte John über seine Wiesen und zwischen seinen Feldern entlang, auf denen schon hoch der Mais stand.
Da nahm er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahr, begleitet von einem Rascheln. Ein hellbraunes Tier erschien zwischen den Fruchtständen, ein Hund, wie er meinte – und sicher keiner von seinen! Er runzelte die Stirn und blickte genauer hin. Eisiger Schrecken durchfuhr ihn. Das war kein Hund, beileibe nicht! Das war überhaupt kein Tier, das er kannte oder dessen er schon einmal ansichtig geworden wäre: Es hatte den Körper eines Hundes, aber den Kopf eines Hasen! Es war ein Ungeheuer! Welche Mächte der Hölle ...?
»Bei des Himmels Barmherzigkeit!«, stieß er hervor und schlug sich die Hand vor die Brust. Dann griff er, immer noch zittrig vor Schreck, nach dem Gewehr, das er immer über dem Rücken hängen hatte, und schoss. Fünf Schüsse gab er auf das Teufelsbiest ab, dann rannte er in Richtung seines Hauses davon. Augenblicke später kamen ihm drei kräftige Diener entgegengeeilt.
»Herr haben geschossen! Was sein geschehen?«, fragten sie aufgeregt.
»Ein Teufelswesen, da hinten im Maisfeld!«, rief er. »Darauf habe ich geschossen!«
Alle schauten sie John an, zögerten, warteten auf seine Anweisungen. Er war ein strenger Herr.
Er wies mit dem rechten Arm in die Richtung, aus der er gekommen war. »Ihr zwei, ihr geht und schaut, ob es noch da ist. Von hinten ein Hund, von vorne ein Hase, mit anderen Worten: ein Ungeheuer!«
»Ein Ungeheuer, Herr?«
»Vertreibt es aus meinen Feldern! Nur der Teufel kann ein solches Geschöpf geschickt haben!«
Zwei der Diener machten sich mit schnellen Beinen auf den Weg. Der dritte stand immer noch bei John. Der spürte auf einmal tiefe Erschöpfung. »Du, Junge, begleitest mich heim!«, brachte er hervor.
Später am Tag fragte er die beiden Diener, ob sie das Tier gesehen hätten.
»Ja, Herr, wir es vertrieben haben, es sein fortgelaufen, in Wald!«
Das war das erste von einigen sehr sonderbaren Ereignissen im Hause Bell und John sollte sich später immer wieder daran erinnern. Zunächst jedoch vergaß er den Vorfall über die Anspannung der Ernte, säumige Kunden und Zwischenhändler und einen immer wieder aufflammenden Streit mit einer Nachbarin.
Etwa eine Woche später saß die ganze Familie Bell am reich gedeckten Tisch. John war gerade dabei, das Tischgebet zu sprechen, da klopfte es plötzlich an den Fensterladen. John stutzte kurz, brachte aber erst das Gebet zu Ende, bevor er das Fenster und den Laden öffnete, um dem Klopfen auf den Grund zu gehen. Doch niemand war draußen zu sehen. Abendliche Windböen schüttelten die Bäume. War es ein Ast des mächtigen Birnbaumes gewesen, der neben seinem Hause wuchs? Er zuckte mit den Schultern, schloss Laden und Fenster und nahm unter den erwartungsvollen Blicken seiner Familie seinen Platz an der Tête des langen Eichentisches wieder ein.
»Es war nichts. Fangen wir an zu essen«, sagte er. Doch kaum hatte er nach dem duftenden, frisch gebackenen Brot gegriffen, da fiel der Deckel vom Topf mit dem Eintopf von alleine herunter und rollte über den Boden. Die Bells zuckten vor Schreck zusammen, alle starrten John an. Doch der ließ sich nicht stören und biss herzhaft in das Brot.
In unnatürlichem Schweigen verlief das Abendessen. Wieder und wieder klopfte es in dieser Nacht an die Wände, an die Fenster, an die Tür und nie war irgendjemand in der Nähe. Lucy, Johns Frau, hörte nicht mehr auf zu beten. Sie hielt die Hände auf dem Schoß verschränkt, lautlos die Lippen bewegend.
An diesem Abend forderte John seine ehelichen Rechte ein, denn sonst hätte er keinen Schlaf gefunden. Mitten in der Nacht krachten Blitz und Donner, heftiger Regen entlud sich über dem Hause der Bells. John fuhr aus dem unruhigen Schlummer, der ihm seine Gedanken monströs im Traum ausgemalt hatte. Dämonen hatten ihn gejagt. Schweiß stand auf seiner Stirn. Er setzte sich im Bett auf, eine Bewegung, die Lucy neben ihm zu wecken schien. Ihre Hand griff nach seinem Arm wie eine Ertrinkende, die nach Rettung sucht. Sie klammerte sich dicht an ihn und er löste ihren Griff und rückte von ihr ab, unangenehm berührt.
Wieder krachte ein Blitz. Lucy stieß einen kleinen Schrei aus. Sie hatte sich schon immer vor Gewittern gefürchtet. John fand das höchst albern, verdrehte die Augen. Dieses blöde Weib.
»Es ist nur ein Gewitter!«, fuhr er sie an. »Nimm dich zusammen, du bist doch kein Kind mehr!«
»Es ist nicht nur der Donner, der mich erschreckt, John. Es ist das Klopfen die halbe Nacht. Vorhin habe ich sogar ein Heulen gehört und ein Flattern wie von Flügeln auf dem Dach.« Auch sie richtete sich zum Sitzen auf. »John, was für dämonische Wesen haben wir da bloß im Haus?« Bei diesen Worten zog sie die Decke enger um sich, als fröstele sie. »Jesus Christus stehe uns bei gegen alle Mächte der Hölle!«
John blinzelte kurz. Sollte er Lucy sagen, dass er sich genau vor den gleichen Mächten fürchtete? Nein. Sie sollte sich nicht beunruhigen. Morgen würde er der Sache auf den Grund gehen.
Also knurrte John: »Unsinn! Das waren keine höllischen Mächte, das waren Zufälle!«
»Und das Klopfen vorhin?«
»Der Wind!«
»Und der Deckel?«
»Zufall!«
»Ich hoffe, du hast recht, John!«, seufzte Lucy.
Kurze Zeit später schon hörte er ihre ruhigen Atemzüge. Sie war eingeschlafen. John aber lag noch eine ganze Weile wach. So sicher, wie er gegenüber seiner Frau getan hatte, war er sich nicht, woher die Geräusche kamen.
Er versuchte sich an die Zufriedenheit zu erinnern, die ihn vorhin erfüllt hatte, bevor das Ungeheuer ihn erschreckt hatte. Denn zu solchen Gefühlen hatte er durchaus das Recht. Trotz der ausgefallenen Ernten des letzten Jahres stand er wirtschaftlich immer noch recht ordentlich da. Und obwohl in diesem Jahr das Wetter wieder warm und sonnig war, fröstelte es John bei diesen Gedanken: Ihm stand immer noch lebhaft vor Augen, welch kläglichen Anblick die Felder unter dem Raureif von 1816 geboten hatten. Umso dankbarer und erleichterter war er, dass er jetzt die Ernte dieses Jahres einbringen konnte und wieder Waren zum Verkaufen hatte – vermutlich sogar zu besseren Preisen als jemals zuvor.
Seine Frau Lucy hatte ihm zur Seite gestanden in all der Zeit, sie war ihm ein gutes Weib. Mittlerweile hatte sie ihm zehn Kinder geboren, von denen neun noch lebten. Er konnte sich glücklich schätzen: Sechs kräftige Söhne waren darunter, die ihn bei der Arbeit unterstützten und die später sein Werk fortführen würden. Nach all diesen arbeitsreichen Jahren waren sie alle jetzt in diesem Land am Cumberland River verwurzelt, sie waren inzwischen ein Teil davon – und von dieser Gemeinde Red River. Seine drei jüngsten Kinder waren hier geboren. Seine Tochter Esther hatte gerade vor zwei Monaten Bennett Porter geheiratet, den Sohn eines der angesehensten Männer der Gegend. Mit dieser Vermählung hatte John das Wurzelgeflecht nochmals dichter gemacht und die Bells mit den Porters untrennbar verbunden. Das erfüllte ihn mit Genugtuung. Doch auch all diese guten Gedanken ermöglichten es ihm nicht, wieder in den Schlaf zurückzufinden. Ruhelos wälzte er sich von der einen Seite auf die andere, nickte kurz ein und schreckte sofort wieder hoch. Als er im Morgengrauen aufstand, fühlte er sich wie gerädert.
Der ganze nächste Tag verlief ohne weitere Zwischenfälle und außer einer bleiernen Müdigkeit hatte John keine Nachwirkungen zu beklagen. So tat er die Geräusche der letzten Nacht als unerklärbar ab und grübelte nicht mehr darüber nach. Bis zum Abend hatte er tatsächlich die Ereignisse des Vorabends vergessen. Allerdings fielen ihm kurz nach dem Abendessen die Augen zu, sodass er sich unverzüglich zu Bett begab. Kaum hatte er das Kissen berührt, war er auch schon eingeschlafen.
Er erwachte von einem stetigen Klopfen an den Fensterläden. Ein Klopfen, gefolgt von einem Rütteln, welches gar nicht mehr aufhören wollte. John zog die Brauen zusammen und stieg aus seinem Bett. Das Nachtlicht in der Hand, fand er den Weg zur Haustür. Auch von hier kam ein ständiges Poltern, als würden Steine dagegen geworfen. John war barfuß und im Nachthemd, doch im Moment dachte er nicht daran. Eisige Kälte kroch ihm, von den bloßen Fußsohlen ausgehend, den Körper empor. Die Härchen an seinen Waden und an seinen Oberschenkeln richteten sich auf, bis der Frost seinen Rücken erreichte und sich an ihm hochtastete, seine ganze Wirbelsäule entlang bis zu seinem Nacken.
Er schauderte, stellte das Licht auf dem Tisch ab und umfing sich selbst mit seinen Armen, um das innere Frösteln zu vertreiben. Mit der Kälte kroch auch Furcht in ihm empor, die er nicht ignorieren konnte. Da! Wieder dieses Rütteln an Fenstern und Türen. John machte sich von innen an einem der Riegel zu schaffen, die die Fensterläden geschlossen hielten. Doch seltsamerweise ließ der Riegel sich nicht bewegen, während es gleichzeitig von außen dagegen hämmerte, als ob irgendjemand oder irgendetwas hineinwollte, zu ihm, zu seiner Familie. Das durfte nicht geschehen. Und doch, er wollte den Geräuschen auf den Grund gehen. So versuchte er es an einem anderen Fensterladen, wendete all seine Kraft an, diesen zu öffnen – vergeblich. Vor Wut stieß er einen lauten Schrei aus.
»Los, geh schon auf!«, zischte er angestrengt, doch keiner der Riegel gab auch nur im Geringsten nach. Dafür hörte er nun hinter sich schabende Geräusche. Als er sich umblickte, kippte sein Nachtlicht schon über die Tischkante. Nicht einmal ein beherzter Sprung konnte es vor dem Herunterfallen bewahren.
John stand plötzlich im Dunkeln. Sein Herz schlug einen Trommelwirbel in seiner Brust, er hörte seinen Puls laut in seinen Ohren pochen. Von draußen war ein anschwellendes Heulen zu vernehmen. Waren hier widernatürliche Kräfte am Werke?
Wind heulte um die Ecken des Hauses, er konnte es hören. Die Geräusche waren ihm vertraut. Gab es am Ende doch eine natürliche Erklärung für das, was hier geschah? War es nur ein heraufziehender Sturm? Hatte er die Kerze einfach zu nahe am Tischrand platziert? Eben hatte er sie aufgehoben und wieder auf den Tisch gestellt ...
»Wer ist da?«, sprach plötzlich eine Stimme. Die Stimme von Jesse, seinem ältesten Sohn, der auf der Treppe stand und ihn anstarrte. Vor Schreck hätte John beinahe die Kerze noch einmal umgeworfen.
»Ich bin's, dein Vater«, gab er zur Antwort. Seine Stimme zitterte leicht.
»Vater, was tut Ihr hier unten? Ich habe Euren Schrei gehört.«
»Die Riegel gehen nicht auf«, erwiderte John.
Mit einem Satz war Jesse bei ihm und mit zwei weiteren langen Schritten an den Fenstern. Ohne jede Anstrengung zog er den Stift zurück. Der Laden flog auf, ließ einen Schwall kalte Luft und Hagelkörner herein, halb so groß wie Musketenkugeln. Wortlos zog sein Sohn die Läden und die Fenster wieder zu und verschloss sie erneut. Dann blickte er sich zu John um und zog die Augenbrauen hoch.
Verblüfft starrte John seinen Sohn an. Langsam und ungläubig bewegte er den Kopf hin und her, war dann mit einem Satz neben Jesse. Auch er konnte jetzt den Riegel ganz leicht verschieben.
»Geh zu Bett, Jesse«, ordnete John an.
Jesse nickte und machte sich wieder auf den Weg nach oben.
John blickte ihm hinterher. Bald schon würde Jesse die schöne Martha Gunn ehelichen, die Tochter des respektablen Reverend Thomas Gunn. Den Ehevertrag hatte John eigenhändig ausgearbeitet, unterstützt von einem guten Rechtsanwalt aus Nashville. Er war es sehr zufrieden. Esther war nicht weit fort und auch Jesse würde mit seiner zukünftigen Frau in der Nähe wohnen. Es könnte alles so schön sein. Wenn ihm nur nicht diese seltsamen und unheimlichen Vorkommnisse noch in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung machten. Noch galt er als sehr angesehenen, noch waren seine Kinder gute Partien, die jeder gerne in seiner Familie aufnehmen mochte. Bis vor ein paar Tagen war er sicher gewesen, dieses Ansehen in der ganzen Gemeinde zu besitzen, für sich selbst und für seine Kinder. Sollten sich jedoch Gerüchte verbreiteten, dass höllische Kreaturen bei ihm ihr Unwesen trieben, dann wäre all seine Mühe vergeblich gewesen.
Eine Gänsehaut überkroch seine Arme und ließ ihn abermals schaudern. Keiner seiner Nachbarn würde noch mit ihm zu tun haben wollen.
Der nächste Tag war ein Sonntag. John war froh, am Morgen von der unterbrochenen Nacht nicht mehr so viel bemerken zu können. Er hatte sich sofort wieder zur Ruhe begeben und tief und so fest geschlafen wie ein Toter. Jetzt beaufsichtigte er draußen die Arbeiten für den Winter. Die Sklaven hackten Holz und das musste hinterher in den Schuppen gebracht, gestapelt und getrocknet werden, damit die Familie im Winter genügend Feuerholz hatte.
Nach diesen Arbeiten bestieg er Nelson, seinen treuen Fuchs, hieß seine Familie in den Wagen steigen und dann ging es zum Gottesdienst. Auf dem Wege nahm er zu seiner Beruhigung wahr, dass der Hagel von gestern Nacht erstaunlich wenig Schäden hinterlassen hatte.
In der Kapelle überkam ihn dann doch die bisher ausgebliebene Müdigkeit. Er rieb sich die juckenden Augen. Während der Predigt nickte er immer wieder ein. Gut, dass er sich dieses Mal nicht zu weit nach vorne gesetzt hatte. Er schwitzte bei dem Gedanken, jemand könnte seine geistige Abwesenheit bemerken und sie falsch deuten, ihn gar der Gottlosigkeit bezichtigen. Denn diese Verfehlung in Zusammenhang mit seinem häuslichen Problem würde nicht unbedingt für ihn sprechen als den gottesfürchtigen Mann, als der er im Allgemeinen galt. Und doch dämmerte er in der Wärme und Dunkelheit der Kirche immer wieder weg, je länger er dort saß. Deshalb war er froh, sich nach dem Segen wieder bewegen zu dürfen.
Im Klang der Glocke verließen sie alle das Gotteshaus. John schlenderte ein wenig beiseite. Da bemerkte er eine junge Frau in einem grünen Kleid. Sie war vielleicht fünfzig Schritte von ihm entfernt. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, es war von ihm abgewendet.
Das wird wohl eine von den Töchtern der Porters sein, dachte er. John rief ihr in einem spontanen Entschluss einen Gruß zu. Sie hob den Kopf und sah ihn an … und löste sich im selben Moment in Nichts auf wie ein Trugbild. Verblüfft starrte er zu der Stelle hinüber, wo sie eben noch gestanden hatte. Doch nichts war dort mehr wahrzunehmen.
»Was zum …«, murmelte er und lief schnell hinüber, dorthin, wo eben noch die Frau gestanden hatte. Doch als er an der Stelle war, gab es nichts zu sehen – keine Fußspuren, die sich bestimmt deutlich in dem weichen Gras eingeprägt hätten. Er bemerkte ja, wie tief er mit seinen Stiefeln an dieser Stelle einsank. Und doch gab es hier nur seine eigenen Spuren. Nicht einmal ein Tier war hier entlanggelaufen, erst recht keine Frau.
Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Ja, wurde er denn langsam verrückt? Konnte er seinen Sinnen nicht mehr trauen? Verzweifelt blickte er sich um. Die anderen Mitglieder der Gemeinde standen schwatzend vor der Kirche. Niemand hatte seinen Ausflug bemerkt. So straffte er sich denn, zog den Rocksaum nach unten und gab sich den Anschein völliger Unbeschwertheit, als er zurück zu den Seinen ging. Kein Wort verlor er über diesen Vorfall.
1: Exorzisten
Tennessee, Port Royal, im Herbst 1817
Am Montag brach John nach Port Royal auf, wo er einige geschäftliche Dinge zu regeln hatte. James Johnston begleitete ihn.
»Treffen wir uns heute Abend im Hotel Elysium«, schlug John vor. James hob grüßend die Hand und wendete sein Tier auf der Hauptstraße seinen Kunden zu, so wie John seine eigenen Leute aufsuchte. Bis zum Abend hatte er sich mit seinen Abnehmern geeinigt.
Die Vorschüsse für die Ernte diesen Jahres schon in der Tasche und hochzufrieden, traf John im Hotel ein. Er nahm sich ein Zimmer, verstaute sein Gepäck und stellte seinen Fuchs im Stall unter, wo dieser mit Heu und einem Sack Hafer gut versorgt wurde. Nun konnte John auch an sein eigenes Wohl denken.
»Herr Wirt, bringt mir doch von Eurem Stew. Das duftet ja ganz köstlich!«, bestellte John und setzte sich an einen freien Tisch.
»Aber gerne, der Herr«, entgegnete der Wirt eilfertig. »Wollt Ihr auch etwas trinken? Wir haben ein außerordentlich gutes Bier, damit schmeckt Euch der Stew noch einmal so gut.«
»Ist es stark?«, fragte John vorsichtig. Er hatte schon unliebsame Erfahrungen mit starken alkoholischen Getränken gemacht – und schließlich hatte er die Einnahmen vom Nachmittag in der Tasche.
»Ach, nicht der Rede wert!« Der Wirt machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ein großer und kräftiger Mann wie Ihr, was sollt Ihr denn von einem leichten Bier merken?«
»Ich halte mich mit Alkohol zurück.«
»Aber es ist ja die reinste Medizin, Sir!«, behauptete der Wirt jetzt. »Ihr schlaft viel wohler, wenn Ihr dieses wunderbare Gebräu getrunken habt.«
Nun wurde John aufmerksam. Er konnte ja tatsächlich nur sehr schwer einschlafen, weil er ständig an die unheimlichen Ereignisse denken musste.
»Ich schlafe besser?«, fragte er daher noch einmal nach.
Jetzt strahlte der Wirt über sein ganzes feistes Gesicht. »Aber ja. Fragt doch hier meine anderen Gäste, Mr. Jones dort drüben zum Beispiel. Auch er ist ein sehr sittenstrenger Mann, doch ein Bier des Abends … Sagt selbst, Mr. Jones!«, forderte er einen untersetzten, fast bulligen Mann Anfang fünfzig auf.
»Ihr habt recht, Herr Wirt«, entgegnete dieser nun und wendete sich John zu. »Gegen ein Bier am Abend nach einem langen harten Tag voller Staub und Schweiß ist tatsächlich nichts einzuwenden. Seit ich mir das gönne, schlafe ich besser und bin des Morgens ausgeruhter für meine Arbeit.«
»So?« John zog die Brauen hoch. »Was arbeitet Ihr denn, wenn ich fragen darf, Mr. Jones?«
»Ich bin Hufschmied«, sagte Jones voller Stolz. »Und Ihr, Mr. …?«
»Bell«, antwortete John und reichte dem anderen Mann die Rechte, die dieser herzhaft drückte. »Ich bin Farmer aus der Siedlung Red River.«
»Euer Diener, Sir«, erklärte Jones mit zurückhaltender Höflichkeit.
»Nun, und welcher Konfession gehört Ihr an, Mr. Jones?«, fragte John. »Ihr müsst nämlich wissen, dass ich selbst der Baptistischen Kirche angehöre und Alkohol trinken wir nur selten.«
»Ich gehöre der Methodistischen Kirche an, Mr. Bell.«
Johns Brauen kletterten bis zum Haaransatz. »Methodist? Und Ihr trinkt Bier? Was sagen denn Eure Ältesten dazu?«
»Da drüben sitzt einer von ihnen.«
»Wirklich?«
»Ja, Mr. Peabody ist Ältester und einer der Priester in dieser Gemeinde.«
Ein hagerer Mann im hinteren Teil der Stube lüftete seinen schwarzen Hut und prostete John zu.
Das überzeugte John. »So will ich es denn auch einmal versuchen.«
Bald stand der schäumende Trank vor ihm und er stillte seinen Durst mit großem Behagen. Gerade wischte er sich etwas weißen Schaum aus dem Mundwinkel, als James die Wirtsstube betrat. In der Tür blieb er verblüfft stehen.
»Aber John!«, rief er aus. »Was trinkt Ihr denn da?«
»Probiert es, es schmeckt ganz köstlich! Das ist das hiesige Bier.«
»Ich weiß, was es ist«, erklärte James amüsiert, indem er an den Tisch trat und sich auf dem freien Stuhl niederließ. »Also habt Ihr das herrliche Gebräu auch entdeckt, John? Ich werde mich Euch gerne anschließen.«
»Mir wurde versichert, es sei die reine Medizin. Ich merke schon, wie es mich angenehm ruhig und schläfrig macht.«
Sie prosteten einander zu. Kurz darauf bekam jeder eine Portion Stew vorgesetzt, die schnell von den Tellern verschwand.
»Hattet Ihr gute Geschäfte, James?«, fragte John nach dem Essen.
»Ich bin zufrieden«, schmunzelte James und klopfte sich vielsagend auf seine Brusttasche. »Und Ihr?«
»Ich kann nicht klagen!«
Sie tranken noch ein zweites Bier und gingen dann zu Bett. John schlief tatsächlich wunderbar in dieser Nacht und erwachte frisch und erholt am nächsten Morgen, frei von nächtlichen Störenfrieden, sowohl von innen als auch von außen. Der Wirt hatte recht gehabt. Das wollte er sich merken.
Nach einem eiligen Frühstück brachen John und James wieder nach Hause auf. Nur wenige Schritte waren sie geritten, als James auf einmal seinen Rappen verhielt und absprang. John zügelte seinen Fuchs und drehte sich zu dem Freund um.
»Was ist passiert?«, erkundigte er sich.
»Mein Pferd hat ein Eisen verloren!«
»Dann weiß ich, wo wir es wieder beschlagen lassen können!« Und er führte den Freund zu Jones, dem Hufschmied.
Nach ein paar Freundlichkeiten und dem geschäftlichen Teil plauderten sie mit dem Liebhaber des Gerstensaftes, während dieser mit seiner Arbeit begann.
Der Schmied war fast fertig mit dem Pferdeschuh, da erhob sich draußen eine große Unruhe. John hob den Kopf, sprang an die Türöffnung und spähte hinaus. Ein lärmender, Staub aufwirbelnder Pöbel bewegte sich ungeordnet wie ein Bienenschwarm über die breite Hauptstraße. In seiner Mitte befand sich irgendjemand oder irgendetwas, das den Unwillen dieses Mobs erregte.
»Sie ist besessen!«, schrie die Menge.
»Bringt sie zum Schmied, der treibt ihr den Satan wieder aus!«
Die lärmende Menge kam näher und näher, sie teilte sich und spie aus ihrer Mitte ein altes Weib in den Raum, welches unkontrolliert zuckend zu Boden stürzte. Dort schob sie sich, von Krämpfen getrieben, weiter fort. Ihre Augen waren so weit verdreht, dass nur das Weiße darin zu sehen war. John schauderte. Die Alte sah wahrlich unheimlich aus. Schaum troff aus ihrem Mund und sie gurgelte unverständliche Laute vor sich hin.
»Der Teufel spricht aus ihr! Hört nur, wie er spricht!«, schrie die Menge erregt. John wich vor dem Weib zurück, als es sich in seine Richtung schob. Hilfesuchend blickte er zum Schmied hinüber. Der wartete, bis die Frau regungslos liegenblieb, dann entkleidete und fesselte er sie, als wäre es nicht das erste Mal, dass er so etwas tat. Er schüttete ihr kaltes Wasser über den Leib. Sie erwachte mit einem Schrei.
Der Schmied jedoch holte einen dicken Strick und schlug sie hart, während er rief: »Weiche, Satanas, gib sie frei!«
Wieder schrie die Frau laut auf, diesmal vor Schmerz. In die Menge kam Bewegung, als sich der Älteste von gestern Abend hindurchdrängte. Er hielt die schwarz eingeschlagene Bibel hoch und betete laut und ohne Unterlass zu den Schlägen des Schmiedes. Das Publikum fiel unterstützend in die Gebete ein, so wie auch John und James.
Die Szene wirkte auf John gespenstisch, aber auf eine ungewöhnliche Art auch feierlich. Das laute Rufen der Gebete, nur unterbrochen vom andächtigen Singen von Kirchenliedern, untermalt mit dem Klatschen der Schläge, den Schreien der Gemarterten und dem erschrockenen Wiehern der Pferde – so etwas hatte John noch nicht allzu oft bezeugt. Er spürte, wie eine ungeheure Erregung aller seiner Sinne ihn ergriff.
Das Kreischen der Frau gipfelte in Bitten um Schonung und erneuten Schmerzensrufen. Sie rief Worte in einer fremden Sprache – und dann endlich wieder in vertrauten Lauten.
»Der böse Geist ist aus ihr gewichen, habt Ihr es auch gesehen? Lobet den Herrn!«, rief der Älteste befriedigt.
Jetzt lag die Frau still da, eine Ohnmacht hielt sie umfangen. John trat einen weiteren Schritt zurück, bis er die Bretterwand in seinem Rücken spürte. Er hätte schwören können, eine schwarze Rauchwolke gesehen zu haben, die gerade aus ihrem Mund gedrungen war. Prüfend schaute er zu James hinüber. Hatte der den Rauch ebenfalls gesehen? Doch der war damit beschäftigt, die Pferde stillzuhalten.
Erschöpft, aber offenbar befriedigt, hielt der Schmied inne und ließ das Tauende sinken.
»Der Geist ist aus ihr gewichen. Vielleicht aber kommt er wieder. Besser ist es, wir warten, bis sie wieder zu sich kommt. Lasst sie vorerst so, wie sie ist, und in Fesseln. Berührt sie nicht, auf dass der Dämon nicht auch Euch befalle.«
Ehrfürchtig staunte die Menge, jetzt still geworden. Viele der Männer hatten die Hüte abgenommen. Auch John hielt den seinen in der Hand. Ungerührt von dem Vorkommnis beschlug der Schmied das Tier zu Ende.
Als die Frau einige Zeit später wieder zu Bewusstsein kam, war der Teufel aus ihr verschwunden. Die Menge zerstreute sich und John war in höchstem Maße beeindruckt. Er unterhielt sich noch ein wenig mit dem Schmied und Mr. Peabody, die er beide auf ein weiteres Bier einlud, während James sich bereits auf den Heimweg machte.
»Nehmt es mir nicht übel, Mr. Bell«, entgegnete der Schmied und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich kann Eure Einladung heute nicht annehmen, ich habe noch zu tun.« Abschätzend maß er John, dann setzte er hinzu: »Ein anderes Mal gerne.«
Der Älteste und Priester hingegen ging mit John in die Schankstube, als wären sie alte Freunde.
»Das war ja fast wie ein Gottesdienst unter freiem Himmel«, gestand John dem Priester.
Dieser nickte ernst. »Dass wir alle unsere Gebete und Gesänge vereint haben, um dem Bösen entgegenzutreten, war immens wichtig! Nur so wird der Höllenfürst nachhaltig vertrieben und abgeschreckt, wieder in sein Opfer zurückzukehren.« Er beugte sich näher zu John hinüber, als wollte er ihm ein Geheimnis anvertrauen. John roch seinen sauren Atem. »Wisst Ihr, wir Männer sind seltener Gefäße für Dämonen. Die Evastöchter dagegen … Nun ja, sie sind leichter zu verführen, den Satan in sich einzulassen. Es sind eben nur schwache Frauen!«
Der Älteste nickte bestätigend und trank einen großen Schluck von seinem Bier. Den Schaum wischte er umstandslos mit seinem Ärmel ab.
»Ja, da mögt Ihr recht haben. Aber, wie Ihr gerade sagtet, es sind Frauen. War denn wirklich so viel Härte notwendig?«, fragte John interessiert.
»Schont ein solches Geschöpf und ihr schont den bösen Geist in ihr!«
Dieser Satz des Ältesten prägte sich John tief ins Gedächtnis.
Am nächsten Nachmittag war John wieder daheim. Zuallererst bat er Lucy, sich um die Kunst des Bierbrauens zu bemühen, da ihm dieser Trunk so gutgetan hatte. Sie versprach es ihm.
Zwei Wochen verstrichen, ohne dass es nennenswerte Störungen gab. Bis auf den Umstand, dass er und seine Söhne auf dem Weg zum Haus mit Tannenzapfen und Zweigen beworfen wurden, die aus dem Nichts zu kommen schienen, begann der darauffolgende Abend sehr ruhig und John fing schon an zu hoffen, dass es dabei bleiben würde. Er begab sich früh zu Bett, unten, in seinem Arbeitsraum. Lange konnte der Schlummer ihn noch nicht überwältigt haben, da ertönte von oben im Haus ein hoher lang gezogener Schrei. John zuckte sogar im Schlaf zusammen wie unter einem Peitschenhieb und war in einem Augenblick hellwach. Sein Herz pochte angstvoll und schnell. Wer, bei Christi Blut, war das gewesen?
Einen langen Moment konnte er sich nicht bewegen, doch als der Schrei sich wiederholte, schüttelte er die Lähmung seiner Tatkraft ab und hastete nach oben. Auf der Hälfte der Treppe hallte erneut ein Kreischen durch das Haus, wie es ein Mensch nur in höchster Not ausstoßen konnte. Das kam aus Betsys Kammer. Er riss ihre Tür auf. Und da stand seine Tochter mitten an die gegenüberliegende Zimmerwand gedrückt, die Augen weit aufgerissen, der Mund eine einzige Wunde von Furcht und Schmerz und Schrecken. Mit ihrem weißen Nachtgewand und dem totenbleichen Gesicht machte sie den Eindruck eines Geistes. Leichte Übelkeit befiel John bei ihrem Anblick. Er schluckte, doch das flaue Gefühl wich nicht von ihm. Ein schweres Gewicht lag auf seiner Brust, erschwerte ihm das Atmen.
»Betsy!«, japste er halblaut. »Was ist geschehen?«
»O Vater!«, rief seine Tochter und warf sich ihm in die Arme.
»Was ist hier geschehen?«, fragte er noch einmal, doch aus Betsy war außer anhaltendem Schluchzen nichts herauszubekommen. Sie klammerte sich wie eine Ertrinkende an ihn und ihm blieb nichts weiter übrig, als sie hilflos im Arm zu halten und zu versuchen, das Kind zu beruhigen. Er spürte, wie nass Betsys Hemd war. Sein Blick durchwanderte das Zimmer. Es sah aus, als wäre ein Tornado hineingefahren. Die Bettdecke lag auf dem Fußboden, die Laken waren völlig zerwühlt. Was, um des Himmels Barmherzigkeit willen, war hier geschehen?
Der Lärm in Betsys Kammer war natürlich auch Lucy nicht verborgen geblieben. Sie stürzte als nächste in die Kammer, gefolgt von John Jr. und Jesse.
Seine beiden Söhne tauschten Blicke mit John und stürmten entschlossen die Treppe hinunter, John dicht hinter ihnen. Die weinende Tochter hatte er einer verwirrt aussehenden Lucy in die Arme gedrückt.
Bewaffnet mit Musketen stießen sie die Tür nach draußen auf. Dort heulte der Wind um das Haus. Die drei Männer umrundeten ihr Heim und die Ställe mit angelegten Gewehren, doch außer dem Pfeifen des Windes und dem Klappern der Läden war kein Geräusch zu vernehmen.
Wieder im Haus, hatten die Frauen sich in der Küche versammelt. Esther, die heute im Rahmen eines Besuchs im Elternhaus übernachtete, und Lucy flößten der immer noch verstört wirkenden Betsy etwas zu trinken ein, dem Geruch nach heißen Kräutertee. Betsy starrte vor sich ins Leere, die Augen immer noch überweit aufgerissen. Sie zitterte trotz des heißen Getränkes, doch sie weinte und schluchzte nicht mehr wie vorher. Auf ihren bleichen Wangen zeichneten sich tiefrot Abdrücke von Fingern ab. Hatte Lucy ihre Tochter ohrfeigen müssen, damit sie mit dem Geschrei aufhörte? John runzelte die Stirn.
Auf die roten Spuren in Betsys Gesicht deutend, fragte er: »Lucy, warst du das?«
Lucy starrte ihn an, zunächst erstaunt, danach empört. »Nein, natürlich nicht!«, wies sie die Anschuldigung von sich. »Wieso sollte ich Betsy schlagen?«
John sah seine Frau betreten an. Gänsehaut kroch unangenehm über seine Arme. »Du warst es nicht?«, fragte er lahm. »Und du auch nicht, Esther?«
Seine ältere Tochter sah ihn an und schüttelte nur den Kopf.
»Aber sie hat doch die Spuren von heftigen Ohrfeigen auf ihren Wangen. Wer ...?« Seine Stimme zitterte bei dieser Frage und halb fürchtete er sich vor der Antwort. Was für ein Wesen ...?
»Es war etwas bei mir im Zimmer«, antwortete Betsy mit überhoher Stimme, aus der die Panik noch deutlich zu erkennen war. »Ich habe nichts gesehen. Aber ich habe etwas gefühlt. Gefühlt, dass da etwas ist!«
Mit der Faszination des Grauens fragte John tonlos: »Was war es?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Betsy im gleichen Tonfall. Ihre Augen quollen beinahe aus ihren Höhlen, während sie weitersprach: »Was immer es war, es hat mir die Decke fortgezogen. Und als ich sie mir wieder nehmen wollte, zog es sie vor mir auf dem Boden entlang, gerade so schnell, dass ich sie nicht erreichen konnte. Und plötzlich …« – sie schluchzte auf bei der Erinnerung und ihre Stimme schlug ins Weinerliche – »… plötzlich erhielt ich eine Ohrfeige. Und dann noch eine und noch eine. Ich schrie und wich zur Wand zurück. Da seid Ihr hereingekommen, Vater ...«
Was immer sie danach noch hatte sagen wollen, ging in erneutem Schluchzen unter. Lucy nahm sie sofort wieder in die Arme und wiegte die Zwölfjährige hin und her, als wäre sie ein kleines Kind.
Langsam beruhigte sich Betsy wieder. Sie trank ihren Becher leer, dann schoben Lucy und Esther sie wieder die Treppe hoch.
»Du musst noch ein wenig schlafen, mein Schatz«, sagte Lucy sanft und strich ihrer Tochter über den schweißfeuchten Rücken.
»Nein!«, kreischte Betsy auf. »Nicht wieder in mein Bett!«
»Alles wird gut«, beruhigte Lucy sie. »Du darfst bei mir schlafen. Morgen sehen wir weiter.«
Johns Söhne folgten der Mutter die Treppe hinauf und gingen ebenfalls wieder zu Bett.
John hörte noch eine Weile das Gemurmel der Frauenstimmen von oben. Er hatte sich an den Tisch gesetzt, den restlichen Tee aus der Kanne in einen Becher gefüllt und getrunken. Sein Herz schlug immer noch zu schnell, als dass er jetzt hätte einschlafen können. Der Spuk, welcher sich in seinem Hause offenbar breitzumachen begann, ließ seine Gedanken nicht mehr los, beschäftigte ihn, bis sein Kopf schwer auf die Tischplatte sank.
Der Duft frischen Kaffees weckte ihn. Stöhnend hob er seinen Kopf, verzog schmerzlich seine Miene, fasste sich in den steifen Nacken. Er hatte tatsächlich am Tisch geschlafen. Mühsam öffnete er die Augen, welche sofort vor Müdigkeit brannten.
O Herr, hilf mir, dachte er. Lass mich den kommenden Tag überstehen, ohne dass ich im Stehen einschlafe. Und schon hatte der Sog des Schlafes ihn wieder erfasst. Es musste wohl so geschehen sein, denn das nächste Mal schreckte er von lautem Gepolter auf.
Harry, der Hausboy, stieß die Läden auf. John blinzelte. Ein greller Sonnenstrahl blendete ihn und er kniff die Augen zu. Mit dem Licht schoss ein ebenso greller Stich direkt in sein Hirn. Er fegte in einer unwillkürlichen Bewegung seinen Teller vom Tischrand, der sofort am Boden zersprang.
»Harry, warum stellst du auch das Geschirr nicht richtig auf den Tisch!«, fuhr er den Sklaven an, der die Familie im Haus bediente.
Dieser bekam große Augen. »Verzeihen ungeschickt Harry, Herr, bitte!«, flehte er, doch seine Unterwürfigkeit machte John noch wütender. Er nahm seinen Becher in die Hand und warf ihn dem Diener hinterher, der kreischend vor Schreck den Raum verließ und die Tür hinter sich zuwarf. Die Tasse zersplitterte scheppernd an der Tür. John stöhnte. Was war nur heute los mit ihm? Er konnte sich selbst nicht verstehen.
Mitten am Nachmittag legte er sich in seinem Arbeitszimmer nieder und schlief sofort ein. Als er wieder erwachte, war es bereits dunkel. Wut auf seine Söhne, seine Töchter, seine Frau, seine Diener, kurz, auf alle Mitglieder seines Haushalts packte ihn.
»Warum habt ihr mich nicht geweckt?«, schrie er.
»Vater, beruhigt Euch!«, mahnte Jesse ruhig. »Ich habe es vor zwei Stunden versucht und John und Drewey auch. Ebenso Mutter. Vor einer Stunde waren wir wieder bei Euch. Aber Ihr habt Euch nicht gerührt, Ihr habt geschlafen wie ein Toter.«
Little John nickte und auch Drewey stimmte seinem Bruder bei. »Wir konnten Euch nicht wecken.«
John atmete tief durch. Dann fragte er, wie seine Söhne mit den Arbeiten auf dem Hof vorangekommen waren. Was sie berichteten, stellte ihn zufrieden und er nickte. »Hoffen wir, dass uns heute eine ruhige Nacht beschert wird.«
Doch in dieser Nacht wiederholten sich die seltsamen Geräusche, es kamen sogar noch einige dazu. Das Patschen von nackten Füßen, ohne dass ein lebendiger Mensch in der Nähe war, erschreckte John in dieser Nacht. Die Luft war erfüllt von schweren Atemgeräuschen und kurz darauf von Schmatzlauten, die keinen Ursprung zu haben schienen. Wieder bekam John nur wenige Stunden Schlaf, der durch die ständigen Unterbrechungen besonders wenig erholsam gewesen war. Viel zu früh blinzelte die Morgensonne durch die Ritzen und die Hähne krähten laut und unmissverständlich. Stöhnend wälzte sich John aus seinem Bett, welches ihn in der Umarmung seiner Decke festzuhalten trachtete. Großer Gott, hatte er das eben wirklich gedacht?
Es war gegen Mittag und John hörte laut streitende Stimmen vor dem Haus. Er eilte hinzu, um nachzuschauen, was das bedeutete.
»Du bist ja so blöd!«, protestierte Betsy, als ihr Bruder Drewey sie an den Haaren zog. »Lass das sein!«
»Hihihi, nein, ich denke nicht daran!«, rief dieser voller Übermut und schnappte sich in einem unbewachten Augenblick Betsys neuen Hut.
»Gib ihn her!«, verlangte Betsy, erst noch lachend und bittend, bald jedoch in befehlendem Ton. Drewey rannte mit dem Hut in der Hand davon. »Du wirst ihn schmutzig machen«, schrie Betsy erbost. »Du wirst ihn zerknicken!«
Aber ihr Bruder lachte nur und verschwand um die Stallecke. Dort rannte er geradewegs in seinen Vater hinein. Nun hatte der Hut eine Beule.
John hielt seinen Sohn fest und schleppte ihn zurück, wo er Betsy schon schimpfen hörte. Kaum jedoch hatte er die Ecke umrundet, traf ihn ein Stein an der Brust. Erschrocken stand Betsy da, die Hand vom Wurf noch erhoben. Diese Hand fuhr jetzt zu ihrem Mund. Die Augen waren voller Schrecken auf ihren Vater gerichtet.
»Betsy!«, rief er seine Tochter zur Ordnung. In diesem Moment läutete der Essensgong. »Wir sprechen uns nach dem Essen!«, drohte er dem Mädchen, welches sofort im Haus verschwand. »Und wir sprechen uns auch noch nachher!«, verkündete er Drewey, der ihn schuldbewusst anstarrte.
Kaum war das Tischgebet gesprochen und alle schickten sich an, mit dem Essen zu beginnen, da fiel Betsy auf einmal wie von einer unsichtbaren Faust getroffen von ihrem Stuhl zu Boden. Rosafarbener Schaum trat über ihre Lippen. John sah kleine Bläschen platzen und er sah, wie das Mädchen unkontrolliert zuckte, wie sie mit dem Kopf gegen das Tischbein stieß, sich krümmte. Großer Gott, dachte er, das ist ja genau wie bei der Frau in Port Royal! Und was hatte der Priester dort noch gesagt? Und der Schmied? Nicht berühren, während der Teufel in der Frau tobt!
Lucy war aufgesprungen, war schon auf dem Weg zu ihrer Tochter, um ihr beizustehen …
»Halt«, rief John in hartem Befehlston.
Lucy hielt inne und blickte ihn an, mit einem Ausdruck höchster Verzweiflung in den Augen.
»Was können wir tun, John?«, fragte sie. »Wie können wir helfen?«
»Jetzt? Gar nicht!«, blaffte er schroff. »Rührt sie nicht an, keiner von euch!«
Er sah das Entsetzen in den Mienen seiner Frau und seiner Kinder, während sie beobachteten, wie Betsy durch die Krämpfe, die der böse Geist ihr bereitete, auf dem Rücken über den Boden rutschte. Doch sie gehorchten. Niemand berührte die Besessene.
Erst als das Kind mit verdrehten Augen und scheinbar ohne Bewusstsein reglos liegen blieb, stieß John sie mit dem Fuß an. Der Dämon schien sich zurückgezogen zu haben, um auszuruhen. Das war der richtige Moment. Er hob seine Tochter auf und trug sie die Treppe empor in ihre Kammer.
Auf der Treppe drehte er sich noch einmal um und rief: »Ihr kommt alle mit mir. Ihr müsst beten und singen für das Seelenheil eurer Schwester – deiner Tochter, die nur eine Tochter Evas ist. Voller Sünde!«
Oben beachtete er seine Familie, die ihm hinterhergeschlichen war, gar nicht mehr, so sehr war er darauf fokussiert, seinem Kind den bösen Geist auszutreiben. Er entkleidete Betsy und band sie am Bett fest. Dann nahm er seinen Gürtel und begann sie zu schlagen, indem er gleichzeitig die Gebete murmelte, die er dem Schmied in Port Royal abgelauscht hatte. Betsy brüllte jetzt laut auf, sie schrie schrill bei jedem seiner Hiebe. John spürte zu seinem Erstaunen nicht Mitgefühl, sondern eine deutliche erotische Erregung. Ihr junger Körper war so schön, so glatt, so begehrenswert. Erbarmungslos schlug er weiter auf sie ein, schlug sie auch dafür, dass sie solche Teufel in ihm weckte. Nicht umsonst ist das Weib die Verführung zur Sünde, dachte er und schlug jedes Mal härter, bis die zarte Haut an manchen Stellen aufzuplatzen begann. Das Blut rauschte in seinen Adern, er kannte keine Schonung, keine Rücksicht. Der Teufel sollte heraus aus ihr und dafür musste er dem Körper seiner Tochter genügend Schmerz bereiten, dass der Dämon seine neue Behausung schnell wieder verließ. Im Hintergrund nur registrierte er, wie alle seine Kinder mitbeteten und die Lieder sangen, die er ihnen zu singen befahl. Doch im Laufe der Zeit wurde dieser Hintergrund immer leiser und zaghafter.
In seinem Rausch bemerkte er bald nichts mehr außer der Prozedur, die er gerade auszuführen im Begriff war. So überraschte es ihn völlig, als auf einmal Lucy in sein Blickfeld geriet, sich über Betsy warf.
»Halt ein, John!«, schrie sie in ihrem Unverstand.
Langsam drangen ihre Worte in sein Bewusstsein, doch den nächsten Schlag konnte er nicht mehr aufhalten. Er traf Lucy.
In John stieg eine ungeheure Wut hoch. Was hatte das Weib hier zu suchen? Hatte er ihr nicht befohlen, hinter ihm stehen zu bleiben, bei den Kindern?
»Hinweg mit dir, Weib!«, brüllte John sie an, packte sie und warf sie zur Tür hinaus. Dann stellte er eine Truhe vor die Tür und fuhr mit den Gebeten und den Schlägen fort. Warum konnte Lucy ihm nicht genügend vertrauen?
Schließlich war er völlig erschöpft vom Schlagen, so wie es Lucy vor der Tür und Betsy vor ihm vom Jammern waren. Seine Hose fühlte sich vorne kalt und feucht an. Als er an sich hinunterblickte, bemerkte er einen dunkelnassen Fleck. Er ließ den Gürtel sinken. Jetzt tat es ihm leid, Betsys schönen Leib so geschunden zu haben, doch die Worte des Priesters klangen ihm noch in den Ohren: »Schont ein solches Geschöpf und Ihr schont den Satan in ihr!«
Die Kleidertruhe mit einem riesenkräftigen Ruck beiseiteziehend, stürzte er aus dem Zimmer, an Lucy vorbei, die vor der Tür zusammengekauert saß. Ihr Gesicht war tränenverschmiert. Das schürte die blanke Wut in ihm.
»Du betrittst dieses Zimmer nicht, hast du mich verstanden? Nach unten mit dir«, herrschte er sie an.
Doch sie starrte ihn nur an wie ein Reh den Jäger. Sie schien keines seiner Worte verstanden zu haben. John schüttelte ungeduldig den Kopf.
Im Türrahmen drehte er sich noch einmal um und befahl harsch: »Und ihr geht auch alle nach unten. Marsch, wirds bald?« Damit lief er hinaus.
Zwei Stunden später kam er wieder zurück. Was er sah, ließ seinen Zorn wieder auflodern. Lucy hatte ihre Tochter gewärmt, mit einer Decke und mit ihrem eigenen Körper. Verdammtes ungehorsames Weib!
»Fort mit dir!«, schrie John und ergriff Lucy grob beim Arm, zog sie aus dem Bett. Sie schrie auf vor Schmerz, doch John ignorierte das. »Raus hier, sofort!«
Und Lucy schlich eingeschüchtert hinaus. Bald hörte er ihre langsamen Schritte auf der Treppe. Gut so.
John riss der zitternden Betsy die Decke vom nackten Leib und begann erneut auf sie einzuschlagen.
Erst nach einer weiteren halben Stunde voller Schmerz und Gebete war John zufriedengestellt. Betsy war inzwischen ohnmächtig. Ihr schöner junger Körper war übersät mit Striemen in Rot und Blau und an manchen Stellen war er blutbespritzt.
John wusste nicht, warum, doch aus irgendeinem Grund spürte er die Erregung wieder, dieselbe sexuelle Erregung wie vorhin. Ein prüfender Blick: Betsy hielt die Augen geschlossen, ihre Muskeln waren erschlafft – ganz sicher war sie ohne Bewusstsein. Sie würde gar nicht merken, wenn er … Und dann konnte er nicht widerstehen: Zärtlich strich er über den Leib seiner Tochter, dachte daran, welches Glück der Mann haben würde, der sie einst bekäme. Er streichelte ihre festen Brüste und strich wohlgefällig über ihre lockige Scham, die Innenseite ihrer Beine entlang …
Ein Blick in das Gesicht seiner Tochter – sie hatte jetzt die Augen offen und starrte ihn an mit einem Ausdruck fassungslosen Grauens. Wie eingefroren bewegte sie sich nicht einmal um einen Inch. John hatte das Gefühl, ein Stein fiele durch seinen Magen. Er floh durch die Tür aus der Kammer und dann aus dem Haus. Nur sehr langsam konnte er sich wieder beruhigen. Er hatte nur eine Erklärung für das, was eben vorgefallen war: Der Dämon musste kurzzeitig auf ihn übergesprungen sein. Und wieder war Betsy das Opfer eines Dämons geworden. Das schien von Zeit zu Zeit der Fall zu sein. Weshalb wunderte er sich denn darüber? Sie war die anfälligste Person in seinem Haushalt: ein Mädchen auf dem Wege zur Frau.
Böse und schreckliche Geister und Dämonen gab es, das wusste er nur zu gut. Auf seinen Reisen in die Stadt war er schon oft Menschen begegnet, die ihm von solchen unheimlichen Besuchern berichtet hatten. In allen Fällen hatte nur ein Priester dem Spuk ein Ende bereiten können – mit nur einer einzigen Ausnahme: Einmal hatte er von einem Geist gehört, welcher nach ein paar Tagen von allein wieder verschwunden war.
Am nächsten Abend wartete John voller Bangen, was der Spuk an diesem Tag wieder für ihn bereithalten würde. Bei diesem Gedanken brach ihm der Schweiß aus. Es dauerte denn auch nicht lange, da vernahm er ein Kratzen an den Wänden, als ob draußen ein Raubtier seine Krallen an der Hauswand erprobte. War das ein Knurren, welches durch das Fenster drang? Mit zitternden Händen schloss er das Schiebefenster und schob den Riegel vor. Dann nahm er seine Muskete von der Wand – ein Mitbringsel aus dem Revolutionskrieg –, stieß die Tür auf und stürmte nach draußen. Das Gewehr im Anschlag, ging er so leise wie möglich einmal um das gesamte Haus herum.
Der Wind kam ihm entgegen, doch ein Raubtier war weder zu sehen noch zu riechen. Auch die Hunde schlugen nicht an. Noch ein zweites Mal unternahm er seinen Rundgang, diesmal mit einer Laterne. Unter dem Fenster, welches er kurz zuvor geschlossen hatte, entdeckte er tiefe Kratzspuren, wie von einem Puma oder einem Bären. Indes, er sah nur die Kratzer in der Wand. Raubtierfährten hingegen waren nicht vorhanden, obgleich er die Stelle unter dem Fenster sorgfältig untersuchte. Mehrfach hob er seine Laterne, leuchtete mehrere Schritte weit in die Nacht, lief sowohl am Haus als auch einige Yards davon entfernt hin und her. Doch außer den frischen Kratzern von scharfen Klauen unter dem Fenster und seinen eigenen Schuhabdrücken gab es keine Spuren. Unwillkürlich fröstelte er. Die Vorkommnisse waren auf natürlichem Wege nicht zu erklären.
Wenn er nur gewusst hätte, womit er es zu tun hatte. War es der ruhelose Geist eines Verstorbenen, welcher den Weg aus diesem Leben hinaus in das nächste nicht geschafft hatte? Es gab über die Gründe solcher verweilenden Geister viele Gerüchte: Manche behaupteten, es wäre diesen Menschen einst großes Unrecht geschehen und deshalb könnten sie sich nicht von dem Orte lösen, wo sie einst gelebt hatten. Oder war es ein böser Dämon, der, aus der Hölle entwichen, hier auf Erden sein Unwesen trieb? War es ein Wesen, welches in Menschen fahren und diese unter seinen Willen zwingen konnte? Er wusste, es war wichtig, die Antwort zu kennen, doch gleichzeitig fürchtete er sich davor, sie zu erfahren.
Welche dieser Kreaturen es auch immer war, er hatte keine Ahnung, wie er sich und die Seinen vor ihnen beschützen sollte. Dennoch war er entschlossen, es zu versuchen, so gut er es eben verstand.
Nach dem Abendessen versammelte er all seine Lieben um den großen Tisch. Vor ihm lag aufgeschlagen eine Bibel. Ein Kandelaber stand in der Mitte der Tischplatte, die Kerzen flackerten und rußten. Im Raum hatte er drei Feuerschalen mit glimmender Holzkohle gegen die Kälte aufstellen lassen.
»Ich habe euch alle hier zusammengerufen, damit wir gemeinsam das Wesen vertreiben, welches in den letzten Nächten uns allen den Schlaf geraubt und die arme Betsy traktiert hat. Setzen wir uns alle und fassen uns bei den Händen, schließen wir den Kreis.«
Alle Mitglieder der Familie folgten dieser Aufforderung. John hatte auf der einen Seite die Hand von Lucy umfasst, auf der anderen Seite die seines Ältesten.
Er atmete tief und entschlossen durch, wie um sich zu rüsten, dann deklamierte er in beschwörendem Ton: »Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wer immer du bist, Dämon, der du dieses Haus heimsuchst, hebe dich von hinnen. Wir glauben fest an unseren Herrn Jesus Christus und hier ist kein Platz für dich.« Er schaute auffordernd in die Runde. »Sprecht mit mir das Vaterunser. Danach wiederholt, was ich sage, so oft ich es tue.« Er begann mit dem Gebet, alle um den Tisch Versammelten fielen ein. Dann hob John von Neuem an: »Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der dieses Haus beschützt. Dämon, wer immer du seist, verlasse dieses Haus.«
Im Chor wiederholte jeder der am Tisch Sitzenden diese Formel. Dann sprach John sie erneut und seine Familie wiederholte den Spruch. Dieses Ritual führten sie eine ganze Stunde lang durch. Am Ende sprach John noch einmal das Vaterunser und die Familie sprach ihm die Worte des Gebetes nach, sobald er Pausen machte. Nun atmete John erleichtert auf. Langsam ließen sie einander los.
»Geht nun alle in eure Kammern«, ordnete John an. »Nur dich, Lucy, brauche ich noch hier unten, du sollst bei noch einem weiteren Ritual mithelfen.«
Seine Frau nickte und schaute ihn mit wachem Interesse an. Als sie allein waren, erkundigte er sich: »Lucy, hast du getrockneten Salbei?«
»Ja, natürlich«, entgegnete diese.
»Gib mir ein paar Blätter«, verlangte John, dem der Rat eines Reisenden gegen unliebsame Besucher wieder eingefallen war.
Mit einem neugierigen Blick in sein Gesicht brachte sie ihm das Verlangte. John nahm ihr die Blätter aus der Hand.
»Das ist zu wenig. Ich brauche mehr!«, gab er ihr barsch zu verstehen.
Während sie sich beeilte, mehr von der Pflanze herbeizuschaffen, verriegelte John alle Türen und Fenster, dann rieb er die Salbeiblätter in eine der Feuerschalen, wo sie sich langsam verkohlend an den Rändern aufwölbten und nach einer Weile von den Flammen verzehrt wurden. Würziger Rauch stieg auf.
Lucy brachte ihm mehrere Zweige. »Das ist alles, was ich dahabe«, sagte sie dabei. »Wird es reichen?«
Skeptisch betrachtete er die wenigen Blätter, die seine Frau ihm da entgegenhielt. »Hmm, ich weiß nicht. Hast du auch Wacholder?«
»Ja, einen Augenblick«, sagte sie und war kurz darauf auch mit Nadeln und Beeren dieser Pflanze wieder da.
John packte alles in die drei Feuerschalen, in denen Blätter, Beeren und Wacholderzweige sofort zu glimmen begannen. Die Pflanzennadeln verbogen sich und wurden schwarz. Bald qualmte es gewaltig und John spürte von dem süßlich-harzigen Rauch einen kratzenden Hustenreiz, dem er nachgeben musste. Doch rasch hielt er sich ein Tuch vor den Mund und wedelte mit einem anderen Tuch den Qualm in alle Ecken. Von anderswo im Raum konnte er sein Weib husten hören, als gäbe es hier ein Echo. Sehen konnte er sie durch den dichten Qualm schon nicht mehr.
»Hilf mir, Lucy!«, forderte er sie auf, doch sie hatte bereits begriffen, was er vorhatte, und unterstützte ihn nach Kräften.
Als sie mit vereinten Kräften alle Ecken ausgeräuchert hatten, riss John, nun unkontrolliert hustend, Fenster und Türe auf.
»Gehe hinfort mit dem Rauch!«, krächzte John dabei.
Erleichtert sog er die klare, reine Außenluft wieder in seine Lungen. Da traf ihn ein eisiger Luftzug im Nacken und er meinte, ein unterdrücktes Kichern zu hören – wobei »hören« nicht der richtige Ausdruck war. Es war mehr ein Gefühl, ein Nachhall.
Die Kerzen im Kandelaber erloschen zischend. John sank in sich zusammen. Der Dämon lachte ihn aus! Na warte, du Bastard, dachte er. Es gab schließlich auch stärkere Mittel.
Diese Nacht war furchtbar. Wind heulte um das Haus und Regen trommelte gegen die Fensterläden. John drehte sich unruhig in seinem Bett hin und her. Da war es wieder, dieses schwere Atmen und Schnaufen. Und plötzlich das Gefühl, etwas oder jemand hätte sich auf sein Bett gesetzt. Es sträubten sich ihm alle Haare im Nacken und auf den Armen.
Auf einmal stand er neben seinem Bett und konnte sich nicht einmal unmittelbar danach daran erinnern, wie er dahin gekommen war. Sein Herz jagte laut und rhythmisch in seinen Ohren. Eine Gänsehaut verbreitete sich blitzartig über seine nackten Arme und Beine. Huh, was war das plötzlich kalt! Das Fenster rappelte wieder, diesmal scheinbar vom Sturm, der draußen tobte. Johns Blick fiel auf den Fensterriegel und zu seinem Erstaunen bemerkte er, wie sich dieser langsam und ruckelnd zurückschob. Gleichzeitig fasziniert und entsetzt nahm er wahr, wie das Fenster aufsprang und der bitterkalte Nachtwind durch die Kammer wehte. In seinem Gepäck führte er erbsengroße Regentropfen mit, die durch den Raum bis hin zu seinen Füßen spritzten.
John war nicht in der Lage, sich zu bewegen. Alle Gedanken waren ihm wie aus dem Kopf geblasen. Erstarrt und mit offenem Mund stand er neben seinem Lager, zitternd und frierend. Dann schrie er laut auf und dieser Schrei schien ihm die Bewegung im gleichen Augenblick wiederzugeben. Er schoss zum Fenster, warf es zu und verschloss es erneut mit dem Riegel. In seinem Schrecken lehnte er sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen, hielt Fenster und Riegel fest. John fühlte, wie das Tosen des Sturmes den Laden wieder aufstemmen wollte, als wäre da draußen ein kraftvolles Tier, welches sich dagegen warf. Unsinn, schalt er sich, es ist nur der Wind.
Langsam beruhigte sich sein Herzschlag und er schloss die Augen, immer noch eng an das Fenster gelehnt. Auf einmal war er so entsetzlich müde, so tief erschöpft, wie er sich noch nie in seinem Leben gefühlt hatte – außer vielleicht nach der langen Reise von North Carolina nach hier, in dieses neue Land.
Kraftlos schleppte er sich wieder zu seinem Lager und sank darauf nieder, ganz gleich, ob noch andere Wesen sich darin breitgemacht hatten oder nicht. Es war mehr Ohnmacht denn Schlaf, die sich seiner bemächtigte, und er wachte erst im Morgengrauen wieder auf. Kopfschmerz hüllte sein Denken ein wie eine undurchdringlich dichte Wolke. Stöhnend setzte er sich auf und vergrub sein Gesicht in den Händen. Sein Kopf fühlte sich an, als hätte er zu viel Alkohol getrunken oder als hätte ihm jemand eins über den Schädel gegeben.
Der Raum schwankte um ihn und der Schmerz verstärkte sich auf das Doppelte, als er sich aufzurichten versuchte. Er fiel haltlos zurück auf den Rücken, quer über sein Bett. Wie ein Echo schrie der Schmerz. Erst mit dem zweiten Versuch schaffte John es, auf die Beine zu kommen.
Langsam schlurfte er zur Tür, hielt sich auf seinem Weg nach unten am Geländer fest wie ein uralter Mann. Dort begegnete ihm Lucy, bereits vollständig angezogen und fröhlich vor sich hinsummend.
»Lucy, hast du etwas gegen Kopfweh?«, fragte er und seine eigenen Worte hallten schmerzhaft in seinem Schädel wider. Er verzog das Gesicht.
»Aber mein Lieber«, sagte Lucy und blickte ihn verwundert an. »Du siehst ja furchtbar elend aus! Warte, ich hole dir deinen Schlafrock!«
John blickte erschrocken an sich hinunter: Er trug nichts weiter als sein Nachthemd.
Nach dem Frühstück ging es John schon etwas besser. Lucy hatte ihm einen Trank gereicht, den er trotz dessen Bitterkeit bis zur Neige geleert hatte. Die Wirkung setzte denn auch bald ein. So langsam drangen wieder Gedanken durch den Nebel des Schmerzes. Ein paar Minuten blieb er noch sitzen, dann stemmte er sich hoch und zog sich ordentlich an. Niemand sollte ihm nachsagen, er würde sich vernachlässigen. Auch wenn sein erster Versuch, den Dämon zu vertreiben, gescheitert war, hatte er keineswegs vor aufzugeben. Mühsam hatte er dies alles aufgebaut und gegen jeden anderen verteidigt. Sollte er es zulassen, dass ein unwillkommener Geist ihm das alles wieder zerstörte?
Die Vorfälle in den letzten Nächten, der wenige Schlaf, mit dem sie alle hatten zurechtkommen müssen, all das hatte John bis an den Rand seiner Kräfte gebracht. Eine Gänsehaut überzog seine Arme, wenn er an die Geräusche dachte, die er in der letzten Nacht gehört hatte. Als hätte jemand Steine an die Hauswände geworfen. Er hatte das sofort überprüft, denn zuerst dachte er an einen bösen Scherz oder an aufständische Sklaven. Doch draußen lag kein einziger Stein. Nichts, was die Geräusche hätte erklären können. Er schluckte trocken und spürte, wie sein Herz schmerzhaft schneller schlug, als er daran dachte. Was hatte er getan? Was würden die Ältesten in der Kirche dazu sagen? Konnte er sich um Hilfe an sie wenden? Nein. Sie würden ihn durch den Teufel bestraft sehen. Ihn böser Werke bezichtigen. Er schloss die Augen und ballte die Fäuste. Dann fasste er einen Entschluss: Niemand durfte von der Erscheinung erfahren! Vielleicht würde es ja auch von ganz allein wieder aufhören, es hatte ja auch ohne sein Zutun begonnen. Ohne sein Zutun? Er zog grüblerisch die Brauen zusammen. Wenn er ganz ehrlich zu sich war, so konnte es, sehr streng genommen, vielleicht doch an seinem nicht immer einwandfreien Verhalten liegen. War es so?
Langsam und unschlüssig bewegte er den Kopf hin und her. Wir sind doch alle nur Sünder, dachte er. Jeder, den er kannte, hatte schon einmal Dinge getan, die getrost als Sünden durchgehen konnten. Aber wurden diese Menschen bestraft? Nein, er war es, der dieses Hexenwerk im Hause hatte. Zuerst hatte er ja Lucy in Verdacht gehabt, ihm einen Schrecken einjagen zu wollen, doch sie war so voller Furcht gewesen … Nein, sie hatte gewiss nichts damit zu schaffen. Und die Sklaven hatten ihm lauter eigene Geschichten erzählt, die alle in dieselbe Richtung wiesen: Er hatte einen Geist im Haus. Was war da zu tun?
Er nahm sich vor, in den nächsten Wochen sehr buchstabengetreu nach dem Glauben zu leben. Keine Sklavinnen mehr im Bett, nie wieder intime Gedanken an Betsy, keine übertriebene Härte Lucy gegenüber. Er wollte Lucy auf seiner Seite wissen, schließlich wollte er zu diesem Zeitpunkt niemanden sonst einweihen. Es musste ein Geheimnis bleiben. Und sonst hatte er ja niemanden zum Reden. Höchstens James. Aber sollte er ihm von seinem Problem erzählen? Nein, nicht zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht in zwei Wochen, wenn sich die Dinge nicht wieder besserten. Ja, das würde er tun.
Nach einem Tag wie im Taumel fiel er ohne weitere Umstände in sein Bett. Lucys Nachttrank, die Wärme, die ihn dabei durchströmt hatte, der mangelnde Schlaf … All das ließ ihn einschlafen, bevor er auch nur noch einen einzigen Gedanken bewegen konnte.
Betsy erholte sich nur langsam von der Tortur, der John sie hatte unterziehen müssen. Lucy machte ihm die bittersten Vorwürfe – aber aus ihr sprach nur der Instinkt der Mutter. Was wusste sie denn schon über Dämonen oder die Methoden und die Notwendigkeit, böse Geister auszutreiben?
John hielt ein waches Auge auf seine Tochter, ob sie noch weitere Zeichen von Besessenheit zeigen würde. Aber nein, diesmal schien es ihm gelungen zu sein, dem Kind die Satansbrut auszutreiben, die sie beherrscht hatte. Stolz erfüllte ihn und Hoffnung. Wenn er seiner Tochter die Dämonen austreiben konnte, so gelang ihm das vielleicht auch mit dem Höllenwesen in seinem Hause.