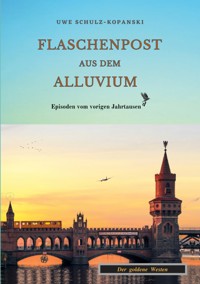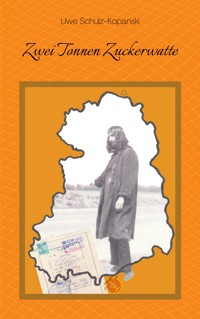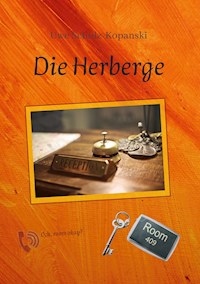
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichten aus dem Alltag einer großen Westberliner Jugendherberge spielen Ende der 80er Jahre und umfassen die ganze Palette der tagtäglich in diesem Hause einquartierten, meist jugendlichen Gäste aus aller Welt sowie die zahlreichen damit einhergehenden Begegnungen, Ereignisse und Verwicklungen. Aber auch das Personal und die Abläufe im Hintergrund werden vorgestellt, bis hin zum Obdachlosen auf dem Hof, der zeitweilig als selbsternannter Nachtwächter agiert. Erzählt wird all das aus der Perspektive von Ecki, einem noch vor der Wiedervereinigung aus dem 'Osten' nach Westberlin übergesiedelten Mittzwanziger, der zunächst als Küchenhelfer und später dann als Rezeptionist dort arbeitet. Dieses Buch ist keine Chronik oder Dokumentation, sondern ein Werk literarischer Fiktion, das vor allem die Atmosphäre des Hauses und den Zeitgeist jener durch den Mauerfall in Berlin geprägten Umbruchjahre widerspiegeln soll. Der Inhalt basiert auf den Erlebnissen des Autors während seiner damaligen vierjährigen Tätigkeit in der größten Berliner Jugendherberge, niedergeschrieben aus der heutigen Distanz von über dreißig Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anfang in der Küche
Sommer 1988
In der Küche & mehr
Sommer 1989
An der Rezeption
Juli 1990
An der Rezeption & mehr
August 1990
In tiefer Dankbarkeit
Für euch alle, ihr Guten
Ich habe euch nicht vergessen
I
Also eigentlich sieht sie ja doch ganz niedlich aus, dachte ich gerade so bei mir, als ich mit Julia mal wieder ein bisschen am Herumalbern war, da kamen plötzlich auch schon zwei Päckchen Kaffee auf mich zugeflogen, und zwar aus dem hintersten Winkel der Vorratskammer. Immerhin fing ich sie beide halbwegs gekonnt, wahrscheinlich wirkte es sogar einigermaßen lässig. In jeder Hand eins haltend, schlug ich sie erst noch ein paarmal spielerisch gegeneinander, wie zwei zu prüfende Ziegelsteine, bevor ich sie rüber zum Ausgabetresen trug. Dort schnappte ich mir das kleine Messer und stach die Vakuumverpackungen in der Mitte an, wobei es leise zischte, um sie dann ringsherum fast gänzlich aufzuschneiden. Den aromatisch duftenden Inhalt ließ ich in die vor mir stehenden Filterkörbe rieseln, in diese suppentopfgroßen Behälter mit Drahtgitterboden und Papiereinlage, die ich hinterher wieder ganz nach oben auf die blanken Edelstahl-Türme der großen, fest an der Wand installierten Kaffeemaschine hob. Zum Schluss schwenkte ich bloß noch den Wasserzulauf bis zum Anschlag nach rechts und drückte unten den Kippschalter, und das wars. Das rote Lämpchen ging an, man hörte ein leises Plätschern, und schon begann sich der erste der beiden Zwölf-Liter-Tanks allmählich mit frisch gebrühtem Kaffee zu füllen. In ungefähr einer Viertelstunde würde diese Seite durchgelaufen sein, danach käme dann die andere dran.
Während ich anschließend stapelweise Teller und ein Dutzend Tabletts mit Tassen nach vorn zum Tresen brachte, bereitete Julia die Servierwagen für die Gruppen vor. Wir beide waren ein eingespieltes Team, Julia und ich, wir hatten schon oft zusammen die erste Stunde in der Küche übernommen. Julia war eine verträumte Maus Anfang Zwanzig, kaum ein Meter sechzig groß und mit der Statur (von einer Figur konnte man da wohl kaum sprechen) einer besonders zierlichen Ballettelevin. Neulich nach der Arbeit hatte ich auch mal kurz ihre Schwester kennengelernt, draußen im Foyer, die war ein genauso winziges Persönchen. Eineiige Zwillinge eben. Wahrscheinlich hatte sich der liebe Gott bei ihrer Geburt erst im allerletzten Moment entschieden, ausgerechnet diese spezielle Leibesfrucht in zwei Babys zu portionieren.
Aber das nur am Rande.
Als ich etwas später mit zwei Kartons Butter aus dem Keller hochkam und die ein wenig klemmende Tür hinter mir mit der Schulter zudrückte, war inzwischen auch der Rest der Frühschicht eingetroffen und machte sich so langsam startklar: die beiden jungen Küchenhelferinnen Milana und Nang, und Omar, der grauhaarige türkische Koch. Frau Bauer, die Küchenleiterin, steckte bloß vom Flur her kurz ihren Kopf zu uns rein, grüßte in die Runde und verschwand danach wie üblich gleich wieder in ihrem Büro.
Nang, unsere so gut wie immer fröhliche Thailänderin, stellte als Erstes die Schüsseln für das benutzte Besteck nach draußen und bereitete dann wieder einmal allein die Spülmaschine vor, während Milana, eine mit jedem Tag mehr in die Breite gehende Jugoslawin um die Dreißig, die bereits vier Kinder hatte, lediglich die Henkel der auf den Servierwagen stehenden Blechkannen etwas zurechtrückte. Sie spielte sich gern ein bisschen als Chefin auf, obwohl sie selber erst seit gut einem Jahr hier arbeitete. Anscheinend glaubte sie, dass ihr als ‚Multi-Mutter‘ (wie sie sich vor Kurzem einmal selbst genannt hatte) auch im hiesigen Kollegenkreis ein paar Privilegien zustehen müssten. Zumindest gab es deswegen öfter mal kleinere Reibereien.
Kurz bevor der Trubel richtig losging, schnitt ich schnell noch etwas Vollkornbrot auf, denn erfahrungsgemäß wollten manche Gäste keine Brötchen. Da klingelte auf einmal das Wandtelefon. Julia, die gerade an der zweiten Säule der Kaffeemaschine hantierte, stöhnte genervt und nahm ab. Die Rezeption war dran, offenbar hatte eine Gruppe kurzfristig vier Teilnehmer zum Frühstück nachgemeldet. Augenrollend murmelte Julia etwas in den Hörer, legte auf und rannte los, um ein weiteres Tablett mit Wurst und Käse vorzubereiten.
„Na wollen wir mal nicht so sein“, brummte ich schließlich, als die ersten drei Gäste vorn am Tresen auftauchten, und begann mit der Ausgabe. Obwohl es ja eigentlich noch zwei Minuten zu früh war; Frühstück gab es nämlich immer erst ab sieben Uhr.
Kaum hatte ich die ersten Teller über den Tresen geschoben und dazu ein paar Tassen Kaffee gezapft, da bemerkte ich plötzlich, dass oben aus dem rechten Filtertopf eine dunkle Brühe quoll, die in breiten Schlieren gemächlich an der Maschine herabsank und sich überall gleichmäßig wie ein brauner Schleier über den blanken Edelstahl legte. Verdammt, schoss es mir durch den Kopf, denn ich wusste augenblicklich, was los war, und im selben Moment hörte ich auch schon Milana zetern, die das Malheur ebenfalls entdeckt hatte.
Sofort griff ich mir einen großen Löffel und stupste damit das Zulaufrohr oben an der Kaffeemaschine, das jetzt mit wütendem Röcheln ununterbrochen kochendes Wasser spuckte, auf die andere Seite rüber, natürlich mit der gebührenden Vorsicht. Also auf Zehenspitzen tänzelnd und immer schön Abstand haltend, um den brühend heißen Spritzern zu entgehen.
Puh, das wäre geschafft, dachte ich erleichtert, als es Sekunden später im linken Behälter beruhigend zu tröpfeln begann. Julia hatte nämlich vorhin das Umschwenken des Rohres vergessen, als sie beim Anstellen der zweiten Säule vom Klingeln des Telefons unterbrochen worden war.
Allerdings hatte sich das Problem damit noch nicht gänzlich erledigt, denn der Kaffee im übervollen rechten Tank, inzwischen zu einer faden Plörre verwässert, würde nun ebenso ungenießbar sein wie das viel zu starke, tiefschwarze Gebräu, welches sich gerade im linken Kessel ansammelte. Weil sich der Automat ja stets von selber nach der gleichen Wassermenge abschaltete. Also zapfte ich von jeder Seite der Kaffeemaschine nun einfach noch ein paar große Blechkannen voll ab, rechts freilich etwas mehr als links, und goss die heiße Flüssigkeit anschließend gleich wieder oben in den jeweils anderen Stahlturm hinein, bis die Mischung am Ende ungefähr stimmte. Routiniert wie ein alter, gerissener Weinpanscher, auf einer wackligen Gemüsekiste als Tritthilfe stehend.
„Katastrophe überstanden, alles okay“, verkündete ich hinterher erleichtert und grinste, als ob nichts gewesen wäre, und mit gedämpfter Stimme fügte ich an Julia gerichtet tröstend hinzu: „Na ist doch logisch, ein einzelner Zwilling kann sich eben immer nur um die eine Hälfte des Blechmonsters kümmern, hm?“. Woraufhin sie mir ein rührend zaghaftes Lächeln schenkte. Auch Milana hatte sich nun wieder beruhigt, vor allem nach einem dezenten Hinweis von Omar, dass ihr vor nicht allzu langer Zeit ja wohl genau das gleiche Missgeschick passiert wäre. Jedenfalls, als die Küchenchefin Frau Bauer ein paar Minuten später aus ihrem Büro kam und einen flüchtigen Blick in Richtung Tresen warf, da sah sie nichts weiter, als dass vorn alles flutschte.
Von irgendeiner Panne hatte sie Gott sei Dank nichts mitgekriegt.
Heute stand ich zusammen mit Julia vorn an der Essensausgabe.
Mit ihr klappte es eigentlich immer ganz gut, man musste bloß darauf achten, dass man sich in der Hektik nicht zu sehr in die Quere kam. Meist bediente ich die Einzelgäste und Julia fertigte die jetzt Schlag auf Schlag eintreffenden Gruppen ab. Wie am Fließband füllte sie Tee- und Kaffeekannen, stellte sie auf die von ihr vorbereiteten Servierwagen und schob diese dann durch die geöffnete Tresenklappe in den Saal hinaus, während ich zügig Essensbons einsammelte, Teller ausreichte und mich immer wieder, die Tasse auffordernd in der Hand haltend, wie eine Sprechpuppe erkundigte: ‚Tee oder Kaffee? Tea or coffee?‘. Wobei ich nicht selten ein zerstreutes ‚äh, yes, please!‘ zur Antwort erhielt, so dass ich zuweilen ernsthaft in Versuchung geriet, diesen Schnarchnasen tatsächlich einmal völlig ungerührt beides zusammen in ein und dieselbe Tasse einzuschenken und sie danach einfach bloß mit einem professionellen ‚der Nächste bitte!‘ stehenzulassen.
Gegen neun war der Andrang am größten, und Milana und Nang an der Spülmaschine hatten ein bisschen Mühe, für ausreichend sauberes Geschirr zu sorgen, besonders die Tassen wurden schnell knapp. Mit langem Arm fischte ich mir dann selber manchmal ein oder zwei Dutzend aus dem dampfigen Inneren der Maschine heraus, noch so richtig schön auf Backofentemperatur und ganz frisch mit Wassertropfen dran, wenn sie gerade erst halb durch die Trocknung gelaufen waren. Aber egal, sagte ich mir, Hauptsache am Tresen konnte es ohne Unterbrechung weitergehen. Zwischendurch schlitterte ich auf den nassen Fliesen auch mal ab und an nach hinten, um Marmelade gegen Honig oder Pflaumenmus umzutauschen oder irgendeinen anderen Extrawunsch zu erfüllen. Margarine statt Butter, eine Scheibe dunkles Brot, oder noch ein zusätzliches gekochtes Ei oder eine Tasse Milch. Solange höflich gefragt wurde und es nicht unverschämt war, ließ sich wirklich fast alles ermöglichen. Besonders natürlich, wenn ein hübsches Mädchen um etwas bat. Und von denen gab es hier so viele, jeden Tag! Genau deshalb machte ich ja am liebsten die Ausgabe, weil man diese göttlichen Geschöpfe da eben ganz aus der Nähe zu Gesicht bekam und hin und wieder mit etwas Glück sogar zum Lächeln bringen konnte. Das war doch das Beste an diesem Job überhaupt! Denn dann fühlte man sich wirklich wie ein kleiner König; für einen Augenblick schien die Sonne und es herrschte plötzlich Stille im Auge des Orkans; alles hielt an, und zumindest einen Moment lang war das tosende Durcheinander ringsum schlagartig ganz weit weg.
Jedenfalls, auf die Mädchen kam es dabei am allermeisten an, das stand fest.
Kurz vor zehn schob ich von draußen den letzten vollen Wagen mit schmutzigem Geschirr in die Spülecke hinein und löste Nang an der Maschine beim Einsortieren ab.
„Wird auch Zeit, heute du spät!“, stöhnte sie lachend, zog die Gummihandschuhe aus und ging zu den anderen rüber, um das Chaos in der Küche schon mal ein bisschen aufzuräumen.
„So, Pause!“, rief Julia schließlich eine Viertelstunde später und schlug dazu übermütig zwei Topfdeckel zusammen, genau als die letzten drei Gäste den Speisesaal verlassen hatten. Umgehend schaltete ich die Spülmaschine aus und atmete erst mal befreit durch. Endlich Ruhe! Zumindest das Schlimmste war damit für heute überstanden. Wir ließen alles stehen und liegen und wuschen uns bloß noch schnell die Hände. Der Rest konnte warten, denn jetzt war Kaffeepause. Oder zweites Frühstück, je nachdem. Unser Personaltisch war jedenfalls reichlich gedeckt, mit allem, was die Küche zu bieten hatte.
Auch Frau Bauer kam aus ihrem Büro und setzte sich zu uns.
„Hundertdreißig“, ließ sie uns wissen, nachdem sie die Schüssel mit den Bons der Einzelgäste durchgezählt hatte, „plus die zweihundertzehn von den Gruppen, macht zusammen dreihundertvierzig Personen beim Frühstück.
Großkampftag, mal wieder.“
„Gestern auch so, ungefähr“, erwiderte Omar, der schon etliche Jahre dabei war und sich längst an solche Zahlen gewöhnt hatte. „Das immer geht ganzen Sommer so, mindestens.“
„Ja“, stimmte ihm Frau Bauer zu, „ich hab vorhin an der Rezeption die Belegungspläne gesehen, da ist jetzt schon alles so gut wie ausgebucht bis Ende September.“
Milana stöhnte, Nang lächelte, und Julia meinte schulterzuckend: „Naja, wer nach Berlin kommt, der will meistens ins Zentrum, und da sind wir nun mal das einzige Haus.“
„Klar“, nickte ich, denn bis auf ein paar kleinere private Hostel, die aber auch teurer waren, gab es außer uns nur noch die beiden Jugendherbergen unten am Wannsee und oben in Hermsdorf, und die lagen wirklich ziemlich weit außerhalb.
Ich wollte gerade aufstehen, um mir neuen Kaffee zu holen, weil die Kanne auf unserem Tisch bereits leer war, da legte mir Julia auf einmal sanft ihre Hand auf die Schulter.
„Ich mach schon, Ecki, bleib ruhig sitzen“, flötete sie charmant, halb ironisch und fast beiläufig aber doch mit so einem gewissen Unterton, und vor allem mit einem Blick dazu, den ich ihr eigentlich gar nicht zugetraut hätte.
Wahrscheinlich wollte sie sich so bei mir für die Aktion mit der Kaffeemaschine bedanken, sagte ich mir.
„Tea or coffee?“, fragte sie dann noch ironisch nach, als sie schon im Gehen war, worauf ich natürlich sofort mit ernster Miene „Oh yes please, yes yes, thank you!“ antwortete.
Was freilich auch bei den anderen für reichlich Heiterkeit sorgte.
Nach der Pause war mein persönlicher Spezialjob an der Reihe: die Reinigung des Speisesaales. Also alle Tische abwischen und die Stühle hochnehmen, dann den Fußboden fegen und wischen und danach wieder sämtliche Stühle an ihren Platz zurückstellen. Manchmal half mir jemand dabei, aber meistens erledigte ich das alles allein.
„Geht doch ganz anders, wenn wir einen Mann dafür haben“, lobte mich die Küchenchefin heute mal wieder auf ihrem Rundgang. Ich hatte den Eindruck, sie hielt mich für einen etwas schüchternen Jüngling. Der Neue aus dem Osten, ganz nett, aber eben doch noch sehr unsicher. Obwohl ich nun mittlerweile bereits zwei Monate dabei war. Letzte Woche hatte sie mich tatsächlich zu irgendeiner Gastronomieveranstaltung mitnehmen wollen, zu einer lustigen Wurstmesse oder sowas, am Sonntag. Da könne man sich immer gut sattessen, hatte sie gemeint, alles umsonst. Eine Art Verkostung, und was zu trinken gäbe es auch. Sie war ungefähr Mitte Fünfzig und ich gerade mal halb so alt, und offenbar lebte sie allein. Was sollte das werden?
Nur mit Mühe war ich aus dieser schrägen Nummer rausgekommen, ohne sie allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Aber zumindest das hatte ich im Osten ja gelernt, nämlich mich bei Bedarf als freundliches Chamäleon zu tarnen und mir auch in den absurdesten Situationen rein gar nichts anmerken zu lassen.
Und diese Fähigkeit schien mir auch hier zuweilen ganz nützlich zu sein.
Als ich mit dem Speisesaal fertig war, hatten die anderen in der Küche längst mit den Vorbereitungen für das Mittagessen begonnen. Hühnerkeulen mit Reis sollte es heute geben, und dazu Paprikasoße. Knapp hundert Personen waren dafür angemeldet, eine durchschnittliche Zahl. Denn nur wenige Gruppen buchten Vollpension, und Einzelgäste (oder ‚Einzelwanderer‘, wie Frau Bauer sie meist altmodisch nannte) kamen so gut wie nie zum Mittagessen. Höchstens vielleicht mal am Anreisetag. Daher ging es mittags meist deutlich ruhiger zu als beim Frühstück.
Allerdings fand ich es schon manchmal seltsam, dass Omar als Moslem zum Beispiel für zweihundert Leute Schweinegulasch kochte, ohne selber überhaupt einen einzigen Bissen davon zu kosten. Einer von uns anderen machte dann halt den Abschmecker und musste zwischendurch öfter mal probieren und ihm sagen, ob genug Salz dran war oder noch irgendwelche Gewürze fehlten. Auch hatte ich zuerst geglaubt, Omar wäre ein bisschen schwerhörig oder würde nur ganz schlecht Deutsch verstehen, denn meistens wollte er, dass ich ihm Frau Bauers Anweisungen für den Tag noch einmal wiederholte. Es dauerte eine Weile bis ich kapierte, dass es ihm dabei eigentlich bloß darum ging, nicht einer Frau gehorchen zu müssen. Schon mit meinem Vorgänger, einem jungen Italiener, war es wohl ähnlich gelaufen, zumindest konnte ich das aus einigen Andeutungen schließen. So hatte man sich im Laufe der Zeit anscheinend irgendwie stillschweigend miteinander arrangiert; die Küchenchefin sprach oft bloß von der Tür aus ganz allgemein in den Raum hinein, was am betreffenden Tag so alles erledigt werden sollte, und ich gab das dann einfach hinterher wie ein Papagei an Omar weiter, kaum dass Frau Bauer wieder in Richtung Büro verschwunden war. Von mir ließ er sich jedenfalls ohne Weiteres sagen, wie viel Kilo Hackfleisch er für die Bolognese nehmen sollte oder welche Sorte Fisch diesmal dran war, damit hatte er kein Problem. Obwohl ich ja nur der Küchenjunge war, aber Hauptsache eben ein Mann.
Wie zu erwarten liefen die fünf oder sechs Gruppen beim Mittagessen problemlos durch. Meistens handelte es sich um Kinder mit ihren Lehrern auf Klassenfahrt, die allesamt schon ein paar Tage hier waren und daher die Abläufe kannten. Also Besteck in die Schüssel, Abfälle in die Behälter, und benutztes Geschirr wieder zurück auf den Wagen. Selbst die Italiener hatten es inzwischen begriffen.
Allerdings gab es da heute auch diese neue Mädchen-Sportmannschaft aus Holland, die zu irgendeinem Turnier angereist war und aus lauter schlanken fünfzehn- oder sechzehnjährigen Schönheiten bestand. Da gab ich mir bei der Einweisung natürlich besonders viel Mühe. Selbst der alte Omar kam dann noch nach vorn an die Ausgabe geschlichen, um die hübschen Teenager beim Essen zu beobachten.
„Schöne Mädchen“, flüsterte er anerkennend, und ich nickte ihm stumm zu und tat so, als würde ich den Tresen abwischen. Aber meine Augen waren natürlich ganz woanders.
Fast alles wurde brav aufgegessen, nur die Hühnerknochen wanderten in die Tonne, und um kurz nach halb eins war der Speisesaal bereits wieder leer.
Bis auf die Wagen mit dem schmutzigen Geschirr natürlich.
“Na ich will mal kein Spülverderber sein”, rief ich Julia und Nang zu, die sich gerade seufzend anschickten, den Abwasch zu übernehmen, “ich mach das schon.” So konnten die beiden in Ruhe den Herd und die anderen Gerätschaften putzen, während Omar und Milana draußen vor der Hintertür gemütlich ein Zigarettchen rauchten.
Anschließend machten wir alle zusammen Mittagspause.
“Ein oder zwei?”, fragte mich Omar am Konvektomaten, als er meinen Teller füllte, auf dem bereits eine Hühnerkeule lag, und nachdem ich ihm aufmunternd zugenickt hatte, landete auch noch die zweite darauf. Zufrieden trug ich mein Tablett zum Tisch, setzte mich zu den anderen und ließ es mir schmecken. In puncto Verpflegung hatte ich hier wirklich nichts zu meckern, das musste ich zugeben. Und auch sonst fühlte ich mich beim Deutschen Jugendherbergswerk, den so hieß diese Institution offiziell, gar nicht so schlecht aufgehoben. Sicher, es wurden nicht unbedingt Spitzenlöhne gezahlt, aber es gab ja noch die Berlin-Zulage, also acht Prozent des Bruttogehalts obendrauf, und zwar steuerfrei, was zusammen mit den jeweils anfallenden Wochenend- und Feiertagszuschlägen am Monatsende unterm Strich doch einen ganz ordentlichen Betrag ergab. Außerdem durfte man nicht vergessen, dass hier alles in allem eine recht anständige Atmosphäre herrschte.
Beispielsweise hatte mir Clarissa, die junge Leiterin, schon nach gut drei Wochen eine äußerst großzügig abgefasste Bescheinigung ausgestellt, die sich bei der Wohnungssuche als sehr hilfreich erwiesen hatte. Denn potentiellen Vermietern ging es ja meist längst nicht nur darum, dass der entsprechende Bewerber die nötige Zahlungsfähigkeit für Miete und Kaution mittels Kontoauszug belegen konnte, sondern man wollte obendrein einen Nachweis über seine ungekündigte Stellung sehen, sowie über regelmäßig eingehende, ausreichende Lohnzahlungen, am liebsten seit mehreren Jahren. Ohne das von Clarissa verfasste und unterschriebene Papier, ohne ihre bereitwillige Unterstützung in dieser Angelegenheit, da würde ich jetzt vielleicht noch immer im Wohnheim hocken, das war mir jedenfalls klar, oder ich hätte höchstens ein Zimmer in einer Zweck-WG ergattert, befristet für wenige Monate. Nur als Untermieter, bis der eigentliche Bewohner wieder von seinem Asientrip oder Auslandssemester zurückkehrte. So aber hatte ich nun nach relativ kurzer Suche eine eigene Wohnung gefunden, was natürlich fantastisch war, und das musste man eben alles mit in Betracht ziehen, wenn man diesen Job reell bewerten wollte. Fürs Erste war ich zumindest ganz gut bedient damit, fand ich, und meine Pläne für ein späteres Studium konnten ruhig noch ein wenig warten.
Allmählich trudelten dann die Kollegen von der Spätschicht ein, die zwei Thailänderinnen Benja und Karo, und Essam, der ägyptische Koch.
Wie meistens standen Benja und Karo gleich wieder mit Nang zusammen und unterhielten sich halblaut, wobei die drei andauernd schon drauflos kicherten, kaum dass sie überhaupt ihre Kittel richtig zugeknöpft hatten.
„Ecki, wann du musst Ostberlin zurück?“, fragte mich Nang plötzlich und gab sich dabei Mühe, möglichst beiläufig zu klingen, obwohl ihre dunklen Augen ziemlich verwegen blitzten. Denn es war nicht das erste Mal, dass sie versuchte, mich damit aufzuziehen, besonders vor ihren Freundinnen.
„Wann deine Urlaub vorbei, und du zurück?“, stichelte sie weiter, natürlich ganz unschuldig.
„Du kleines Biest, du, na warte nur“, drohte ich ihr spielerisch mit dem Finger, und schon konnte sie ihr Grinsen nicht mehr unterdrücken.
„Beim nächsten Mal jag‘ ich dich zwei Runden durch die Spülmaschine“, rief ich schließlich warnend, „und zwar einmal mit und einmal ohne Kittel!“
Alle drei gackerten los, so etwas leicht Frivoles schien ihnen zu gefallen.
Unterdessen brachten Julia und Milana ihr benutztes Geschirr in die Spülecke und gingen danach pünktlich zum Umziehen nach unten, und auch Omar folgte ihnen einen Augenblick später, nachdem er sich vorher noch kurz mit Essam besprochen hatte.
„Soll was davon in den Kühlraum runter, oder nach draußen in den Abfall?“,
bot ich Essam noch kurz vor meinem Feierabend Hilfe an und zeigte auf das bisschen übriggebliebenen Reis und den Topf mit der Paprikasoße.
„Ah, lohnt sich das nicht, bring weg das Fraß, danke“, winkte er bloß grinsend ab, und zusammen kratzten wir die Reste in einen Müllbeutel, den ich dann raustrug und auf dem Hof in den Container warf.
Danach ging ich runter in den Keller zum Duschen, wobei mich diese Tür oben an der Treppe wieder einmal nervte. Sie klemmte, das heißt sie hing etwas schief in den Angeln und scharrte deshalb beim Öffnen und Schließen am Boden entlang, was jedes Mal ziemlich unangenehme Kratzgeräusche produzierte. Zwar war der Hausmeister auf Frau Bauers Bitte hin neulich deswegen tatsächlich schon einmal zu einer ersten fachkundigen Inaugenscheinnahme direkt vor Ort erschienen, hatte dann allerdings auch nur etwas von ‚Türblatt einkürzen‘ gemurmelt und sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Aber nun ja, dachte ich, es gab wohl Schlimmeres.
Ich war jedenfalls froh über die kleine Personaldusche im Untergeschoss. Eine einfache Kabine, kein Luxus, aber immerhin. Eigentlich wurde sie nur relativ selten benutzt und war wohl vor allem für die Köche gedacht, weil man nämlich beispielsweise nach dem Braten von zweihundert Fischfilets natürlich auch entsprechend roch und so vielleicht nicht unbedingt nach Hause gehen wollte. Aber da in meiner neuen Wohnung derzeit leider nur ein altmodischer Küchenausguss mit Kaltwasser zur Verfügung stand, brauchte ich momentan eben selbst dringend eine vernünftige Waschgelegenheit.
Also hatte ich vor zwei Wochen sowohl bei Omar und Essam als auch bei Frau Bauer dezent deswegen angefragt und war auf keinerlei Vorbehalte gestoßen, so dass ich hier nun täglich nach der Schicht duschen konnte.
Es sollte ja auch nur vorübergehend sein.
Als ich gegen kurz nach drei zu Hause ankam, machte ich sogleich nahtlos da weiter, wo ich gestern aufgehört hatte: beim Renovieren. Wohnzimmer und Flur waren bereits komplett durchgemalert, in lindgrün beziehungsweise zartgelb, heute kam die Küche dran. Weiß, nur die eine große Wand leicht orange abgetönt, so war der Plan. Hinterher sollten dann noch die Maisstrohmatten ausgelegt werden, damit ich nicht länger auf dem hässlichen, kalten Linoleum laufen musste. Außerdem wartete eine Lampe darauf, montiert zu werden, und vor allem brauchte ich endlich Möbel. Denn bis auf die neu gekaufte Matratze und zwei wacklige Stühle war die Bude ja gegenwärtig sozusagen bloß mit Luft gefüllt.
Ich zog mir meine alten verklecksten Klamotten vom Vortag an, schob eine meiner drei Kassetten in den klapprigen Recorder, den ich neulich billig auf dem Flohmarkt erstanden hatte, und drehte die Lautstärke auf. ‚Us and Them‘ von Pink Floyd erklang, danach würde dann ‚School‘ von Supertramp kommen, gefolgt von Americas ‚A Horse with No Name‘, und so weiter.
Längst kannte ich die Reihenfolge der Songs auswendig.
Bevor ich loslegte, rührte ich zunächst mit einem alten Holzlöffel die Wandfarbe im Eimer durch.
Ja, ich hatte es geschafft, sagte ich mir, ich war raus aus dem Wohnheim, die erste Etappe lag hinter mir. Aber es gab eben noch so verdammt viel zu tun!
Bloß fokussiert bleiben, ermahnte ich mich im Stillen, während ich ein ums andere Mal die Rolle in die Pampe tunkte, das Lammfell am Sieb abstrich und dann immer schön gleichmäßig die Wand mit der matschigen Farbe einkleisterte. Rauf und runter, wie ein Uhrwerk, hin und her. Hauptsache ‚das Momentum beibehalten‘ (oh, ich liebte zuweilen solch hochtrabende Floskeln, vielleicht weil ich ihnen etwas Beschwörendes zuschrieb), ja doch, verflucht, darauf kam es jetzt an, vor allem ‚das Momentum beibehalten‘! Das war mein aktuelles Mantra. Stets den Blick nach vorn und erst recht kein sentimentales Gejammer wegen irgendwelcher ‚guten alten Zeiten’, solchen Quatsch konnte ich mir nicht leisten! Bloß nicht schlappmachen! Nein, einfach alles andere ausblenden, bis das Ziel erreicht war, und fertig. Auf Kurs bleiben und voll durchziehen, eine reine Frage der Selbstdisziplin.
Aber zumindest eine anständige Stereoanlage würde ich mir demnächst gönnen, versuchte ich mich per Autosuggestion schon mal in positive Stimmung zu versetzen. Good vibration – best motivation! Gleich nächste Woche, dachte ich voller Vorfreude, sobald mein Monatslohn auf dem Konto ist, da wird zugeschlagen. Yeah!
Denn es wurde höchste Zeit, dass wieder ein bisschen mehr Musik in mein Leben kam.
Zwei Stunden später war ich so gut wie fertig mit der Küche, nur ein paar schwierige Stellen um das Fenster herum mussten noch ein bisschen nachgearbeitet werden.
Kleine Pause, dachte ich einigermaßen zufrieden, betrachtete mein Werk und schälte mir eine Apfelsine. Extra zur Feier des Tages, wegen der nun frisch in feuchtem Orange schimmernden Wand.
Vorsichtig drehte ich hinterher mit meinen klebrigen Fingern die abgelaufene Kassette im Recorder um und machte anschließend mal wieder den imaginären Ansager: „Ladies and Gentlemen, die Gruppe THEM aus Belfast, mit Van Morrison und dem guten alten Song: Don‘t look back! Eine wunderschöne Mischung aus Melancholie und Zuversicht, und achten Sie besonders auf das herrlich schwummrige Piano, allein schon dieses markante Intro – und los geht‘s!“
Dann drückte ich die PLAY-Taste, das Band lief an, und kurz darauf sang ich lauthals mit: „Don‘t look back, to the days of yesteryear… those days are gone… don't look back, whoa, no-no, don't look back…“Auch am nächsten Tag hatte ich wieder mit Julia zusammen Frühdienst.
Freilich stand der Schichtbeginn heute zunächst unter keinem guten Vorzeichen, denn Julia, die an sich schon durchaus ein kleines Morgenmuffelchen sein konnte, war heute offenbar besonders schlecht gelaunt. Hauptsächlich wohl deshalb, so ließ sie nach und nach durchblicken, weil sie auf dem letzten Wegstück von der U-Bahn zur Jugendherberge mal wieder von irgendwelchen notgeilen Freiern, die dort mit ihren Autos im Schritttempo patrouillierten, verbal entsprechend belästigt und zum Einsteigen geradezu genötigt worden war. Die meisten unserer Küchen- und Etagenfrauen hatten bereits ähnliche Erfahrungen gemacht, denn das ganze umliegende Areal war seit langem berüchtigt als Straßenstrich, oder ‚Kiez‘, wie es beschönigend hieß. Normalerweise passierten solch unangenehme Vorfälle eigentlich meistens nach der Spätschicht, wenn das Nachtleben dort gerade erst anfing. Julias heutigen (insgesamt recht spärlichen) Angaben nach zu urteilen schien frühmorgens jedoch eindeutig die schlimmere Klientel unterwegs zu sein.
Um sie etwas aufzuheitern, erzählte ich ihr von der Einladung zur Wurstausstellung, mit der mich neulich Frau Bauer zu beglücken versucht hatte. Wobei ich mir Mühe gab, die Angelegenheit noch ein wenig auszuschmücken und sowohl stimmlich als auch von der Mimik her mit angemessener Komik vorzutragen. Ja und tatsächlich, schon bald zeigte sich der Anflug eines ersten zögerlichen Lächelns auf Julias Gesicht, und ihre Laune besserte sich zusehends.
Wie üblich bereitete sie die Servierwagen für die Gruppen vor, während ich mich zunächst um die schwereren Sachen kümmerte. Voller morgendlicher Energie wuchtete ich die Stapel der Bäckerkisten von draußen in die Küche, holte Butter, Milch und Wurst von unten aus dem Kühlraum hoch (wobei die obere Kellertür wieder ganz erbärmliche Schleifgeräusche von sich gab) und stellte dann Teller und Tassen bereit, damit sich alles nachher gleich bequem in Reichweite befand. Auch die Kaffeemaschine wurde natürlich startklar gemacht, und zwar ohne dass sie diesmal überlief.
Zu guter Letzt kniete ich mich im Flur auf den Fußboden vor der Kellertreppe hin und rieb dort die von der Tür zerkratzten Stellen kräftig mit Kerzenwachs ein, einfach mit einem von zu Hause extra dafür mitgebrachten Teelicht.
„So, jetzt knarrt und schrammt hier nix mehr“, stellte ich anschließend befriedigt fest und ließ die Tür ein paarmal lautlos hin und her schwingen.
„Muss man eventuell demnächst mal wiederholen, aber auf den Hausmeister können wir ja wohl lange warten.“
„Cool“, meinte Julia bloß lächelnd, und wir zapften uns schon mal einen frischen Kaffee.
„Wie weit bist du jetzt eigentlich mit deiner Wohnung?“, erkundigte sie sich.
„Es geht vorwärts“, antwortete ich und berichtete ihr von meinen Aktivitäten der letzten Tage. Malern, Lampen und Gardinenstangen anbringen, Fensterrahmen und Scheuerleisten streichen.
„Außerdem kriege ich heute Abend endlich ‘n Kühlschrank geliefert“, fuhr ich fort und füllte dabei gleichzeitig schon mal etwas Reiniger aus dem großen Kanister in die Spülmaschine. „Gebraucht von privat. Den muss ich bloß noch schön mit Essigwasser auswaschen, und gut. Hab ich mir vor drei Tagen schon angeguckt. So ‘n Typ, der fährt Entrümplungen und Umzüge, der bringt mir den auf seiner letzten Tour vorbei, so um sieben rum.“
Ich beschrieb ihr meine kleine Altbauwohnung, an der zwar erst noch einiges gemacht werden musste, die dafür aber nur knapp einhundertfünfzig Mark monatlich kostete und damit bloß etwa ein Drittel einer von Lage und Größe her vergleichbaren Unterkunft. Aufgrund der Deckenhöhe von rund vier Metern war sie allerdings schon mal bestens für ein Hochbett geeignet, so dass ich dann trotz der lediglich dreißig Quadratmeter genügend Platz darin haben würde. Auch die Ofenheizung störte mich nicht weiter. Der einzige echte Haken an der Sache war jedoch das fehlende Bad. Denn es gab nur eine Toilette, plus ein Waschbecken in der Küche. Aber mein Plan war, mir eine separate Duschkabine mit Boiler und Pumpe zu besorgen, so wie ich es bei Bekannten gesehen hatte. Vielleicht würde ich ja demnächst schon etwas Passendes finden, schließlich guckte ich täglich in der ‚Zweiten Hand‘ sämtliche Annoncen durch. Also alles in allem war ich durchaus glücklich mit meinem jetzigen Domizil. Es ließ sich etwas draus machen, keine Frage, und bald würde ich es richtig gemütlich haben, das stand für mich fest. Jedenfalls war ich bestimmt nicht in den Westen gegangen, nur damit dann mein ganzes Geld für eine halbwegs moderne Behausung mit ein paar Annehmlichkeiten draufging. Nein, für mich gab es da wahrlich noch andere Ziele. Außerdem hatte ich schon etliche Jahre in deutlich primitiveren Bruchbuden zugebracht, ohne vernünftige Heizung und mit frostigem Außenklo. Von daher konnte es hier für mich sowieso nur aufwärts gehen.
Julia, die mir die ganze Zeit über aufmerksam zugehört hatte, schien von den Schilderungen meiner (eigentlich wohl eher bescheidenen) Heimwerker-Fähigkeiten durchaus beeindruckt zu sein. Sie wohnte ja noch wohlbehütet bei ihren Eltern, die im Alltag weiterhin vieles für sie regelten. Vielleicht fand sie es daher auch besonders spannend, dass ich mir überhaupt zutraute, eine ziemlich verwohnte Höhle in ein behagliches Zuhause zu verwandeln, so ganz allein und aus eigener Kraft. Denn darüber staunte sie wohl am allermeisten.
Zehn Minuten später staunte ich jedoch, und zwar nicht schlecht, als Julia nämlich so ganz nebenbei erwähnte, dass sie bisher nur ein einziges Mal aus Westberlin herausgekommen wäre. Ein einziges Mal, für sechs Tage, bei einer Klassenfahrt irgendwohin nach Schleswig-Holstein. Das war alles.
Oh du heiliger Strohsack, dachte ich, und ich hatte tatsächlich einen Moment lang Mühe, mich zu beherrschen und mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen. Obwohl ihr die ganze Welt offenstand, hatte sie also bis auf diese eine Woche ihr gesamtes Leben freiwillig in dieser eingezäunten Inselstadt verbracht, immer nur hinter der Berliner Mauer! Kein einziger Kurztrip nach London oder Amsterdam, keine Busreise nach Fehmarn oder Hamburg, geschweige denn ein Flug auf die Kanaren oder nach Amerika!