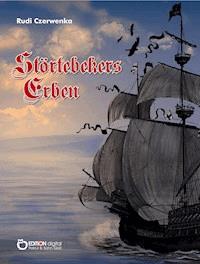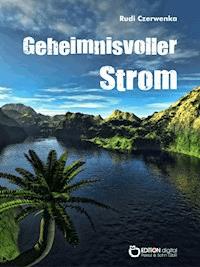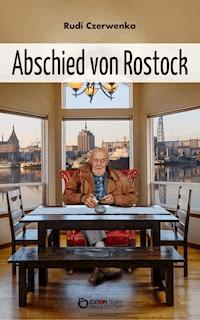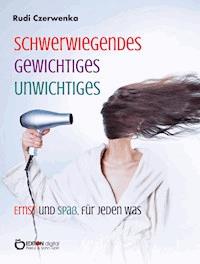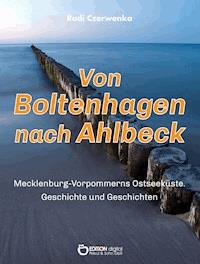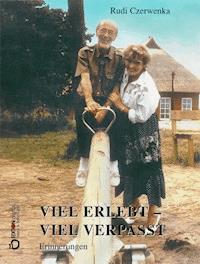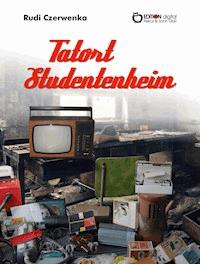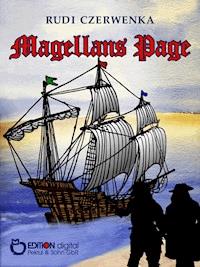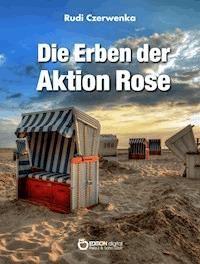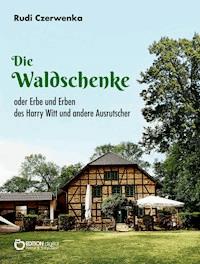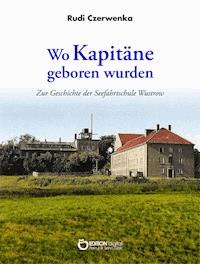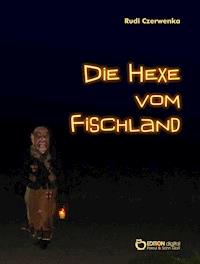
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wustrowerin Tillsche Schellwegen liebt den Frauenverführer Johann Holste. Während sie diese Beziehung ernst nimmt, sieht Holste diese bald nur noch als Hinderungsgrund für sein Fortkommen. Um das Küsteramt zu bekommen, nimmt er die Witwe des Küsters zur Frau, will aber Tillsche nicht verlieren. Da sie inzwischen verheiratet ist, plant er ein Attentat auf den Fischer Hans Dahm, das einen anderen Dorfbewohner tötet. Um sich selbst zu retten, bezichtigt er Tillsche der Hexerei. Dabei sekundiert ihm der skrupellose Fritz von Wagenhof, der nach Abschluss der Greifswalder Juristenfakultät zum Gerichtsadjunkt in Ribnitz aufgestiegen war. Und so nimmt das Grauen seinen Lauf: Tillsche wird festgenommen, gefoltert und nach missglückter Flucht auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der spannende historische Roman entstand nach Akten über die letzte Hexenverbrennung in Güstrow am 17. Mai 1664. INHALT: „Du hast meinen Hund totgemacht, du sollst verflucht sein!“ „Der Herr lässt keinen Unterschied zwischen Mann und Weib. Wir alle sind Geschöpfe Gottes." „... In Gottes Namen, für den ihr euer schändlich Werk betreibt, wenn dieses auch des Teufels ist." Dort war sicher ein anderes Leben als auf dem engen, leidgeprüften, vom Krieg kahl gefressenem Fischland An jenem Morgen zeigte sich im Dorf ein wohlgekleideter Fremder ... „Wenn dieser Mensch sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er dafür nicht nur über Stock und Stein, sondern auch über dich." „Du hättest mich haben können. Du hast dieses blöde Amt vorgezogen. Und damit hast du dich entschieden." „Die Welt ist ein einziger Misthaufen. Die gleichen Ratten treffen sich immer wieder.“ „Küster, hilf mir aus meiner Not!“ „Wo bleiben unsere verbrieften Rechte, wenn jeder kleine Landherr innerhalb unserer Mauern tun und lassen kann, was er will?" „... Sollte sie aber in guthem nicht bekennen wollen die Wahrheit, so seid ihr mit der scharffen Frage zuzugreifen voll befuget." „Das war des Teufels Werk. Wenn es noch eines letzten Beweises bedurfte, so haben wir ihn jetzt." „Das ehrenwerte Gericht unserer Stadt hat vor Gott und nach Recht und Gesetz befunden ..." Denn alle Schuld rächt sich auf Erden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Rudi Czerwenka
Die Hexe vom Fischland
Leben und Leiden der Tillsche Schellwegen
ISBN 978-3-86394-429-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1999 im Scheunen-Verlag Kückenshagen.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
„Du hast meinen Hund totgemacht, du sollst verflucht sein!“
Eine leichte Brise lichtete den Frühnebel, der wie ein Schleier über dem Bodden gelegen hatte und nun aufriss. Der Küstenstreifen war noch verhüllt, doch der mit Buschwerk überzogene Haken, hinter dem sich der Ribnitzer See nach Osten öffnete, schälte sich allmählich aus dem Dunst. Dort wurde ein Boot sichtbar. Es schien stillzuliegen. Nur die Wasserkringel um die Ruderblätter deuteten darauf hin, dass es sich näherte. Tillsche, die knapp zwanzigjährige Tochter der Magd Ilse Schellwegen aus dem Kirchdorf Wustrow, war auf dem Weg zum Ribnitzer Markt.
Man schrieb das Jahr 1635. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Nach ihrer Landung an der Peenemündung hatten nun die Schweden die zuvor von den Kaiserlichen besetzten Ribnitzer Schanzen und damit auch das Fischland erobert, wo es allerdings nicht mehr zu viel zu holen gab. Ein paar Dutzend Familien hatten in dem von wechselnden Machthabern ausgelaugten Landstreifen zwischen Meer und Bodden überlebt. Die Äcker lagen brach, die Wiesen waren verwildert. Die Menschen hatten lernen müssen, dass es sich kaum noch lohnte, Vieh einzustallen oder Felder zu bebauen. Die fremden Kriegsscharen, jetzt auch die Schweden, nahmen, was sie fanden. Über diese regulären Armeen hinaus saßen abgespaltene Landsknechtsrotten und Räuberbanden in den Wäldern und durchstreiften plündernd das Land. Nichts und niemand war vor ihnen sicher.
Am Beginn dieses Krieges, als Ilse Schellwegen in schwangerem Zustand von ihrem Diensthof verwiesen worden und durch die Küstendörfer geirrt war, hatte sie in einer leer stehenden Kate auf dem Fischland ein Mädchen, ihre Tillsche zur Welt gebracht. Und sie war hier geblieben. Das Kind wurde wie ein Junge gehalten, auch gekleidet und erzogen. Zwar waren auch Knaben vor dem Zugriff der unterschiedlichsten Werber nicht sicher, doch Mädchen lebten weitaus gefährdeter. Der Zufall wollte es, dass die in der Nachbarschaft lebende Bäuerin Trin Permin im gleichen Jahr ihren bereits zweiten Buben in die Welt setzte.
Frei und zwanglos wuchsen die drei Kinder heran, wobei das Mädchen fast immer den Ton angab und damit das gemeinsame Tun bestimmte. So eroberten sie sich ihre Heimat, das Fischland, auf ihre kindliche Weise. Unbekümmert zeigten sie sich in den Lagern der Söldner und der sonstigen Schnapphähne, durchschnüffelten die kümmerlichen Vorratsverstecke der Einwohner, besuchten die Hühnergelege von Pastor Mund und den Obstgarten ihres Schulmeisters, des Küsters Bradhering. Ob es nun um derart riskante Ausflüge oder um Knüppelspiele, ums Klettern, Schwimmen oder Wettlaufen ging, das Mädchen Tillsche stand Chell und Rohle Permin in nichts nach.
Die Kinderfreundschaft hielt, auch als die drei herangewachsen waren.
Der seit Langem umstrittene, von den großen Hansestädten zerstörte und in den Kriegsjahren zunehmend verfallende Ribnitzer Hafen war erreicht. Tillsches Kahn schurrte aufs Ufer. Boris, der Hund, sprang an Land und schüttelte sich die Frühfeuchte aus dem Zottelfell. Mühelos hob das Mädchen die hölzerne Karre aus dem Boot. Es folgten die mit feuchtem Leinen abgedeckten Fischkörbe, gefüllt mit der Beute von Hans Dahm, dem Fischer vom Kirchdorf. Tillsche sicherte den Kahn, indem sie ihn vollends auf Land zog.
Dann legte sie sich den Karrengurt über die Schultern und rumpelte mit ihrer Last hügelan zur Stadt. Bald war der Marktplatz erreicht, der noch die Morgenstille atmete. Tillsche legte hier nur eine kurze Verschnaufpause ein. Boris hob zweimal das Bein, einmal beim Korbflechter Drews, der seinen Verkaufsbock aufbaute und den Hund davonscheuchte, das zweite Mal dicht neben dem blinden Gustav, der auf seinem Sackpolster hockte und seinen Kleinkram anpries, obwohl zu dieser Stunde noch kein einziger Käufer in Sichtweite war.
Tillsche überquerte den Markt und nahm die Gasse zum nahen Kloster, das seit 40 Jahren keines mehr war, doch weiterhin so genannt wurde. Gute 300 Jahre hatten die grauen Schwestern nicht nur über St. Claren, sondern auch über das Fischland und etliche weitere Dörfer verfügt, über Holzungen und Weiden, über Fischteiche, Bierbrauen und Mühlen, über Markt- und Wegerechte. Nur mit reichlichen Zugeständnissen hatte sich die Stadt einige Rechte innerhalb ihrer Mauern sichern können.
Doch dann hatten der Doktor Luther und seine Reformatoren den wohllebenden Nonnen einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Das Kloster ging in den Besitz der Mecklenburgischen Landschaft über. Anstelle der Äbtissin regierte nun Domina Ursula von Kerkdorps das Stift für unversorgte Adelsdamen und bestimmte über die immer noch ansehnlichen Pfründe und Rechte. Tillsche zog kräftig am Glockenstrang neben dem Klostertor. Der Schaffer öffnete, brummte einen Morgengruß und ließ sie ein. Der Fischkarren ratterte über die Kopfsteine zum Wirtschaftstrakt. Der Koch, ein maßloser Schwabbelbauch auf zwei gefährlich dünnen Beinchen, quälte sich die wenigen Stiegen herunter und begutachtete den Inhalt der Fischkörbe. Boris beschnüffelte den verlockend stinkenden Mann. Der wies auf die leicht gepökelten Heringe und winkte Tillsche, das Gewünschte zur Kellerluke zu bringen.
Das Mädchen hatte noch einen weiteren Auftrag zu erledigen. Ilse Schellwegen hatte ein Beutelchen mit Heilkräutern für eine der Stiftsdamen mitgegeben. Doch deren Kammer war leer. Einer der Hofknechte holte die Frau aus dem Lesesaal. Berta von Wagenhof war höchstens zehn Jahre älter als Tillsche, aber dürr und klapprig wie eine Greisin. Lange Kleiderärmel und ein breiter Schalkragen verhüllten ihre Gestalt, doch das durch bläulich rote Pusteln vernarbte Gesicht entstellte sie.
Die beiden Frauen setzten sich auf eine der klobigen Bänke im Windschatten der Klostermauer.
Tillsche zog das mitgebrachte Leinensäckchen aus dem Hemd und übergab es. "Mit guten Wünschen von der Mutter. Wir haben noch Ginstertriebe beigemischt, nicht nur Huflattich und Scharfgarbe. Ihr solltet die Kräuter mit wenig Wasser aufbrühen und eine Weile stehen lassen. Wenn sich neue Schwären bilden, dann tränkt ein Tuch und legt es auf."
"Ich danke euch." Die Frau steckte Tillsche einen viertel Silbertaler zu. "Und wie geht es der Mutter?"
Tillsche zuckte die Schultern. "Im Winter war sie kein einziges Mal aus der Tür. Jetzt versucht sie's wieder. Auch mit den Augen wird es immer schlimmer."
"Ein Jammer ist das. Da hat sie so vielen Menschen geholfen und ihre Leiden gemildert. Und nun, wo sie selbst Hilfe braucht, kann ihr nur noch Gott helfen."
"Wir tun, was wir können, die Nachbarin Permin und ich."
Frau von Wagenhof erhob sich seufzend.
"Es ist doch empfindlich kühl hier", sagte sie. "Ich will wieder nach drinnen. Unser neuer Lesemeister erzählt uns von seinen Abenteuern."
"Abenteuer erlebe ich selbst genug auf unserer Insel."
"Aber der Mann hat die Welt gesehen", warf die Stiftsdame ein, "bis nach Arabien hat es ihn verschlagen, wo die Männer Turbane tragen. Auch bei Hofe ist er gewesen, sowohl in Güstrow als auch in Schwerin und hat dort die Damen unterhalten.” Damit verschwand Frau von Wagenhof hinter einer der Türen.
Tillsche, die noch nie über den Darßer Wald und über Ribnitz hinausgekommen war, war neugierig geworden, vor allem wegen dieses Mannes mit dem Turban. Zunächst jedoch holte sie ihren unter einer Kastanie abgestellten Karren und rumpelte vom Hof. Boris wollte in Richtung Markt davontoben. Sie pfiff ihn zurück und schob ihr Gefährt entlang der Klostermauer bis zu der Stelle, wo diese an den Lesesaal stieß. Mit beiden Händen krallte sie sich an zwei aus dem Mauerwerk ragende Steine, nahm Schwung und war oben. Vorsichtig kroch sie auf der Krone entlang bis zu dem ersten Fenster.
Die Damen in dem Raum kehrten ihr den Rücken zu. Ihnen und somit auch Tillsche zugewandt saß jener Mann, der zu ihrer Enttäuschung überhaupt keinen Turban trug. Dafür hatte er langes, wie Seide schimmerndes, blondes Haar, das ihm über den weißen Kragen fiel, der den langen schwarzen Rock zierte. Er bewegte die Lippen, doch Tillsche hörte nichts, denn die Fenster waren geschlossen. Das also war der Vorleser, von dem die Damen seit wenigen Wochen ausnahmslos schwärmten und der ihnen die weite Welt in ihre Einsamkeit brachte. Wie gebannt starrte Tillsche in das Halbdunkel des Raumes. Das hier war doch ein anderer Kerl als die, die sie kannte, als Fischer Dahm oder Fiete Permin oder ihre Freunde Chell und Rohle. Ihre Neugier wuchs, und sie wagte sich auf der schmalen Mauer immer weiter vor. Da sah der Mann auf, und Tillsche zuckte zurück, während ihr Herz klopfte. Als sie sich dennoch wieder hervortraute, hielt sie den Blicken stand, die er nun fast ununterbrochen auf sie richtete. Er war so jung, und die Augen waren so hell, und das Haar war so weich.
Der laute Klang der Klosterglocke riss sie in die Wirklichkeit zurück. Dies war das Signal, das den Bauern und Knechten auf den Feldern und Wiesen seit alters her die vormittägliche Arbeitspause ankündigte. Nun aber mahnte es Tillsche, dass sie hier noch anderes zu tun hatte, als faul auf der Mauer zu hocken.
Sie sprang herab, sodass Boris jäh aus seinem Nickerchen gerissen wurde.
Wenige Minuten später war sie auf dem Markt. Sie drängte sich durch das Gewühl zu ihrem angestammten Platz, deckte die Körbe ab und beteiligte sich an den Geschäften. Dabei genoss sie den Vorteil, dass allein sie Fische anbot.
Das Treiben war inzwischen voll im Gange. Die Handwerker hatten ihre Frauen geschickt. Sie konnten besser reden, die Waren erfolgreicher anpreisen. Die Kleinkrämer dagegen saßen selbst an ihren Ständen und schafften es durchaus, die Weiber zu übertönen. Doch nicht nur Verkäufer und Kauflustige bevölkerten den Markt, sondern auch viele Gaffer, Gesellen, Schulkinder und Soldaten. Denn hier konnte man nach Jahren der Flaute, seit die Schweden das Zepter übernommen hatten und zu ihrem Nutzen für Ordnung sorgten, immer etwas erleben.
Es ging auf Mittag. Tillsche hatte nur noch Reste ihrer Schellfische und ein paar Marellen in ihren Körben. Abgesehen von dem Tribut für die Klosterküche, waren die Heringe und auch die Muscheln, die Dahm aus seinen Reusen gepflückt hatte, für gutes Geld unter die Leute gebracht. Die Schar der Menschen auf dem Platz war zusammengeschrumpft.
Auch im Adelsstift näherte man sich der Essenszeit, wie aus dem über den Hof ziehenden Fischgeruch unschwer zu erschnuppern war.
Frau von Wagenhof hatte heute bereits zum zweiten Mal Besuch. Fritzing, der Sohn ihres Bruders, war gekommen, um die Tante, deren Bett- und Leibwäsche infolge ihrer Krankheit stark und schnell verschmutzte, mit frischem Zeug zu versorgen.
Sie saß in ihrem Lehnstuhl. Das Bürschlein stand vor ihr und rieb sich das Hinterteil nach dem langen und schmerzvollen Ritt aus den Schwaanschen Landen.
"Dass dich der Vater heute ohne Knecht diesen weiten Ritt hat machen lassen", sprach die Frau vorwurfsvoll, "mit dem guten Zeug und dem Geld!"
"Mir geschieht schon nichts. Harro ist ein friedliches Pferd, wenn auch ein bisschen breit im Kreuz. Und sollte mir mal einer an den Kragen gehen wollen", Fritz schlug die Weste zurück und wies auf das breite Messer, das im Gurt steckte, "ich kann mich wehren."
"Gott möge dich behüten!", barmte die Tante.
Auch Tillsche hatte derweil Besuch an ihrem Marktstand.
Amtmann David Hinrich, begleitet vom Stadtknecht Jürgen Kolpin, drehte bereits die zweite Runde an diesem Tag, denn für die Stadt zählte jede, auch die geringste Einnahme.
"Da ist ja kaum noch etwas drin", staunte Hinrich beim Blick in Tillsches Körbe. "Und dabei warst du vorhin noch gar nicht hier. "
Das Mädchen lachte. "Ich habe mich eben angestrengt. Doch Eure Magd hat noch genügend Hering mitnehmen können."
"Und wann kommt der Aal?"
"Das hängt nicht von mir ab, sondern vom Aal selbst und von Fischer Dahm."
Hinrich wurde amtlich und ließ sich das Marktheft reichen. "Das Standgeld hat Dahm gezahlt. Und auch der Wiegemeister ist zu seinem Recht gekommen. Die besten Stücke hat dir wohl wie immer das Kloster abgenommen“, scherzte er.
"Eine Wanne voll", erwiderte Tillsche und sprudelte drauflos. "Den neuen Lesemeister habe ich auch gesehen."
"Ach, den Johann Holste!" Hinrich winkte ab.
"Aber er kommt aus Arabien, wenn auch ohne Turban", ereiferte sich das Mädchen, "und er hat Geschichten erzählt."
"... und er lässt sich bestaunen und bekochen und wohl noch mehr, der Taugenichts", fügte der Amtmann hinzu. Dann setzte er seinen Weg fort. "Grüß mir dein Fischland und deine Frau Mutter!"
Es wurde kühl und windig. Die Frühlingssonne, die zunächst einen wärmeren Tag versprochen hatte, versteckte sich hinter düsteren Wolken. Tillsche beschloss abzubauen. Die letzten Fische schenkte sie wie üblich den Marktknechten, verstaute den Verkaufsbock und die Körbe auf dem Karren und machte sich auf den Weg zum Hafen. Eben, als sie ablegen wollte, blinzelte die Sonne doch wieder durch ein erstes Wolkenloch. Tillsche blickte zum Himmel, der im Westen völlig auf geklart war. Sie beschloss, die Gunst des Tages zu nutzen und mit Boris ein wenig durch das Brachland entlang der Recknitz zu stromern.
Weiter und weiter entfernte sie sich von der Stadt. Ihre Gedanken weilten im Kloster, bei dem Mann, dessen Namen sie nun kannte: Johann Holste.
Das Gebell das Hundes riss sie aus ihren Träumen. Sie schreckte auf. Ganz in der Nähe, über dem jungen und dennoch schon hohen Reetgras sah sie einen Reiter auf einem recht schweren Pferd herumzappeln und schließlich herabfallen. Und der Hund bellte weiter.
"Boris!”, schrie sie und rannte zum Ort des Geschehens.
Zuerst sah sie das Pferd. Es stampfte mit den Hufen, schnaufte und schüttelte die Mähne. Daneben hockte der eben aus dem Sattel geworfene Bursche. Es war Fritz von Wagenhof. Er zeigte auf die zerrissene Hose.
"Das Vieh hat mich ins Bein gebissen", jammerte er.
Und dann erblickte sie ihren Boris. Er lag auf der Seite. Ein Messer steckte in seinem Hals, und das Blut floss ihm aus dem Maul, färbte sein schwarzes Fell sowie das frische Grün ringsum. Er zitterte, richtete seine Augen noch einmal auf das Mädchen und hörte dann, zur Seite sinkend, auf zu atmen.
"Die Hose, was ist das schon." Tillsche streichelte den warmen Körper ihres geliebten Boris. "Aber du hast meinen Hund totgemacht. Du sollst verflucht sein!"
"Na und?" Fritz von Wagenhof rappelte sich auf, klopfte das Gras von der Kleidung, trat zu seinem Pferd, kraxelte noch etwas verstört in den Sattel und trabte davon.
Am späten Nachmittag durchritt er bereits das Kösterbecker Hügelland. Übellaunig hockte er im Sattel. Das Erlebnis in den Ribnitzer Wiesen klang nach. Er hatte das Tier nicht töten wollen. Aber was hätte er tun können, als er vom Pferd gefallen war und der Hund ihn verbellte?
Gemächlich ritt er durch ein kleines, in gelbe Blütenpracht getauchtes Tal, als aus einem niedrigen Gehölz vier Strauchdiebe auf ihn zustürzten. Er wollte nach dem Messer greifen, doch das war nicht mehr da. Inzwischen war der eine Kerl dem Pferd in die Zügel gefallen, der andere wollte ihn aus dem Sattel ziehen, erwischte aber nur einen der auf Zuwachs gefertigten Stiefel. Doch schließlich lag Fritz wehrlos am Boden, und die Wegelagerer durchsuchten ihn. Zunächst griffen sie nach dem Beutel mit der Schmutzwäsche und warfen ihn enttäuscht zur Seite. Die Durchsuchung förderte nichts Brauchbares zutage. Der eine Strolch begutachtete Fritzings Hut, riss die Federn heraus und warf das vorher doch so gute Stück fluchend beiseite. Schließlich kamen die Stiefel an die Reihe, und sie passten dem kleinsten der Banditen. Nicht sehr zufrieden mit dem gesamten Raubzug, nahmen sie das geduldig wartende Pferd am Zügel und zogen damit ab.
Fritz von Wagenhof hockte in dem blühenden Frühlingstal und heulte vor sich hin, barfüßig und ohne Pferd, und der Heimweg war noch weit. Dieser Tag hatte ihm reichlich Unglück beschert. "Sollst selber verflucht sein", schrie er plötzlich in die stille Landschaft und wischte sich trotzig die Tränen aus dem Gesicht.
Die, der die Verwünschung galt, kauerte derweil immer noch vor ihrem toten Freund und strich über sein verklebtes Fell. Zehn Jahre lang hatte Boris sie begleitet, als Beschützer, als Vertrauter, dem sie alle Geheimnisse zuflüstern konnte.
Es war die Zeit, als die Scharen des Dänenkönigs durch das schmale Fischland quollen und über das Meer fliehen mussten. Unter den nachrückenden Wallensteinschen war einer, der keine Waffen trug, sondern nur seine Flöte. Wenn er abends an den Lagerfeuern der Kaiserlichen aufspielte, dann wurden die wildesten Gesellen plötzlich zahm und still und vergaßen sogar die Hühner, die an den Spießen zu verbrutzeln drohten. Auch Tillsche, Chell und Rohle hockten dann oft bei den Landsknechten, nicht nur wegen der Musik, auch wegen des kleinen schwarzen Hundes, der dem Mann nicht von der Seite wich.
Doch dann kam die große Pest, die auch die fremden Söldner nicht verschonte. Eines Tages war ihr Lagerplatz öd und verlassen. Nur den Pfeifer hatten sie zurückgelassen, denn er war tot. Und neben seiner Leiche saß sein Hund.
Tillsche nahm ihn mit und taufte ihn Boris, wie der Mann von den Lanzenknechten genannt worden war. Er wuchs heran und wurde zum unbestrittenen Schutzpatron der Kindergruppe. Auch Ilse Schellwegen fand sich bald mit ihm und seinem ständigen Fresstrieb ab. Er bedankte sich bei ihr auf seine Art. Er begleitete sie auf ihren Gängen durchs Dorf. Er brachte Tillsche zur Schule und wartete geduldig am Hoftor von Küster Bradhering, bis sie wieder herauskam. Im Laufe der Zeit beneideten die Dorfleute sogar die Schellwegens, bei denen kaum einmal eine Gans vom Hof oder ein Huhn aus dem Verschlag verschwand.
Doch nun war Boris tot, und Tillsche war verzweifelt wie nie zuvor in ihrem jungen Leben.
„Der Herr lässt keinen Unterschied zwischen Mann und Weib. Wir alle sind Geschöpfe Gottes."
"Das tat gut", sagte die Frau und schob die Schale von sich. Nur noch ein Bodensatz der Sauermilch, die der Pastor der Kranken hatte zukommen lassen, war übrig geblieben. Ilse Schellwegen war dankbar für jede Zuwendung, die sie erfuhr, auch vonseiten des Kirchenmannes.
Vor zwei Jahrzehnten, als sie, wie viele andere in jener ruhelosen Zeit, auf dem Fischland eine neue Bleibe gesucht und gefunden hatte, war das noch ganz anders gewesen. Die einstige Magd auf einem ritterschaftlichen Hof in der Nähe von Doberan war vom Sohn ihres Herrn geschwängert und daraufhin ausgewiesen worden. Mit dem Bündel ihrer bescheidenen Habseligkeiten und ihrer wachsenden Leibesfrucht hatte sie sich nach Norden durchgeschlagen und auf dem von den niedersächsisch-dänischen Kämpfen noch unberührten Fischland eine verlassene Hirtenkate inmitten eines kleinen Obst- und Kohlgartens entdeckt. Unter dem schützenden Strohdach hatte sie ihre Tochter zur Welt gebracht, ganz allein und ohne jegliche Hilfe.
In den Dörfern zwischen Meer und Bodden war jeder zuvörderst mit sich selbst befasst. Etwa zur gleichen Zeit jedoch hatte am entgegengesetzten Ortsende Trin Permin ihren ersten Sohn geboren. Bei ihr floss die Milch, während sie bei Ilse Schellwegen alsbald versiegte. Die eine junge Mutter half der anderen, und so lernten sie sich kennen.
Die Freundschaft wuchs in der Not, als der Krieg auch auf das Fischland vordrang, als wechselnde Söldnerrotten immer neue Kontributionen und Abgaben einforderten, als auch im Kirchdorf Häuser in Flammen aufloderten, Felder zu Brachen wurden und das Vieh von den Weiden wie aus den Ställen in fremde Töpfe geriet.
Dann kam das Jahr, wo auch Trin Permin, inzwischen Mutter zweier Buben, den Mann verlieren sollte. Eigentlich hatte er nur die Ziegen heimholen wollen, die er jeden Morgen in den verwilderten, aber durch eine dichte Hecke geschützten Hofgarten einer verwaisten Bauernstelle in Oldenhagen brachte. Diesmal war er ausgeblieben. Am nächsten Tag machte sich Trin Permin in Begleitung ihres Sohnes Chell und dessen jüngeren Bruders Rohle auf die Suche. Ihre ängstlichen Vorahnungen bestätigten sich. Das Gatter der Hofkoppel war zerstört, die Ziegen waren weg, und Fiete Permin lag in seinem kalten Blut.
Bis Ilse Schellwegen auch bei Pastor Mund Anerkennung fand, sollten dagegen mehrere Jahre ins Land gehen. Der übereifrige Kirchenmann hatte der Zuwanderin und ihrer vaterlosen Tochter anfangs sogar den Zugang zum Gotteshaus und zu den Sakramenten verwehrt. Doch Johannes Mund musste im Laufe der Zeit eigene Kriegserfahrungen sammeln. Unheil und Not, Krankheiten und Tod schlugen auch in seiner Gemeinde zu, wenn auch sein persönlicher Besitz stets einigermaßen respektiert wurde, von den Unionsparteien wie von den Kaiserlichen, aus welchen Ländern sie auch kamen. Die wilde Welt blieb außerhalb des festen Zaunes, der das Pfarrhaus, die Scheune und den Stall und das Backhaus, den Kohl- und den Obstgarten abschirmte. Nach wie vor genoss Mund die Abgaben der Bauern, der Halbbauern und Kossäten, das Messkorn, das Brennholz und die Dienste. Doch auch der Pastor war nicht nur älter geworden, sondern auch ruhiger und klüger. Donnerte er dazumals von der Kanzel: "Die Weiber sind das Gefäß alles Bösen; sie sind böser als der Böse selbst", so klang das zwei Jahrzehnte später schon versöhnlicher: "Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Der Herr lässt keine Unterschiede zu zwischen Mann und Weib."
Stockfisch mit Speck und Klößen, Gänsefleisch in durchaus nicht zeitgemäßen Mengen und das ihm reichlich zufließende Malzbier hatten bei Johannes Mund im Laufe langer Dienstjahre auch äußerliche Spuren hinterlassen. Er schnaufte schon die Kanzelstiege hinauf und war, oben endlich angelangt, auch körperlich nicht mehr fähig, dröhnende Schimpfkanonaden auf die unter ihm Versammelten loszulassen. Die Völlerei hielt ihn gefangen. Trotz inbrünstiger Gebete rettete ihn sein himmlischer Herr weder vor der Fress- noch vor der Sauflust. Das übernahm die früher von ihm so oft gescholtene Schellwegen. Ihr Tee aus Kümmelsamen und Gundelrebe räumte den Stau aus seinem Gedärm, ihre Ginstertriebe und Huflattichblätter brachten ihn wieder auf die lahmen Beine und durchlüfteten sein Hirn.
Und nun war es an Johannes Mund, der kranken Frau nicht nur durch Gebete Hilfe und Beistand zu leisten.