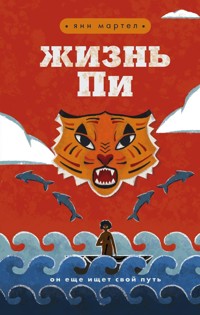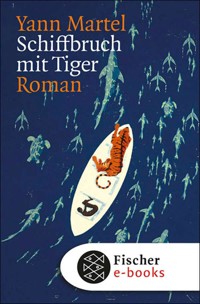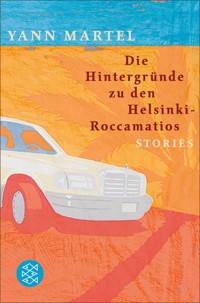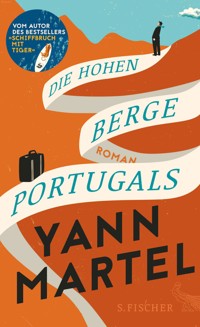
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Bestseller ›Schiffbruch mit Tiger‹ jetzt der neue große Roman von Yann Martel: ›Die Hohen Berge Portugals‹ ist ein Meisterwerk voller Weisheit und Witz. Lissabon, Anfang des 20. Jahrhunderts: In einem sogenannten Automobil begibt sich der junge Tomás auf eine abenteuerliche Expedition in die Hohen Berge Portugals. Ein tragikomischer Roadtrip beginnt - der ein unvorhergesehenes Ende nehmen soll. Doch das ist erst der Anfang einer phantastischen Geschichte, die die einsame Gegend noch Jahrzehnte später umweht wie ein tragischer Zauber. In seinem neuen großen Roman verknüpft Yann Martel verschiedene Fäden eindrucksvoll zu einem literarischen Wunder: ein unglaubliches und doch absolut glaubhaftes Meisterwerk über das Leben, den Tod und die Liebe – voller Weisheit und Witz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Yann Martel
Die Hohen Berge Portugals
Roman
Über dieses Buch
In seinem neuen großen Roman verknüpft Yann Martel eindrucksvoll verschiedene Fäden zu einem literarischen Wunder: ein unglaubliches und doch absolut glaubhaftes Meisterwerk über das Leben, den Tod und die Liebe – voller Weisheit und Witz.
Lissabon, 1904: Auf der Suche nach einem jahrhundertealten Schatz aus den afrikanischen Kolonien begibt sich der Museumskurator Tomás auf eine abenteuerliche Expedition in die hohen Berge Portugals, am Steuer eines der ersten Automobile im Land. Die Reise wird zu einer Höllenqual für den feinsinnigen jungen Mann: Nicht nur muss er mit dem launischen Gefährt zurechtkommen, das bald seine elegante Erscheinung einbüßt, sondern sich auch vor so manchem Dorfbewohner entlang der Strecke in Acht nehmen. Völlig abgezehrt und schon längst nicht mehr im Zeitplan nähert er sich schließlich seinem Ziel – bevor seine Reise ein unvorhergesehenes Ende nimmt. Doch das ist erst der Anfang einer unglaublichen Geschichte, die die hohen Berge Portugals noch Jahrzehnte später umweht wie ein tragischer Zauber.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Yann Martel wurde 1963 in Spanien geboren. Er wuchs in Costa Rica, Frankreich, Mexiko, Alaska und Kanada auf, als Sohn eines Diplomaten, und lebte später im Iran, in der Türkei und in Indien. Sein Roman ›Schiffbruch mit Tiger‹ erschien in über 50 Ländern, wurde millionenfach verkauft und 2002 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Die Verfilmung von Regisseur Ang Lee wurde 2013 mit vier Oscars prämiert. Yann Martel lebt mit seiner Familie in Saskatoon, Kanada.
Manfred Allié, geboren 1955 in Marburg, übersetzt seit über dreißig Jahren Literatur. 2006 wurde er mit dem Helmut-M.-Braem-Preis ausgezeichnet. Neben Werken von Jane Austen, Joseph Conrad und Patrick Leigh Fermor übertrug er unter anderem Romane von Yann Martel, Richard Powers, Joseph O'Connor, Reif Larsen und Patricia Highsmith ins Deutsche. Er lebt in der Eifel.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
›The High Mountains of Portugal: A Novel‹
bei Spiegel & Grau, an imprint of Random House,
a division of Penguin Random House LLC, New York.
Copyright © 2016 by Yann Martel
All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung/-gestaltung: hißmann, heilmann, hamburg unter Verwendung eines Motives von ©rtguest / istockphoto
aukitz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403332-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Erster Teil Heimatlos
Zweiter Teil Heimwärts
Dritter Teil Heimat
Für Alice, und für Theo, Lola, Felix und Jasper: die Geschichte meines Lebens
Erster TeilHeimatlos
Tomás beschließt, zu Fuß zu gehen.
Von seiner bescheidenen Wohnung in der Rua São Miguel im verrufenen Alfama-Viertel zum vornehmen Anwesen seines Onkels im baumbeschatteten Lapa ist es ein angenehmer Spaziergang, quer durch einen Großteil von Lissabon. Er wird dafür ungefähr eine Stunde brauchen. Aber es ist ein schöner Morgen, strahlend, nicht zu warm, und der Spaziergang wird ihn beruhigen. Und schon gestern hat Sabio, ein Diener seines Onkels, seinen Koffer und auch die hölzerne Truhe mit den Papieren abgeholt, die er für seine Mission in den Hohen Bergen Portugals braucht, so dass er nun keine andere Last mehr zu tragen hat als sich selbst.
Er befühlt die Brusttasche seiner Jacke. Das Tagebuch von Pater Ulisses ist da, in ein weiches Tuch gewickelt. Leichtsinnig von ihm, es einfach so mit sich herumzutragen, so lässig. Es wäre eine Katastrophe, wenn es verloren ginge. Wenn er auch nur halbwegs vernünftig wäre, hätte er es in der Truhe gelassen. Aber am heutigen Morgen braucht er etwas, das ihn aufbaut, wie immer, wenn er einen Besuch bei seinem Onkel macht.
Selbst in seiner Aufregung denkt er daran, statt seines üblichen Spazierstocks den zu nehmen, den sein Onkel ihm geschenkt hat. Der Griff dieses Stocks ist aus Elfenbein gefertigt, aus dem Stoßzahn eines Elefanten, der Schaft aus afrikanischem Mahagoni, aber ungewöhnlich daran ist vor allem der runde Taschenspiegel, seitlich unmittelbar unterhalb des Griffes angebracht. Der Spiegel ist ein wenig konvex und bietet folglich ein Panoramabild. Trotzdem ist er zu nichts nütze, eine abwegige Idee, denn ein Spazierstock ist nun einmal, seiner Bestimmung entsprechend, ständig in Bewegung, und das Bild bleibt zu verschwommen und flüchtig, als dass man damit etwas anfangen kann. Aber es handelt sich um ein eigens angefertigtes Geschenk seines Onkels, und jedes Mal, wenn er ihn besucht, hat Tomás diesen kuriosen Stock dabei.
Er nimmt die Rua São Miguel, die ihn zum Largo São Miguel führt, weiter die Rua de São João da Praça, und von dort biegt er in die Arco de Jesus – all das mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der durch eine Stadt spaziert, die er schon sein Leben lang kennt, eine schöne Stadt, eine geschäftige Stadt, eine Stadt des Kommerzes und der Kultur, der Herausforderungen und der Chancen. Auf der Arco de Jesus springt ihn eine Erinnerung an Dora an, lächelt, streckt schon die Hand aus, um ihn zu berühren. Da ist ihm der Stock nun doch nützlich, denn Erinnerungen an sie bringen ihn jedes Mal aus dem Gleichgewicht.
»Da habe ich mir einen Reichen geangelt«, hatte sie einmal zu ihm gesagt, als sie im Bett lagen, in seiner Wohnung.
»Ich fürchte nein«, hatte er geantwortet. »Mein Onkel, der ist reich. Ich bin der arme Sohn seines armen Bruders. Papa ist im Geschäft immer so erfolglos gewesen wie Onkel Martim erfolgreich ist, im genau umgekehrten Verhältnis.«
Das hatte er noch nie zu jemandem gesagt – so geradeheraus, so ungeschönt über die klägliche Karriere seines Vaters gesprochen, seine Projekte, die eins nach dem anderen gescheitert waren, so dass er immer mehr in der Schuld seines Bruders stand, der ihn jedes Mal von neuem rettete. Doch mit Dora konnte er über diese Dinge sprechen.
»Ach, das sagst du, aber die reichen Leute haben doch immer irgendwo ganze Kisten mit Geld versteckt.«
Er lachte. »Tatsächlich? Mein Onkel ist mir noch nie wie ein Mann vorgekommen, der aus seinem Wohlstand ein Geheimnis macht. Und wenn es so ist, wenn ich ein reicher Mann bin, wieso heiratest du mich dann nicht?«
Leute starren ihn an, wenn er vorüberkommt. Einige sagen etwas, manche machen Scherze, doch die meisten wollen helfen. »Vorsicht, sonst fallen Sie noch!«, ruft eine besorgte Frau. Er ist diese Art von Aufmerksamkeit gewohnt; lächelnd nickt er den Wohlmeinenden zu, ansonsten kümmert er sich nicht darum.
Schritt für Schritt geht er seinen Weg nach Lapa, unbeschwert schreitet er dahin, jedes Mal den Fuß hoch in die Höhe gehoben und mit Nachdruck auf das Pflaster gesetzt. Es ist ein eleganter Schritt.
Er tritt auf eine Apfelsinenschale, rutscht aber nicht aus.
Er bemerkt den dösenden Hund nicht, aber sein Absatz landet gerade noch neben dem Schwanz.
Er stolpert auf einer geschwungenen Treppe, aber er hat die Hand am Geländer und steht gleich wieder fest auf den Beinen.
Und weitere kleine Missgeschicke dieser Art.
Doras Lächeln war verschwunden, als er vom Heiraten sprach. So war sie; binnen einer Sekunde wechselte sie von Übermut zu größtem Ernst.
»Nein, deine Familie würde dich verstoßen. Familie bedeutet alles. Du kannst dich nicht von deiner Familie abwenden.«
»Du bist meine Familie«, hatte er geantwortet und sie fest angeblickt.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das bin ich nicht.«
Seine Augen, die meiste Zeit befreit von der Bürde, ihn führen zu müssen, entspannen sich in seinem Schädel wie zwei Passagiere in Liegestühlen am Heck eines Dampfers. Statt die ganze Zeit mürrisch zu Boden zu blicken, können sie träumerisch schweifen. Sie verfolgen die Umrisse der Wolken und der Bäume. Sie flitzen den Vögeln nach. Sie beobachten ein Zugpferd, wie es schnaubt. Sie legen sich auf nie bemerkte architektonische Details. Betrachten das Verkehrsgewühl auf der Rua Cais de Santarém. Alles in allem sollte es ein schöner Morgenspaziergang sein, an diesem angenehmen Spätdezembertag des Jahres 1904.
Dora, die schöne Dora. Sie war Dienerin im Haushalt seines Onkels gewesen. Tomás hatte sie gleich bei seinem ersten Besuch nach ihrer Anstellung dort bemerkt. Er konnte kaum den Blick von ihr wenden, und sie ging ihm nicht mehr aus dem Sinn. Er gab sich Mühe, besonders höflich zu ihr zu sein, verwickelte sie in kurze Gespräche über immer wieder neue Kleinigkeiten. Dabei konnte er ihre elegante Nase betrachten, ihre strahlenden schwarzen Augen, ihre kleinen weißen Zähne, die Art, wie sie sich bewegte. Plötzlich war er viel häufiger bei seinem Onkel zu Gast. Er konnte sich noch genau an den Augenblick erinnern, an dem Dora merkte, dass er sie nicht als Dienerin ansprach, sondern als Frau. Verstohlen sah sie auf, einen kurzen Moment lang trafen sich ihre Blicke, dann wandte sie sich ab – doch nicht bevor ein Mundwinkel sich in einem kurzen komplizenhaften Lächeln kräuselte.
Etwas Bedeutsames wurde damals in ihm freigesetzt, und die Schranken des Standes, der gesellschaftlichen Stellung, des vollkommen Unwahrscheinlichen und Unmöglichen schwanden. Als er ihr beim nächsten Besuch seinen Mantel gab, berührten ihre Hände sich, und beide verweilten bei dieser Berührung. Von da an ging alles rasch voran. Er hatte bis dahin sexuelle Erfahrung nur mit einigen wenigen Prostituierten gehabt, Begegnungen, die er ungeheuer aufregend, dann ungeheuer deprimierend gefunden hatte. Jedes Mal war er geflohen, hatte sich vor sich selbst geschämt und sich geschworen, so etwas nie wieder zu tun. Bei Dora war es ungeheuer aufregend, dann ungeheuer aufregend. Sie spielte mit den dichten Haaren auf seiner Brust, wenn sie den Kopf darauf legte. Vor ihr musste er nirgendwohin fliehen.
»Heirate mich, heirate mich, heirate mich«, hatte er gefleht. »Jeder wird der Reichtum des anderen sein.«
»Nein, wir werden arm und einsam sein. Du weißt nicht, wie das ist. Ich weiß es, und ich will nicht, dass du so etwas durchmachen musst.«
In diesen Stillstand ihrer Liebe hinein wurde ihr kleiner Gaspar geboren. Hätte er sich nicht unermüdlich für sie eingesetzt, wäre sie aus dem Haushalt seines Onkels entlassen worden, als man entdeckte, dass sie schwanger war. Der Einzige, der sich hinter ihn gestellt hatte, war sein Vater gewesen; der hatte ihm gesagt, er solle seine Liebe zu Dora leben, ganz im Gegensatz zu seinem Onkel und dessen vorwurfsvollem Schweigen. Dora wurde zu Arbeiten in der Tiefe der Küche abgestellt, wo niemand sie sah. Genauso unsichtbar lebte Gaspar im Haus der Lobos, unsichtbar geliebt von seinem Vater, der unsichtbar seine Mutter liebte.
Tomás kam so oft zu Besuch, wie es ihm auf diskrete Weise möglich war. An Doras freiem Tag kamen sie und Gaspar zu ihm in die Alfama. Dann gingen sie in den Park, setzten sich auf eine Bank und sahen Gaspar beim Spielen zu. An solchen Tagen waren sie wie ein ganz normales Paar. Er war verliebt und glücklich.
Er kommt an einer Straßenbahnhaltestelle vorbei, und eben rumpelt auf ihren Schienen eine Bahn heran, eine Neuheit im Straßenverkehr, noch nicht einmal drei Jahre alt, leuchtend gelb und elektrisch. Leute, die zur Arbeit wollen, stürmen los, um einzusteigen, andere drängen ebenso hektisch heraus. Er weicht allen aus – bis auf einen, mit dem er zusammenstößt. Nach ein paar wenigen Worten, Entschuldigungen, die auf beiden Seiten erbeten und angenommen werden, zieht er weiter.
Auf dem Trottoir stehen mehrere Pflastersteine höher heraus, aber er gleitet mühelos darüber hinweg.
Er stößt mit dem Fuß an das Bein eines Kaffeehausstuhls. Ein kleiner Ruck, sonst nichts.
Der Tod hat ihm Dora und Gaspar genommen, gnadenlos einen nach dem anderen, und der Arzt, nach dem sein Onkel geschickt hatte, hatte seine Künste vergebens eingesetzt. Zuerst Halsschmerzen und Mattigkeit, dann Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, das Schlucken war ihnen schwergefallen, dann das Atmen, dann kamen Krämpfe, mit weit aufgerissenen Augen, wie gewürgt; schließlich hatten sie den Verstand verloren – und dann war es vorüber, ihre Leiber so grau, so verdreht, so reglos wie die Laken, in denen sie sich gewälzt hatten. Beide Male war er dabei. Gaspar war fünf Jahre alt, Dora vierundzwanzig.
Er war nicht dabei, als ein paar Tage später sein Vater starb. Er war im Haus der Lobos, im Musikzimmer, saß still mit einem seiner Vetter dort, stumm vor Schmerz, da trat mit grimmiger Miene sein Onkel ein. »Tomás«, sagte er, »ich habe eine entsetzliche Nachricht. Silvestre, dein Vater, ist tot. Ich habe meinen einzigen Bruder verloren.« Die Worte waren nur Laute gewesen, aber Tomás fühlte sich wie zerschmettert, als wäre ein großer Felsen auf ihn gestürzt, und er heulte wie ein verwundetes Tier. Sein Vater, dieser gutmütige Bär! Der Mann, der ihn aufgezogen hatte, der seine Träume gutgeheißen, ihm Mut gemacht hatte!
Im Verlauf einer einzigen Woche – Gaspar war am Montag gestorben, Dora am Donnerstag, sein Vater am Sonntag – war ihm das Herz aufgerissen worden, als platze ein Kokon auf. Heraus kam kein Schmetterling, sondern eine graue Motte, die sich auf die Wand seiner Seele setzte und dort reglos sitzen blieb.
Es gab zwei Begräbnisse, ein armseliges für ein Dienstmädchen aus der Provinz mit seinem unehelichen Sohn, ein reich inszeniertes, ausgerichtet von einem reichen Mann für einen bettelarmen Bruder, von dessen Misserfolgen im Geschäftsleben man diskret schwieg.
Er bemerkt ein Fuhrwerk nicht, das herankommt, als er eben vom Bürgersteig tritt, aber der Kutscher ruft eine Warnung, und mit einem schnellen Satz entgeht er dem Pferd.
Er stößt an einen Mann, der mit dem Rücken zu ihm steht. Er hebt die Hand, sagt »Entschuldigung«. Der Mann zuckt nur freundlich mit den Schultern und sieht ihm nach.
Einen Schritt nach dem anderen geht er, und alle paar Schritte dreht er den Kopf und wirft einen Blick über die Schulter nach vorn, und so spaziert Tomás nach Lapa, mit dem Rücken voran.
»Warum? Warum tust du das? Warum kannst du nicht wie ein normaler Mensch gehen? Lass endlich diesen Unsinn!«, hat sein Onkel schon mehr als nur einmal gerufen. Tomás hat sich als Antwort eine Reihe guter Argumente für seine Art zu gehen ausgedacht. Ist es nicht vernünftig, den Elementen – dem Wind, dem Regen, der Sonne, dem Ansturm der Insekten, der mürrischen Miene von Fremden, der Unsicherheit der Zukunft – mit dem Schild zu trotzen, den unser Hinterkopf uns bietet, die Rückseite der Jacke, der Hosenboden? Das ist unser Schutzschild, unsere Rüstung. Sie sind dazu gemacht, den Wechselfällen des Schicksals zu widerstehen. Die empfindlicheren Teile hingegen – Gesicht, Brust, die hübscheren Details der Kleidungsstücke – sind, wenn man rückwärtsgeht, vor der Grausamkeit der Welt vor uns geschützt, und man zeigt sie nur denen, denen man sie zeigen will, zu einem Zeitpunkt, zu dem man es will, mit einer einfachen Drehung, mit der man sich zu erkennen gibt. Gar nicht zu erwähnen Argumente eher athletischerer Art. Wenn man einen Berg hinuntergeht – was, argumentiert er, ist da natürlicher als rückwärts zu gehen? Der Vorderfuß berührt behutsam tastend den Boden, die Wadenmuskeln können präzise ihre Spannung aufbauen und sich wieder entspannen. So bewegt man sich elastisch, ohne Anstrengung, bergab. Und wenn man stolpert – kann man da besser fallen als rückwärts? Die gepolsterten Pobacken fangen den Schlag auf. Besser als wenn man vornüberfällt und sich die Handgelenke dabei bricht. Und er besteht ja auch nicht immer darauf. Er macht Ausnahmen, etwa wenn er die langen, gewundenen Treppen des Alfama-Viertels hinabsteigt oder wenn er laufen muss.
All diese Rechtfertigungen tat sein Onkel mit einer ungeduldigen Handbewegung ab. Martim Augusto Mendes Lobo ist ein erfolgreicher Mann und hat für so etwas keine Zeit. Trotzdem weiß er, warum Tomás rückwärts geht, auch wenn er ihn noch so gereizt danach fragt und sein Neffe noch so ausweichende Antworten gibt. Einmal hat Tomás zufällig mit angehört, was er zu einem Freund, der zu Besuch weilte, sprach. Gerade weil die Stimme des Onkels plötzlich leiser wurde, hatte Tomás die Ohren gespitzt.
»… ausgesprochen lächerliche Szene«, sagte sein Onkel eben sotto voce. »Stellen Sie es sich vor: Vor ihm – mit anderen Worten hinter ihm – steht ein Laternenpfahl. Ich rufe meinen Sekretär Benedito, und wir sehen in fasziniertem Schweigen zu, beide in Gedanken mit derselben Frage beschäftigt: Wird mein Neffe gegen den Laternenpfahl laufen? In dem Augenblick taucht ein zweiter Fußgänger auf, am anderen Ende der Straße. Dieser Mann sieht, wie Tomás auf ihn zukommt, rückwärts. Aus der Art, wie er den Kopf schief legt, sehen wir, dass die kuriose Fortbewegungsmethode meines Neffen seine Aufmerksamkeit erregt hat. Aus Erfahrung weiß ich, dass es zu einem kurzen Austausch kommen wird – eine Bemerkung, ein Scherz, mindestens aber ein verblüffter Blick, wenn er vorüberkommt. Und tatsächlich, ein paar Schritte, bevor Tomás an der Laterne ankommt, beschleunigt der andere Mann seine Schritte und bringt ihn zum Halten, indem er ihm auf die Schulter klopft. Benedito und ich hören nicht, was die beiden zueinander sagen, aber wir verfolgen es als Pantomime. Der Fremde zeigt auf den Laternenpfahl. Tomás lächelt, nickt, legt sich die Hand vor die Brust zum Zeichen seiner Dankbarkeit. Der Fremde lächelt zurück. Sie reichen sich die Hand. Zum Abschied winken sie einander noch zu, jeder setzt seinen Weg fort, der Fremde die Straße hinunter und Tomás – der sich umdreht und rückwärts weitergeht – in die andere Richtung. Als sei gar nichts dabei, macht er einen Bogen um die Laterne.
Aber warten Sie, die Geschichte ist noch nicht zu Ende! Nach ein paar Schritten dreht der andere Fußgänger sich um, blickt zu Tomás zurück und ist sichtlich überrascht, dass er immer noch rückwärts geht. Man sieht die Sorge auf seinem Gesicht – Vorsicht, Sie fallen noch, wenn Sie nicht aufpassen! –, aber auch ein gewisses Maß an Verlegenheit, denn Tomás blickt ihn ja an und hat gesehen, wie er sich nach ihm umgedreht hat, und schließlich wissen wir alle, dass man Leute nicht anstarren soll. Rasch dreht der Mann sich wieder um, aber zu spät: Er stößt mit dem nächsten Laternenpfahl zusammen. Er schlägt dagegen, wie ein Schwengel die Glocke trifft. Benedito und ich winden uns beide unwillkürlich vor Mitgefühl. Der Mann strauchelt, verzieht das Gesicht, fährt sich mit den Händen an Kopf und Brust. Tomás läuft hin, um ihm zu helfen – er läuft vorwärts. Man sollte denken, es sieht normal aus, wenn er sich vorwärts bewegt, aber das tut es nicht. Keinerlei Elastizität in seinem Gang. Mit großen, langen Schritten stapft er voran, sein Leib bewegt sich gleichmäßig in einer geraden Linie, wie auf einem Förderband.
Wieder unterhalten die beiden Männer sich miteinander, aber wir hören nichts; Tomás ist sichtlich besorgt, der Mann tut es mit einer Handwegung ab, obwohl er sich mit der anderen immer noch das Gesicht hält. Tomás hebt dem Mann den zu Boden gefallenen Hut auf. Noch einmal reichen sie sich die Hände, winken, wenn auch diesmal zurückhaltender, dann stolpert der arme Mann davon. Tomás, Benedito und ich sehen ihm nach. Erst als der Mann hinter der nächsten Straßenecke verschwunden ist, setzt Tomás, wie üblich rückwärts, seinen Weg fort. Aber der Vorfall beschäftigt ihn offenbar noch, denn nun prallt er mit Wucht gegen genau den Laternenpfahl, den er eine Minute zuvor noch so elegant umgangen hatte. Er reibt sich den Hinterkopf, dreht sich um und schaut den Pfahl böse an.
Und trotzdem, Fausto, macht er immer weiter. Egal, wie oft er sich den Kopf stößt, egal, wie oft er fällt, er geht trotzdem immer wieder rückwärts.« Tomás hörte, wie sein Onkel lachte, und Fausto, der Freund, stimmte ein. Dann fuhr sein Onkel in ernsthafterem Ton fort. »Es fing an dem Tag an, an dem sein kleiner Junge, Gaspar, an Diphtherie starb. Ein unehelicher Sohn mit einer Dienerin hier im Haus. Auch sie ist an der Krankheit gestorben. Dann nahm das Schicksal uns nur wenige Tage später meinen Bruder Silvestre; er fiel einfach tot um, mittags, mitten im Wort. Tomás’ Mutter war schon gestorben, als er noch ein Kind war. Jetzt sein Vater. So schwer vom Leben geprüft! Manche lachen nie mehr. Andere werden Säufer. Mein Neffe entschloss sich, von nun an rückwärts zu gehen. Vor einem Jahr war das. Wie lang wird diese bizarre Trauer dauern?«
Sein Onkel versteht nicht, dass das Rückwärtsgehen, mit dem Rücken zur Welt, dem Rücken zu Gott, kein Ausdruck von Trauer ist. Es ist Protest. Denn wenn jemandem alles, was ihm lieb war im Leben, genommen wird, was soll er da anderes tun, als zu protestieren?
Er geht einen Umweg. Von der Rua Nova de São Francisco de Paula nimmt er die Rua do Sacramento. Er ist fast da. Als er den Kopf dreht und einen Blick über die Schulter wirft – er erinnert sich, hier steht ein Laternenpfahl –, sieht er die Rückseite des herrschaftlichen Hauses seines Onkels, mit den kunstvollen Friesen und Simsen, den hohen Fenstern. Er spürt einen Blick und bemerkt eine Gestalt an einem Eckfenster im ersten Stock. Da sich genau dort das Büro seines Onkels befindet, ist anzunehmen, dass es sein Onkel Martim ist, also dreht er den Kopf wieder um und gibt sich Mühe, selbstbewusst zu gehen, und macht sorgsam einen Bogen um die Lampe. Er folgt der Mauer um den Besitz seines Onkels, bis er ans Tor kommt. Er dreht sich um, streckt die Hand nach dem Zug für die Klingel aus, doch mitten in der Bewegung hält er inne. Er zieht die Hand zurück. Obwohl er weiß, dass sein Onkel ihn gesehen hat und auf ihn wartet, zaudert er. Dann holt er das alte ledergebundene Tagebuch aus der Brusttasche seiner Jacke, nimmt es aus dem Baumwolltuch, lehnt sich mit dem Rücken an die Wand und lässt sich hinuntergleiten, bis er dort auf dem Bürgersteig hockt. Er sieht sich den Einband an.
Hierinnen beschrieben das Leben
sowie die Bestimmungen, sein Vermächtnis betreffend,
von Pater Ulisses Manuel Rosário Pinto
ergebener Diener Gottes
Er kennt das Tagebuch von Pater Ulisses genau. Ganze Passagen kann er auswendig. Er schlägt willkürlich eine Seite auf und liest.
Wenn die Sklavenschiffe sich der Insel nähern, um ihre Last abzuliefern, werden an Bord mancherlei Rechnungen angestellt & allerlei Hausarbeit wird getan. Schon in Sichtweite des Hafens werfen sie Menschenleiber ins Meer, an Back- & an Steuerbord, manche schlaff & biegsam, andere gestikulieren noch schwach. Das sind die Toten & die Schwerkranken; Erstere werden fortgeworfen, weil sie keinen Wert mehr haben, Letztere aus Furcht, dass die Krankheit, mit welcher sie geschlagen sind, sich ausbreiten & den Wert der anderen mindern könnte. Der Wind steht so, dass er mir die Schreie der Lebenden zuträgt, ihre Proteste, weil sie über Bord geworfen werden sollen, & auch das platschende Geräusch trägt er herüber, wenn ihre Leiber auf das Wasser treffen. Sie verschwinden im Gewimmel jener Vorhölle, welche den Grund der Bucht von Ana Chaves ausmacht.
Auch das Haus seines Onkels ist eine Vorhölle, aus unvollendeten, unerfüllt gebliebenen Leben. Er schließt die Augen. Die Einsamkeit stellt sich bei ihm ein wie ein Hund, der kommt und an ihm schnüffelt. Der Hund bedrängt ihn. Mit einer Handbewegung will er ihn wegscheuchen, aber er lässt ihm keine Ruhe.
Nur wenige Wochen nachdem sein eigenes Leben für alle Zeit zuschanden gemacht worden war, ist er auf das Tagebuch von Pater Ulisses gestoßen. Es war ein Zufallsfund im Nationalmuseum für alte Kunst, in dem er als Hilfskurator tätig ist. Der Kardinal-Patriarch von Lissabon, José Sebastião de Almeida Neto, hatte dem Museum kurz zuvor eine Sammlung geistlicher und nichtgeistlicher Objekte gestiftet, Dinge, die im Laufe der Jahrhunderte aus dem gesamten portugiesischen Weltreich zusammengekommen waren. Mit Kardinal Netos Erlaubnis hatte das Museum Tomás zum Bischöflichen Archiv an der Rua Serpa Pinto entsandt, um die genaue Herkunft dieser wunderbaren Kunstgegenstände zu ermitteln, die Geschichten zu finden, die erzählten, wie ein Altar, ein Abendmahlskelch, ein Kruzifix oder Psalter, ein Gemälde oder ein Buch in die Hände der Diözese von Lissabon gekommen war.
Er fand das Archiv nicht gerade in mustergültiger Ordnung. Die lange Reihe der Sekretäre der vielen Erzbischöfe von Lissabon hatte offensichtlich der irdischen Aufgabe, Tausende von Papieren und Dokumenten zu ordnen, nicht allzu viel Aufmerksamkeit angedeihen lassen. Und auf einem Regalbrett mit den Dokumenten aus der Zeit Kardinals José Francisco de Mendoça Valdereis, des Patriarchen von Lissabon zwischen 1788 und 1808, in einer bunt gemischten Abteilung mit der treffenden Bezeichnung Miudezas – Dies und Das – war es, dass er die fadengeheftete Kladde mit dem braunen Ledereinband entdeckte, mit dem handschriftlichen Titel darauf, trotz Flecken und Verfärbungen immer noch lesbar.
Wessen Leben war das, wessen Vermächtnis?, fragte er sich. Wie lauteten die Bestimmungen? Wer war dieser Pater Ulisses? Als er den Band aufschlug, gab der Buchrücken ein Geräusch von sich, als bräche er ihm winzige Knochen. Handgeschriebene Zeilen sprangen ihn an, verblüffend frisch, die schwarze Tinte in starkem Kontrast zum elfenbeinfarbenen Papier. Die schnörkelige, mit einem Federkiel geschriebene Schrift einer längst vergangenen Zeit. Nur an den äußersten Rändern waren die Seiten zu einem Sonnengelb gebräunt, was vermuten ließ, dass sie seit den Tagen, an denen sie beschrieben worden waren, nur wenig Licht gesehen hatten. Er bezweifelte, dass Kardinal Valdereis den Band je gelesen hatte; ja, da keinerlei Archivmaterial beigefügt war, auch kein Verweis im Inneren – keine Katalognummer, kein Datum, keine Vermerke –, und das Buch nirgendwo in den Verzeichnissen auftauchte, sah es sehr danach aus, als habe niemand es je gelesen.
Er sah sich die erste Seite genauer an und fand ganz am oberen Rand ein Datum und einen Ort: 17. September 1631, Luanda. Vorsichtig blätterte er. Weitere Datumsangaben. Das letzte aufgeführte Jahr, allerdings ohne Tag und Monat, war 1635. Ein Tagebuch also. Hie und da fielen ihm Ortsangaben auf: »die Berge von Bailundu … die Berge von Pungo Ndongo … die alte Straße nach Benguela«, offenbar alles in Portugiesisch-Angola. Am 2. Juni 1633 taucht ein neuer Ort auf: São Tomé, die kleine Inselkolonie im Golf von Guinea, »diese Schuppe vom Schopf Afrikas, lange Tage nordwärts entlang der dampfenden Küste dieses todbringenden Kontinents«. Sein Blick blieb an einem Satz hängen, ein paar Wochen später geschrieben: Esta é a minha casa. »Das ist meine Heimat.« Aber es stand nicht nur einmal da. Die ganze Seite war damit bedeckt. Eine ganze Seite, eng beschrieben nur mit diesem einen kurzen Satz, die Zeilen ein wenig schwankend, hinauf und wieder hinab: »Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat.« Dann hörte es auf, es kamen eher alltägliche Beschreibungen, doch ein paar Seiten weiter tauchte der Satz wieder auf, diesmal über eine halbe Seite: »Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat.« Dann, ein Stück weiter, noch einmal, eineinviertel Seiten lang: »Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat.«
Was bedeutete das? Warum wiederholte er es so manisch? Schließlich stieß Tomás auf eine mögliche Antwort an einer Stelle, an der zwar der Satz genauso wiederholt wurde wie an all den anderen, diesmal über fast zwei Seiten hinweg, aber mit einem entscheidenden Unterschied, einer Erweiterung am Ende – der Beweis, dass es sich bei diesem Satz um ein Kürzel handelte, das der Schreiber bei jedem einzelnen Mal in Gedanken vervollständigte: »Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Hierhin hat Gott der Herr mich geschickt, bis Er mich ergreift und an Sein Herz drückt.« Offenbar hatte schreckliches Heimweh Pater Ulisses gequält.
Auf einer Seite fand Tomás eine merkwürdige Skizze, eine Zeichnung, die ein Gesicht darstellte. Die Züge waren nur grob skizziert, mit Ausnahme der traurigen Augen; diese waren in allen Einzelheiten ausgeführt. Er studierte die Augen mehrere Minuten lang. Er versenkte sich in ihre Traurigkeit. Erinnerungen an seinen kürzlich verlorenen Sohn drehten sich in seinem Verstand. Als er an jenem Tag das Archiv verließ, versteckte er das Buch zwischen unauffälligen Papieren in seiner Aktentasche. Es war nicht einfach nur eine informelle Ausleihe – es war glatter Diebstahl. Nachdem das Bischöfliche Archiv von Lissabon Pater Ulisses’ Tagebuch mehr als zweihundertfünfzig Jahre lang nicht vermisst hatte, würde es den Band auch jetzt nicht vermissen, und er wollte ihn in Ruhe und gründlich studieren.
Sofort als er die Zeit dazu fand, begann er mit der Lektüre und der Transkription des Tagebuchs. Es war mühsame Arbeit. Die Handschrift entwickelte sich von den mustergültigen ersten Seiten zu einem kalligraphischen Wust, bei dem er lange überlegen musste, welcher Kringel für diese Silbe stehen mochte und welcher Hüpfer für jene. Es war auffällig, wie ausgeglichen die Schrift auf den früheren Seiten war und wie sichtlich sie sich dann verschlechterte. Die letzten Seiten waren kaum noch zu entziffern. Einige Worte konnte er nicht einmal erraten, sosehr er sich auch bemühte.
Was Pater Ulisses in seiner Zeit in Angola schrieb, war nichts weiter als ein pflichtschuldiger Bericht und nur von mäßigem Interesse. Er war nur einer unter den vielen Bütteln des Bischofs von Luanda, der »im Schatten auf der Landungsbrücke auf seinem marmornen Thron saß«, während er bis zur Benommenheit schuftete, hin und her rannte und scharenweise Sklaven taufte. Aber auf São Tomé ergriff eine verzweifelte Macht von ihm Besitz. Er begann mit der Arbeit an etwas, dem Vermächtnis, von dem der Titel sprach. Die Arbeit an diesem Objekt nahm seinen Verstand vollkommen ein und beanspruchte seine sämtliche Kraft. Er schrieb davon, dass er »das vollkommenste Holz« und »die angemessenen Werkzeuge« suchte, und von seiner Lehrzeit als junger Mann in der Werkstatt seines Onkels. Er beschrieb, wie er jene Gabe, sein Vermächtnis, mehrere Male mit Öl einrieb, um sie haltbarer zu machen, »meine glitzernden Hände die Arbeiter ergebener Liebe«. Gegen Ende des Tagebuchs fand Tomás die folgenden eigentümlichen Worte, aus denen sich die Ausmaße seines Werks erahnen ließen:
Es schimmert, es schreit, es bellt, es brüllt. Wahrlich, es ist der Sohn Gottes in Seinem Aufschrei & Sein letzter Seufzer, als der Vorhang im Tempel zerriss von obenan bis untenaus. Es ist vollbracht.
Was war das für eine Lehre, die Pater Ulisses absolviert hatte, was wurde in der Werkstatt seines Onkels hergestellt? Was war es, das er mit seinen Händen geölt hatte? Was schimmerte, schrie, bellte und brüllte? In Pater Ulisses’ Tagebuch fand Tomás keine klare Antwort, allenfalls Andeutungen. Wann hatte der Sohn Gottes aufgeschrien und seinen letzten Seufzer getan? Am Kreuz. Handelte es sich also, überlegte Tomás, bei diesem Objekt um ein Kruzifix? Eine Art Skulptur musste es auf alle Fälle sein. Aber es war mehr daran. Es war, wie Pater Ulisses selbst schrieb, ein höchst eigentümliches Werk. Die Motte in Tomás’ Seele regte sich. Er dachte an Doras letzte Stunden. Als sie nicht mehr aufstehen konnte, hatte sie mit beiden Händen ein Kruzifix gehalten, und ganz gleich, wie sehr sie sich hin- und herwarf, ganz gleich, wie heftig sie schrie, sie ließ es nicht los. Es war ein billiges Messingbildnis mit stumpfem Schimmer, eher klein, die Art Kreuz, die man sich an die Zimmerwand hängte. Sie hatte es sich an die Brust gedrückt, als sie starb, in ihrem kleinen, kargen Zimmer, und nur Tomás war dabei gewesen, auf einem Stuhl neben ihrem Bett. Als der letzte Augenblick kam – das dramatische Innehalten ihres lauten, keuchenden Atems war das Zeichen (anders als bei ihrem Sohn, der so still gegangen war, wie ein Blütenblatt fiel) –, da war er sich vorgekommen wie eine Eisscholle in einem reißenden Fluss.
In den folgenden Stunden, während die lange Nacht zu Ende ging und der neue Tag zäh begann, während er auf den Leichenbestatter wartete, der nicht wie versprochen kam, war er aus Doras Zimmer geflohen und wieder zurückgekehrt, immer hin und her, war entsetzt zurückgeschreckt, wiedergekommen wie getrieben von einem Zwang. »Wie soll ich ohne dich weiterleben?«, hatte er flehend zu ihr gesagt. Sein Blick war auf das Kruzifix gefallen. Bis dahin hatte er sich im Strom der Religion mittreiben lassen, nach außen hin gläubig, nach innen gleichgültig. Jetzt ging ihm auf, dass man diese Sache mit dem Glauben entweder bedingungslos ernst nehmen musste oder bedingungslos verwerfen. Er hatte das Kruzifix angestarrt, die Argumente zwischen absolutem Glauben und absolutem Unglauben erwogen. Noch bevor er sich für die eine oder die andere Seite entschieden hatte, war ihm der Gedanke gekommen, das Kruzifix als Andenken zu behalten. Doch Dora, oder besser Doras Leichnam, ließ es nicht los. Mit Händen und Armen umklammerte sie das Ding mit unnachgiebiger Macht, selbst da noch, als er im Versuch, es ihr zu entwinden, ihren Leichnam schon beinahe vom Bett zerrte. (Gaspar hingegen war weich im Tode gewesen, wie eine große Stoffpuppe.) In schluchzender Wut hatte er aufgegeben. Und in dem Augenblick war die Entscheidung gekommen – eine Drohung eher. Wütend hatte er das Kruzifix angefunkelt, hatte gezischt: »Du! Du! Mit dir werde ich noch fertig, wart’s nur ab!«
Dann war der Leichenbestatter gekommen und hatte Dora und ihr verfluchtes Kruzifix fortgeschafft.
Wenn es sich bei Pater Ulisses’ Kunstwerk um das handelte, was Tomás aus dem fiebernden Gekritzel im Tagebuch des Priesters schloss, dann war es ein monumentales, ein epochales Werk, etwas, das anders war als alles andere. Etwas, das groß genug war, um das Christentum auf den Kopf zu stellen. Etwas, mit dem er seine Drohung wahrmachen konnte. Aber gab es dieses Kunstwerk noch? Das war die Frage, die Tomás gepackt hatte, seit er ans Ende der Lektüre des Tagebuchs gekommen war, in seiner Wohnung, nachdem er es aus dem Bischöflichen Archiv herausgeschmuggelt hatte. Womöglich hatte man das Werk von Pater Ulisses verbrannt, in Stücke gehackt. Doch in vorindustrieller Zeit, als jedes Objekt ein Einzelstück war, nicht massenhaft verbreitet, da leuchteten die Dinge mit einem Wert, der ihnen mit dem Aufstieg der modernen Industrie verlorengegangen war. Nicht einmal Kleider warf man fort. Das wenige, was Christus am Leibe trug, teilten sich die römischen Soldaten, die ihn für nichts weiter als einen unbedeutenden jüdischen Aufwiegler hielten. Wenn man selbst gewöhnliche Kleider weitergab, dann würde man doch gewiss eine große Skulptur bewahren, gerade wenn sie auch noch religiöser Art war.
Wie konnte er in Erfahrung bringen, was daraus geworden war? Zwei grundsätzliche Möglichkeiten gab es: Entweder das Objekt war auf São Tomé geblieben, oder es war von São Tomé fortgeschafft worden. Da die Insel arm war und man dort Handel trieb, vermutete er eher, dass es von der Insel fortgekommen war. Er hoffte, dass es nach Portugal gelangt war, ins Mutterland, aber es konnte auch in einem der vielen Handelsposten, in den Städten entlang der afrikanischen Küste, gelandet sein. In beiden Fällen wäre der Transport per Schiff erfolgt.
Nachdem alle, die er geliebt hatte, gestorben waren, verbrachte Tomás Monate damit, herauszubekommen, was aus dem Werk von Pater Ulisses geworden war. Im Nationalarchiv, der Torre do Tombo, suchte und studierte er die Logbücher portugiesischer Schiffe, die in den ersten Jahren nach Pater Ulisses’ Tod an der Westküste von Afrika gefahren waren. Er ging davon aus, dass das Schnitzwerk São Tomé auf einem portugiesischen Schiff verlassen hatte. Wenn es auf einem ausländischen Schiff gefahren war, dann wusste nur der Himmel, wohin es gekommen war.
Schließlich stieß er auf das Logbuch eines gewissen Kapitäns Rodolfo Pereira Pacheco, dessen Galeone am 14. Dezember 1637 von São Tomé aufgebrochen war und unter anderem »eine Darstellung Unseres Herrn am Kreuze« an Bord hatte, »eigentümlich & wundersam«. Sein Herz schlug schneller. Dies war der erste und einzige Hinweis auf ein religiöses Objekt gleich welcher Art, auf den er im Zusammenhang mit der armseligen Kolonie überhaupt gestoßen war.
In der nächsten Spalte war in dem Logbuch zu jedem Objekt der Ort vermerkt, an dem es wieder ausgeschifft worden war. Viele der Güter waren an den Häfen der Sklaven- und Goldküste ausgeladen, verkauft oder gegen andere Güter eingetauscht worden. Er kam in Kapitän Pachecos Logbuch an den Vermerk neben dem Kreuz: Lisboa. Es war ins Mutterland gekommen! Er stieß einen Freudenjuchzer aus, ganz und gar unziemlich in einem Lesesaal des Nationalarchivs.
Er stellte die ganze Torre de Tombo auf den Kopf, um herauszubekommen, was nach seiner Ankunft in Lissabon aus Pater Ulisses’ Kruzifix geworden war. Am Ende fand er die Antwort nicht im National-, sondern, zurückgekehrt, im Bischöflichen Archiv, da, wo seine Suche begonnen hatte. Die Ironie war sogar noch bitterer. Die Antwort lag in Gestalt zweier Briefe auf genau dem Regalbrett von Kardinal Valdereis’ Archiven, auf dem er das Tagebuch gefunden hatte, unmittelbar neben der Stelle, an der es gestanden hatte, bevor er es gestohlen hatte. Wäre auch nur ein Bindfaden um Buch und Briefe gelegt gewesen, dann wäre ihm viel Arbeit erspart geblieben.
Der erste Brief stammte vom Bischof von Bragança, António Luís Cabral e Câmara, datiert auf den 9. April 1804, in dem er sich an den gütigen Kardinal Valdereis mit der Bitte um ein Geschenk wandte, für eine Gemeinde in den Hohen Bergen Portugals, in deren Kirche kürzlich ein Brand den Chorraum verwüstet hatte. Es sei »eine prachtvolle alte Kirche«, schrieb er, nannte aber weder den Namen noch den Ort. In seiner Antwort, von der eine Abschrift dem Brief von Bischof Câmara beigefügt war, schrieb Kardinal Valdereis: »Es soll mir ein Vergnügen sein, Ihnen ein Andachtsobjekt zu schicken, welches sich schon seit einer ganzen Weile im Besitz der Diözese von Lissabon befindet, eine ungewöhnliche Darstellung Unseres Herrn Jesus am Kreuze, aus den Kolonien in Afrika.« Da die Briefe neben dem Tagebuch aus den Kolonien in Afrika gelegen hatten, konnten sie sich da auf eine andere Darstellung Unseres Herrn beziehen als die von Pater Ulisses? Verblüffend, dass Kardinal Valdereis, obwohl er es direkt vor Augen hatte, nicht gesehen hatte, worum es sich bei diesem Objekt handelte. Aber der Gottesmann wusste es nicht – und deshalb konnte er es auch nicht sehen.
Im Briefwechsel mit der Diözese von Bragança erfuhr er, dass es kein afrikanisches Objekt gab – oder kein als solches bezeichnetes –, das während der Amtszeit von Bischof Câmara von dort weitergeschickt worden wäre. Das quälte Tomás. Ein Werk, das an seinem Ursprungsort als »eigentümlich und wundersam« gegolten hatte, wurde in Lissabon nur noch »ungewöhnlich« genannt und war in den Händen der Provinzler alltäglich geworden. Das oder man hatte absichtlich seine Eigenart ignoriert. Tomás musste einen neuen Anlauf nehmen. Das Kruzifix sollte in eine Kirche kommen, die bei einem Feuer Schaden genommen hatte. In den Archiven fand er, dass es zwischen 1793, als Câmara zum Bischof von Bragança geweiht worden war, und 1804, als er an Kardinal Valdereis schrieb, Brände unterschiedlicher Stärke in einer ganzen Reihe von Kirchen in den Hohen Bergen Portugals gegeben hatte. Das waren die Risiken, wenn man Kirchen mit Kerzen und Fackeln erhellte und an den hohen Feiertagen Weihrauch brennen ließ. Câmara schrieb, das Kruzifix sei für eine »prachtvolle alte Kirche« bestimmt. Welche hätte der Bischof mit einem solchen Kompliment ausgezeichnet? Tomás stellte sich vor, dass es eine gotische, vielleicht sogar romanische sein musste. Was bedeutete, eine Kirche aus dem 15. Jahrhundert oder vielleicht noch älter. Der Sekretär der Diözese von Bragança erwies sich nicht gerade als Kirchenhistoriker. Aber als Tomás weiter nachfragte, erfuhr er, dass es fünf feuergeschädigte Kirchen gab, die als Kandidaten für das Lob von Bischof Câmara in Frage kamen, weit über die Provinz verstreut; dies waren die Kirchen von São Julião de Palácios, Santalha, Mofreita, Guadramil und Espinhosela.
Tomás schrieb an die Priester jeder dieser Kirchen. Die Antworten ergaben nicht viel. Jeder pries seine eigene Kirche über alles, sang ein Loblied auf deren Alter und Schönheit. Diesen Briefen nach zu urteilen waren die Hohen Bergen Portugals geradezu übersät mit Ebenbildern des Petersdoms. Doch keiner dieser Priester hatte etwas Erhellendes über das Kruzifix, das Herzstück seiner Kirche, zu sagen. Jeder versicherte ihm, dass es ein anrührendes Werk des Glaubens sei, aber keiner wusste, wann seine Kirche es erworben hatte oder von wo es gekommen war. Tomás gelangte zu dem Schluss, dass ihm nichts anderes übrigblieb, als hinzufahren und selbst herauszufinden, was es mit dem Kreuz des Paters Ulisses auf sich hatte. Dass es gerade in den Hohen Bergen Portugals gelandet war, in jener ablegenen, einsamen Provinz im äußersten Nordosten des Landes, war nur eine kleine Komplikation. Schon bald würde er dieses Werk mit eigenen Augen erblicken.
Eine Stimme schreckt ihn auf.
»Hallo, Senhor Tomás. Sie kommen uns besuchen, nicht wahr?«
Es ist der alte Hausmeister, Afonso. Er hat das Tor geöffnet und blickt hinunter zu Tomás. Wie hat er es so lautlos öffnen können?
»Ja, Afonso, deswegen bin ich hier.«
»Ist Ihnen nicht wohl?«
»Mir geht es gut.«
Mühsam kommt er wieder auf die Beine und steckt dabei das Buch zurück in die Tasche. Der Hausmeister zieht am Glockenstrang. Das Rappeln der Glocke könnte ebenso gut der Ausdruck von Tomás’ Nervenzustand sein. Er muss hinein, es geht nicht anders. Nicht nur dieses Zuhause, das, in dem Dora und Gaspar gestorben sind, sondern jedes hat jetzt diese Wirkung auf ihn. Die Liebe ist ein Haus mit vielen Zimmern; hier haben wir das, in dem die Liebe genährt wird, dort unterhält man sie, hier ist das Zimmer, in dem sie sich waschen kann, dort wird sie angekleidet, in jenem wiederum darf sie sich ausruhen, und jeder dieser Räume kann ebenso gut der für das Lachen sein, der für das Zuhören, der, in dem man seine Geheimnisse erzählt, das Zimmer zum Trübsalblasen, das für die Entschuldigungen oder das, in dem man miteinander intim ist, und natürlich gibt es auch die Räume für die Neuankömmlinge in diesem Haushalt. Die Liebe ist ein Haus, in dem neue Gefühle an jedem Morgen aus dem Wasserhahn sprudeln, die Abwasserrohre spülen alte Zwistigkeiten fort, und durch die offenen Fenster zieht strahlend die frische Luft der wiedergewonnenen Zuneigung ein. Die Liebe ist ein Haus mit unerschütterlichen Fundamenten und einem unzerstörbaren Dach. Auch er hatte einmal ein solches Haus, doch dann wurde es abgerissen. Jetzt hat er nirgendwo mehr ein Zuhause – die Wohnung im Alfama-Viertel ist kahl wie eine Mönchszelle –, und immer wenn er eines betritt, erinnert es ihn daran, dass er selbst heimatlos ist. Er weiß, das ist der Grund dafür, dass ihn Pater Ulisses so sehr beschäftigt: das Heimweh, das ihnen beiden gemeinsam ist. Tomás fallen die Worte des Priesters ein, als die Frau des Gouverneurs von São Tomé stirbt. Sie war die einzige europäische Frau auf der Insel. Die nächste solche Frau lebte in Lagos, etwa achthundert Kilometer jenseits des Meers. Pater Ulisses hatte die Gouverneursgattin nie kennengelernt. Er hatte sie nur ein paar wenige Male gesehen.
Der Tod eines weißen Menschen ist ein tieferer Riss auf dieser entsetzlichen Insel, als er es in Lissabon ist. Und wenn es dann noch eine Frau ist! Ihr Verlust lastet schwer auf allem. Ich fürchte, nie wieder wird der Anblick einer Frau meiner eigenen Art mich trösten. Nie wieder Schönheit, Sanftheit, Anmut. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann.
Tomás und Afonso überqueren den gepflasterten Hof, der Hausmeister ehrerbietig einen Schritt vor ihm. Da er wie üblich rückwärts geht, gehen sie im Gleichschritt Rücken zu Rücken. Am Fuße der Treppe zum Haupteingang tritt Afonso zur Seite und verneigt sich. Es sind nur wenige Stufen, also steigt Tomás sie rückwärts hinauf. Noch bevor er oben angelangt ist, öffnet sich die Tür, und er tritt ein, rückwärts. Beim Blick über die Schulter sieht er Damião, den langjährigen Butler seines Onkels, der ihn schon als kleinen Jungen gekannt hat; er wartet lächelnd, mit gebreiteten Händen. Tomás dreht sich zu ihm um.
»Hallo, Damião.«
»Menino Tomás, welche Freude, Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut?«
»Das tut es, danke. Wie geht es meiner Tante Gabriela?«
»Bestens. Sie beglückt uns mit ihrem Glanz wie die Sonne.«
Was die Sonne anbelangt, die scheint durch die hohen Fenster auf die Vielfalt und Pracht der Eingangshalle. Sein Onkel handelt mit Waren aus Afrika, vor allem Elfenbein und Holz, und hat es damit zu gewaltigem Reichtum gebracht. Eine Wand schmücken die beiden riesigen Stoßzähne eines Elefanten. Zwischen beiden hängt ein verschwenderisch schimmerndes Porträt von König Karl I. Seine Majestät höchstpersönlich bewunderte dieses Bildnis, als er den Onkel mit einem Besuch hier im Hause beehrte. Weitere Wände sind mit Zebra- und Löwenfellen geschmückt, darüber hängen präparierte Tierköpfe: Löwe und Zebra, aber auch Elenantilope, Flusspferd, Gnu, Giraffe. Auch Stühle und Couch sind mit Fell bezogen. In den Raumecken und auf Regalbrettern sind afrikanische Kunstgegenstände ausgestellt: Halsschmuck, grob gearbeitete Holzbüsten, Talismane, Messer und Speere, bunte Stoffe, Trommeln und so weiter. Eine Reihe von Gemälden – Landschaften, Porträts portugiesischer Landbesitzer, denen Einheimische aufwarten, aber auch eine große Afrikakarte, auf der die portugiesischen Besitzungen farbig hervorgehoben sind – zeigen die Szenerie und einige der Protagonisten. Und zur Rechten, geschickt zwischen hohem Gras aufgestellt, der ausgestopft lauernde Löwe.
Mit den Augen des Kurators gesehen, ist diese Eingangshalle ein Albtraum, ein Mischmasch der Kulturen, jedes einzelne Stück aus dem Kontext gerissen, der ihm einmal einen Sinn gab. Aber Doras Augen leuchteten, wenn sie hierherkam. Sie bewunderte dies Füllhorn imperialer Pracht. Es machte sie stolz auf das portugiesische Weltreich. Sie fuhr mit den Fingern über jedes Stück, das sie erreichen konnte, ausgenommen den Löwen.
»Es freut mich, zu hören, dass es meiner Tante gutgeht. Mein Onkel ist in seinem Büro?«, fragt Tomás.
»Er wartet im Innenhof auf Sie. Wenn Sie so freundlich sein wollen, mir zu folgen.«
Tomás dreht sich um und folgt Damião quer durch die Eingangshalle und dann einen teppichbelegten Gang hinunter; Bilder und Vitrinen säumen dort die Wände. Sie biegen in einen weiteren Gang. Damião öffnet für Tomás die beiden Flügel einer Fenstertür und tritt beiseite. Tomás kommt auf einen halbrunden Treppenabsatz. Er hört die laute, gutmütige Stimme seines Onkels: »Tomás, sieh dir das iberische Nashorn an!«
Tomás sieht über die rechte Schulter. Er tastet sich die drei Stufen in den großen Innenhof hinunter, eilt dem Onkel entgegen und dreht sich unmittelbar vor ihm um. Sie reichen sich die Hände.
»Onkel Martim, wie schön, Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut?«
»Wie sollte es mir nicht gutgehen? Ich habe gerade das Vergnügen, meinen einzigen Neffen zu sehen.«
Tomás ist im Begriff, sich noch einmal nach der Tante zu erkundigen, aber sein Onkel tut sämtliche Nettigkeiten mit einer Handbewegung ab. »Genug, genug. Nun, was hältst du von meinem iberischen Nashorn?« Er zeigt darauf. »Das schönste Stück meiner Menagerie!«
Das besagte Tier steht mitten im Hof, gleich bei seinem großen, hageren Wärter Sabio. Tomás betrachtet es. Das Licht ist weich und milchig, hüllt es in schmeichlerische Gaze, doch trotzdem ist es in seinen Augen eine Farce, eine Monstrosität. »Es ist … großartig«, antwortet er.
Aber so abschreckend er sein Äußeres auch findet, hat er stets das Schicksal dieses Tiers bedauert, das einst die ländlichen Gegenden des Landes mit seiner Anwesenheit beglückte. Waren nicht tatsächlich die Hohen Berge Portugals die letzte Bastion des iberischen Nashorns gewesen? Merkwürdig, wie sehr dieses Tier die Phantasie der Portugiesen beflügelt hat. Der Fortschritt der Menschheit machte ihm ein Ende. Es wurde, konnte man sagen, von der Moderne überrollt. Es wurde gejagt und gehetzt bis zu seiner Ausrottung, und dann war es fort, lächerlich geworden wie eine aus der Mode gekommene Idee – und wurde schon im selben Moment, in dem es verschwunden war, betrauert und zurückersehnt. Heute ist es Stoff für den Fado, gehört zum Standardrepertoire jener so eigentümlich portugiesischen Form der Melancholie, der saudade. Tatsächlich überkommt beim Gedanken an dieses schon vor so langem ausgestorbene Geschöpf die Saudade auch Tomás. Er ist, wie die Redewendung lautet, tão docemente triste quanto um rinoceronte, von so süßer Trauer wie ein Rhinozeros.
Dem Onkel gefällt seine Antwort. Tomás beobachtet ihn mit einem gewissen Maß an Furcht. Auf einem soliden Knochengerüst hat der Bruder seines Vaters seinen Leib mit Wohlstand wattiert, eine rundliche Hülle, die er mit gutmütigem Stolz spazieren führt. Er lebt im Luxus, hier im Lapa-Viertel. Er gibt schwindelerregende Summen für jedes neue Spielzeug aus. Vor einigen Jahren hatte er seine Liebe zum Fahrrad entdeckt, einem zweirädrigen Fortbewegungsmittel, das der daraufsitzende Fahrer mit seinen eigenen Beinen antrieb. Auf den steilen Pflasterstraßen von Lissabon ist ein Fahrrad nicht einfach nur unpraktisch, es ist gefährlich. Man kann es ohne Sturzgefahr nur auf den Wegen der Parks benutzen, wo man dann im Kreise fährt, die Spaziergänger stört und ihre Kinder und Hunde erschreckt. Sein Onkel hat einen ganzen Stall voller französischer Peugeot-Fahrräder. Als Nächstes legte er sich motorisierte Fahrräder zu, die um vieles schneller als pedalbetriebene fuhren und dazu auch noch Lärm machten. Und hier steht nun ein Belegstück seiner neuesten teuren Liebhaberei, erst kürzlich erworben. »Aber Onkel«, fügt er zögernd hinzu, »ich sehe nichts weiter als ein Automobil.«
»Nichts weiter, sagst du?«, entgegnet sein Onkel. »Dieses technische Wunderwerk ist der unsterbliche Geist unserer Nation, zu neuem Leben erwacht.« Er setzt einen Fuß auf das Trittbrett des Wagens, einen schmalen Steg, der über die ganze Länge zwischen Vorder- und Hinterrädern läuft. »Ich habe gezögert. Welchen sollte ich dir leihen? Meinen Darracq, meinen De Dion-Bouton, meinen Unic, meinen Peugeot, meinen Daimler, vielleicht sogar meinen amerikanischen Oldsmobile? Die Wahl war nicht leicht. Aber schließlich, da du mein lieber Neffe bist und im Gedenken an meinen tief betrauerten Bruder, entschied ich mich für den besten von allen. Dies ist ein nagelneuer Vierzylinder-Renault, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Sieh ihn dir an! Eine Kreation, die nicht nur von der Macht der Logik leuchtet – sie singt von der Faszination der Poesie. Lasst uns die Tiere loswerden, die unsere Stadt mit ihrem Unrat beschmutzen! Ein Automobil braucht niemals Schlaf – kann ein Pferd da mithalten? Auch ihre Kraft, ihre Leistung, lässt sich nicht vergleichen. Die Motorleistung dieses Renault wird mit vierzehn Pferdestärken angegeben, aber das ist eine rein wissenschaftliche Mindestzahl. Die Zugkraft dürfte eher bei zwanzig Pferdestärken liegen. Und die mechanische Pferdestärke zählt mehr als die eines Tieres; du kannst dir getrost eine Kutsche mit dreißig vorgespannten Pferden vorstellen. Siehst du es vor dir, dreißig Pferde in Zweierreihen, wie sie stampfen und mit den Hufen scharren? Na, du musst es dir nicht vorstellen: Hier hast du es vor Augen. Die dreißig Pferde stecken alle zusammen in diesem Metallkasten hier zwischen den Vorderrädern. Die Leistung! Die Sparsamkeit! Nie zuvor hat das Feuer der Vorzeit einen so großartig modernen Nutzen bekommen. Und wo ist beim Automobil der Abfall, der beim Pferd so sehr unser Missfallen erregt? Es gibt keinen, nur eine Rauchwolke, die in der Luft verpufft. Ein Automobil richtet genauso wenig Schaden an wie eine Zigarette. Lass es dir gesagt sein, Tomás: Dieses Jahrhundert wird als das Jahrhundert der Rauchwolke in die Geschichte eingehen!«
Sein Onkel strahlt, sprudelt geradezu über vor Freude, vor Stolz auf sein gallisches Spielzeug. Tomás kneift die Lippen zusammen. Er teilt die Liebe seines Onkels zu Automobilen nicht. Ein paar von diesen neumodischen Apparaturen finden sich seit kurzem auf den Straßen von Lissabon. In dem geschäftigen Zugtierverkehr der Stadt, über dessen Lärm man sich alles in allem nie beklagen konnte, fahren diese Motorwagen nun umher wie gewaltige brummende Insekten, lästig für die Ohren, schmerzlich für die Augen, unangenehm für die Nase. Er kann ihnen nichts abgewinnen. Da ist auch das burgunderrote Exemplar seines Onkels keine Ausnahme. Jegliche Eleganz oder Symmetrie geht ihm ab. Die Kabine scheint ihm auf geradezu absurde Weise zu groß im Verhältnis zu dem winzigen Stall, in dem die dreißig Pferde stecken. Die Metallteile, und davon gibt es viele, blitzen und funkeln gefährlich – unmenschlich, findet er.
Er hätte sich gern von einem herkömmlichen Zugtier in die Hohen Berge Portugals bringen lassen, aber er macht die Reise zur Weihnachtszeit, verbindet Urlaubstage, die ihm zustehen, mit ein paar weiteren, die er, praktisch auf den Knien, vom Museumsdirektor erbettelt hat. Zusammen sind es nur zehn Tage, um seine Mission zu erfüllen. Die Entfernung ist zu groß, seine Zeit zu begrenzt. Mit einem Tier schafft er es nicht. Also muss er die von seinem Onkel so großzügig angebotene, wenn auch unansehnliche Maschine nehmen.
Türen klappern, Damião kommt mit einem Tablett mit Kaffee und Feigengebäck auf den Hof. Ein Ständer für das Tablett wird hervorgeholt, dazu zwei Stühle. Tomás und sein Onkel setzen sich. Heiße Milch wird eingegossen, Zucker abgemessen. Es ist ein Augenblick für gepflegte Unterhaltung, doch stattdessen fragt Tomás geradewegs: »Also, Onkel, wie funktioniert es?«
Er fragt, weil er sich von dem Gedanken an das ablenken will, was unmittelbar hinter dem Automobil zu sehen ist, entlang der Mauer, die den Besitz seines Onkels abschließt, gleich neben dem Pfad zu den Dienstbotenquartieren: die Reihe von Apfelsinenbäumen. Denn dort pflegte sein Sohn immer auf ihn zu warten, versteckt hinter einem der nicht allzu dicken Stämme. Quietschend ergriff Gaspar die Flucht, sofort wenn sein Vater ihn erblickt hatte. Tomás lief dann dem kleinen Witzbold nach, tat, als hätten seine Tante oder sein Onkel oder einer ihrer vielen Spione ihn nicht gesehen, wie er diesen Pfad einschlug, genau wie die Diener taten, als sähen sie ihn nicht, wenn er ihr Quartier betrat. Ja, besser über Automobile sprechen als diese Bäume anzusehen.
»Ah, gut, dass du fragst! Lass mich dir das Wunderwerk von innen zeigen«, antwortet sein Onkel und springt sofort von seinem Stuhl auf. Tomás folgt ihm zur Vorderseite des Wagens, wo der Onkel bereits den Verschluss der kleinen, abgerundeten Blechhaube löst und sie an ihren Scharnieren nach vorn klappt. Zum Vorschein kommen verschlungene Schläuche und bauchige Objekte aus schimmerndem Metall.
»Das musst du bewundern!«, kommandiert sein Onkel. »Ein Reihenvierzylindermotor mit einem Hubraum von 3054 Kubikzentimetern. Eine Schönheit und ein Meisterstück. Sieh sie dir der Reihe nach an: Motor, Kühler, Reibkupplung, Schubradgetriebe, Kardanwelle zur Hinterachse. So sieht die Zukunft aus. Aber lass mich dir als Erstes das Wunder des Verbrennungsmotors erklären.«
Er zeigt mit einem Finger, der sichtbar machen will, wie die Zauberkräfte wirken, die jenseits der undurchsichtigen Motorwand am Werke sind. »Hier an dieser Stelle wird vom Vergaser der Moto-Naphtha-Dampf in die Brennkammern gesprüht. Der Magnet sorgt dafür, dass die Zündkerze einen Funken abgibt; der Dampf wird entzündet und explodiert. Der Kolben hier wird hinuntergedrückt, wodurch …«
Tomás versteht kein Wort. Er starrt benommen vor sich hin. Als der Onkel mit dem Höhenflug seiner Erläuterungen fertig ist, nimmt er vom Sitz des Führerhauses ein dickes Heft. Er drückt es seinem Neffen in die Hand. »Das ist das Handbuch zu dem Wagen. Es wird dir erläutern, was du vielleicht jetzt noch nicht verstanden hast.«
Tomás wirft einen Blick darauf. »Es ist auf Französisch, Onkel.«
»Ja. Renault Frères ist eine französische Firma.«
»Aber …«
»Ich habe deiner Ausrüstung ein französisch-portugiesisches Wörterbuch hinzugefügt. Besondere Sorgfalt musst du beim Abschmieren des Wagens walten lassen.«
»Beim Abschmieren?« Ebenso gut könnte sein Onkel französisch reden.
Lobo achtet nicht auf den verblüfften Unterton. »Sind die Kotflügel nicht prächtig? Rate mal, woraus sie gemacht sind.« Dabei versetzt er einem davon einen Klaps. »Elefantenohren! Ich habe sie eigens anfertigen lassen, ein Souvenir aus Angola. Ebenso die Außenseite der Kabine – mit feinster Elefantenhaut bespannt.«
»Was ist das hier?«, fragt Tomás.
»Die Hupe. Damit kannst du warnen, zur Ordnung rufen, deine Ankunft signalisieren, du kannst drängen und dich beschweren.« Sein Onkel drückt die dicke Gummiknolle, die an der Außenwand des Wagens angebracht ist, links vom Steuerrad. Ein tiefer Ton wie von einer Tuba, mit einem leichten Vibrato, erklingt aus dem Schalltrichter, an dem die Knolle sitzt. Ein Laut, der Aufmerksamkeit schafft. Vor Tomás’ innerem Auge erscheint das Bild eines Reiters, mit einer Gans unter dem Arm wie ein Dudelsack, die er jedes Mal drückt, wenn Gefahr im Verzug ist, und er kann ein Lachen nicht unterdrücken. Es klingt, als ob er hustet.
»Darf ich probieren?«
Er drückt die Knolle mehrere Male. Bei jedem Hupton muss er lachen. Er hört damit auf, als er merkt, dass sein Onkel es nicht so lustig findet wie er, und versucht sich wieder mehr auf die Magie des Motorenzeitalters zu konzentrieren. Es handelt sich eher um andächtige Beschwörungen als um Erläuterungen. Wenn das übelriechende Metallspielzeug seines Verwandten Gefühle zeigen könnte, würde es vor Verlegenheit erröten.
Sie kommen an das Steuerrad, kreisrund und von der Größe eines großen Tellers. Lobo streckt noch einmal den Arm ins Führerhaus und legt seine Hand darauf. »Wenn du das Fahrzeug nach links steuern willst, dann drehst du das Rad nach links. Soll der Wagen nach rechts fahren, drehst du das Rad nach rechts. Um geradeaus zu fahren, hältst du das Rad gerade. Nichts könnte logischer sein.«
Tomás schaut es sich genau an. »Aber wie kann man sagen, dass ein Rad, das sich um seinen Mittelpunkt dreht, sich nach rechts oder links dreht?«, fragt er.
Sein Onkel blickt ihm forschend ins Gesicht. »Ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann. Siehst du den oberen Teil des Steuerrads, da wo ich meine Hand habe? Das siehst du doch, oder? Gut, dann stell dir vor, dass dort ein Punkt ist, ein kleiner weißer Punkt. Wenn ich jetzt das Rad in diese Richtung drehe« – er zerrt an dem Rad – »siehst du dann, wie der kleine weiße Fleck sich nach links bewegt? Ja. Nun, dann fährt das Automobil nach links. Und wenn du das Rad in diese Richtung drehst« – hier stemmt er das Rad in die Gegenrichtung – »siehst du, wie der kleine weiße Fleck sich dann nach rechts bewegt? In diesem Falle fährt das Automobil nach rechts. Hast du es jetzt verstanden?«
Tomás’ Miene verfinstert sich. »Aber schauen Sie sich« – er zeigt mit dem Finger – »das andere Ende des Steuerrades an! Wenn dort ein kleiner weißer Fleck wäre, würde er sich in die jeweils andere Richtung bewegen. Mag sein, dass Sie, wie Sie sagen, am oberen Ende das Rad nach rechts drehen, aber am unteren drehen Sie es nach links. Und was ist mit den Seiten des Rades? Wenn Sie es nach rechts oder links drehen, dann drehen Sie eine Seite nach oben, die andere nach unten. Egal, in welche Richtung Sie das Rad drehen, Sie drehen es immer gleichzeitig nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Wenn Sie behaupten, Sie drehten das Rad in eine bestimmte Richtung, dann scheint es mir ein Paradoxon, wie etwas, das Zenon von Elea, der griechische Philosoph sich, ausgedacht hat.«