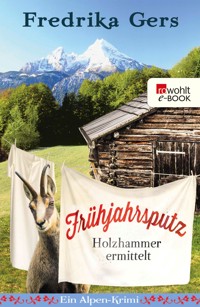9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Holzhammer ermittelt
- Sprache: Deutsch
Gestatten: Franz Holzhammer, Hauptwachtmeister in Berchtesgaden Mitten in der sommerlichen Alpenidylle stürzt ein Gleitschirmflieger vom Himmel. Der junge Mann ist auf der Stelle tot. Hauptwachtmeister Franz Holzhammer hat ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Sein Vorgesetzter will die Angelegenheit als Unfall abtun, doch Holzhammer ist es egal, wer unter ihm Chef ist – er beginnt zu ermitteln. Kurz darauf kommt eine Patientin der örtlichen Reha-Klinik ums Leben. Christine, ihre Ärztin, will nicht an einen natürlichen Tod glauben. Und so wird die Zugereiste unvermutet Holzhammers wichtigste Verbündete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Fredrika Gers
Die Holzhammer-Methode
Ein Alpen-Krimi
Über dieses Buch
Gestatten: Franz Holzhammer, Hauptwachtmeister in Berchtesgaden
Mitten in der sommerlichen Alpenidylle stürzt ein Gleitschirmflieger vom Himmel. Der junge Mann ist auf der Stelle tot. Hauptwachtmeister Franz Holzhammer hat ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Sein Vorgesetzter will die Angelegenheit als Unfall abtun, doch Holzhammer ist es egal, wer unter ihm Chef ist – er beginnt zu ermitteln. Kurz darauf kommt eine Patientin der örtlichen Reha-Klinik ums Leben. Christine, ihre Ärztin, will nicht an einen natürlichen Tod glauben. Und so wird die Zugereiste unvermutet Holzhammers wichtigste Verbündete.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
Coverabbildung plainpicture/Westend61; plainpicture/Reto Puppetti;
plainpicture/Christine Basler; iStockphoto/Fabio Filzi
ISBN 978-3-644-46551-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
1
«Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land», murmelte Hauptwachtmeister Franz Holzhammer, als er den toten Gleitschirmflieger inmitten der duftend blühenden Alpenflora erreichte. Doch ob es Gott gewesen war, der den jungen Mann hatte fallen lassen, oder jemand anders – das würde sich erst noch herausstellen müssen. Auf jeden Fall war es kein Akt der Liebe gewesen.
Die Sonne stand hoch über dem Watzmann und schien ungehindert auf schwitzende Bergwanderer, Eis essende Rentner und bräunungshungrige Hautkrebs-Ignoranten, die um diese Tageszeit in Scharen die Terrassen der Wirtschaften, die Wanderwege und Almwiesen bevölkerten. Eine ganze Karawane bewegte sich von der Bergstation der Jennerbahn talwärts. Erholungssuchende auf der Jagd nach einem Bergerlebnis ohne Anstrengung.
Holzhammer stand auf der großen Wiese, die als Gleitschirm-Landeplatz diente. Der Tote hatte sich für sein spektakuläres Ende einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, kurz vor Dienstschluss an einem heißen Sommertag. Holzhammer hätte schon längst daheim auf seiner Baustelle sein können. Nur am Rande nahm er wahr, wie sich das Gesurr der Insekten mit entfernten Juchzern aus dem Freibad und dem gelegentlichen Aufbrummen eines schweren Motorrads vermischte. Auch das beeindruckende Panorama interessierte ihn nicht – er kannte das alles von klein auf. Die Berge ringsherum hätte er mit geschlossenen Augen malen können. Man konnte von hier das Kehlsteinhaus sehen, rechts davon ragte der Hohe Göll schroff empor. Noch weiter rechts führte die Seilbahn über grüne Almen hoch zum Gipfel des Jenner. Über den tiefen Einschnitt, in dem der Königssee lag, grüßten die obersten Spitzen des Steinernen Meeres. Im Südwesten schließlich lag als grüner Hügel der freundliche Grünstein und direkt dahinter, von hier aus zu Fuß zu erreichen, der berühmte Watzmann, Deutschlands zweithöchster Berg.
Der Duft der Wildblumen und Kräuter überlagerte größtenteils die Abgase der PKW, die dem Großparkplatz zwischen Jennerbahn und Königssee zustrebten oder ihre Passagiere bereits wieder talauswärts Richtung Autobahn beförderten.
Weder der McDonald’s noch die Tankstelle waren von diesem Punkt aus zu sehen. Ausschließlich Häuser mit Holzbalkonen und weit überkragenden, im Dreißig-Grad-Winkel geneigten Dächern. Auf diese Konsequenz in Sachen bayerischer Bauart war man in der Gemeinde sehr stolz. Der Himmel jedoch war heute mehr blau als bayerisch weiß-blau. Nur eine einzige Wolke stand am Himmel. Das war die Wolke bunter Gleitschirme über dem Jennergipfel.
Am Rande der Wiese, auf der Holzhammer stand, parkte ein Krankenwagen. Die Sanitäter wussten bereits, dass sie hier nichts mehr tun konnten. Doch bisher war noch nicht einmal der Arzt erschienen, um den Tod offiziell festzustellen. Neben dem Toten stand mit versteinertem Gesicht der junge Mann, der den Vorfall per Handy gemeldet hatte.
«Der Schirm sieht in Ordnung aus», sagte er gerade zu Holzhammer, als direkt hinter ihm mit viel Schwung ein weiterer Flieger zur Landung ansetzte.
«Alexander, was ist passiert?», schrie der Neuankömmling noch aus der Luft. Eilig befreite er sich aus seinen Gurten und stürzte auf den reglosen Körper zu. Neben dem Leichnam fiel er auf die Knie und machte Anstalten, den Toten an den Schultern zu rütteln, als ob er ihn aufwecken wollte.
«Obacht, nichts berühren», warnte der Hauptwachtmeister, «sonst kann ich die Spurensicherung gleich wieder abbestellen. Sie kannten den Toten?»
«Ja, wir sind zusammen hier, er ist mein bester Freund.» Und leiser: «Er war mein bester Freund. Was ist nur passiert?»
«Das wird sich rausstellen», antwortete Holzhammer. «Aber jetzt machen wir alle erst mal ein paar Schritte vom Fundort weg, und dann geben Sie mir Ihre Personalien.» Holzhammer hatte naturgemäß viel mit Touristen zu tun. Aufgrund langjähriger Erfahrung hatte er sich angewöhnt, mit ihnen zu sprechen wie mit kleinen Kindern.
Er nahm die Ferien- und Heimatadressen auf. Der Tote hieß Alexander Klein und war zusammen mit seinem Freund Tobias Pfahl vor einer Woche aus Bremen angereist, um hier Urlaub zu machen. Sie wohnten in einem der vielen Privatzimmer mit Bergblick bei einer Frau Schön.
«Wir waren so gut drauf, gestern haben wir noch bis nachts auf dem Balkon gesessen und Witze erzählt – viel gelacht –, es war so schön draußen … Dreimal war die Wirtin da und hat herumgezickt, bis wir dann reingegangen sind», erzählte Pfahl stockend, die Tränen mühsam unterdrückend.
«Haben Sie den Absturz gesehen?», fragte Holzhammer.
«Nicht richtig, ich war drüben, über dem Jenner. Hab nur gesehen, dass Alexander sehr hoch über dieser Wiese kreiste. Dann ging er plötzlich in eine Steilspirale über, als wollte er so schnell wie möglich zum Boden.»
Das hat er geschafft, dachte Holzhammer. Er hakte nach: «Steilspirale?»
«Ja, man fliegt enge, steile Kurven und kreiselt so nach unten.»
«Und was passierte dann?»
«Dann sah ich, dass er einen Einklapper hatte. Aber normalerweise hätte er das in den Griff bekommen.»
«Einen Einklapper?»
«Ein Teil des Schirms faltet sich durch einen Strömungsabriss an der kurveninneren Vorderseite des Schirms zusammen, wenn man zu stark bremst. Bei der Steilspirale kann das besonders leicht passieren. Aber normalerweise ist das in der Höhe kein Problem. Man gibt einfach die Bremse frei, und die Sache hat sich.»
Franz Holzhammer verstand überhaupt nichts vom Gleitschirmfliegen. «Aber das hat Ihr Spezi nicht gemacht?»
«Diesmal anscheinend nicht. Ich war ja mehrere 100 Meter weg, aber es sah aus, als hätte er plötzlich völlig vergessen, wie man fliegt. Normalerweise hätte der Schirm sich sogar ohne jede Einwirkung wieder stabilisieren können. Hätte eben etwas länger gedauert. Das wäre in der Höhe aber egal gewesen.»
«Doch das tat er nicht.» Holzhammer blickte auf das alles andere als stabil aussehende Schirm-Mensch-Bündel.
«Nein, er ging in einen Spiralsturz über. Es gab wohl einen Verhänger. Das heißt, der Schirm blieb beim Ausklappen in den Leinen hängen und konnte sich deshalb nicht mehr ganz entfalten.»
«Verhänger, aha.» Holzhammer hatte inzwischen seinen Notizblock gezückt und schrieb einzelne Wörter mit. Irgendwann würde er daraus ein Protokoll zusammenbasteln müssen.
«Ich bin dann im Schnellflug rübergekommen und so schnell wie möglich gelandet. Mein Gott. Eigentlich war er der bessere Flieger. Wie konnte das nur passieren?» Über seine fachlichen Erklärungen hatte der junge Mann kurzfristig den Schrecken vergessen. Jetzt wurde ihm wieder bewusst, was ihn überhaupt zu diesen fachlichen Ausführungen veranlasst hatte.
«Mir werden’s rausfinden», gab Holzhammer sich zuversichtlich. «Unsere Spurensicherung hat Erfahrung mit Sportunfällen.» Das stimmte leider. Er wandte sich dem Gleitschirmflieger zu, der den Absturz gemeldet hatte. Aber der konnte nicht viel beitragen. Er hatte den Unfall erst bemerkt, als ihm sein Sportskamerad fast auf den Kopf gefallen war, während er selbst sich auf der Landewiese gerade von seinem Schirm befreite.
Der Hauptwachtmeister klappte sein Notizbuch zu und überlegte. Vermutlich würde sein Chef, der Leiter der Polizeidienststelle Berchtesgaden, irgendwann hier am Absturzort auftauchen. Aber war der überhaupt schon informiert? In letzter Zeit war es öfter vorgekommen, dass der Chef sich stundenlang in angeblichen oder tatsächlichen Funklöchern befand. Insofern machte es wahrscheinlich keinen Sinn, die beiden Zeugen hier warten zu lassen. «Wenn Sie wollen, können Sie beide jetzt gehen», sagte Holzhammer. «Aber bleiben Sie bis auf weiteres im Ort. Wahrscheinlich will mein Chef Sie morgen noch sprechen.»
«Wann wissen Sie denn, was genau passiert ist?», fragte Tobias, der Freund des Toten.
«Weiß man jemals, was genau passiert ist?», fragte Holzhammer philosophisch zurück. «Aber wenn jemand seine Hand im Spiel hatte, finden wir das schon raus. Und wenn es am Schirm lag, auch. Wie gesagt, die Spurensicherung ist verständigt, die werden den Schirm unter die Lupe nehmen. Und die Leiche wird natürlich auch untersucht.» Beide Sportler nickten. Dann sammelten sie ihre Schirme ein und trotteten gemeinsam davon.
Holzhammer vermutete, dass es hier bald von Schaulustigen und Wichtigtuern jeglicher Art wimmeln würde. Deshalb hoffte er, dass die Kollegen von der Spusi schnell eintreffen würden, damit er ihnen den Tatort übergeben und sich selbst aus dem Staub machen konnte. Auf den Arzt musste er allerdings noch warten. Hier im hintersten Winkel der Bundesrepublik gab es keinen eigenen Polizeiarzt. Man verständigte einfach den nächstgelegenen niedergelassenen Arzt und bat ihn, schnellstmöglich zu kommen, um den Tod festzustellen. Wenn der Mediziner allerdings gerade bis zum Ellenbogen in einem Privatpatienten steckte, dann konnte es auch mal ein Stündchen dauern.
Die Spurensicherung kam aus Traunstein, das konnte also ebenfalls dauern. Holzhammer versuchte trotzdem nicht, sich selbständig auf Spurensuche zu begeben. Dafür würde er bloß wieder einen Rüffel kassieren, wegen «Verfälschens von Beweismitteln». Auf den ersten Blick allerdings sah es so aus, als sei der Schirm intakt – im Gegensatz zum Piloten. In Ermangelung entsprechender Pfosten blieb Holzhammer nichts anderes übrig, als ein Absperrband um den Toten herum auf die Erde zu legen. Dann stellte er sich zu den Neugierigen, die sich rund um seine improvisierte Absperrung ansammelten. Die meisten von ihnen fielen nach und nach vom Himmel. Allerdings langsamer, als es der Tote getan hatte.
Noch vor einer halben Stunde hatte sich hoch über der großen Wiese ein ganzer Schwarm von Gleitschirmen in der Luft befunden. Sie waren knapp unterhalb der Bergstation der Jennerbahn gestartet, und die Mutigsten hatten sich bei den idealen Wetterbedingungen bis auf rund 3600 Meter über dem Meeresspiegel hinaufgeschraubt – 3 Kilometer über der Landewiese und immer noch einen Kilometer über dem Gipfel. Jetzt war der Himmel leer.
Holzhammer hatte schon mehr Tote gesehen als die meisten anderen Dorfpolizisten. Das lag an der schönen Bergwelt. Es waren auch keineswegs nur Touristen, die sich in Gefahr begaben und dann darin umkamen. Holzhammer selbst hatte bereits drei gute Freunde am Berg verloren. Da war zum Beispiel der Familienvater gewesen, der beim winterlichen Ausflug auf die Kneifelspitze den Handschuh seiner kleinen Tochter vor dem Absturz retten wollte. Der Mann war Bergführer und die Kneifelspitze mit 1189 Metern nur ein besserer Hügel. Aber den Fehler, sich am verschneiten Gipfel einen Meter zu weit vorzuwagen, hatte sie nicht verziehen. 50 Meter weiter unten hatte die Bergwacht den Mann tot geborgen.
Manchmal war es auch schwer zu erkennen, ob es sich um einen Unfall, Mord oder Selbstmord handelte, wenn eine vermisste Person nach vielen Tagen oder Wochen am Fuß eines Steilhangs gefunden wurde. Oder wenn die Ehefrau von einem Ausflug ohne ihren Mann zurückkehrte.
Holzhammer war früher selbst viel in den Bergen herumgekraxelt. Alle wichtigen Routen war er damals gegangen. Einige hatte er zusammen mit seinem Bergspezi Sepp eröffnet. Als er noch rank und schlank war, hatte er eine richtige Kletterfigur gehabt: klein und drahtig. Klein war er immer noch.
Seit einer halben Stunde starrte Dr. Dr. Christine Müller-Halberstadt aus ihrem Bürofenster, anstatt das Gutachten über die Panikattacken der vierzigjährigen Patientin zu schreiben, die sich vor ihrem eigenen Kater fürchtete. Doch die Tatsache, dass auf der blühenden Wiese vor der Klinik etwas Ungewöhnliches vorging, drang nicht in ihr Bewusstsein vor.
Christine war eine ebenso zierliche wie energische Frau mit problematischen Haaren, die sie momentan durch Strähnchen aufzuwerten suchte. Sie leitete die psychosomatische Abteilung der Reha-Klinik Schönau. Das bedeutete, sie hatte mit den unterschiedlichsten Fällen zu tun, von der frustrierten, übergewichtigen Hausfrau über den scheinbar unheilbaren Schmerzpatienten bis hin zum Unfallopfer, das nach einer Amputation in schwerste Depressionen verfiel. In ihrem großen Büro stand ein riesiger Schreibtisch aus poliertem Buchenholz, auf dem sich Papierkram stapelte. An den Wänden reihten sich abschließbare Rollschränke. Für psychologische Gespräche gab es eine kleine Sitzecke mit einem bequemen Eileen-Gray-Sessel aus schwarzem Leder, passendem Glastisch und einem Ledersofa, von dem Christine wusste, dass es eine billige Kopie war. Die pompöse Einrichtung war nicht ihre Idee gewesen. Christine hätten ein IKEA-Schreibtisch und ein paar Holzstühle gereicht. Aber die Klinikleitung wollte, dass der Raum «Gediegenheit» ausstrahlte. Eine auf Reha-Kliniken spezialisierte Beratungsfirma hatte das empfohlen, um mehr Privatpatienten anzulocken.
Für Christines Geschmack sah das Ganze mehr nach dem Büro eines Top-Managers aus als nach der Behandlung kranker Menschen. Und eine Behandlung hätte sie selbst momentan gut gebrauchen können. Vor einer halben Stunde hatte eine Frau angerufen und erklärt, sie sei die Freundin von Christines Mann, und dieser würde nicht mehr nach Hause kommen. Christine hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, dass ihr Mann fremdging. Oder nicht haben wollen? Zugegeben, sie fuhr jeden Morgen sehr früh zur Arbeit, denn ihr Wohnort im Chiemgau lag rund 80 Kilometer von der Klinik entfernt. Und wenn ihr Mann abends bei ihrer Rückkehr noch nicht zu Hause gewesen war, hatte sie sich nie gewundert. Meistens hatte er sie schon vorher angerufen und etwas von «Computerproblemen» gemurmelt. Damit ließ sich heutzutage ja alles entschuldigen.
Sie fragte sich, was die Welt – oder der momentane Stand des Geschlechterdiskurses – jetzt von ihr erwartete: Trauer, Wut, Selbstverwirklichung? Sie hatte sich schon längst selbstverwirklicht. Sie hatte Karriere gemacht – und trotzdem immer versucht, ihrem Mann «ein Heim zu bieten», wie man das ja wohl nannte, wenn die Frau den Löwenanteil der Hausarbeit übernahm und mehrmals in der Woche abends kochte. Nun war dieses Heim leer. Sollte sie wirklich heute Abend dorthin zurückkehren? In den Klinkerbau in trügerischer Dorfidylle am Südufer des Chiemsees mit schmiedeeisernem Gartentor?
Ursprünglich war Christine ein Nordlicht. Sie war in Lübeck geboren und hatte in Hamburg studiert. Damals noch mit dem Ziel, eines Tages die gynäkologische Abteilung eines großen Krankenhauses zu leiten. Dort hatte sie auch ihren Mann – ihren zukünftigen Exmann – kennengelernt. Er hatte damals gerade an seiner Dissertation gearbeitet, sie war bereits im praktischen Jahr gewesen. Die angehende Gynäkologin und der angehende Orthopäde – einträglich und prestigeträchtig. Da die bildgebenden Verfahren in der Orthopädie immer wichtiger wurden, hatte sie sich schon damals an seine «Computerprobleme» gewöhnt. Einige Jahre später waren sie dann gemeinsam nach Bayern gegangen, ins Land der Reha-Kliniken mit Dubai-Flügel.
Christine hatte zunächst am Klinikum Traunstein in der Gynäkologie gearbeitet. Doch nach der hundertsten Mastektomie, der dreihundertsten Ovarektomie, dem tausendundersten Kaiserschnitt hatte sie plötzlich kein Blut mehr sehen können. Ihr wurde übel, wenn sie nur daran dachte, schon wieder in unversehrte Haut schneiden zu müssen, sich durch gelbliches Fettgewebe zu diversen Organen vorzuwühlen, irgendwas herauszuschneiden und am Ende einen Menschen zuzunähen wie ein gefülltes Hähnchen.
Deshalb hatte sie noch zwei weitere Facharztausbildungen drangehängt. Finanziell war das kein Problem gewesen, denn ihr Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits in eine große Praxis eingestiegen und verdiente mehr als genug, um ein kinderloses Ehepaar zu ernähren. Jetzt war sie nicht nur Fachärztin für Gynäkologie, sondern auch für Psychotherapeutische Medizin und für Rehabilitationsmedizin. Und fünfundvierzig Jahre alt. So war sie vor einem Jahr hier in der Reha-Klinik gelandet. Die Leitung der psychosomatischen Abteilung war ihr quasi auf den Leib geschnitten und machte ihr meistens auch Spaß. Den langen Heimweg nach Rosenheim hatte sie gerne in Kauf genommen.
Als Christine aus den Tiefen ihrer Gedanken auftauchte, wurde ihr endlich bewusst, dass vor den Fenstern ihres Büros etwas Ernsthaftes passiert sein musste. Auf der großen Wiese liefen immer mehr Menschen zusammen, zwei Polizeiwagen und ein Krankenwagen waren auch aufgefahren. Aber was ging sie das schon an? Es betraf sie frühestens dann, wenn die Insassen des Krankenwagens so weit hergestellt waren, dass sie in der Reha-Klinik auftauchten. Endlich machte sie sich an das Gutachten über die katerbedingten Panikattacken ihrer neuesten Patientin.
Eine halbe Stunde nachdem Franz Holzhammer den Leichenfundort abgesperrt hatte, erschien endlich der Internist Dr. Emanuel Lieder. Man hatte ihn verständigt, weil seine Praxis dem Ort des Geschehens am nächsten lag. Doch der Tote, der ihm da beinahe in den Schoß gefallen wäre, interessierte ihn nur mäßig. Die öffentliche Hand bezahlte seiner Meinung nach viel zu wenig für diese Einsätze. Und in seiner Praxis musste er derweil Patienten warten lassen. Die Verletzungen, die vom Sturz herrührten, hatte er schnell gefunden und beschrieben. Bruch des ersten und zweiten Halswirbels inklusive Abriss aller relevanten Gefäße. Selbstverständlich eine tödliche Verletzung. Theoretisch sollte bei einer Leichenschau die Leiche vollständig entkleidet, bei geeigneter Beleuchtung begutachtet und an allen Körperöffnungen untersucht werden. Aber Dr. Lieder war sicher, einen Unfalltoten vor sich zu haben. Das sagte er Holzhammer.
«Bericht brauch ma trotzdem», erklärte der Hauptwachtmeister. Er mochte den Arzt nicht, der seiner Meinung nach etwas zu wenig Idealismus an den Tag legte. Außerdem hatte er Holzhammers gesetzlich versicherte Schwägerin neulich mit neununddreißig Grad Fieber eine Stunde lang im Wartezimmer sitzen lassen.
«Schon klar», erwiderte der Arzt knapp, packte seine Sachen zusammen und verschwand.
Beinahe gleichzeitig holperte ein altersschwacher Opel Astra auf die Wiese. Holzhammer erkannte sofort das Dienstfahrzeug von Bolko Magiera, dem rasenden Reporter des Lokalradios. Nur wenige Meter dahinter folgte ein wesentlich repräsentativeres Fahrzeug – der schwarze BMW von Dr. Klaus Fischer, Holzhammers Chef. Jetzt folgt die Polizei hier schon der Presse, dachte Holzhammer und überlegte dann, dass das vielleicht gar nicht so abwegig war. Wahrscheinlich kam Fischer von irgendeiner Veranstaltung, auf der auch Magiera als Pressevertreter anwesend war. Dann waren beide gleichzeitig telefonisch hierher beordert worden, und Fischer, der sich in der Gegend noch nicht so gut auskannte, hatte sich an den Reporter gehängt. Nicht nur, um zum Tatort zu kommen, sondern auch, um auf keinen Fall die Gelegenheit zu verpassen, in ein Mikrophon zu sprechen.
Einträchtig kamen beide über die Wiese. Holzhammer erklärte kurz, was los war. Anschließend hielt der Reporter Dr. Fischer sein Diktiergerät unter die Nase.
«Es passiert viel in unseren Bergen. Deshalb ist die lokale Polizeiarbeit so wichtig», schwadronierte dieser. «Und deshalb haben wir bereits Anfang des Jahres eine Aufstockung unserer Mittel beantragt.» Zum Fall selbst hatte er nichts zu sagen, er wusste ja auch nichts. Noch nicht einmal, ob es überhaupt ein Fall war. Der Reporter wirkte enttäuscht. Darum fügte Dr. Fischer als Zugabe noch hinzu, dass die Leiche nach Abschluss der Spurensicherung in die Prosektur des Kreiskrankenhauses überführt und dort bis zur endgültigen Freigabe aufbewahrt werden würde. In diesem Moment rollte der weiße VW-Bus der Spurensicherung auf die Wiese. Mehrere Männer in Plastikanzügen begannen, die Einzelteile des Fallschirms zu fotografieren, zu beschriften und einzusammeln.
«Ihr sagt dann Bescheid, wenn der Tote weg kann?», vergewisserte sich Holzhammer.
«Aber freilich», antwortete der Chef der Spurensicherung. Und das hieß für Holzhammer: Er konnte Feierabend machen, sich endlich wichtigeren Dingen zuwenden. Er konnte zu seiner Baustelle.
An den senkrechten Nordabstürzen des Dürreckbergs schraubten sich zwei Steinadler empor. Ohne einen Flügelschlag kreisten sie im warmen Aufwind und stießen dabei immer wieder ihren überraschend kläglichen Schrei aus: ein hohes Piepsen, das von den Felswänden widerhallte. Noch vor einer Stunde waren sie auf der anderen Seite des Hohen Göll über das Blühnbachtal geschwebt. Doch jetzt, da die Gleitschirmflieger alle gelandet waren, hatten sie sich den Himmel über Berchtesgaden zurückerobert. Die Adler hielten Ausschau, ob sich irgendwo in den steilen Felswänden ein verletztes Tier befand, das sich leicht schlagen ließ. Jetzt im Sommer, da die Gamskitze langsam zu groß wurden, ernährten sich die Steinadler hauptsächlich von Murmeltieren. Das tote zweibeinige Tier auf der großen Wiese mitten in der Schönau hatten die Adler natürlich längst entdeckt – sie konnten einen Kadaver aus einem Kilometer Entfernung erkennen. Aber Kadaver waren weniger interessant als lebende Beute. Und dieser war für sie sowieso unerreichbar. Zum einen, weil dort so viele Menschen herumstanden, und zum anderen, weil ihr Instinkt den Adlern verbot, so weit unten im Tal zu landen.
Doch auch die Adler wurden beobachtet. Auf einem großen Stein am Alpentalsteig saß eine Gestalt und sah ihnen beim Kreisen zu. Schon als Kind hatte sie die Adler oft beobachtet. Und sich unzählige Male glühend gewünscht, sich einfach in die Lüfte zu erheben und davonzufliegen. Die Landewiese der Gleitschirmflieger lag ebenfalls in ihrem Blickfeld, gerade wurden die Überreste des jungen Mannes abtransportiert. Alles verlief nach Plan.
2
Die Sonne stand bereits über der Reiteralm, und Christines Dienst war längst zu Ende, aber sie schrieb weiter und weiter an ihrem Gutachten. Noch nie in der Geschichte der Medizin war eine katzenbedingte Panikattacke so ausführlich dargelegt worden. Im Moment erschien ihr jedoch alles verlockender, als sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sie ihren Feierabend verbringen sollte. Nach Hause würde sie auf keinen Fall fahren, so viel stand fest. Erst als sie merkte, dass sie sich bei der Schilderung der Symptome bereits öfter wiederholt hatte als die Patientin selbst, schloss sie die Datei. Sie hob den Kopf und blickte aus dem Fenster. Die Wiese war inzwischen leer, nur ein Mann im Plastikanzug war noch dabei, einige Metallspieße in den Erdboden zu rammen und rotweißes Absperrband daran zu befestigen.
Christine entschied sich, erst einmal in den Aufenthaltsraum der Ärzte und des Pflegepersonals zu gehen. Die Reha-Klinik hielt sich viel darauf zugute, keine Standesunterschiede zwischen studierten und nicht studierten Angestellten zu machen. Am Kaffeeautomaten traf sie auf Ullrich Zickert, den Pflegedienstleiter der Klinik. Er war einer der wenigen Einheimischen, die hier arbeiteten. Christine wusste, dass er mit seinen zweiundvierzig Jahren noch immer bei seinen Eltern wohnte.
«Sag mal, Ullrich, wo geht man als Einheimischer hier eigentlich abends hin?», fragte sie ihn spontan. Bisher war sie jeden Abend nach der Arbeit direkt nach Hause gefahren. Es hatte keinen Grund gegeben, sich über das hiesige Nachtleben zu informieren, noch nicht einmal, um ihren Patienten Empfehlungen geben zu können, denn die sollten schließlich um zweiundzwanzig Uhr in ihren Betten liegen und sich erholen. Aber an diesem denkwürdigen Tag würde sie sich irgendwie die Zeit im Ort vertreiben und dann ein Hotelzimmer nehmen. Hauptsache, nicht nach Hause.
Ullrich gab bereitwillig Auskunft. «Kommt auf die Uhrzeit an. Jetzt kann man eigentlich nur essen gehen. Oder Kaffee trinken. Später kannst du ins Chill-Out oder ins Upstairs. Wenn du unter zwanzig bist, gibt’s noch zwei Discos und Bodos Kneipe.»
«Und wenn man sich entspannen will?»
Der Pfleger sah sie prüfend an. «Tja, dann gibt’s noch das Nachtcafé, das macht um zwanzig Uhr auf. Aber da gehen eigentlich nur Einheimische hin. Fragst du für dich oder für einen Patienten?»
Darauf wollte Christine nicht eingehen, sie hatte keine Lust, ihre momentane Gemütsverfassung vor Ullrich auszubreiten. «Ganz allgemein», antwortete sie deshalb reserviert und verzog sich mit ihrem Kaffee in eine Ecke. Ullrich verstand den Wink und bohrte nicht weiter nach. Dass sie nicht mit ihm ausgehen wollte, war ohnehin klar gewesen.
Christine schaffte es, die Zeit bis zwanzig Uhr totzuschlagen. Zuerst machte sie einen ausgiebigen Spaziergang rund um die Gleitschirmfliegerwiese. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto in den Ort, parkte in der Nähe des Zentrums und schlenderte durch die Fußgängerzone zum Berchtesgadener Schloss und wieder zurück. Kurz nach acht Uhr stand sie schließlich vor dem Nachtcafé.
Die Kneipe lag in einer Seitenstraße nahe dem Marktplatz. Der Eingang mit der schiefhängenden Tür wirkte nicht gerade einladend, und dahinter lag ein langer schummriger Flur, in dem es nach altem Bohnerwachs roch. Am Ende des Gangs fand Christine schließlich neben der Tür zu den Toiletten die Tür zur Gaststube.
Das Lokal hatte schon bessere Zeiten gesehen. An den Wänden befanden sich Emailleschilder und Prominentenfotos, die runden Bänke in den Nischen waren mit braunem Kunstleder bezogen, der Tresen bestand aus furniertem Sperrholz, davor standen durchgewetzte, ehemals fellbezogene Barhocker. Die Wände waren in einem blassen Hellgrün gestrichen. Aus der Musikanlage schallte die passende Musik: Jennifer Rush schmalzte vor sich hin.
Christine hatte das Gefühl, in eine Art Zeitblase eingedrungen zu sein. Die meisten Gäste wirkten, als hätten sie von Anfang an zum Inventar des Lokals gehört. Das galt sogar für die Teenager an einem der runden Tische, und die waren bei der Eröffnung der Kneipe wahrscheinlich gerade gezeugt worden. Sie waren gekleidet wie in den Städten die Teenager der Achtziger.
Da alle Tische besetzt waren, steuerte sie auf das kurze Ende des L-förmigen Tresens zu, dessen lange Seite in eine immer enger werdende Nische lief. Dort hinten drängten sich einige Gestalten, die schwer einzuordnen waren. Sie waren wohl zwischen dreißig und fünfzig Jahren und auf jeden Fall allesamt nicht sehr modebewusst. Der größte von ihnen trug schwarze Jeans und ein schwarz-orange kariertes Outdoor-Hemd aus dickem Flanell über der Hose. Dazu aschrotblonde Haare ohne wirkliche Frisur. Der Nächste war ein Blonder mit verwaschenem Gesicht und ebenso verwaschenen Klamotten. Dann stand da noch ein auffallend zierliches Kerlchen in Jeans und einem braunen Schlupfpulli mit Kapuze, vor sich ein halbvolles Weißbierglas. Der Große, den jeder für einen Biertrinker gehalten hätte, hielt zierlich ein Glas Prosecco – ein Getränk, das in den Metropolen dieser Welt ebenfalls schon längst wieder aus der Mode gekommen war. Die mittlere Gestalt hatte ein normales Helles vor sich stehen. Mit dieser Gruppe unterhielt sich auch die Barfrau. Doch kaum hatte Christine sich hingesetzt, kam sie herüber und fragte sehr freundlich nach ihren Wünschen. Christine wollte wissen, welche Rotweine es gebe, und erhielt zur Antwort die recht bescheidene Getränkekarte. Schnell suchte sie sich einen Italiener aus.
Während die Barfrau ihr den Wein einschenkte, blickte Christine wieder zum anderen Ende des Tresens hinüber. Die drei Männer wurden ergänzt durch zwei sehr unterschiedliche Frauen. Die eine war blass, blond und schlank, die andere ein Walross mit hennagefärbten Locken. Das Walross unterhielt sich angeregt mit dem großen Kerl im Flanellhemd. Die Unterhaltung drehte sich um einen Fallschirmunfall von heute Nachmittag, so viel bekam Christine mit, aber Einzelheiten verstand sie wegen des schweren Dialekts nicht. Der Berchtesgadener Dialekt ähnelte in vielen Ausdrücken bereits dem Österreichischen, jedoch gänzlich ohne den näselnden Schmäh.
In der Mitte des langen Tresens saß noch ein weiteres Pärchen – offensichtlich Touristen, die sich hierher verirrt hatten. Sie wurden von der Gruppe am Ende der Theke komplett ignoriert. Lediglich die Barfrau wandte sich ihnen ab und an zu. Die beiden trugen Pseudotracht – Machwerke aus billigen Materialien, wie sie extra für Touristen entworfen wurden. Jedenfalls waren sie die Einzigen im ganzen Lokal, die auch nur im Entferntesten bayerisch gekleidet daherkamen.
Christine nippte an ihrem Rotwein und war gerade kurz davor, in unangenehmes Grübeln zu verfallen, als die Tür aufging und der untersetzte Polizist hereinpolterte, den sie am Nachmittag auf der Wiese gesehen hatte.
«Servus! Grüß euch!», rief er in die Runde.
Die Barfrau kam hinter der Theke hervor und umarmte ihn herzlich. Klar, dachte Christine, mit der Ordnungsmacht sollte man sich gutstellen.
Der Polizist deutete auf den Stuhl neben Christine: «Ist es gestattet?», fragte er altmodisch.
Sie bejahte, und der Poltergeist stieg mit einiger Mühe auf den Barhocker, der für seine Figur denkbar ungeeignet war. Er kam mit den Füßen weder auf die Fußraste am Hocker noch auf die umlaufende Stange unten am Tresen. Und durch seine immense Bierkugel hatte er sogar Mühe, vom Sitz aus den Tresen zu erreichen.
«Manu, ein Jubi!», verlangte er. Dann wandte er sich Christine zu: «Hab dich noch nie hier gesehen, Ärger mit dem Mann?»
Christine war erst einmal sprachlos. Sollte sie sich mehr über die plumpe Anmache ärgern oder über die Tatsache, dass dieser Typ mit seiner steinzeitlichen Analyse auch noch voll ins Schwarze getroffen hatte? Sie entschied sich, den Ärger herunterzuschlucken, ließ das Fossil aber trotzdem abblitzen: «Das geht Sie überhaupt nichts an.»
Ihr Ton war wohl etwas scharf ausgefallen, denn sie war mühelos bis zum anderen Ende der Bar zu verstehen gewesen, wo ihre Antwort ungeahnte Heiterkeitsstürme auslöste.
«Hey, Holzei, das war wohl nichts», rief der Große herüber.
«Oan Versuch hat jeder, helft ja nix», gab dieser gutmütig zurück. Dann wandte er sich Christine zu und erklärte ihr in halbwegs verständlichem Hochdeutsch, dass er lediglich ein Gespräch anfangen und sie keineswegs anbaggern wolle. Er sei glücklich verheiratet und habe zwei sehr nette Kinder. Außerdem heiße er Franz.
Die treuherzige Art, mit der er diese Tatsachen vorbrachte, machte ihn irgendwie sympathisch und ließ Christines Ärger schnell wieder verfliegen. Sie gab ihm versöhnlich die Hand und stellte sich ebenfalls vor. Was am anderen Ende der Theke umgehend mit zustimmendem «Hey, hey, hey!» quittiert wurde. Christine fühlte sich, als wäre sie in der Steinzeit gelandet – ein Haufen Erwachsener, die sich wie Teenager benahmen und an denen die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten dreißig Jahre komplett vorbeigegangen waren. Die Touristen blickten sich peinlich berührt an und begannen, miteinander zu tuscheln.
Die Bardame stellte dem Polizisten ein Bier vor die Nase, und Christine wunderte sich. Wo sie herkam, war ein «Jubi» ein Jubiläumsaquavit und kein Bier.
«Übrigens, ich bin die Manu», sagte die Bedienung zu Christine und begann dann ein Gespräch mit dem Ordnungshüter.
So erfuhr Christine, was am Nachmittag auf der Wiese vor ihren Bürofenstern passiert war: Der Gleitschirm des Toten hatte sich in großer Höhe ohne erkennbaren Grund eingefaltet, und der Flieger war fast wie ein Stein zu Boden gestürzt. Manipulationen am Schirm konnten zunächst nicht festgestellt werden. Der Tote lag jetzt zwar in der Kühlkammer des Kreiskrankenhauses, sollte aber laut dem Polizisten nicht obduziert werden. Sein Chef, ein gewisser Dr. Fischer, habe darin keine Notwendigkeit gesehen.
«Ich hab gehört, dass der Tote ein Gast aus Norddeutschland war und mit einem Freund im Haus Schön wohnte», erzählte Manu dem Polizisten. Damit wusste sie mehr als er.
«Das werden wir morgen früh überprüfen», antwortete Holzhammer, machte aber keine Anstalten, weiter nachzufragen, was Manu sichtlich enttäuschte. Offensichtlich renommierte sie gern mit den vielen Informationen, die ihr von Berufs wegen zu Ohren kamen. Christine versuchte, ihr Alter zu schätzen. Die Wirtin sah etwas verlebt aus, mit einigen tiefen Linien um Mund und Augen herum. Das Gesicht einer langjährigen Barfrau, die ständig zu wenig Schlaf bekam und auch sicher keine Befürworterin des Rauchverbots war. Ihre langen Haare waren auffällig rot gefärbt und fielen ihr tief in die Stirn. Sie trug eine ziemlich offenherzige Bluse, schwarz, halb transparent, mit einem spitzenbesetzten BH darunter, der am Dekolleté hervorblitzte. Um ihren Hals lag eine dünne Goldkette mit einem schlichten Kreuz.
Als plötzlich ein neuer Gast eintrat, registrierte Christine verblüfft, dass Manus Begeisterung bei der Begrüßung tatsächlich noch steigerungsfähig war.
«Servus, Klaus, wie schön!», kreischte sie beinahe, flog um die Theke herum und küsste den Mann auf beide Wangen. Dann bat sie die beiden Touristen, ein Stück in Richtung Christine und Holzhammer aufzurücken, um dem Neuankömmling einen Ehrenplatz in ihrer Nähe frei zu machen.
«Mein Chef», raunte Holzhammer Christine zu und seufzte. Christine registrierte, dass der Neue schlanker war als die meisten hier und unauffällig elegant gekleidet. Der dunkelgrüne Kaschmir-Rolli unter dem anthrazitfarbenen Tweed-Sakko passte perfekt zu seinen grüngrauen Augen, und es war offensichtlich, dass das kein Zufall war.
Als der Leiter der Polizeidienststelle, Dr. Klaus Fischer, es sich auf dem Barhocker bequem gemacht hatte, stand vor ihm auf der Theke bereits ein Glas Whisky-Soda. Er nahm einen kräftigen Schluck und stellte das Glas deutlich hörbar wieder ab. Fischer war nicht ganz freiwillig in dieser schönen Gegend gelandet – er befand sich sozusagen im Berchtesgadener Exil. Denn sein Ehrgeiz hatte ihn seinerzeit in München dazu verführt, sich etwas zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Als Einser-Jurist war er mit der Vorstellung in den höheren Polizeidienst gegangen, einmal mindestens Polizeipräsident zu werden. Um diesem Ziel näherzukommen, hatte er versucht, sich in einem medienwirksamen Fall durch besonders energisches Auftreten zu profilieren. Leider hatte er dabei die ein oder andere Kleinigkeit übersehen. Er hatte kalkuliert, dass ein entschiedenes Vorgehen gegen die als «Bayerische Art» bekannt gewordene Arbeitsweise der Münchner Polizei und für ein rechtsstaatlicheres Verhalten dieses Organs ihm breite Bekanntheit und Zustimmung in den Medien und damit bei der Bevölkerung einbringen würde. Deshalb hatte er einen Polizeibeamten, der am Hauptbahnhof einen angetrunkenen Bankkaufmann verprügelt hatte, ohne großes Federlesen, dafür aber mit viel Tamtam, aus dem Dienst entfernen lassen. Doch anstatt sein Eintreten für den Rechtsstaat zu loben, hatten die Medien Interviews mit der Ehefrau des Polizisten gebracht und Fischers Herzlosigkeit angeprangert. Auch tauchten bald Zeugen auf, die gesehen haben wollten, dass der Banker zuerst zuschlug. Doch das Genick gebrochen hatte ihm letztlich ein weiterer Umstand, den er leider übersehen hatte: Die siebzehnjährige Tochter des Polizeibeamten sah nicht nur sehr gut aus – sie schlief auch mit dem jüngsten Sohn eines maßgeblichen Referenten des bayerischen Innenministers. Das Ende vom Lied war gewesen, dass der Innenminister Fischer unter vier Augen nahegelegt hatte, sich auf diesen völlig abwegigen Posten hier in Berchtesgaden zu bewerben. Widerstandslos hatte Fischer das getan – er hatte keine Wahl gehabt.
Deshalb leitete Kriminaloberrat Dr. Klaus Fischer jetzt seit drei Jahren die hiesige Polizeiinspektion und wartete ständig auf seine Chance, irgendwie auf die Münchner Bühne zurückzukehren. Berchtesgaden war ein Abstellgleis. Außerdem war er ein Großstadtmensch und kam sich inmitten der Berge eingesperrt vor. Er war kurz vor dem Alpenkoller. Ein weiterer, nicht unerheblicher Gesichtspunkt: Hier gab es keinerlei Möglichkeiten, gelegentlich inkognito über die Stränge zu schlagen. Jeder kannte jeden, und alles wurde peinlich genau registriert. Mit wem er redete oder nicht, ob er sein Auto ein- oder zweimal im Monat wusch oder ob er vielleicht dann und wann mal nach Salzburg ins Bordell ging. Und wenn er abends ins Nachtcafé ging, dann traf er dort auch noch seine Belegschaft. So wie heute. Aber irgendwann musste man ja mal raus.
Besonders schlimm am Landleben fand Fischer, dass hier nicht nur jeder jeden kannte, sondern auch jeder über jeden alles wusste. Sogar er wusste inzwischen zum Beispiel, dass der Hauptwachtmeister in spätestens zehn Minuten zahlen und heimgehen würde, weil er sonst seine Frau nicht mehr wach anträfe, die einen anstrengenden Job im örtlichen Supermarkt hatte. Genau aus diesem Grund kam Fischer sonst meistens noch eine halbe Stunde später als heute.
Fischer grüßte kurz zu seinem Untergebenen hinüber, und der grüßte zurück. Bei der Gelegenheit bemerkte Fischer, dass Holzhammer neben einer ausgesprochen attraktiven, ihm bislang unbekannten Frau saß. Und wie er vorausgesehen hatte, rief Holzhammer kurz darauf die Barfrau zum Bezahlen.
Als Holzhammer das Geld auf den Tresen legte, blickte Christine von ihrem Glas auf. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie noch immer nicht wusste, wo sie heute Nacht eigentlich schlafen sollte. Also nutzte sie die Gelegenheit und erkundigte sich bei Manu nach einer halbwegs günstigen und ordentlichen Pension.
«Gar nicht so einfach, jetzt in der Hauptsaison», sagte Manu. «Aber ich weiß zufällig, dass im Alpenglück heute ein Gast kurzfristig abgesagt hat. Die Pension ist ganz in der Nähe. Ich ruf gerne dort an, um das Zimmer zu reservieren.»
Als das geklärt und Holzhammer gegangen war, bestellte Christine noch einen Rotwein und begann zu grübeln. Wie hatte ihr das passieren können? Sie, die selbst Therapien durchführte, die alles über Beziehungen und Kommunikation wusste, über kognitive Dissonanzen promoviert und ihre Ratschläge zu Eheproblemen immer verteilt hatte wie Bonbons – sie stand jetzt vor den Scherben ihrer Ehe. Unversehens rollte ihr eine Träne über die Wange.
Da wurde ihr plötzlich von der linken Seite ein Tempotaschentuch zugeschoben. Halb erschrocken, halb dankbar blickte sie auf. Und da saß er auch schon neben ihr, der Mann, den Manu von allen Gästen am enthusiastischsten begrüßt hatte.
«Hallo, ich bin Klaus», sagte er, erholsamerweise in reinstem Hochdeutsch.
«Christine.»
«Darauf trinken wir», antwortete Fischer. Und er zeigte sich schnell als charmanter Gesprächspartner. Er brachte Christine zum Lachen und flocht in seine Anekdoten ständig kleine Komplimente ein. Seine Tätigkeit als örtlicher Polizeichef stellte er als spannende und verantwortungsvolle Aufgabe dar, bei der es vor allem darum ging, den anarchischen Umtrieben des Bergvolks Einhalt zu gebieten. Er erzählte von dem Einheimischen, der seit zehn Jahren ohne Führerschein Auto fuhr, und von dem Toten, der seit vierzig Jahren in seinem VW Käfer auf dem Grund des Königssees saß. Der Mann hatte angeblich in betrunkenem Zustand versucht, über den zugefrorenen See nach St. Bartholomä zu fahren und war auf halbem Wege eingebrochen. Als Taucher nach Jahren den Wagen entdeckten, war der Fahrer durch das kalte Wasser kaum verwest und hielt das Steuer, als wollte er immer noch weiterfahren. Man hatte die Ehefrau gefragt, ob man den Wagen inklusive Leiche bergen solle. Aber die hatte geantwortet, das sei ihr zu teuer. Und überhaupt: Was solle sie mit einer Leiche und einem völlig verrosteten Auto.