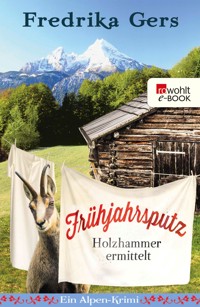9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Holzhammer ermittelt
- Sprache: Deutsch
Beim Berchtesgadener Weihnachtsschießen wird einer der Schützen tödlich getroffen. Wie kann das sein, wo die traditionellen Vorderlader doch gar keine Kugeln abfeuern? Leider hatte das Opfer, ein Orthopäde, so viele Feinde, dass Hauptwachtmeister Holzhammer gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Ungewohnt eifrig stürzt er sich in die Arbeit, denn er hat ein schlechtes Gewissen: Das Opfer hatte sich in den letzten Wochen verfolgt gefühlt – und Holzhammer den Mann nur belächelt. Nur gut, dass seine norddeutsche Lieblingsärztin Christine ihm bei der Aufklärung wieder rückhaltlos zur Seite steht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Fredrika Gers
Gut getroffen
Holzhammer ermittelt
Ein Alpen-Krimi
Über dieses Buch
Beim Berchtesgadener Weihnachtsschießen wird einer der Schützen tödlich getroffen. Wie kann das sein, wo die traditionellen Vorderlader doch gar keine Kugeln abfeuern? Leider hatte das Opfer, ein Orthopäde, so viele Feinde, dass Hauptwachtmeister Holzhammer gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Ungewohnt eifrig stürzt er sich in die Arbeit, denn er hat ein schlechtes Gewissen: Das Opfer hatte sich in den letzten Wochen verfolgt gefühlt – und Holzhammer den Mann nur belächelt. Nur gut, dass seine norddeutsche Lieblingsärztin Christine ihm bei der Aufklärung wieder rückhaltlos zur Seite steht!
«Fazit: Kann Kluftinger absolut das Wasser reichen.» (Bayern 3)
«Gers’ launiger Alpenkrimi liefert ein liebevoll ironisches Porträt der Region.» (Hörzu)
«Ein lustiger Krimi mit viel alpinem Lokalkolorit, spannend dazu.» (NDR 90,3)
«Der lockere und angenehm lesbare Schreibstil lässt den Leser in der Welt der Berchtesgadener rund um Franz Holzhammer und Psychologin Christine versinken und mitfiebern.» (Buch-Magazin)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
Coverabbildung by-studio-Fotolia.com; mauritius images/Peter Lehner; mauritius images/Alamy; Pitamaha/shutterstock.com
ISBN 978-3-644-52261-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Hinweis
Prolog
24. Dezember, 14 . 57 Uhr.
Eigentlich fing alles schon am 5. an
Der 5. wurde erst später wild
Am 6. kam nicht nur der Nikolaus
Am 7. hagelte es Anzeigen
Am 16. gab’s nicht nur Glühwein
Am 24. greift jetzt Holzhammer ein
Am 25. rotiert Holzhammer schon morgens
Der Vormittag legt ein Nordlicht lahm
Der Abend spült Verwandtschaft rein
Der Rest entgleist komplett
Der 26. beginnt zäh
Zu Mittag gibt’s lila Tunke im Schnee
Der 27. beginnt mit einer Blamage
Später kriegt Christine eine Massage
Am Abend werden Märchen erzählt
Am 28. gibt’s tierisch Stress
Am 29. wird’s langsam eng
Am 30. wird einer frech
Nachmittags gibt’s was im Fernsehen
Silvester knallt’s
An Neujahr kommt die Müllabfuhr
Postskriptum
Bei den vorigen Bänden brauchte es den Hinweis nicht, aber diesmal möchte ich es doch betonen: Die Handlung ist frei erfunden. Insbesondere hat das Mordopfer kein reales Vorbild bei uns im Talkessel, denn von den hiesigen Orthopäden lässt sich nur das Beste sagen.
Prolog
24. Dezember, 14 . 57 Uhr.
Einhundertsechsundzwanzig Männer mit altertümlichen Handfeuerwaffen standen in einer auseinandergezogenen Kette auf dem flachen, langgestreckten Hügel namens Bodnerbi. Sie trugen lange Lederhosen, blaugraue Joppen und auf dem Kopf entweder den schmalen Schützenhut ohne Krempe oder die bequemere und wärmere Zipfelhaube. Ganz links, in der Nähe des Glühweinstands, hatte der Kanonier Aufstellung genommen.
Hinter den Schützen erhob sich majestätisch der Jenner über Berchtesgaden. Die Seilbahnstützen zogen sich als beleuchtetes Band von der Talstation bis zum Gipfel. Diese Beleuchtung sollte Romantik verbreiten, und das klappte gut. Auch Christine sah abends gern vom Wohnzimmerfenster zu den Lichtern hinüber. Schon Wochen zuvor hatten die neu angeschafften Schneekanonen auf Vorrat weiße Pracht produziert. Und vor einer Woche waren nun endlich die Skipisten eröffnet worden.
Das Christkindlanschießen hingegen war ein uralter Brauch und wurde heute noch so ausgeübt wie vor hundert Jahren. Mit dem Anschießen war nicht gemeint, dass man das Christkind vom Himmel holen wollte. Der Lärm sollte ihm nur den Weg nach Berchtesgaden zeigen. Christine fand das nicht ganz logisch, denn auf der anderen Seite hieß es im Weihnachtslied ja: «Still, still, weil’s Kindlein schlafen will.» Und dann kamen die Berchtesgadener und feuerten überall im Talkessel ihre alten Vorderlader ab. Die unförmigen Waffen hießen Böller, was darauf hinwies, dass ihr einziger Zweck darin bestand, Krach zu machen. Da schlief garantiert kein Kind mehr. Und auch keine Gams, kein Steinbock, kein Adler und kein Schneehuhn. Nur die Murmeltiere, tief in ihren Höhlen, deren Eingänge sie sicherheitshalber mit Lehm verstopft hatten, konnten in diesen Tagen durchschlafen. Christine fand diese jährliche Lärmbelästigung für die Tierwelt keineswegs bedenklich. Die Viecher erlebten das seit Hunderten von Jahren: Es musste zu den Dingen gehören, die die Jungen von den Alten lernten. Sie stellte sich vor, wie die älteren Gämsen ihre Kitze aufklärten: «Das machen die Menschen jedes Jahr um diese Zeit. Keine Sorge, es gilt nicht uns. Friss weiter.»
Die Sonne war bereits hinter dem Watzmann im Rücken der Zuschauer verschwunden. Sie bildeten vor dem Absperrband eine Kette, die genauso lang war wie die der Schützen, jedoch viel dichter. Traut vereint standen Einheimische und Feriengäste am Fuße des flachen Hügels den Schützen gegenüber. Obwohl nicht scharf geschossen wurde, empfahl es sich, einen gewissen Abstand einzuhalten. Zwar war es seit einigen Jahren verboten, aber noch immer noch klopften viele nach dem Einfüllen des Schwarzpulvers einen grob zugeschnitzten Holzpfropf vorn in den Lauf ihres Böllers. Denn das ergab einen schöneren Wumms.
Christine und Matthias standen fast in der Mitte der Kette. Sie fröstelten etwas, denn der Schnee unter den Füßen der vielen Menschen verwandelte sich zunehmend in Matsch und drang in ihre Schuhe. Auf dem Hinweg hatte Matthias ihr gerade erzählt, wie er früher zusammen mit seinem Vater selbst geschossen hatte. Sie hatten immer an der gleichen Stelle gestanden, gleich vor dem kleinen Gebüsch. Gar nicht einfach sei es gewesen, rechtzeitig mit dem Nachladen fertig zu sein. Vor allem, wenn es sehr kalt war, wollten die klammen Finger nicht so recht. Inzwischen schoss Matthias nicht mehr, immerhin war er jetzt Buddhist. Trotzdem hing die Urkunde für seine zwanzigjährige Mitgliedschaft bei den Schönauer Weihnachtsschützen immer noch in der Küche über der Eckbank.
Christine versuchte, die Schützen zu zählen. Sie wusste, dass viele Zuschauer das machten. Das galt besonders für die Einheimischen, die stolz waren, dass immer noch so viele der Ihren diese Tradition fortleben ließen. Und ein bisschen fühlte sie sich ja auch schon als Einheimische. Beim ersten Zählen kam sie auf einhundertvierundzwanzig, beim zweiten auf einhundertsiebenundzwanzig.
Der Schützenmeister stand knapp hinter der langen Reihe. Schon drang sein erstes Kommando zu den Zuschauern herüber: «Mach ma a Salve! Schützen – auf – Feuer!»
Einhundertsechsundzwanzig Vorderlader wurden senkrecht in die Luft gereckt und abgefeuert. Einer hatte allerdings Ladehemmung. Der Rauch vom Schwarzpulver mischte sich mit dem feuchten Nebel, der über der Wiese stand. Mehrfach rollte das Echo zwischen Hohem Göll, Untersberg und Watzmann hin und her. Auch aus den Nachbargemeinden hörte man das Schießen.
Die Schützen luden gleich nach. Man hörte allgemeines Klopfen, denn das Schwarzpulver musste im Lauf komprimiert werden. Die meisten hatten ihre Utensilien – Schwarzpulver, Zündhütchen, Hammer, Ladestock, Flachmann – in einem stilechten altmodischen Leinenrucksack dabei.
Der Schützenmeister sprach jetzt etwas leiser mit den Schützen. Christine konnte nichts verstehen, aber Matthias kannte die Sprüche: «Der wird jetzt fragen ‹seid’s fertig?›. Und wenn welche ‹nein› sagen, dann kommt ‹macht’s zua, mir san hier ned in da Kirch›.»
Christine grinste. Beten und spotten ging gut zusammen in Berchtesgaden.
Dann ertönte wieder ein lautes Kommando: «Dea ma ummi schiaß’n – erster ofanga.»
Christine freute sich über die unmilitärische Art und Weise, in der die Befehle gegeben wurden. Beim «ummi schiaß’n» wurden die Waffen einzeln abgefeuert. Erst wenn das Echo des vorigen Schusses zurückkam, zog der Nächste den Abzug durch. Der Schütze ganz rechts begann, und den Schlusspunkt setzte die Kanone beim Glühweinstand.
«Danach ist bestimmt Schnellfeuer dran», sagte Matthias zu Christine. Einen gewissen Heimatstolz konnte er dabei nicht verbergen. Beim Schnellfeuer schossen die Schützen einzeln wie beim «ummi schiaß’n», aber blitzschnell hintereinander. Schnellfeuer gab es zwar auch bei den anderen Weihnachtsschützenvereinen im Talkessel, aber nur die Schönauer waren in der Lage, gleich mehrere Runden nonstop zu absolvieren. Das funktionierte nämlich nur bei über hundert Schützen, sonst reichte die Zeit nicht zum Nachladen. Und selbst in der Schönau kam es vor, dass ein Schütze nicht ganz fertig wurde. Dann gab er seinem Nebenmann einen Wink, gleich weiterzumachen.
Matthias hatte recht gehabt. Die dumpfen Böllerschüsse ertönten jetzt unmittelbar hintereinander, sodass die Echos sich zu einem anschwellenden Donnern mischten, welches das ganze Tal erfüllte und sicher hinauf bis ins Steinerne Meer und weiter bis nach Bischofswiesen zu hören war. Der Qualm wurde dichter, schweflige Rauchschwaden zogen über die Zuschauer hinweg. Die meisten Schützen waren nur noch schemenhaft zu erkennen, die entfernteren sah man gar nicht mehr. Nur die Mündungsfeuer leuchteten gelbrot über den Köpfen auf. Sobald die Kanone gefeuert hatte, fing der erste Schütze ganz rechts wieder an.
Die dritte Runde war gerade bis zur Mitte gekommen, als es geschah: Genau während seines Schusses, die Waffe in der erhobenen Hand, fiel plötzlich ein Schütze vornüber in den Schnee.
Das Schießen hörte auf. In der Schützenreihe war plötzlich eine Lücke. Die Nebenmänner stürzten zu ihrem reglos daliegenden Kameraden, knieten sich in den von Schwarzpulver grauen Schnee.
Christine war schon unter dem Absperrband hindurch. «Ruf die Rettung!», rief sie Matthias über die Schulter zu. So schnell es im sulzigen Schnee eben ging, hetzte sie den Hügel hinauf.
«Ich bin Ärztin», stieß sie oben ganz außer Atem hervor. Die Umstehenden machten Platz und gaben den Blick frei.
Ein Weihnachtsschütze lag bewegungslos am Boden, das Gesicht im Schnee. Neben ihm knieten einige Kameraden. Immer mehr von ihnen kamen von beiden Seiten heran. Christine hockte sich neben den Liegenden und fühlte seinen Puls an der Halsschlagader. Nichts. Dann sah sie am linken Schulterblatt das Loch in seiner Joppe. Sie drehte den Mann um und suchte nach Lebenszeichen. Nichts. Erst jetzt erkannte sie ihn und erschrak. Es handelte sich um den Orthopäden Heimito Waberer, im weiteren Sinne also um einen Kollegen. Aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass ihr Lieblingspolizist sich die Schuld daran geben würde.
Eigentlich fing alles schon am 5. an
Hauptwachtmeister Franz Holzhammer stand am Glühweinstand auf dem Weihnachtsschützenplatz, vor sich ein Spezi. Dieses erstaunliche Schauspiel bekam man nur einmal im Jahr zu sehen, und zwar am fünften Dezember. Im schönen Bayern, dessen Ministerpräsident schon mal verkündete, man könne auch nach zwei Maß Bier noch prima Auto fahren, brauchte ein Polizist es normalerweise mit dem Alkohol nicht so genau zu nehmen. Doch die zahllosen Touristen, die sich heute hier drängten, waren nicht gekommen, um einen abstinenten bayerischen Hauptwachtmeister zu sehen. Vielmehr freuten sie sich darauf, von Berchtesgadener Buttnmandln erschreckt, mit Kohle bemalt und mit Haselruten geschlagen zu werden – oder zumindest zu fotografieren, wie anderen dies geschah. Manch einer war extra aus Japan angereist, um die wilden Gesellen zu sehen, die im Berchtesgadener Talkessel den Nikolaus begleiteten.
Für die Touristen dauerte das Spektakel nur zwei Tage, doch im Talkessel beherrschte es seit Monaten das Denken, Tun und Treiben. Buttnmandllaufen war wichtiger als Weihnachten, sogar fast wichtiger als Skifahren. Ein Jugendfreund von Holzhammer hatte sogar seine Hochzeit verschoben, um noch ein letztes Mal mitlaufen zu dürfen.
Obwohl das Treiben überall im Talkessel stattfand, konzentrierten die Zuschauermassen sich grundsätzlich in der Fußgängerzone, also genau dort, wo der Platz sowieso begrenzt war und durch die Stände des Christkindlmarkts noch weiter eingeschränkt wurde.
Heute würde es noch enger werden als morgen, denn am ersten Tag mischten traditionell auch noch die Gebirgsjäger der Bundeswehr mit. Ihre Route war jedes Jahr die gleiche: Sie zogen die Maximilianstraße hinunter, bogen nach links in die Fußgängerzone ein, überquerten den Weihnachtsschützenplatz und schlängelten sich zwischen den Ständen des Christkindlmarkts hindurch bis zum Schlossplatz. Das verlief normalerweise alles recht geordnet; die Jager-Buttnmandl erlaubten sich keine Übergriffe, schließlich waren sie als Aushängeschild der Bundeswehr unterwegs.
Trotzdem stellte dieser Zug eine Herausforderung dar, die Jager schickten nämlich nicht nur Fußtruppen. Die halbe Tragtierkompanie mit ihren Maultieren, Haflingern, Wagen und Kutschen war unterwegs. Da hieß es höllisch aufpassen, damit keine entfesselten auswärtigen Digitalkamerabesitzer unter die Räder kamen. Da brauchte es Überblick, da brauchte es Absperrungen, da brauchte es einen stocknüchternen Hauptwachtmeister Franz Holzhammer.
Im Moment herrschte die Ruhe vor dem Sturm. Alles war vorbereitet und geregelt, Holzhammers Mannen an den strategischen Punkten postiert. Er fand sogar ein paar Minuten Zeit, mit dem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk zu spielen, das er sich selbst gestern gemacht hatte. Neben seinem Diensthandy lag ein nagelneues Smartphone auf dem Stehtisch. Er liebte es schon jetzt. Woher diese Affinität zu modernen Kommunikationsmedien kam, wusste er selbst nicht. Seinem Chef gegenüber suchte er seine Kenntnisse tunlichst zu verbergen, sonst wäre er bald der Computerdepp vom Dienst.
Holzhammer hatte schon länger Internet als die meisten im Talkessel. Auf seinem Laptop spielte er seit Jahren Schach gegen Menschen aus aller Welt. Mit dem neuen Smartphone konnte er das nun endlich auch während langweiliger Dienstbesprechungen tun. Bei dem Gedanken musste sich ein breites Grinsen über sein Gesicht gelegt haben, denn die Norddeutschen vom Nebentisch sahen ihn plötzlich an wie einen entlaufenen Irren.
Das Diensthandy klingelte. Am anderen Ende war kein Polizeiobermeister, sondern Tante Steffi. Eigentlich Großtante, auf jeden Fall aber seine beste Informantin. Sie war über neunzig und hatte nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag aus dem Fenster zu schauen. Weshalb sie auch tatsächlich den ganzen Tag aus dem Fenster schaute. Ihre Wohnung lag direkt an der Maximilianstraße. Den Buttnmandlzug der Jager würde sie also bequem vom eigenen Wohnzimmer aus verfolgen können. Wahrscheinlich hatte sie deshalb auch schon ihre Brille besonders gut geputzt.
«Du, Franz, da unten schleicht einer umanander, ich glaub, der will was aus den Autos stehlen», meldete die alte Dame. Sie war eine der wenigen, die Holzhammer beim Vornamen nannten.
«Hast du’s vielleicht a bissl genauer?»
«Ja, rechts beim Parkplatz. So a Kleiner mit Zipfelhaube, trägt an oiden Parka. Ich glaub, er hat a Werkzeug unter der Jopp’n.»
«Danke, Steffi, vielen Dank. Ich kümmer mich gleich», sagte Holzhammer automatisch.
Aber hatte er wirklich die Zeit, jetzt noch seinen Posten zu verlassen, um einen Automarder zu stellen? Wenn er es tat, dann definitiv nur, um seine Lieblingsinformantin bei Laune zu halten, die garantiert mit dem Fernglas im Anschlag seines Auftritts harrte. Holzhammer sah auf die Uhr. Zum vermeintlichen Tatort waren es nur wenige Fußminuten. Die Jager würden erst in einer halben Stunde den Ortseingang erreichen. Und den Kontakt zu seiner eigenen Truppe konnte er auch im Gehen halten.
Holzhammer stieg von der Bierkiste, die er zwecks besserer Übersicht requiriert hatte, und drängte sich zur Maximilianstraße durch. Dort wandte er sich nach rechts. Zahlreiche Schaulustige strebten ihm entgegen, in Richtung Fußgängerzone, andere hatten sich bereits wie festgenagelt am Straßenrand aufgebaut. Als gäbe es nicht genug Straßenrand für alle zwischen hier und der Kaserne.
Der Parkplatz, an dem Tante Steffis Wohnung lag und den Holzhammer nun erreichte, war voll belegt. Er duckte sich hinter einen sperrigen Geländewagen, wobei er sich allerdings nicht viel kleiner machen musste, als er schon war. Für Polizisten hatten kompakte Abmessungen manchmal eben auch Vorteile.
Hier im Ortskern gab es normalerweise kaum Autoaufbrüche. Dafür war eher der Großparkplatz am Königssee prädestiniert, wo die Autos der Skifahrer und Seebesucher den ganzen Tag unbeaufsichtigt standen. Niemand achtete dort auf potenzielle Automarder. Die Feriengäste hatten genug damit zu tun, zum Jennergipfel hinaufzublicken, sich über die Parkgebühren zu ärgern oder das Klo zu suchen. Nur heute standen mehr Autos im Markt als am Königssee. Gut möglich, dass sich jemand den ganzen Trubel zunutze machen wollte.
Der Hauptwachtmeister spähte an dem absurden Kuhfänger seiner Deckung vorbei. Tatsächlich. Am anderen Ende des Parkplatzes trieb sich einer herum, der mit Sicherheit nicht sein eigenes Auto suchte. Holzhammer erkannte Nepomuk Maus. Der arme Schlucker besaß nicht einmal einen Führerschein. Trotzdem war er früher häufig mit dem Fahrzeug seiner Schwester unterwegs gewesen. Holzhammer hatte ihn einmal angehalten und eigenhändig heimchauffiert. Der bisherige Höhepunkt von Nepomuks krimineller Karriere war ein Banküberfall gewesen. Er war unmaskiert in die Berchtesgadener Sparkasse marschiert, hatte eine Wasserpistole hochgehalten und zur Kassiererin gesagt: «Dies ist ein Überfall.»
«Servus, Nepomuk», hatte die Kassiererin geantwortet und ihm ein paar Scheine gegeben, wie es die Richtlinien vorsahen. Um sich und anwesende Kunden nicht zu gefährden, sollte man auch vermeintlich harmlose Räuber auf keinen Fall provozieren.
Das Geld in der Hand, war der Möchtegern-Räuber zu Fuß heimgegangen, wo Holzhammer schon gewartet hatte. Für diese Art Verbrecher empfand er eher Mitleid, und so hatte er die Sache im Protokoll möglichst heruntergespielt. Auch die Kassiererin, die mit Nepomuks Schwester zur Schule gegangen war, hatte ausgesagt, dass sie das Ganze von vornherein als Scherz aufgefasst habe, schließlich sei Fasching gewesen. So hatte der verhinderte Bankräuber lediglich eine Strafe wegen groben Unfugs bekommen.
Nun musste Holzhammer also verhindern, dass Nepomuk eine Karriere als Autoknacker startete, bei der außer Sachbeschädigung sowieso nicht viel herauskommen würde. Autoknacker war ein qualifizierter Beruf – und wahrscheinlich anspruchsvoller als Bankräuber.
Als Nepomuk ihm den Rücken zuwandte, um durch die Heckscheibe eines nagelneuen Mercedes zu spähen, sah Holzhammer den Zeitpunkt zum Einschreiten gekommen. So leise wie möglich – also nicht besonders leise – ging er von hinten auf den schmächtigen Mann im abgewetzten Parka zu. Der war so vertieft in die Verheißungen des Wageninneren, dass er nichts merkte, bis Holzhammer ihm die Hand auf die Schulter legte.
«Servus, Nepomuk, was machen wir denn da?», fragte Holzhammer freundlich.
Der Ertappte drehte sich so ruckartig um, dass ihm drei Holzbeitel aus der Tasche fielen.
«Damit wolltest du Autos knacken?», sagte Holzhammer. «Das hätt eh nicht funktioniert, glaub mir’s.»
Nepomuk bückte sich schweigend nach seinem Werkzeug und sammelte es ein.
Holzhammer fuhr in seinem Grundkurs für Autoknacker fort: «Die Autos heutzutage san narrisch kompliziert, weißt du. Und der Mercedes da – weißt du nicht, dass so einer eine Alarmanlage hat? Wenn die losgeht, wackelt der Watzmann.»
«Ich wollt bloß schaun», verteidigte sich der unterqualifizierte Automarder.
«Ins Auto fremder Leut? Mit a halben Schnitzwerkstatt in der Joppn?»
Darauf wusste Nepomuk nichts zu sagen.
«Ich sag dir was: Du gehst jetzt direkt heim zu deiner Schwester. In a halben Stund ruf ich an. Wenn du dann ned dort bist, schreib ich dich zur Fahndung aus. Verstanden? Und jetzt schau, dass d’ weiterkimmst.»
Der Ertappte nickte brav.
Christine kam gerade von ihrem letzten Termin für heute, einer Gruppensitzung mit älteren Reha-Patienten. Sie war zufrieden. Ihre Botschaft, dass der Erfolg der Reha ganz entscheidend von der Mitarbeit der Rekonvaleszenten abhing, war angekommen. Es machte einen Riesenunterschied, ob ältere Damen nach der Hüftoperation die Bewegungsangebote der Klinik konsequent nutzten oder sich nur gemütlich massieren ließen.
Als Leiterin der psychosomatischen Abteilung half sie den Patienten, das Beste aus der Reha zu machen oder auch bleibende Einschränkungen besser zu verarbeiten. Außerdem gab es Fälle, in denen die physische Rehabilitation nur als Feigenblatt für die Behandlung von Burn-out oder Depressionen diente. Für diese Patienten war sie natürlich die Hauptansprechpartnerin.
Gut gelaunt betrat Christine ihr protziges Büro im Erdgeschoss der Reha-Klinik. Sie selbst legte keinen Wert auf das Designersofa und den riesigen Mahagonischreibtisch, aber so stellte der hauseigene Innenarchitekt sich nun einmal das Wohlfühlambiente für Privatpatienten aus den Ölstaaten vor, und zehn von denen wogen zweihundert deutsche Kassenpatienten auf. Wenigstens hatte sie verhindern können, dass die Wände mit ihren sämtlichen Facharzt- und Promotionsurkunden bepflastert wurden. Wer brauchte schon zu wissen, dass sie ursprünglich Gynäkologin gewesen war – die eines Tages kein Blut mehr hatte sehen können. Erst danach hatte sie die Ausbildungen zur Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin und für Rehabilitationsmedizin absolviert.
Zum Glück hatte das ästhetische Feingefühl des Innenarchitekten irgendwo zwischen Aktenschüben und Originalkunst auch ein Waschbecken mit Spiegel erlaubt. Dort versuchte sie nun, sich ein bisschen zurechtzumachen. Doch ihre Haare waren störrisch wie eh und je – wie ihre Trägerin, behaupteten manche.
Seit fünf Jahren arbeitete Christine nun schon hier, aber erst vor zwei Jahren – nachdem ihr Mann sie verlassen hatte – war sie in den Berchtesgadener Talkessel gezogen. Kurz darauf hatte sie Matthias kennengelernt, der in wenigen Minuten auftauchen würde, um sie abzuholen.
Christine wollte dieses Jahr unbedingt den Buttnmandlzug der Gebirgsjäger sehen. Letztes Jahr hatte sie ihn wegen einer Fortbildung verpasst. Dass Matthias weniger erpicht auf das Spektakel war, hatte er bereits deutlich zum Ausdruck gebracht. Trotzdem klopfte es jetzt an der Tür, pünktlich auf die Minute.
«Prima, wir können los», sagte Christine, als Matthias ins Zimmer trat.
Dieser griff sich ihren Mantel, um ihr hineinzuhelfen. Revoluzzer und Kavalier, heimatverwurzelt, aber ohne Sinn für die heimatlichen Bräuche, das waren nur einige der Widersprüche im Wesen ihres bayerischen Buddhisten. In einer durch und durch katholischen Umgebung hatte er eines Tages die Kreuze abgehängt und stattdessen den Schrein mit der altindischen Schriftrolle aufgestellt.
«Ich war dieses Jahr noch kein einziges Mal auf dem Weihnachtsmarkt», sagte Christine auf dem Weg zum Auto. Zack – schon wieder war es ihr herausgerutscht. Sie wusste, was jetzt kam.
«Christkindlmarkt», sagte Matthias.
«Sorry, ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Immerhin heißt Weihnachten doch auch hier Weihnachten.»
«Schon, aber der Weihnachtsmann und seine Rentiere haben Lokalverbot. Das steht sogar in den Richtlinien für die Standbetreiber. Hier gibt es nur Christkindl und Engerl.»
Das war typisch Matthias. Einerseits gab er vor, nichts an den Traditionen zu finden, andererseits kannte er sich bestens aus. Bei ihr war es genau umgekehrt. Sie hatte keine Ahnung und wollte gern alles über die lokalen Bräuche erfahren. Und wenn sogar Matthias nicht genug darüber zu erzählen wusste, fragte sie Holzhammer. Oder ihren Friseur. Kein Witz, denn der hatte das dicke Buch über die Buttnmandl geschrieben, das unter Einheimischen als beliebtes Weihnachtsgeschenk galt.
Sie parkten unten am Bahnhof und nahmen den Fußweg hinauf zur Maximilianstraße. Oben angekommen, stieg Christine ein Hauch von Weihnachten in die Nase. Zu beiden Seiten der Straße standen bereits zahlreiche Zuschauer.
«Sollen wir nicht gleich hierbleiben?», fragte sie.
«Lass uns weitergehen, die Jager werden es auch dieses Jahr schaffen, bis zum Schlossplatz vorzurücken», sagte Matthias.
Christine kannte ihn gut genug, um zu übersetzen: Lass uns weitergehen bis zum Christkindlmarkt, wo es Glühwein und Bosna gibt. «Na gut.»
Der Weihnachtsduft wurde intensiver. Christine konnte jetzt Noten von Zimt, Weihrauch und Würsteln unterscheiden. Sie erreichten die Fußgängerzone, deren Eingang während der Weihnachtszeit mit einem überdimensionalen hölzernen Torbogen markiert war. Der Durchgang musste so hoch sein, weil sonst die Wagen nicht hindurchgepasst hätten.
Zielsicher steuerte Matthias auf den großen Glühweinstand am Weihnachtsschützenplatz zu, Christine folgte ihm in seinem Kielwasser. Normalerweise hatte sie kein Problem damit, sich selbst durchzuboxen, aber Matthias hatte mit seinen 1,94 Metern einfach den besseren Überblick und folglich weniger Mühe, Franz Holzhammer im Gewühl zu erspähen. Der Hauptwachtmeister hatte ihnen verraten, dass er hier irgendwo sein Hauptquartier aufschlagen würde. Ob er neben Fremden oder neben Freunden stand, mache für die Pflichterfüllung keinen Unterschied, deshalb könnten sie genauso gut dazustoßen. Als Matthias genau vor dem Hauptwachtmeister anhielt, war Christine trotzdem erstaunt. Normalerweise überragte Matthias den Polizisten um zwei Köpfe, doch heute standen sie auf Augenhöhe. Ein Blick nach unten klärte die Sachlage: Christine entdeckte die Bierkiste, die dem Ordnungshüter einen besseren Überblick verschaffte. Und um einen noch besseren Überblick zu haben, hatte er ausnahmsweise kein Weißbier, sondern ein Spezi vor sich stehen.
«Servus, grüß euch!», freute sich Holzhammer. «Braucht’s ihr Haferl?»
Christine kannte den Hintergrund dieser Frage. Die Glühweinbecher wurden nicht zurückgenommen, man musste sie jedes Mal kaufen, sofern man noch keinen Becher hatte. Mit dieser Regelung sparten die Standbetreiber sich den Abwasch. Für die vielen Gäste, die nur an einem Tag den Markt besuchten, war das völlig in Ordnung, zumal die Becher nur einen Euro kosteten. Sie wollten das bunte Haferl sowieso als Erinnerung mitnehmen. Den Einheimischen jedoch, die öfter vorbeischauten, war die Regelung ein Dorn im Auge. Man wollte schließlich nicht die gesamte Wohnküche mit Berchtesgadener-Advent-Glühweinhaferln füllen. Ebenso wenig wollte man während der gesamten Adventszeit ständig ein Haferl bei sich tragen, nur für den Fall, dass einen die Lust auf Glühwein überkam.
Aber natürlich war schnell eine echt Berchtesgadener Lösung gefunden worden. Die meisten Standbetreiber, ob sie nun Selbstgestricktes, Holzspielzeug oder Maroni verkauften, hielten inzwischen unter dem Ladentisch strategische Haferlreserven für Freunde und Familie bereit.
Da Christine noch keinen Becher der diesjährigen Edition ihr Eigen nannte, verzichtete sie auf das Angebot, eine der Holzhammer’schen Haferlquellen anzuzapfen. Das Sammeln von Weihnachtsmarktbechern war eine Macke, die auf den ersten Blick gar nicht zu ihrer sonst so vernunftbetonten Art passte. Aber das tat ihre Gewohnheit, auf einsamen Bergtouren mit den Tieren zu reden, auch nicht. Matthias hingegen legte keinen Wert auf eine doppelte Haferlsammlung und lieh sich eins bei Holzhammers Tante Hildegard, die schräg gegenüber einen Stand mit selbstgestrickten Trachtensocken betrieb.
Holzhammers Handy klingelte. «Ist gut», sagte er hinein und steckte es in die Tasche. «Mir müssen jetzt absperren, die Jager san gleich da», erklärte er den beiden und stieg von der Bierkiste.
«Oh, dann lauf ich jetzt vor zur Straße», verkündete Christine.
«Nur zu, ich halte hier die Stellung», sagte Matthias.
Der 5. wurde erst später wild
Holzhammer ging zu seinen jungen Kollegen, die versuchten, mit Hilfe von Absperrbändern einen Weg durch die Menschenmenge freizumachen. Er seufzte. Jedes Jahr das Gleiche, die Schaulustigen ließen sich nur widerwillig zur Seite drängen. Dabei hätte man sich nur wenige Meter entfernt, draußen an der Straße, immer noch ganz entspannt einen guten Platz suchen können – so wie Christine es vermutlich gemacht hatte. Richtig eng war es nur hier in der Fußgängerzone, zwischen den Ständen des Christkindlmarkts. Aber so waren die Leute. Wenn sich an einer Stelle dichte Trauben bildeten, glaubten alle, dort sei es am schönsten. Unter gewissem Körpereinsatz und dank Holzhammers kugelförmiger Autorität schafften sie es trotzdem, rechtzeitig einen kutschenbreiten Korridor freizumachen.
In der ersten mit Haflingern bespannten Karosse fuhr der ehrwürdige Nikolaus, außerdem diverse Kinder und Erwachsene in Zivil – vermutlich Bekannte und Verwandte des Standortkommandanten. Anschließend kam eine Kutsche mit Soldaten in Ausgehuniform. Eine Verbindung zu irgendwelchem Brauchtum war nicht festzustellen, aber im Grunde war die Tragtierkompanie an sich ja schon Brauchtum. Keins dieser Tragtiere würde jemals in einen Kampf ziehen, das wusste Holzhammer aus erster Hand, denn der Standortkommandant war einer seiner Schachpartner. Die Maultiere und Haflinger fungierten hauptberuflich als Sympathieträger, nebenberuflich transportierten sie Bier zu einigen abgelegenen Almen.
Ein Schwarm kleiner Engel ritt vorbei. Sie wurden von Jagern und Jagerinnen in Ausgehuniform am Zügel geführt. Wieder einmal registrierte Holzhammer mit Wohlgefallen, wie gut die traditionellen Keilhosen den Soldatinnen standen. Auch die taillenkurzen Jacken waren kleidsam. Sie betonten den Busen und saßen bei einigen Rekrutinnen ganz schön stramm. Dabei hatten die Erfinder garantiert nicht damit gerechnet, dass ihre Kreation einmal weibliche Formen betonen würde. Rund um Holzhammer klickten die Digitalkameras.
Mitten im größten Getümmel wurde er plötzlich von hinten an der Schulter gepackt. Unwirsch drehte er sich um – und stand vor Heimito Waberer, einem der wenigen Menschen im Talkessel, die er lieber gehen als kommen sah.
Gestikulierend wie ein Sitcom-Schauspieler, stieß Waberer hervor: «Ich werde angegriffen, ich brauche sofort Polizeischutz.»
Holzhammer spähte demonstrativ an ihm vorbei. «I siag neamds.»
Der vierschrötige Orthopäde war allgemein als Quertreiber bekannt. Alle naslang zeigte er aus nichtigen Gründen jemanden an. Aber dass er direkt halluzinierte, war neu.
«Ein Buttnmandl hat mich niedergeschlagen. Gerade eben. Von hinten, aus heiterem Himmel. Dann ist es in der Menge verschwunden. Aber bestimmt versucht er es wieder.»
Holzhammer fand es lächerlich, dass Waberer so angestrengt Hochdeutsch sprach. Er stammte zwar nicht aus dem Talkessel, aber immerhin ebenfalls aus Oberbayern. Und das mit dem Angriff glaubte er nicht. Sicher hatte der bloß irgendwo im Weg herumgestanden und war ganz versehentlich angerempelt worden. Die Buttnmandl konnten in ihren Verkleidungen schlecht sehen, da konnte es leicht passieren, dass man mit den Hörnern oder Glocken an einem sperrigen Nervbolzen hängen blieb. Selbst wenn er es gewollt hätte, hätte Holzhammer jetzt nichts für ihn tun können. Er stand hier mitten im Großereignis des Jahres und versuchte, ein paar tausend Menschen zu bändigen. Merkte der depperte Boandlschrauber das nicht? Nein, der redete immer weiter. Um ihn endlich loszuwerden, sagte Holzhammer schließlich: «Kimm halt morgen auf d’ Polizei, dann mach ma a Protokoll.»
Verärgert vor sich hin schimpfend, wurde Waberer von der Menschenmenge verschluckt.
Weitere Wagen zogen vorbei, begleitet von Buttnmandln in Fell und Stroh. Ganz am Schluss ging ein einsamer Scharfschütze im typischen Tarnlook. Er sah aus, als wäre ein Stück Unterholz aus dem Wald aufgestanden und hätte sich dem Zug angeschlossen.
Mit halbvoller Speicherkarte fand Christine sich wieder am Glühweinstand bei Matthias ein. «Hey, das war klasse.»
«Sollte es auch sein», sagte Matthias. «Schließlich wird der Struber Standortkommandant hauptsächlich daran gemessen, ob er einen gescheiten Buttnmandlzug auf die Beine bringt.»
Das war wieder eine dieser trockenen Bemerkungen, bei denen Christine sich über den Wahrheitsgehalt nicht ganz im Klaren war.
Auch Holzhammer tauchte wieder auf und bestieg aufs Neue seine Feldherren-Bierkiste.
«So a Depp», sagte er kopfschüttelnd zu niemand Bestimmtem.
«Wer denn?», fragte Christine.
Holzhammer erzählte knapp von seiner Begegnung mit Heimito Waberer. «Und dieser Vollpfosten ist fast a Kollege von dir. Kaum zu glauben.»
Inzwischen dämmerte es. Die Jager waren fort, die Absperrung aufgelöst. Viele Zuschauer schauten bereits in ihren dritten oder vierten Glühwein. Der Zug der Jager war nur das jugendfreie Vorspiel gewesen. Jetzt begann der zweite, wildere Teil des Schauspiels. Bald drang aus allen Richtungen das Scheppern schwerer Kuhglocken, die auf dem Rücken maskierter Jungberchtesgadener im Laufschritt durch die Straßen getragen wurden. Und es kam näher.
«Trink mit, bevor der kalt wird», sagte Christine zu Matthias und stellte ihm ihren aktuellen Glühwein vor die Nase.
Sie tauchte in die Menge, die wie ein Fischschwarm hin- und herwogte, weil noch nicht zu erkennen war, wo es in den nächsten Minuten am meisten zu sehen geben würde. Plötzlich quietschten einige Jugendliche direkt vor ihr auf und drängten rückwärts. Unversehens stand Christine in der ersten Reihe.
Riesige Gestalten mit furchterregenden Fratzen rannten scheppernd und brüllend auf sie zu. Genauso hatte das archaische Gebrüll damals in Manus Nachtcafé geklungen, als sie und Matthias dort in eine Buttnmandlversammlung geraten waren. Die Neuen hatten damit ihr Talent beweisen müssen, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Im Café hatte es mit dem Schrecken nicht wirklich funktioniert, aber hier, maskiert und in freier Wildbahn, war es etwas anderes. Tatsächlich zuckte Christine ein paarmal richtig zusammen, sodass ihre Fotos teilweise ziemlich verwackelt waren.
Es gab zwei Sorten von Buttnmandln. Die einen waren von Kopf bis Fuß in schweres, dickes Fell gehüllt, die anderen sahen aus wie wandelnde, x-förmige Strohhaufen. Alle aber trugen Masken in verschiedenen Ausführungen. Am beeindruckendsten fand Christine die riesigen, bemalten Holzmasken, Larven genannt, mit den langen Hörnern. Andere Masken waren aus Fell, mit langen, roten Zungen, die aus den Mündern hingen.
Wo war bloß der Nikolaus? Christine wusste, dass er eigentlich von seiner wilden Horde nicht überholt werden durfte. Aber das war wohl im Eifer des Gefechts in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, denn ursprünglich gehörte der katholische Heilige ja gar nicht dazu. Er war erst vor ein paar hundert Jahren in den ehemals heidnischen Brauch integriert worden – wie Christine die Berchtesgadener kannte, um die Verbote zu umgehen. Theoretisch war er nun die Hauptperson, praktisch aber interessierte sich alle Welt nach wie vor nur für die wilden Buttnmandl.
Außerdem gab es in jeder Buttnmandlgruppe, Bass genannt, noch eine weitere Sorte Fellbekleideter, nämlich die Ganggerl. Ihre Aufgabe war es, die Bass zusammenzuhalten und umgefallene Strohbuttnmandl wieder auf die Beine zu stellen. Da die Ganggerl voll beweglich sein mussten, trugen sie leichtere Felle und statt der schweren Kuhglocken kleine Schafsglöckchen. Alle außer dem Nikolaus waren mit geflochtenen Ruten bewaffnet. Von Matthias wusste Christine, dass sie den Leuten damit nur auf die Beine schlagen durften. Weshalb die kluge Berchtesgadenerin an den Nikolaustagen nur in Hosen aus dem Haus ging.
Links von Christine gab es jetzt noch mehr Radau, denn die Buttnmandl stoben nun seitlich in die Menge und schwärzten einigen Vorwitzigen mit Holzkohle die Gesichter. Überall kicherte und kreischte es, die einen drängten zurück, die anderen nach vorn.
Mitten in diesem Durcheinander kniete eine der Fellgestalten sich friedlich vor ein kleines Kind. Zögernd streckte es die Hand aus und kraulte dem Ungeheuer den Bauch. Während Christine noch in diese Szene vertieft war, legte sich plötzlich ein fellbedeckter Arm um ihre eigenen Schultern. Da war es mit der Contenance vorbei, und auch sie quietschte wie ein Teenager.
Ein anderes Buttnmandl mit gleich vier gedrehten Hörnern am Kopf kam hinzu und schlug mit der geflochtenen Rute gegen ihre Beine. Selbst durch die Jeans zog das ganz ordentlich. Zum Schluss fuhr eine der Fellgestalten ihr noch mit der Pfote durchs Gesicht. Schon ließen sie wieder von ihr ab und eilten weiter. Die Umstehenden lachten, wahrscheinlich war sie ganz schwarz.
Christine fotografierte hinter den Davonlaufenden her, auf deren Rücken die schweren Kuhglocken tanzten. Das letzte Strohbuttnmandl hatte offenbar nicht mehr genug Kraft für den Laufschritt, oder die wippenden Glocken schmerzten zu sehr. Aber ausruhen ging nicht. Es dauerte Stunden, die Burschen in das Stroh einzubinden, es gab keine Möglichkeit, das schwere Kostüm zwischendurch abzulegen. Und die Glocken mussten unterhalb des Strohs befestigt werden, sodass auch sie auf Gedeih und Verderb festsaßen. Wer seine Kraft überschätzte und sich zu viel auflegen ließ, hatte Pech gehabt. Wer sich hingegen im Stroh bewährte, durfte vielleicht schon nächstes Jahr Fell tragen.
Als Christine sich wieder bei Matthias und Holzhammer blicken ließ, war das Gelächter groß.
«Weißt du, wie du aussiehst?», fragte Matthias.
«Jedenfalls ned wia a Studierte», fiel Holzhammer ein und legte einen Arm um Matthias’ Schulter, was ihm dank der Bierkiste unter seinen Füßen ausnahmsweise möglich war.
Während Christine die beiden feixenden Spaßvögel fotografierte, fiel ihr auf, dass die beiden leeren Becher vor Matthias zwei verschiedene Bildmotive zeigten.
«Freilich», sagte Holzhammer. «Die Haferl unter Tante Hildegards Ladentisch san ja aus dem vorigen Jahr.»
Christine spähte zu den anderen Stehtischen hinüber. Tatsächlich, das Verhältnis von alten zu neuen Haferln betrug rund eins zu vier, machte zwanzig Prozent sparsame Berchtesgadener, achtzig Prozent Besucher. «Da kann man ja Einheimische und Gäste unterscheiden, noch bevor sie den Mund aufmachen.»
«Richtig. Aber dass diese Unterscheidung Einfluss auf die Preisgestaltung hat, ist natürlich nur ein Gerücht», sagte Matthias und machte sein Buddhisten-Gesicht.
«Die Auswirkungen des becherförmigen Personalausweises werde ich gleich mal testen», sagte Christine.
Sie nahm das Vorjahreshaferl vom Tisch, kämpfte sich zum nahe gelegenen Maronistand durch und stellte es dort demonstrativ auf die Theke.
Sogleich fragte die Verkäuferin freundlich: «Grias di, was magst denn?»
«Einmal Maroni», sagte Christine. Normalerweise hätte die Standbetreiberin aufgrund des norddeutschen Zungenschlags jetzt auf «Sie» umgeschwenkt. Tat sie aber nicht. Im Gegenteil, Christine bekam noch zwei Maroni extra in die bereits vorgefüllte Tüte gesteckt.
«Quod erat demonstrandum», sagte sie, als sie wieder bei Matthias ankam.
Zu dritt verspeisten sie die Maroni und beobachteten das Treiben rundum.
«Was ist das denn?», sagte plötzlich Matthias und deutete auf einen Mann, die mit der Menschenmenge an ihnen vorbeitrieb. Es handelte sich um einen Herrn in Berchtesgadener Tracht, der Christine vage bekannt vorkam. Seine Ausstattung war vom Feinsten, von der langen Hirschledernen bis zum riesigen Gamsbart. Alle Sachen sahen so neu aus, als kämen sie direkt aus dem Schaufenster vom Lederhosen-Aigner. Unwillkürlich schaute man, ob nicht irgendwo noch ein Preisschildchen baumelte.
«Das ist nichts weiter», sagte Holzhammer. «Bloß der Fischer.»
«Seit wann trägt der denn Tracht?», fragte Christine entgeistert. Sie kannte den smarten Polizeichef ausschließlich in Kaschmirpulli und Edeljeans – und auch ganz ohne, aber das war eine Geschichte, die sie gern vergessen wollte.
«Er will sich assimilieren», erklärte Holzhammer. «Mir werden sehen, wie lang er braucht, um sich auch dabei wieder komplett zum Affen zu machen.»
Zweimal hatte sich der aus München strafversetzte Polizeichef jetzt schon zum Gespött der Leute gemacht. Vor zwei Jahren hatte er mehrere Morde bis zuletzt als Unfall abgetan und letztes Jahr fälschlicherweise den Bürgermeister der Schönau verhaftet. Dass dieser die Aktion mit Fassung getragen und keinerlei Konsequenzen gezogen hatte, war reine Glückssache gewesen. Es war wirklich höchste Zeit für Fischer, sich endlich eine gewisse Reputation zuzulegen. Der protzige Gamsbart verschwand in der Menge.
Inzwischen war es fast dunkel. Christine konnte keine guten Fotos mehr schießen, und die Speicherkarte in ihrer Kamera war auch fast voll.
Matthias ergriff die Gelegenheit. «Lass uns gehen, morgen gibt’s ja auch noch was zu schauen. Da kommt die Bernei-Bass bei uns zu den Nachbarn, das haben sie mir erzählt. Da kannst du sowieso viel besser sehen, und es ist auch viel originaler und stimmungsvoller.»
Christine grinste. Sie kannte ihren Matthias gut genug, um seine wahren Beweggründe zu erkennen. Ihre spontane Diagnose lautete «Sportereignis im Fernsehen». Aber sie stimmte trotzdem zu.
Matthias brachte das Haferl zu Tante Hildegard zurück, und die beiden verabschiedeten sich von Holzhammer, der natürlich bis zum Schluss bleiben musste. Dann machten sie sich auf den Weg zum Auto. Überall lagen jetzt Strohhalme. Und noch unten am Bahnhof hörte man das Scheppern der Glocken.
Hinter dem Bosna-Stand der Caritas, genau vor dem Eingang der Stiftskirche, standen zwei Männer. Von der Bühne drang der piepsige Gesang eines Kinderchors herüber.
«Was soll das heißen, du hast es noch gar nicht versucht?», fragte der Auftraggeber mit einem drohenden Unterton. Der Mann besaß eine Vollglatze und stechende blaue Augen. Er erinnerte Nepomuk an den Kannibalen aus «Schweigen der Lämmer». Außerdem sprach er in dem gleichen seltsamen Dialekt wie sein überaus strenger Großvater selig, der nach dem Krieg aus Ostpreußen ins Berchtesgadener Land gekommen war.
«I hob des Objekt erst einmal ausobserviert», antwortete Nepomuk in fast perfektem Einbrecherisch, ein Stück Bratwurst mit Zwiebelsenf herunterschluckend. «Und dabei hab i halt gespannt, dass die Nachbarn dort alles spannen. Keiner kimmt da eini, ohne dass eam einer siagt. Besonders auf d’ Nacht, weil da ist da normal kein Mensch. Deshalb hab ich ma denkt, vielleicht war’s überhaupts besser am Tag.»
«Pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich sag dir genau, was du tun sollst, und das tust du dann. Und nur dann gibt’s Geld. Verstanden?»
Nepomuk nickte. Er war gerade besonders knapp bei Kasse, und die Sache mit dem Autoknacken hatte sich ja auch zerschlagen.
«Also: Diese Buttnmandl laufen ja schließlich nicht nur durch die Fußgängerzone. Und gerade dort hinten, wo der Kerl wohnt, sind viele Kinder. Als ich im Sommer dort war, haben welche ihren blöden Ball auf meinen Q7 geschmissen. Dort haben sicher einige Familien den Nikolaus bestellt. Vermutlich vorzugsweise morgen, denn der Sechste ist ja wohl auch hier draußen der eigentliche Nikolaustag.»