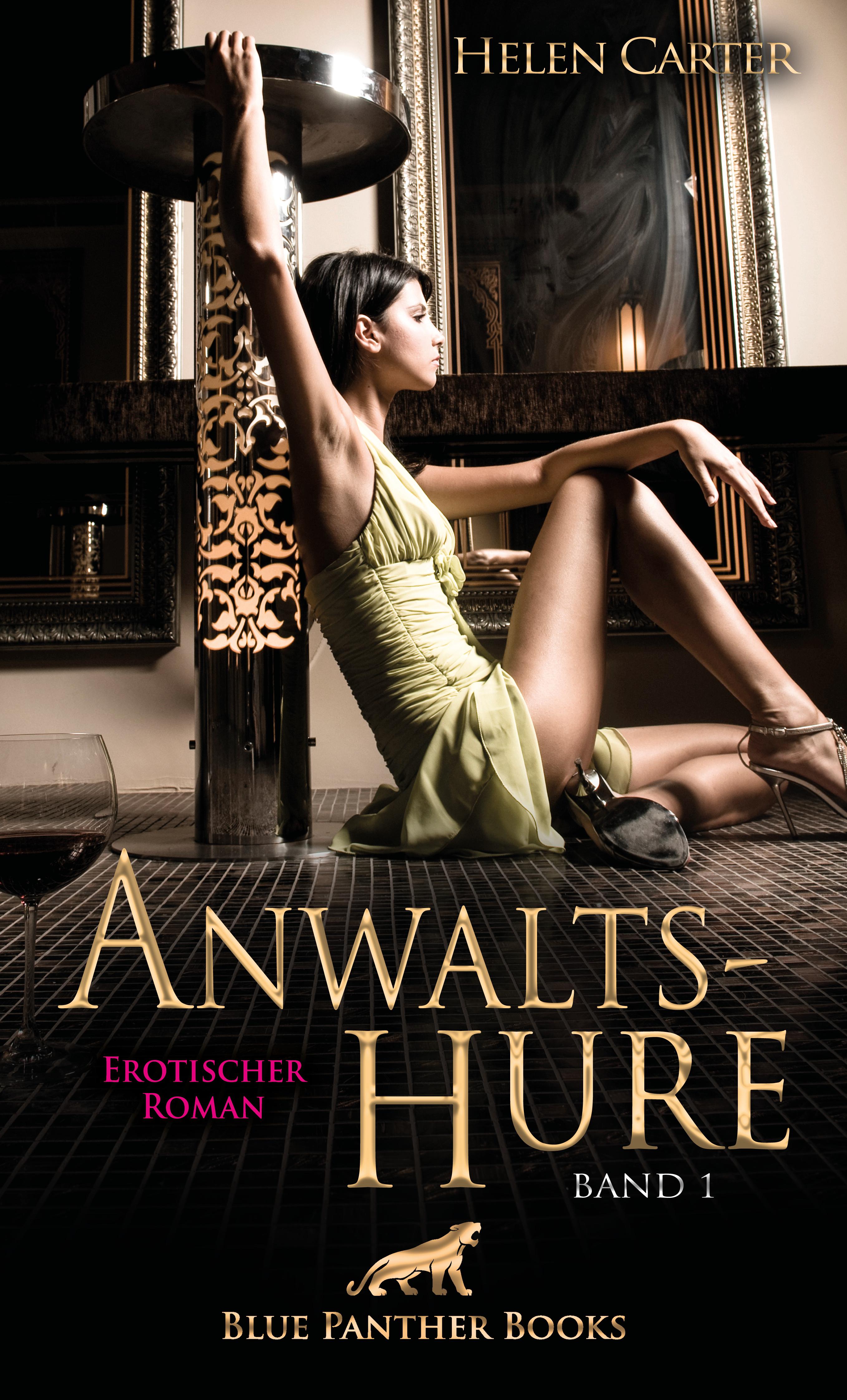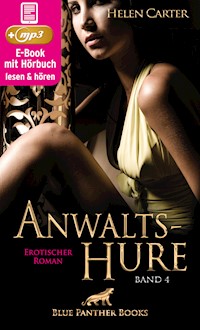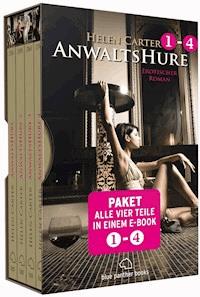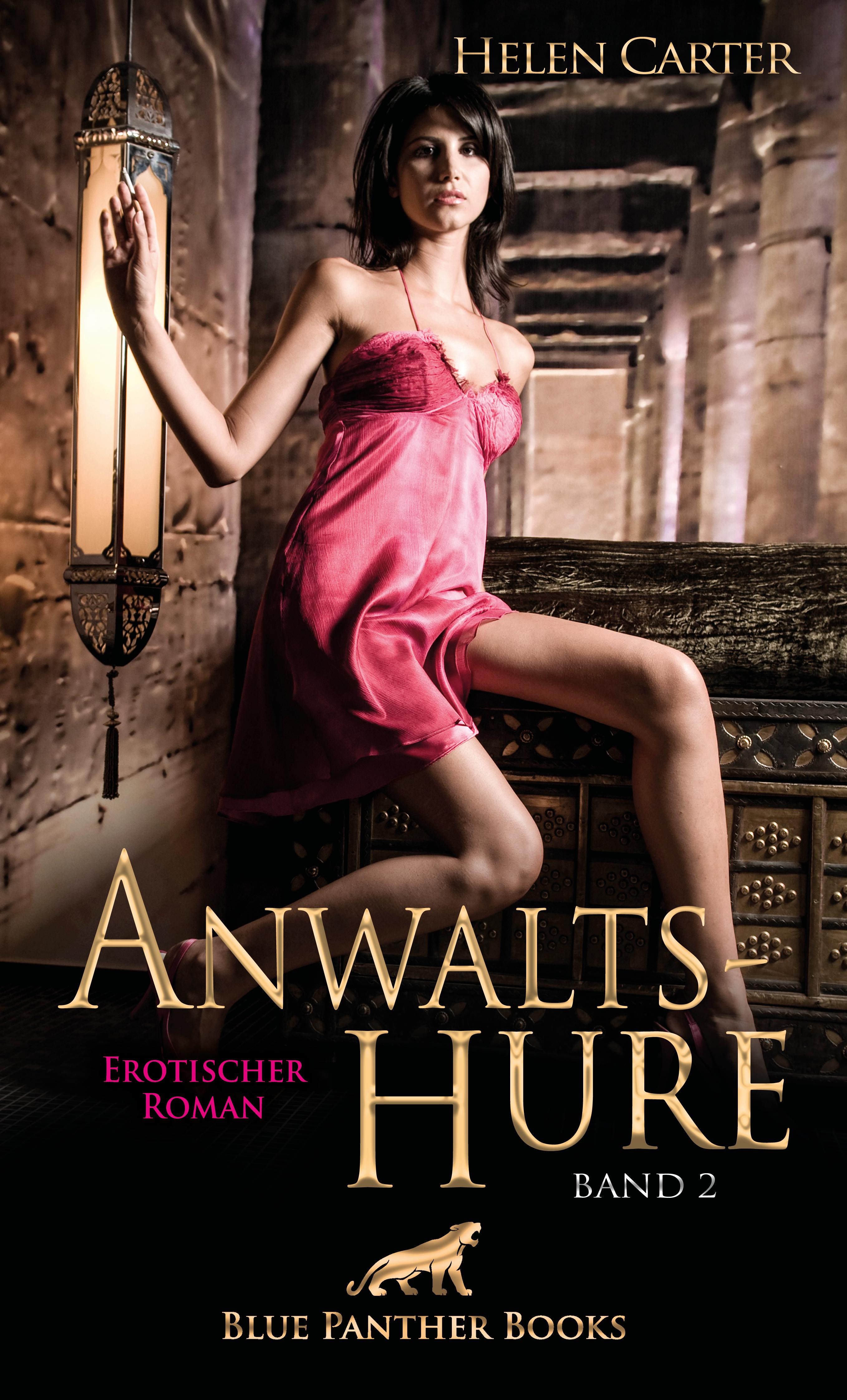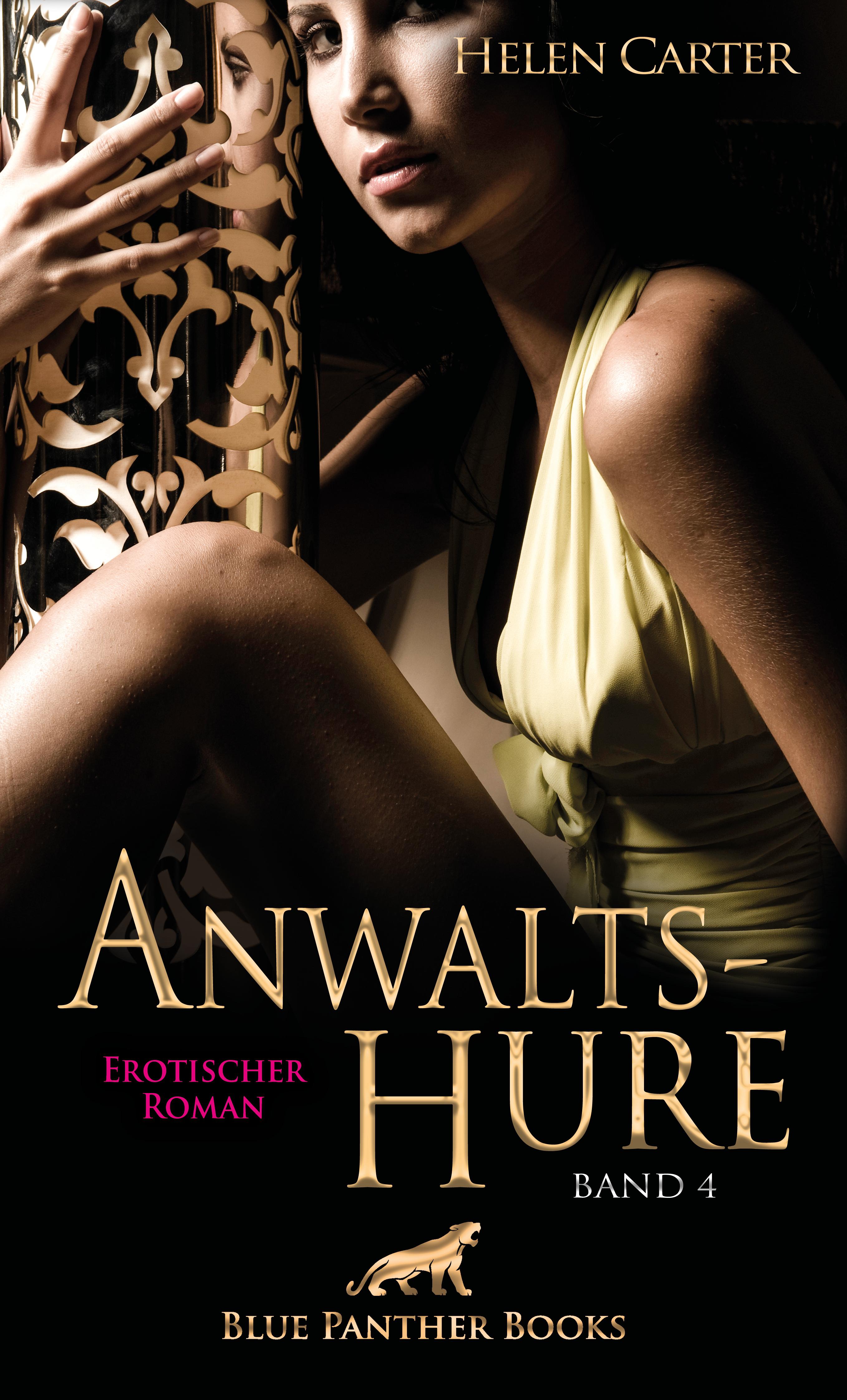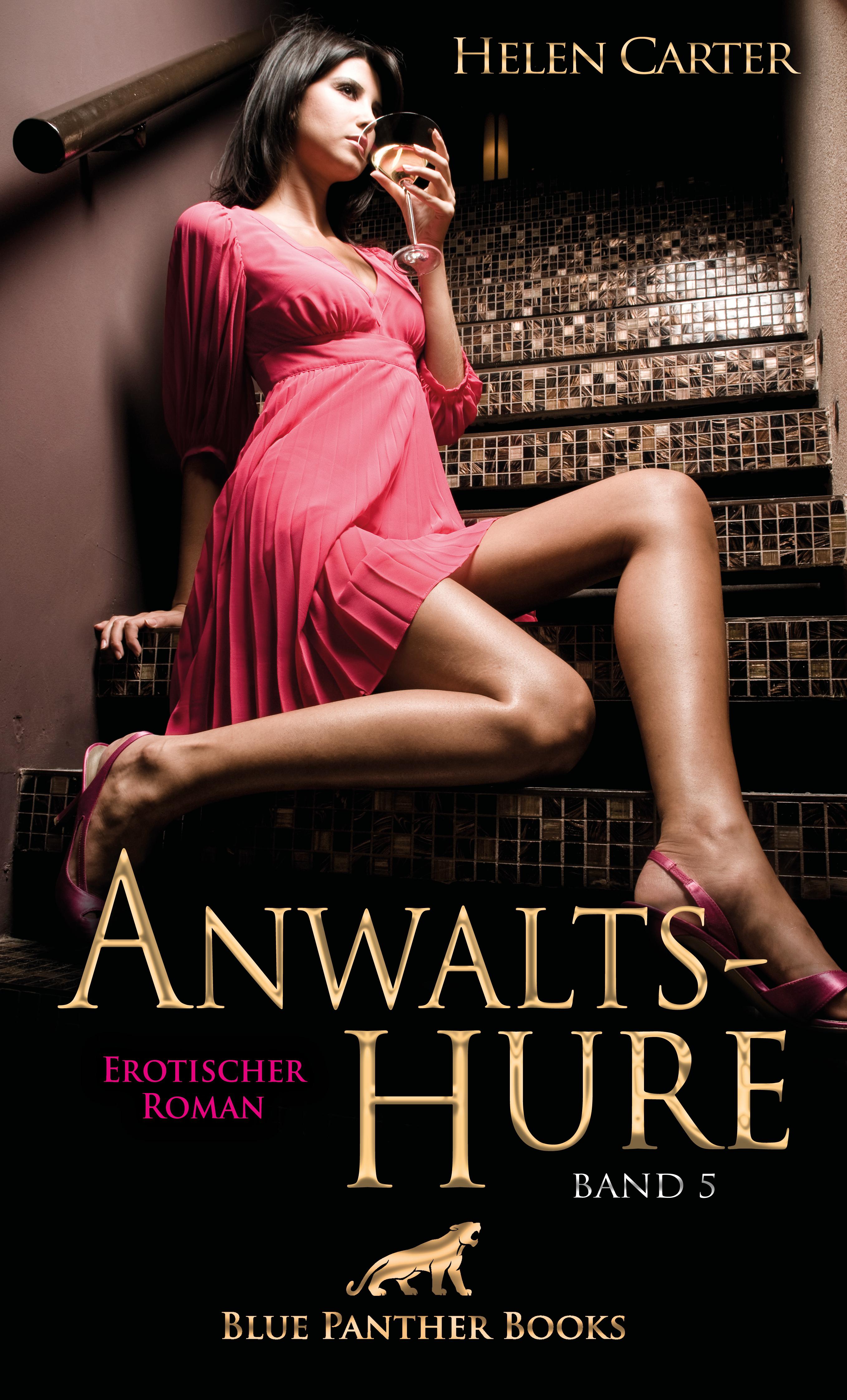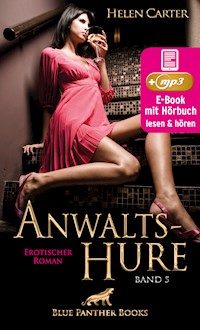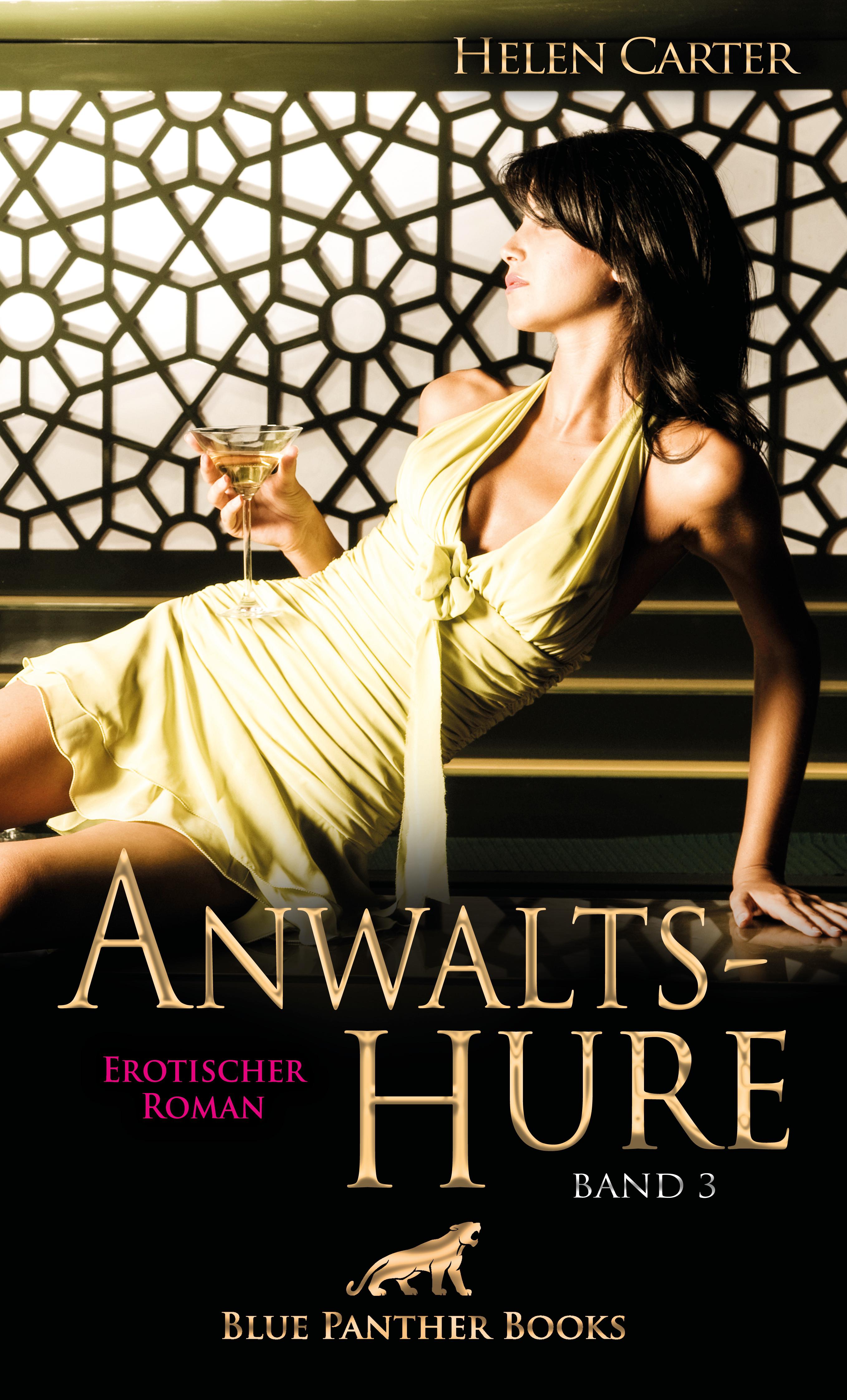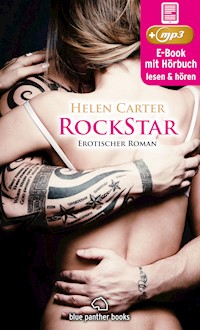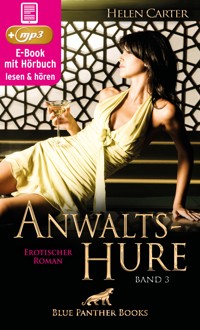9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Erotik Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht ca. 208 Taschenbuchseiten ... Céléstine muss sich im revolutionären Paris durchschlagen. Sie und ihre Freundin Heloise tricksen gemeinsam reiche Männer aus, indem sich die eine ihm hingibt und die andere ihn ein Stockwerk tiefer beklaut. Nur so schaffen es die beiden, zu überleben. Später verdingen sie sich im Palais Royale, wo Céléstine jede Menge gut betuchter Soldaten kennen und auch lieben lernt. Einer von ihnen ist ein junger korsischer Offizier, der nicht nur ihr Leben, sondern auch bald ganz Europa auf den Kopf stellen wird. Für welchen der vielen Männer wird sie sich entscheiden? Und welcher Mann entscheidet sich für sie? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Sammlungen
Ähnliche
Impressum:
Die Hure von Paris | Historischer Roman
von Helen Carter
Helen Carter wurde 1965 an der englischen Ostküste geboren.Bereits mit dreizehn Jahren begann sie, erste Geschichten zu schreiben. Es dauerte allerdings noch weitere zehn Jahre, bis sie bei den erotischen Romanen ihre wahre Heimat fand. Ihre Familie war mit diesem Genre nicht besonders glücklich. Besonders ihr Vater hatte Probleme mit den sehr expliziten Texten. Doch Helen wich nicht von ihrem Weg ab. Im Gegenteil: Sie begann damit, immer intensiver eigene Erlebnisse in ihre Romane einfließen zu lassen. Und so entstand ein prickelnder Mix aus Fantasie und Realität. Nach ihrem Studium an der Universität von Oxford arbeitete Helen im PR-Bereich. Irgendwann kam der Moment, wo sie sich zwischen ihrer zeitraubenden Arbeit in der PR-Agentur und ihren immer erfolgreicheren Romanen entscheiden musste. Helen wählte den zeitweise recht steinigen Weg der Autorin.Heute lebt Helen in den ländlichen Cotswolds, wo sie ein ruhiges Cottage bewohnt, das ihr Zeit und Muße für ihre Arbeit lässt und dennoch nahe genug am aufregenden Treiben in London und den Küstenorten liegt. Sie ist nicht verheiratet und hat auch keine Kinder, denn - so betont sie - man müsse eine Sache richtig und ohne Abstriche machen. Zudem vertrage sich ihr Leben nicht mit einer gewöhnlichen Form der Ehe.
Lektorat: Nicola Heubach
Originalausgabe
© 2023 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © lightfieldstudios @ 123RF.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783750780804
www.blue-panther-books.de
Kapitel 1
Selbst der Nebel hatte sich gegen mich gewendet. Um diese Jahreszeit stieg er eigentlich zuverlässig bei Einbruch der Dämmerung vom Seine-Ufer auf und bewegte sich dann langsam durch die gewundenen engen Gassen der Hauptstadt. Nicht so an diesem Abend.
Lange hatte ich im Schatten der Bäume gestanden, dicht bei der Mauer und hatte beobachtet, wie die Straße sich leerte.
Bewaffnete begannen zu patrouillieren. Hatte ich zunächst noch gehofft, sie würden sich mit jeder neuen Runde abwechseln, so sah ich mich bald getäuscht, denn es waren immer die gleichen Männer mit schiefsitzenden Mützen und verdreckten, gestreiften Hosen, die an mir vorbeikamen.
Nachdem ich offensichtlich begonnen hatte, ihr Interesse zu wecken, musste ich mir etwas überlegen. Ich musste eine gute Begründung …
»He … Bürgerin! Was machst du denn da?«
Wie überrascht wandte ich mich zu den beiden um, die hinter meinem Rücken stehen geblieben waren. »Bitte?«
»Ich beobachte dich schon eine ganze Zeit lang. Stehst hier an der Mauer und schaust nur.«
Ihm fehlte ein Schneidezahn. Sein rötlich-blondes Haar trat struppig unter seiner roten Mütze hervor. Er sah aus wie die Hunderte von Männern, die seit Monaten die besseren Viertel von Paris bevölkerten. Sein Kamerad hingegen hatte ein sauber rasiertes Kinn und seine Kleidung war gepflegter. Nicht zerrissen. Es gab die eine oder andere glänzende Stelle, die ich sogar im Zwielicht erkennen konnte, aber insgesamt machte er einen wesentlich besseren Eindruck.
»Man hat nicht rumzustehen und zu schauen, Bürgerin!«, mahnte er mich, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, einen Lehrer vor mir zu haben.
Ich holte beinahe theatralisch tief Luft, als müsse ich eine überaus schwere Entscheidung treffen. »Gut, wohlan denn … Ich stehe hier, weil ich dieses Haus beobachte.«
So viel Offenheit überraschte die beiden Bewaffneten sichtlich.
»Du beobachtest das Haus?«, fragte der Lehrer irritiert.
»Ja, Bürger. Das tue ich.«
»Willst du es ausrauben?«
»Nein, Bürger. Aber jener Bürger, der dort in dem Haus lebt, hat mir übel mitgespielt.« Ich ließ den letzten Satz einfach so stehen, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Sollten sie ihrer Fantasie ruhig freien Lauf lassen.
»Was hat er denn getan?« Offensichtlich hatte der Wissensdurst des Lehrers das Wettrennen mit den Bildern im Kopf des Zerlumpten gewonnen.
Ich starrte auf den etwas verdreckten Saum meines Capes. Dann holte ich abermals tief Luft. Atmete aus. Schwieg. Die Männer warteten einen Moment.
»So schlimm?«
Zwischen den zusammengepressten Lippen stieß ich hervor: »Mein Herz hat er gebrochen, der Schuft! Gespielt hat er mit mir wie die Katze mit der Maus.« Wütend stampfte ich auf. »›Ich bin frei wie ein Vogel‹, hat er gezwitschert. ›Du bist die Liebe meines Lebens!‹«, äffte ich den verschwundenen Liebhaber nach. »Und jetzt? Die Corday trifft mich auf dem Markt und erzählt mir brühwarm, was wirklich los ist. Verheiratet ist er! Verheiratet! Stelle man sich das vor! Alles hat er von mir bekommen! Sachen, die würde man keiner …« schockiert über meine offenen Worte schwieg ich und hoffte, man sah in der hereinbrechenden Dunkelheit mein heißes Erröten nicht.
»Und wieso stehst du jetzt hier?«, fragte er nach einer angemessenen Pause. »Willst du ihn stellen oder wartest du auf seine Frau?«
Betrübt senkte ich den Kopf. »Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Eigentlich will ich nur mit ihm reden.«
»Wenn du willst, schlage ich ihm aufs Maul!«, erbot sich der Zerlumpte.
Das hätte mir gerade noch gefehlt.
»Nein«, stieß ich hervor und hob dabei abwehrend die Hände. »Ich will nur mit ihm reden.«
Wir waren wohl zu lange stehen geblieben, denn plötzlich näherten sich zwei weitere Bewaffnete. Sie hoben die Hände zum Zeichen, dass sie auf unserer Seite waren.
»Hey … Guigoz. Was treibt Ihr so lange? Wir dachten schon, ihr wäret in irgendein Händel geraten.«
Sie traten zu uns heran und betrachteten mich eingehend.
»Silvain, du alter Schwachkopf. Wir kamen nur gerade mit Mademoiselle … mit der Bürgerin hier ins Gespräch.« In knappen Sätzen schilderte er seinen Kameraden, was mir widerfahren war.
Jetzt durfte ich nur nicht die Nerven verlieren. Ich kontrollierte meinen Atem und wie intensiv sich meine Brust hob und senkte. Wenn jetzt etwas schiefging, hatte ich keinen alternativen Plan in der Tasche.
»Du meinst den Bürger Balleyrand? Dort in dem Haus mit der Laterne und der gelben Mauer?« Der, den sie Guigoz nannten, ließ nicht locker.
»Ja, der!«, beharrte ich.
»Aber dann hat jener dir keinen Dreck erzählt. Der Bürger Balleyrand ist nicht verheiratet.«
Meine maßlose Erleichterung musste ich nicht spielen. Das war eine wunderbare Neuigkeit.
»Aber da ging doch eine junge Frau ein und aus?«, forschte ich ungläubig nach.
»Das kann nur das Dienstmädchen Madeleine gewesen sein.« Der Lehrer trat einen halben Schritt vor und sagte verhalten: »Da muss man sich keine Gedanken machen, Bürgerin. Selbst wenn er mit der ab und an das Bett teilen sollte, so sagt das doch gar nichts. Nicht wahr?«
Ich nickte mit niedergeschlagenen Lidern. »Gewiss«, flüsterte ich. »Jetzt schäme ich mich, weil ich so töricht war und dem Marktgeschwätz geglaubt habe.«
»Ach was … Der Bürger Balleyrand ist vertrauenswürdig. Und kein schlechter Fang, wenn ich das so sagen darf.«
Das hoffte ich allerdings auch.
»Dann lassen wir die Bürgerin jetzt mal allein. Sie ist hier sicher. Wenn noch etwas sein sollte, so kommen wir ja auf unserer Runde noch ein paar Mal hier durch.«
Das wiederum hoffte ich nicht.
»Immerhin haben wir ja jetzt Ausgangssperre«, fügte der vierte Bewaffnete belehrend hinzu, zu dem ich bislang keinen Namen hatte.
Die vier Männer machten sich also auf den Weg, und zu meiner größten Freude sah ich sie in der Ferne am Wirtshaus stehen bleiben.
Balleyrand also …
Wie es Vorschrift war, hatte man das Haus hell erleuchtet und keine der Türen verriegelt, damit jederzeit eine unverzügliche Hausdurchsuchung durchgeführt werden konnte. Wobei ich mir jetzt sicher war, dass im Hause Balleyrand in den nächsten Stunden keiner stören würde.
Nachdem ich noch ein paar Minuten gewartet hatte, und die Straße – soweit ich sehen konnte – inzwischen menschenleer war, trat ich an eines der Erdgeschossfenster und blickte vorsichtig hinein. Am anderen Ende des Raumes sah ich einen Kamin, in dem ein Feuer brannte. Davor stand ein Sessel, in dem ein Mann mittleren Alters saß und las. Ein perfektes, abendliches Idyll.
Ich wartete so noch ein Weilchen und erst als ich sah, wie er sich selbst eine Flasche Wein geholt und eingeschenkt hatte, öffnete ich vorsichtig die Haustür und trat ein.
»Bürger?«, rief ich vorsichtig. »Bürger?«
Mit langsamen Schritten ging ich durch den hell erleuchteten Flur. Er war mit viel Stuck ausgekleidet, dazwischen tummelten sich dicke Putten, die wahlweise Kerzen oder Füllhörner trugen.
»Bürger?«, rief ich erneut und zuckte zusammen, als er plötzlich durch die Tür trat und mich verwundert ansah.
»Was tun Sie in meinem Haus, Ma… Bürgerin?«
Ertappt und erschrocken war ich förmlich zu einer Salzsäule erstarrt. »Nun … Ich fürchte, ich wurde von der Ausgangssperre überrascht.«
»Ah ha. Und wieso klopfen Sie dann nicht, sondern schleichen sich herein wie ein Dieb in der Nacht?«
»Ich bitte um Verzeihung … Aber ich komme aus Giverny und bin etwas überwältigt von Paris.«
»Man pflegt also in Giverny nicht anzuklopfen, bevor man ein fremdes Haus betritt?«
Da mir nichts anderes mehr einfiel, machte ich einen tiefen Knicks.
Offensichtlich peinlich von meinem Kniefall berührt, packte er meine Hand und zog mich wieder hoch. Er hatte hübsche hellblaue Augen und strohblondes Haar. Nur die Falten über seiner Nasenwurzel und um den Mund herum zeigten, dass er kein junger Mann mehr war. Seine Lippen waren schmal und wirkten entschlossen.
Schnell entzog ich ihm meine Hand und ging mit schnellen Schritten zurück zur Haustür.
»Was haben Sie vor, Bürgerin?«
»Ich gehe wieder. Es war unverfroren von mir, derart in dieses Haus einzudringen.«
Bereits die Türklinke umfassend, hielt mich seine energische Stimme zurück. »Sie wissen, was Ihnen blüht, wenn man Sie da draußen aufgreift, nicht wahr, Bürgerin?«
Zu ihm umgedreht, sah ich ihn mit großen Augen an.
»Nichts da! Sie bleiben hier. Ich kann doch eine junge Frau nicht so mir nichts, dir nichts in ihren Untergang laufen lassen. Mein Name ist übrigens Balleyrand. Francois Balleyrand. Und wie heißen Sie, Bürgerin?«
»Céléstine. Céléstine Noailles.«
»Aber nicht etwa mit den Noailles verwandt?«
Er hatte sich mir weit entgegengebeugt, sodass ich ein leichtes, herbes Parfüm riechen konnte, das sich mit dem Duft von schwerem Rotwein mischte. Seine Stimme war kaum mehr als ein Raunen.
»Nein! Um Gottes willen«, stieß ich schockiert hervor.
Die Anspannung, die seine Lippen für einen Moment noch schmaler hatte wirken lassen, löste sich augenblicklich und machte einem Lächeln Platz. »Wie lange irren Sie schon dort draußen umher?«
Hilflos zuckte ich mit den Schultern. »Ein paar Stunden, denke ich.«
Scheinbar erinnerte er sich wieder seiner Gastgeberpflichten und machte eine einladende Bewegung in Richtung des Raumes mit dem sanft flackernden Feuer. »Treten Sie doch näher … Nehmen Sie Platz.«
Galant nahm er mir mein Cape ab und füllte ein weiteres Glas mit Wein.
»Wenn Sie etwas essen möchten, kann ich das Mädchen rufen …«, schlug er vor.
Erschrocken wehrte ich ab. Das hätte mir gerade noch gefehlt. »Aber nein, Monsieur. Lassen Sie sie schlafen.«
Er lächelte über meine Rücksichtnahme und setzte sich mir gegenüber hin.
»Giverny also …«, begann er die Unterhaltung. »Ich habe Verwandte in Giverny. Vielleicht kennen Sie sie ja. Paul und Germaine Leclos.«
Die Namen schwebten düster zwischen uns, und ich wusste für einen Moment nicht, was ich sagen sollte. Am besten war stets in solcher Situation, wenn man bei der Wahrheit blieb.
»Nein, Monsieur. Da muss ich leider passen.« Jetzt galt es dringend, das Thema zu wechseln. »Die Ausgangssperre – wie lange wird sie noch gelten?« Ich strich meinen Rock glatt und mied seinen Blick.
»Das ist schade. Es ist immer nett, wenn man gemeinsame Bekannte hat. Sie wohnen in der Rue Du Lis. Wenn Ihnen das etwas sagt.«
In dieser Situation musste ich nicht viel dafür tun, dass meine Lippen nervös aufeinanderrieben und die Farbe aus meinen Wangen wich.
»Monsieur … Ich bitte Sie … Ich habe meine Heimatstadt aus düsterem Grunde verlassen und möchte jegliche Erwähnung dieses Ortes vermeiden. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ansonsten würde ich es vorziehen, zu gehen.«
Er schien ehrlich erschrocken. »Aber nein … Nicht doch … Es tut mir leid, Mademoiselle.«
Mit einem Satz saß er neben mir und hob meine Hand an seine Lippen. Wenn sie meine Haut auch nicht berührten, so sandten sie doch heiße Wellen über meinen Rücken, und ich spürte ein Kribbeln, das bis in meine Beine lief.
»Ich bin untröstlich!«
Seine überraschende Distanzlosigkeit aufgreifend, legte ich meine Hand auf sein Knie. »Vergeben Sie mir, Monsieur. Es lag mir fern … Ich möchte nur nicht über … diesen Ort und seine Menschen sprechen.«
»Auf keinen Fall. Trinken wir lieber noch einen Schluck.« Er erhob das Glas auf mein Wohl, und ich erwiderte die Geste, meine Hand auf seinem Knie.
Alles hing von seiner nächsten Bewegung ab. Schüchtern war er mit Sicherheit nicht, so viel stand für mich fest. Ließ er meine Hand lediglich, wo sie war, hatte ich verloren. Legte er seine darauf, so hatte ich gewonnen. Manchmal waren die Dinge so simpel.
Er legte seine freie Hand auf meine und drückte sie sanft.
»Und das Mädchen schläft?«, fragte ich leise.
»Soll ich sie wecken?« Seine Stimme war warm und weich wie Samt. Sein Gesicht so dicht vor meinem und der Druck seiner Finger … Ich spürte, wie sich die Säfte in meinem Schoß sammelten. Es gibt für mich nichts derart Aphrodisierendes wie den herben Duft eines Mannes, die Wärme seiner Haut, die Tiefe seiner Stimme.
Diese eine Frage ließ eine Welt an Fantasien in meinem Kopf erstehen. Doch schnell wehrte ich ab. »Nein. Wir lassen sie schlafen.«
»Wie du meinst …«
Als seine Lippen die meinen berührten, hatte ich nur einen Gedanken, der über alle anderen triumphierte: Welchem Gott hatte ich es zu verdanken, dass das alles so reibungslos ging?
Tatsächlich mahnte mich diese Sorglosigkeit, noch vorsichtiger zu sein, meinen Sinnen noch mehr zu misstrauen. Vor allem aber jenem Druck oberhalb meiner Möse, der mich dazu brachte, Dinge zu tun, die sich im Nachhinein leider viel zu häufig als nicht besonders klug erwiesen.
Da meine Lust mit jedem Atemzug wuchs, öffnete ich meine Lippen und ließ seine Zunge ein. Er erkundete meine Zahnreihen, die Innenseite meiner Wangen, und er tat dies mit einer solchen Geschicklichkeit, einer solch sinnlichen Gier, dass ich nur von dem träumen konnte, was er für mich bereithielt.
Während er sich noch gegen mich drängte, öffnete ich bereits meine Schenkel, um den Säften so freien Lauf zu lassen. Mit seiner gesamten Handfläche glitt er mein Bein hinauf, knetete mein Fleisch und schob dabei meine Röcke beiseite. Wie ich nur konnte, kam ich ihm entgegen. Tief in meinem Verstand erhob sich die Frage, ob er vorhatte, mich hier – praktisch vor den Augen aller möglichen Passanten – zu nehmen. Doch ich verwarf die Frage, denn die Einzigen, die hier vorbeikommen mochten, waren die Patrouillen.
Wie ein Blitz erhellte eine Fantasie meinen Kopf, in der die Männer, die mich praktisch hier hereinbefördert hatten, durch die Fenster schauten und uns beim Kopulieren entdeckten. Ich sah ihre aufgerissenen Augen und die vom Geifer überzogenen Lippen. In meiner Szene kamen sie durch die offenstehenden Türen herein und schlossen sich uns an. Nur einen Augenblick später waren wir alle nackt, und die Männer nahmen mich abwechselnd in allen Löchern. Ich lutschte Schwänze und schluckte maßlose Mengen immerzu fließenden Samens. Diese Fantasie brachte mich derart um den Verstand, dass ich mir sehnlichst die Umsetzung zu wünschen begann.
»Lass uns hochgehen!«, stieß es heiß an mein Ohr.
Als er das sagte, war mein Korsett mir schon so eng geworden, dass ich kaum noch Luft bekam. Mein Saft floss meine Schenkel herab, und meine Nippel rieben steinhart an dem billigen Stoff meines Hemdes. Wenn er mich nicht bald mit aller Wucht mit seinem Stamm rammen würde – dessen war ich mir sicher –, dann würde ich irgendeinen Gegenstand nehmen und ihn selbst in mich stoßen.
Halb besinnungslos vor Gier stolperte ich beinahe die Stufen in den ersten Stock hinauf, als ich ihn plötzlich zischen hörte: »Halt!«
Ich erstarrte. Zorn stieg in mir auf. Was zum Teufel mochte er vergessen haben, dass er mich in solchem Moment bremste?
»Knie dich hin!«, kommandierte er mit gepresster Stimme.
Die Lippen mit meiner Zunge benetzend, tat ich, was er wollte.
»Raff deine Röcke! Ich will deine Fotze sehen!«
Die Treppe war viel zu eng für all diese Stoffmengen, doch ich zog, drückte und presste, bis er mein nasses Fleisch unbehindert von meinem Kleid sehen konnte. Mühsam drehte ich mich zu ihm um und sah gerade noch, wie er seine Hand ausstreckte. Scharf Atem holend, spürte ich mehrere Finger in meiner Möse. Ich schrie leise auf, biss mir aber gleichzeitig auf die Zunge, denn das Mädchen durfte auf keinen Fall geweckt werden.
Der Druck seiner Hand war überwältigend. Am scharfen Schmerz erkannte ich, dass er nicht nur mit einem Finger, oder derer zwei, mein Innerstes erkundete, sondern dass er vielmehr daran arbeitete, alle Finger – außer dem Daumen – in mir auf Reisen zu schicken. Meine Linke umklammerte die Stäbe des Treppengeländers, während meine Rechte den kleinen Vorsprung der Stufenkante packte. Nur so hatte ich das Gefühl, ihn wenigstens einigermaßen dirigieren zu können, sodass er mich nicht vollständig auseinanderriss.
»Bei allen Göttern im Himmel … Wie kann man nur so nass sein? Sieh es dir an! Es läuft sogar an meinem Arm herab!« Mit einem Ruck hatte er seine Finger aus mir herausgezogen und hielt sie mir vors Gesicht, als könnte ich seine Behauptung sonst nicht glauben.
»Leck meinen Arm ab!«, befahl er und drückte mit seinem Unterarm meinen Mund auf.
Salziger Mösensaft umspülte meine Zunge.
»Ich will lieber deinen Samen schlucken!«, begehrte ich auf.
»Sei still, oder ich ficke dich hier auf der Treppe bis deine Knie aufreißen.«
Als wollte er seinen Worten Nachdruck verleihen, entzog er mir seinen Arm und stieß seine Finger abermals mit Macht in meine Möse. Er schabte und rieb an meinem Innersten, dass ich vor Geilheit beinahe den Verstand verlor. Ohne mich wirklich wehren zu können, stieß ich wieder und wieder gegen die harten Kanten der Treppenstufen. Nur die wilde Entschlossenheit, endlich den vollen Genuss seines Schwanzes in meinen Löchern erleben zu wollen, trieb mich dazu, mich seinem Griff zu entziehen und langsam die Treppe hinaufzukriechen, wobei Francois mir erbarmungslos folgte. Da ich des Öfteren meinen Rock mit den Knien einklemmte, riss ich damit bald mein Mieder herunter und meine Brüste hüpften aus der festen Ummantelung.
Endlich hatte ich es geschafft, und den Treppenabsatz erreicht. Nun konnte ich meine Röcke raffen und wieder auf die Beine kommen. Mein ganzer Körper bebte. Meine Wangen glühten. Als ich mich zu ihm umdrehte, erkannte ich, dass es ihm nicht anders ging.
Mit einer abrupten Kopfbewegung wies er mir die Tür, durch die ich gehen sollte. Es war sein Schlafzimmer.
»Ich bin so geil – ich werde erst dich ficken, dann Madeleine und dann euch beide.«
Während ich atemlos in Richtung des Bettes wankte, blieb er an der Tür stehen.
»Dreh dich um!« Seine Stimme hatte jegliche Festigkeit verloren.
Er war genauso wenig Herr seiner Taten wie ich. Was immer uns jetzt leitete, es hatte mit Verstand nichts mehr zu tun. Francois starrte auf meine nackten Brüste, als könnte er sein Glück nicht fassen. Ich wusste um deren Wirkung auf die Männer, kannte den Gegensatz zwischen meiner schmalen Taille, den sanft sich wölbenden Hüften und der beachtlichen Oberweite.
»Weich und willig«, murmelte mein Liebhaber.
Dann war er mit wenigen Schritten bei mir, öffnete mein Mieder und riss mir meine verbliebene Kleidung vom Körper. Er stieß mich rücklings aufs Bett, und während ich noch so – mit leicht gespreizten Schenkeln – dalag, zog er sich selbst in einer solchen Schnelligkeit aus, dass es kaum zu fassen war.
Welch prachtvoller Ständer da vor mir wippte! Dick und lang. In Gedanken führte ich ihn bereits in meine Auster ein und maß dabei, wie tief er in mich würde eindringen können.
»Fick mich!« Mehr konnte ich nicht sagen. Geistreicheres fiel mir nicht ein.
Und er tat, was ich wollte.
Die Beine mit beiden Händen gestützt, meine Spalte weit geöffnet, bot ich ihm alles dar, was er zu nehmen plante. Doch anstatt mich mit seinem Stamm zu verwöhnen, presste er sein Gesicht in mein nasses, geschwollenes Fleisch und leckte mich in einer Tiefe, um die so mancher Schwanz seine Zunge beneidet hätte. Er erforschte jede Falte, durchmaß die Länge meiner Auster und bearbeitete sie so intensiv, dass sie jene glatte Haut meiner Fotze in eine überempfindliche Oberfläche verwandelte. Eine Leinwand für die Orgasmen, die er mir zu bereiten vorhatte.
Ich aber schrie und keuchte wie eine Besessene. Hatte ich mich noch für wenige Augenblicke zu beherrschen vermocht, so riss mich unser beider Geilheit mit sich fort wie eine Sturmflut. Gewiss, ich hatte nicht schreien wollen, nicht mal laut stöhnen, denn das Mädchen durfte auf gar keinen Fall geweckt werden, aber es ging nicht.
Und als schließlich seine Zunge seinem Schwanz Platz machte, war ich bereits am Ende meiner Kräfte. Meine Kehle war wundgeschrien und meine Lungen brannten, als hätte ich tagelang nur gekeucht und nicht geatmet. Mit wirren Abwehrbewegungen versuchte ich, mir Francois wenigstens für einen Augenblick vom Leib zu halten, mir eine Sekunde der Ruhe und Besinnung zu verschaffen. Doch er dachte nicht daran, mir nachzugeben. Stattdessen pumpte sein Stamm mit roher Gewalt in meine Möse. Sich mit einer Hand abstützend, packte seine andere meine ruckende Brust und bohrte seine Nägel hinein. Doch anstatt mich damit zu quälen, steigerte jene grobe Behandlung noch meine Geilheit, meine Befriedigung. Er knetete meine Titte, kniff in meinen Nippel. Bald zeichneten sich dunkelrote Marken auf meinem weißen Fleisch ab. Dann wieder stützte er sich förmlich auf meine weiche Halbkugel und drohte, sie zu zerquetschen. Aus mir aber lief in Strömen mein geiler Saft. Ich wischte ihn mit der flachen Hand ab, wichste dabei seinen Ständer und trieb ihn an, mich immer härter zu benutzen.
Sein verzerrtes Gesicht über mir … der Schweiß, der von seiner Stirn rann … Ich hielt ihm meine besudelte Hand hin.
»Leck sie ab!«, herrschte ich ihn an und er gehorchte.
Ja, mehr noch! Er biss in meine Handkante, saugte so hart an ihr, dass die Lust den Schmerz zu betäuben schien.
Und in diesem Moment nutzte ich seine Unachtsamkeit, packte ihn und warf ihn mit der Kraft meines Körpers so zur Seite, dass ich ihn auf den Rücken rollen und mich selbst über seinen Lenden positionieren konnte. Ich hielt seinen Stamm aufrecht und ließ seinen Helm für einen Moment am Zugang zu meiner Möse verharren. Den Unterleib auf das Festeste angespannt, stieß ich ihn mit einem Ruck in mich hinein. Der Schmerz war überwältigend. Francois schrie auf, als seine Vorhaut zurückgerissen wurde. In meiner Willenlosigkeit schlug ich ihm ins Gesicht und erstickte so den Schrei. Er aber bohrte seine Nägel in meine Hüfte, kratzte brutal über mein Fleisch, während ich ihn rücksichtslos zu reiten begann. Das Klatschen meiner Arschbacken erfüllte den Raum, und Francois starrte fassungslos meine hüpfenden Titten an. Ab und an hielt ich über seiner Eichel inne, genoss die Anspannung, die Erwartung in seinem Gesicht, nur um mich im unerwarteten Augenblick mit einem Ruck auf ihm niederzulassen und dann sanft zu ficken. Ich knetete ihn in mir, nur mit den Muskeln in meiner Möse, bereitete ihm alle Genüsse, die ich zu bieten hatte, und er – im Gegenzug – machte sich selbst zum Werkzeug meiner Lust.
»Ich spritze!«, stieß er plötzlich atemlos hervor.
»Das sagst du öfter …«, korrigierte ich ihn lächelnd, wusste ich doch nur allzu gut, dass ich so manchen Höhepunkt beiseite gewischt hatte, noch bevor er meinen Liebhaber hatte übermannen und mir so meinen Spaß hatte verkürzen können.
Jetzt aber spürte ich an der Art, wie sich sein Körper verkrampfte, dass er sich wirklich nicht mehr halten konnte. Also stieg ich ab und kniete mich zwischen seine Schenkel. Sacht bog ich seinen nassen Schwanz in meine Richtung und nahm ihn tief in meine Kehle auf. Dabei vergaß ich natürlich nicht, ihn nachdrücklich zu reiben. Und während meine vollen Brüste rhythmisch auf seine Haut klatschten, ließ ich ihn seinem Höhepunkt entgegenstoßen. Seine Beine drehten sich ein und aus. Er kämpfte gegen den Orgasmus an, versuchte offensichtlich, seinen Samen noch weiter zurückzuhalten. Doch es gelang nicht länger. Mit einem tiefen, lang gezogenen Ächzen jagten seine Samenfontänen in meinen Mund.
Ich versuchte ernsthaft, so viel zu schlucken, wie es mir irgend möglich war. Ich versuchte, nicht zu atmen, dann wieder besonders schnell. Aber ich wurde der Mengen nicht Herr. Seine Creme floss aus meinem Mund, tropfte auf meine Brüste. Ich kniete aufgerichteten Oberkörpers über ihm und blickte auf seinen ermatteten Körper herab.
Dann folgte ich einem plötzlichen Impuls und beugte mich vor, öffnete seinen Mund mit meinen Lippen und zwang ihn so dazu, seinen eigenen Samen zu trinken. Wenn er mich auch im ersten Moment abzuwehren versuchte, so ergab er sich doch nur Sekunden später dem absoluten Genuss des eigenen Saftes. Ja, er schien es sogar so zu genießen, dass er begann, mein Gesicht und meine Brüste abzulecken. Er saugte an ihnen, als gelte es, nicht einen Tropfen zu verschwenden.
»Nie zuvor hat mich eine Frau dazu gebracht, meinen eigenen Samen zu kosten«, murmelte er, als wir Arm in Arm – halb schlummernd – nebeneinander lagen.
Ich fragte ihn nicht, ob es ihm gefallen hatte. Es spielte keine Rolle. Tatsächlich war ich ein wenig enttäuscht, denn obwohl die Vereinigung mit ihm lustvoll, ja überaus geil gewesen war, so war mir selbst doch der Orgasmus verwehrt geblieben, und ich verstand nicht warum. Mein Schoß fühlte sie hohl und leer an. Konnte es denn wirklich sein, dass es nach solchem Erlebnis noch nötig war, mich selbst zu reiben, um das Natürlichste der Welt zu bekommen? So hing ich meinen Gedanken nach und lauschte auf seinen tiefer und gleichmäßiger werdenden Atem.
Francois schlief ein, und ich weigerte mich, es mir zu machen. Diese Erniedrigung vor mir selbst war inakzeptabel. Es musste einen anderen Weg geben.
Vorsichtig, um so wenige Geräusche als irgend möglich zu machen, stand ich auf. Der Mond war voll und schien beinahe wie eine Sonne auf die vom Regen glänzenden Gassen. Den Regen hatte ich in meiner erotischen Umnachtung nicht bemerkt.
Ich nahm meine Röcke, das Hemd und das Mieder, Strümpfe, Strumpfbänder und Stiefel und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer. Wenn ich mich richtig erinnerte, so hatte die Treppe beim Hinaufkriechen nicht geknarrt. Also würde sie es auch jetzt nicht tun. Zornig auf mich selbst stellte ich fest, dass ich nicht auf die Kirchenglocken geachtet hatte. Wie spät es war, konnte ich also nicht sagen. Die Treppe hielt ihr Versprechen und verriet mich nicht.
Unten angekommen, kleidete ich mich zügig an und begab mich zur Hintertür, die hinaus auf den Hof führte. Jetzt konnte ich nur beten, dass die brav schlafende Madeleine keine Hühner hielt …
Nein. Alles blieb ruhig.
Wenn es auch einen längeren Weg bedeutete, so hielt ich mich trotzdem im Schatten und umrundete den Hof immer dicht an der Mauer entlang, wobei ich die Fenster im Auge behielt. Abermals hatte ich Glück. Nichts rührte sich, und es schien auch noch so tief in der Nacht zu sein, dass die Dienstboten in den Häusern drumherum tief und fest schliefen.
Endlich erreichte ich jene kleine Tür, die – wie auch der Haupteingang – unverschlossen bleiben musste, um unangekündigte Hausdurchsuchungen zu ermöglichen. Es war kalt, und dies spürte ich umso mehr, als die Hitze von Francois’ Körper nach und nach von mir glitt. Mit beinahe gefrorener Hand drehte ich den kleinen Knauf und zog die Tür auf. Jetzt befand ich mich mitten in der Gefahr. Käme die Patrouille jetzt an mir vorbei, wäre ich verloren. Diesmal würden sie mich verhaften und mitnehmen müssen. Abermals fluchte ich auf mich selbst, da ich es versäumt hatte, ihr Vorbeimarschieren abzuwarten und dann erst loszugehen. Jetzt wusste ich nicht, ob mir eine Minute oder derer dreißig blieben. Ohne Zweifel, der Sex mit Francois hatte mich leichtsinnig, wenn nicht gar töricht gemacht! So stand ich außerhalb seines Grundstückes, den Rücken flach gegen die feuchtkalte Mauer gepresst und lauschte in die Nacht.
»Pst!«, machte es plötzlich. »Pst … Hier!«
Ich sah mich um.
»Hier bin ich«, zischte es.
»Wollten wir uns nicht bei Brissac treffen?« Meine Stimme klang ungehaltener, als ich es geplant hatte.
Sie legte den kleinen Kopf schief und sah mich mit gerunzelter Stirn an. »Wieso bist’ n so zänkisch? War er nicht gut im Bett?«
Seltsamerweise hatte ich keine Lust, über Francois’ Fähigkeiten zu plaudern.
Heloise war klein und zierlich und wirkte wesentlich jünger als ihre knapp achtzehn Jahre. Braune Locken kringelten sich wirr unter ihrer Haube und lugten hervor, und das Cape war ihr ein gutes Stück zu lang, was noch zu ihrem kindlichen Gesamteindruck beitrug. Heloise hatte eine kleine Stupsnase und große braune Augen, mit denen sie Steine zum Schmelzen bringen konnte. Das war ihre Masche. Ich hatte schon erlebt, dass sie einem Gendarmen, der sie bereits fest am Arm hatte, erzählte, sie habe sich verlaufen, anfing zu weinen und von ihm sogar noch nach Hause gebracht wurde. Als er mit hineinwollte, um ihrem Papa kräftig die Meinung zu sagen, wie man solch ein kleines Mädchen allein herumlaufen lassen konnte, weinte sie noch heftiger und bettelte ihn erfolgreich an, er möge nichts dergleichen tun, denn dann wisse der Vater ja, dass sie bei Dunkelheit herumgelaufen wäre … Sinnlos zu erwähnen, dass der Gendarm unverrichteter Dinge davon marschierte. So viel zu Heloise …
»Komm schon, Céléstine … Du hast immer tolle Ficker. Einmal muss auch eine Niete darunter sein.«
»Du weißt, du sollst solche Ausdrücke nicht verwenden«, wies ich sie scharf zurecht, woraufhin sie einen gezierten Knicks machte.
»Um Vergebung, Mademoiselle. Ich will es auch nicht wieder tun …« Dann aber grinste sie breit. »Wenn er vielleicht auch nicht gerade gut fickt, so hat sich die Sache aber doch gelohnt.«
Schweigend gingen wir den Rest des Weges bis zu unserer Unterkunft. Es war eine billige Schänke, die unter dem Dach mehr oder minder große Verschläge als Gästezimmer vermietete.
Es war fast eine Stunde Fußmarsch, doch wir hielten es für sicherer, weit entfernt von unserem Jagdgebiet zu wohnen. Und so schlichen wir ebenso langsam wie leise die Stufen hinauf, wobei wir dem lauten Schnarchen aus den verschiedenen Stockwerken lauschten.
In unserem Verschlag angekommen, legte Heloise ihren Umhang ab und gab so den Blick auf jene Eigenkonstruktion frei, die sie einst selbst erfunden hatte, und auf die sie ungeheuer stolz war. Es handelte sich dabei um einen Unterrock, der eine Tasche neben der anderen aufgenäht hatte. In diesen Taschen verstaute sie alles, was sie in den Häusern Wertvolles finden konnte. Weitere Röcke darüber und darunter hinderten silberne Teller, goldene Kerzenleuchter, Diamanthalsbänder und Perlen daran, einen infernalischen Krach zu machen. So ruhten sie still und geschützt in Heloises Taschenrock.
Auch jetzt stellte ich fest, dass sie ganze Arbeit geleistet hatte. Während ich oben Francois’ Schwanz aufgenommen hatte, hatte Heloise seine Schalen, Uhren, Goldmünzen und Duellpistolen genommen.
So vorsichtig wir konnten, untersuchten wir jedes einzelne Stück.
»Pierrot wird ganz schön staunen …«, murmelte sie.
»Wenn sie uns damit erwischen, küssen wir ›Madame la Guillotine‹ …«
Heloise hob die Schultern und ließ sie wieder sacken. »Das glaube ich nun wirklich nicht. Wir nehmen es vom Adel und geben es der Revolution!«, erklärte sie, als hielte sie gerade eine Rede im Tempel der Vernunft.
Wobei man sagen musste, dass wir regelmäßig vergaßen, es der Revolution zu geben.
»Hoffentlich sieht das Bürger Robespierre genauso«, murmelte ich, woraufhin Heloise wieder die Schultern hob und fallen ließ und dazu ein gelangweiltes »Pfff« ausstieß.
Kapitel 2
»Wir könnten endlich mal wieder etwas unternehmen. Immer nur arbeiten … Wer weiß, wie lange das schöne Wetter noch anhält.« Heloise kniete auf unserer Pritsche und schaute aus dem winzigen Fenster, dessen Glas nur noch vom Rahmen zusammengehalten wurde. Es war so schmutzig, dass sie mit Spucke eine Art Guckloch freigewischt hatte.
»Und wo willst du hin?«
Sie flog herum und strahlte mich an. »Was hältst du vom Palais Royal? Wir könnten der Musik zuhören … tanzen …«
Man sah ihrem Gesicht an, dass sie sich bereits dort sehen konnte, wie sie – einen galanten jungen Mann am Arm – zwischen den Arkaden flanierte.
»Warum eigentlich nicht. Aber was sollen wir anziehen?« Ich blickte an unseren fadenscheinigen Kleidern herab.
»Wart’s ab!« Heloise sprang von der Pritsche und kroch halb darunter. Als sie wieder auftauchte, hatte sie einen prallvollen Sack an einem Zipfel und machte sich daran, ihn zu öffnen.
»Nein! Die nicht! Die wollen wir der alten Vaucluse verkaufen! Wenn die Kleider Schaden nehmen …«, versuchte ich einzuschreiten.
Doch Heloise hörte mir schon gar nicht mehr zu. Sie hatte die Kleider, die wir bei einem unserer letzten Beutezüge ergattert hatten, bereits ausgewickelt und hielt sich eines davon an. Es glänzte wie die Sonne, und das aus den richtigen Gründen – nicht wie unsere alten Sachen.
»Es ist vielleicht nicht der allerneueste Schnitt, aber heute Abend werden wir großartig darin aussehen!«
Und sie hatte recht. Mit ein paar Kordeln und Bändern, einer Raffung hier und einem Wickeln dort, hatten wir uns die Kleider passend gemacht.
»Wir sind heute Nacht die schönsten Mädchen im Palais Royal!«, verkündete Heloise und strahlte über das ganze Gesicht.
Meine Begeisterung wurde allerdings etwas getrübt, als ich überlegte, wo die ursprüngliche Besitzerin dieser Kostbarkeiten wohl inzwischen war. Und noch ein anderer düsterer Gedanke erfasste mich, nämlich der, ob uns bei solch einem Ausflug eine Gefahr drohen konnte. Natürlich konnte sie. Immerhin traf sich ganz Paris in der Anlage. Zum Sehen und Gesehen-Werden. Letzteres war es, was mir die meisten Sorgen bereitete. Was, wenn einer unserer Geber dort auftauchte und mich erkannte?
»Ach was!«, wiegelte Heloise ab. »Und wenn schon … Dann verschwindest du mit ihm in den Büschen, und schon ist alles wieder gut.«
Vielleicht war diese sehr bodenständige Lösung wirklich die richtige. Tatsächlich sehnte ich mich nicht weniger als meine Begleiterin nach ein wenig Abwechslung. Schöne Kleider sehen, vornehme Leute – oder wer von ihnen noch übrig war – Musik hören … Es musste das Paradies sein.
Kapitel 3
Als die Sonne langsam sank und der Nachmittag dem Abend Platz zu machen begann, wickelten wir uns fest in unsere Capes, nahmen jede ein paar Münzen in einem Beutelchen mit und machten uns auf den Weg.