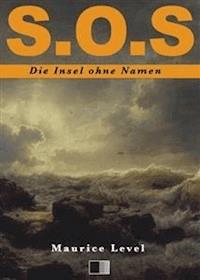Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich bin nicht närrisch, Herr Hardant, ich bin nur beunruhigt, wie's mein Recht ist, ja, fast meine Pflicht. Nun sind es bereits dreißig Tage, seit das Schiff abgegangen ist ...« »Wir haben von jedem Landungsplatz Nachrichten gehabt: wir sind in ständiger Radioverbindung mit ihm geblieben ...« »Jedoch seit St. Paul, das es am 17. berührt hat, nichts mehr.« »Von St. Paul bis Melbourne fährt es ohne Aufenthalt ...« »Das dürfte es nicht verhindern, uns ein Radiotelegramm zu schicken ...« »Das Schiff hat vielleicht einen Schaden gehabt; Maschine ist eben Maschine.« »Das sag' ich mir auch, und deswegen hab' ich nicht alle Hoffnung aufgegeben.« Der Angestellte sprach mit unerschütterlicher Ehrerbietung; Herr Hardant sah ihm in die Augen: »Sie haben also Angst, Le Goutelier?« »Ich gebe es zu, Herr Hardant. Selbstverständlich sage ich keinem etwas von meinen Befürchtungen, im Gegenteil versuche ich, denjenigen Vertrauen einzuflößen, die um Nachrichten kommen; ich möchte Ihnen aber nicht verheimlichen, daß dies immer schwieriger wird. Die Leute denken sich, daß wir die Wahrheit verbergen ... Hinzu kommt, daß unselige Gerüchte rätselhaften Ursprungs in Umlauf sind ...« »Was für Gerüchte?« Le Goutelier zuckte die Achseln: »Weiberklatsch, leeres Geschwätz ...«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Level
Die Insel ohne Namen
(S. O. S.)
Roman
Aus dem Französischen übertragen von Emil Straßberg
idb
ISBN 9783962243531
Prolog
Joachim Halz schrieb hinten in seinem Laden, einem Raum, der mehr lang als breit war, mit schwarzen Wänden, schwarzer Decke, möbliert mit einem Ladentisch, Regalen voller Bücher, einigen Stühlen und einem Geldschrank. Dieser Laden ging auf die Utrechtschedwarsstraße, eine der ärmsten Straßen des ärmsten Viertels von Amsterdam.
Tageslicht konnte man das, was das Schiebefenster durchließ, nicht nennen: dieses unbestimmte gelbe Licht, das vom Regen des Oktobernachmittags noch verdunkelt wurde.
Hier gleicht der Regen keinem Regen in irgendeinem anderen Land. Er fällt langsam, dicht aus einem düsteren, gleichmäßig grauen Himmel auf ein Ziegelsteinpflaster, wo die Schritte gedämpft klingen, an den Wänden herunter, die so vermodert sind von Feuchtigkeit, daß man sagen könnte, im gleichen Maße, wie das Wasser vom Himmel tropfe, steige von unten her ein dichter Dampf auf, der sich in den übelriechenden Pfützen der toten Kanäle auflöst. Man kann sich vor Kälte, vor Wind, vor Sonne schützen, vor so etwas nicht. Im Innern der Häuser zerfällt der Putz, und kleine Mulden bilden sich in den Ecken der Wände und des Steinpflasters, wo schmierige Ratten kriechen, zunächst schüchtern, dann aber, das Loch erweiternd, sich festsetzen, mästen und wimmeln.
Es schlug sechs; Joachim Halz wollte gerade sein Kontobuch zuklappen. In diesem Augenblick klopfte es kurz ans Fenster. Er hob den Kopf, ließ mit einem Druck des Daumens das Schloß seines Geldschranks zuschnappen und öffnete.
Sofort drang der Wind in den Raum; dem Kachelofen entströmte eine Rauchwolke, und der Schatten eines Mannes erschien im Türrahmen.
»Was wollen Sie?« fragte Halz.
»Ist's hier richtig bei Joachim Halz, dem Steinhändler?«
»Das ist hier; was wünschen Sie?«
Der Besucher trat ein, blickte mißtrauisch um sich und schüttelte sich wie ein Hund, der aus dem Nassen kommt. Das Wasser rieselte von seinem Gummimantel, bildete um seine Füße einen leuchtenden Kreis und tropfte von der heruntergeschlagenen Hutkrempe. Nachdem er sich umgeschaut hatte, heftete er die Augen auf den Inhaber; dann hob er seine Schuhsohlen gegen die Wärme des Kachelofens und blieb schweigsam.
Halz mußte solche Art gewohnt sein, denn er fand nichts dabei, kehrte zu seinem Geldschrank zurück, nahm etwas aus einer Schublade, und erst dann wiederholte er seine Frage:
»Womit kann ich dienen?«
»Das da«, sagte der Mann und zog unter seinem Mantel einen mit einer Schnur zusammengebundenen Lederbeutel hervor.
Jetzt war es Halz, der schweigsam blieb. Nachdem der Mann seinen Regenmantel abgelegt hatte, löste er die Schnur und leerte den Inhalt des Sackes – vier kleinere Säcke – auf den Ladentisch. Er nahm drei davon, steckte sie wieder in seine Hosentasche und öffnete den vierten. Sogleich schien das Licht auf dem Ladentisch aufzuflackern. Halz schnupperte und sagte:
»Gestatten Sie, daß ich die Fensterläden schließe, ich war gerade dabei, als Sie klopften.«
Er ging hinaus, schlug die Läden zu, verriegelte sie, überblickte die einsame Straße, soweit seine Augen reichten, kehrte zu seinem Kunden zurück, trat hinter den Ladentisch und, eine Uhrmacherlupe in seine Augenhöhle klemmend, begann er die Steine zu prüfen: sechs große Diamanten, drei Smaragde in Rohschliff, zwölf Saphire und acht Rubine. Der Unbekannte folgte schweigend seinen Bewegungen, jede Hantierung der Finger scharf beobachtend. Als er das sah, kreuzte Halz die Hände auf dem Rücken. Diese Vorsichtsmaßnahme schien dem Mann zu gefallen, denn er sagte:
»Fassen Sie ruhig an.«
»Ist nicht nötig«, antwortete der Steinhändler; »ich kann's auch so beurteilen.«
Bis jetzt hatte der Mann ein schlechtes Holländisch gesprochen, untermischt mit Deutsch und Flämisch. Da er nicht gut verstanden hatte, fragte er:
»Wäre es Ihnen möglich, englisch zu sprechen?«
»Wenn Sie es vorziehen? Sind Sie Engländer?«
»Ire. Ich bin aus Cork, aber ich habe lange in den Kolonien gelebt.«
Halz maß ihn mit durchdringendem Blick und brummte:
»Wenn Sie wollen ...«
Schon hatte er den Kopf wieder gesenkt, um die Prüfung der Steine fortzusetzen; der Mann schien von der Antwort enttäuscht und fuhr in barschem Ton fort:
»Wenn ich es Ihnen doch sage ...«
»Bah,« machte der Steinhändler, »was kümmert's mich, ob Sie Engländer, Irländer oder Schweizer sind! Sie verkaufen, ich kaufe; alles andere ist mir gleichgültig. Denn ich denke, Sie sind zu mir gekommen, um das Zeug zu verkaufen.«
»Na, natürlich.«
Halz lehnte sich an die Wand, fuhr mit der Hand über seinen Mund und das Spitzbärtchen und fragte:
»Was wollen Sie fürs Ganze?«
»Potztausend, wie Sie rangehen«, grinste der Mann. »Bilden Sie sich etwa ein, daß ich das im Ramsch verkaufe wie altes Eisen?«
»Sie verkaufen es, wie Sie es gekauft haben«, antwortete Halz in ruhigem Ton. »Übrigens,« fügte er hinzu mit einer Bewegung, als wolle er die Steine zurückschieben, »ich mache nicht solche Geschäfte. Ich befasse mich nur mit dem Schleifen von Diamanten ...«
Der Unbekannte zuckte die Achseln:
»Hier? In diesem Stall? Na, alter Seeräuber, markier' nicht den Oberschlauen bei mir; wir wollen lieber weiterreden, ich glaub', wir werden schon zusammenkommen. Die Kieselsteine sind hübsch; du hast nicht oft Gelegenheit, solche zu sehen ... Mach' nicht gleich die Ware schlecht, sie ist ohne Fehler: keine Trübung, nicht ein Fleck, und ich kenne den Wert und weiß Bescheid, genau so wie du.«
Halz, der sich auf den Ladentisch gesetzt hatte und mit dem größten Diamanten spielte, sagte:
»Sprich französisch, es wird dir leichter fallen.«
Der Unbekannte ballte die Fäuste. Er war herkulisch gebaut, er hätte Halz leicht mit einer Hand hochheben können. Aber dieser kleine Alte hatte eine so ruhige Art, zu reden und vor allem irgend etwas in der Tasche seines weiten Überrocks zu bewegen, daß der Riese es für besser hielt, vernünftig zu bleiben. Er sagte nun doch französisch:
»Mach' mir ein Angebot, Stein für Stein.«
»Nein, das Ganze.«
»Nein.«
Danach sammelte er das, was er »die Kieselsteine« nannte, in der hohlen Hand und, bereit, sie in den Sack gleiten zu lassen, betonte er:
»Ist das dein letztes Wort?«
Seine Frage klang so bestimmt, daß Halz zögerte. Die Steine waren schön, wirklich, und es ist töricht, sich zu versteifen, wenn ein Geschäft möglich ist.
»Lassen Sie mich nochmal sehen.«
Der Unbekannte öffnete die Hand; Halz ordnete die Steine nach Farbe und Schliff, machte einen flüchtigen Überschlag und sagte, sie Stück für Stück mit dem Zeigefinger bezeichnend:
»Dreitausend Francs; zweitausendfünfhundert; zweitausenddreihundert; diese beiden fünfzehnhundert.«
Der Mann wartete ab, dann, in seinem Stuhl zurückgelehnt, sagte er mit ironischer Stimme:
»Willst du auch meine Uhr?«
»Meiner Treu,« antwortete Halz, ohne seine Gemütsruhe aufzugeben, »wenn es sich lohnt ... Aber genug gescherzt; zur Sache. Man wird sowas nicht so leicht los wie Banknoten; bevor ich sie absetze, werde ich sie sechs Monate halten müssen, ein Jahr, vielleicht noch länger ... Das ist totes Kapital ...«
»Du kannst sie morgen verkaufen, wenn du Lust hast.«
»Jawoll,« sagte der Steinhändler, »und die Polizei?«
»Die Polizei hat nichts damit zu tun; die Steine können nicht beschlagnahmt werden. Wenn du die Beschreibungen der in Europa seit einem Jahr, seit zwei Jahren und selbst noch früher gestohlenen Schmucksachen durchsiehst, so wirst du keine finden, die sich auf meine Kieselsteine bezieht ...«
»Wenn's so ist, warum bietest du sie mir an und nicht einem Juwelier? Er würde dir einen besseren Preis zahlen ...«
»Frag' ich dich vielleicht, warum du, reich wie du bist, in solch einem Loch haust? Du hast dein Geheimnis, ich hab' meins. Wollen wir keine Zeit verlieren, verdopple den Preis und die Sache ist gemacht.«
»Vierzigtausend rund.«
»Gemacht, vierzigtausend.«
Halz, der die Scheine aus dem Schrank geholt hatte, murmelte:
»Vierzigtausend! Vierzigtausend! Das ist ein Stück Geld ... Abgemacht ist abgemacht ... Hast du sonst nichts?«
»Da«, antwortete der Mann, zog aus seiner Tasche die drei Säckchen, leerte ihren Inhalt, wie er es mit dem ersten gemacht hatte; »dieselbe Ware, dasselbe Gewicht, der gleiche Preis.«
»Hundertzwanzigtausend!« rief der Steinhändler aus.
»Keinen Sou weniger.«
Er schickte sich an, seine Ware wieder einzupacken; Halz unterbrach ihn:
»Gott, hast du's eilig! Laß mich verschnaufen, zum Teufel! Ich überlege ... Wenn ich das Geld hätte, würde ich ja nichts sagen ... Aber ich hab' bloß die Hälfte ... Willst du sechzigtausend sofort und den Rest in drei Tagen? Kannst ganz beruhigt sein; das Geld ist sicher; mein Wort ist ebensogut wie ein Scheck.«
Während er noch sprach, zählte er bereits ein neues Geldpäckchen auf. Der Unbekannte schien zu zögern, dann entschloß er sich:
»Einverstanden.«
Halz wandte den Kopf zur Seite, um sein Lächeln zu verbergen, und zählte die Scheine mit nervösen Fingern.
»Siebenundfünfzig, achtundfünfzig, neunundfünfzig, sechzig.«
Der Mann nahm das Päckchen Banknoten und wandte sich zur Tür. Im Begriff, sie zu öffnen, drehte er sich auf dem Absatz um.
»Wenn man solch eine Summe bei sich hat, weiß man nie, ob einem nicht was Schlimmes begegnet ... Hast du nicht vielleicht einen Revolver zu verkaufen?«
»Einen Revolver? Doch, ich hab' gerade einen ausgezeichneten da.«
Er hielt einen großen Browning hin. Der Mann betrachtete ihn:
»Wieviel?«
»Hundert Francs.«
»Zieh' ab, ich hab' kein Kleingeld; da ist 'n Tausender.«
Halz wehrte ab.
»Laß doch! Ich werde diese Kleinigkeit vom Rest abziehen.«
»Wie du willst«, sagte der Unbekannte, und hob die Waffe hoch, als ob er den Mechanismus prüfen wollte.
Halz lächelte, machte eine freundschaftliche Bewegung mit der Hand und zog verschmitzt aus seiner rechten Tasche eine gleiche Waffe hervor!
» Dieser hier ist geladen, und ich brauchte nur eine kleine Bewegung zu machen, nicht wahr, um wieder in den Besitz meines Geldes zu kommen? Gestehe, an meiner Stelle würdest du nicht zögern.«
»Schieß doch!« brummte der Mann, wütend, daß man ihn so gut erraten hatte.
»Ich, schießen? Wo denkst du hin? Das Gefängnis, – schlimmstenfalls, – aber der Strick ... brrr! Möchtest du nun Patronen für den Weg? ...«
Der Mann schleuderte den Revolver mitten ins Zimmer und ging hinaus, indem er die Tür zuknallte. Halz sah, wie er sich mit großen Schritten entfernte und, unter dem Platzregen geduckt, um die Straßenecke bog. Er kehrte in seinen Laden zurück, streute den Inhalt der vier Säckchen auf den Ladentisch, betrachtete ihn lange mit Andacht, dann schüttelte ein Lachen seine Schultern, und er sagte laut:
»Einige Millionen für hundertzwanzigtausend Francs, ja, ja! Das ist nicht schlecht, alter Joachim!«
Aber das Geschäft war noch viel besser, als er dachte, denn der Unbekannte kehrte nie wieder, um den Rest des Geldes abzuholen.
Erster Teil
I
Herr Hardant hemmte seinen Schritt beim Eintreten in die Halle der Transozeanischen Gesellschaft, deren Direktor er war. Eine aufgeregte Menge drängte sich vor den Tafeln, wo ein Angestellter von Zeit zu Zeit Depeschen aufklebte.
Seit zehn Tagen war man ohne Nachrichten von der »Shanghai«. An diesem Morgen meldete ein Radiotelegramm aus New York eine Katastrophe, ohne genaue Angaben zu machen, und die meteorologischen Nachrichten der Nacht vermerkten einen heftigen Sturm im Indischen Ozean; dies in Verbindung mit dem Schweigen der Gesellschaft hatte das Publikum vollends verwirrt.
Ein Page lief herbei, um das Gitter des Aufzugs zu öffnen; Herr Hardant machte eine verneinende Bewegung, wandte sich nach links, trat durch eine andere Tür und ging in sein Büro hinauf.
Etwa zwanzig Telegramme häuften sich auf seinem Tisch. Er warf einen Blick auf das erste, schob die anderen beiseite, ohne sie zu lesen, machte einige Schritte kreuz und quer durch das Zimmer, betrachtete, die Stirn an der Scheibe, das Wirrwarr der Schiffsmasten im alten Hafen, den von Menschen wimmelnden Kai, ließ dann den Vorhang fallen, wandte sich einer an der Wand befestigten Karte zu und verfolgte mit dem Finger eine Linie, welche von Havre ausgehend den Atlantischen Ozean durchquerte, das Kap der Guten Hoffnung berührte, dann durch den Indischen Ozean in Australien endete. Sein Finger hielt einen Augenblick inne, und seine Augenbrauen zogen sich zusammen.
Die Tür öffnete sich: alsbald nahm sein Gesicht einen ruhigen Ausdruck an und, ohne sich umzusehen, sagte er:
»Sind Sie es, Le Goutelier?«
»Ja, Herr Hardant.«
»Etwas Neues?«
»Nichts.«
Er pfiff die ersten Takte eines Liedes und murmelte:
»Das ist ärgerlich.«
»Das ist sogar beunruhigend.«
Herr Hardant drehte sich um:
»Ach, alle verlieren hier den Kopf, meine Angestellten sowohl wie das Publikum. Weil ein schlecht informierter Journalist eine dumme Depesche veröffentlicht, seid ihr alle närrisch geworden. Was, sogar Sie ...«
»Ich bin nicht närrisch, Herr Hardant, ich bin nur beunruhigt, wie's mein Recht ist, ja, fast meine Pflicht. Nun sind es bereits dreißig Tage, seit das Schiff abgegangen ist ...«
»Wir haben von jedem Landungsplatz Nachrichten gehabt: wir sind in ständiger Radioverbindung mit ihm geblieben ...«
»Jedoch seit St. Paul, das es am 17. berührt hat, nichts mehr.«
»Von St. Paul bis Melbourne fährt es ohne Aufenthalt ...«
»Das dürfte es nicht verhindern, uns ein Radiotelegramm zu schicken ...«
»Das Schiff hat vielleicht einen Schaden gehabt; Maschine ist eben Maschine.«
»Das sag' ich mir auch, und deswegen hab' ich nicht alle Hoffnung aufgegeben.«
Der Angestellte sprach mit unerschütterlicher Ehrerbietung; Herr Hardant sah ihm in die Augen:
»Sie haben also Angst, Le Goutelier?«
»Ich gebe es zu, Herr Hardant. Selbstverständlich sage ich keinem etwas von meinen Befürchtungen, im Gegenteil versuche ich, denjenigen Vertrauen einzuflößen, die um Nachrichten kommen; ich möchte Ihnen aber nicht verheimlichen, daß dies immer schwieriger wird. Die Leute denken sich, daß wir die Wahrheit verbergen ... Hinzu kommt, daß unselige Gerüchte rätselhaften Ursprungs in Umlauf sind ...«
»Was für Gerüchte?«
Le Goutelier zuckte die Achseln:
»Weiberklatsch, leeres Geschwätz ...«
»Was für Geschwätz? Was für Klatsch? Bitte, keine Verheimlichung. Sie wissen, ich liebe das nicht, und Sie haben zuviel gesagt, um jetzt nicht alles sagen zu müssen.«
Er packte seinen Angestellten am Rock und sprach mit einer vor Zorn und Erregung zitternden Stimme.
»Also schön: man sagt, daß die ›Shanghai‹ ein altes verbrauchtes Schiff sei, daß sie nicht ohne sorgfältigste Prüfung hätte abfahren dürfen, daß ihre Ladung zu schwer war, daß der Kapitän Sie vor der Abfahrt darauf aufmerksam gemacht hätte ...; schließlich und endlich, daß die Gesellschaft sich eine Nachlässigkeit hat zuschulden kommen lassen ...«
Herr Hardant schlug mit der Faust auf den Tisch:
»Zum Donnerwetter! Wer hat das gesagt?«
»Niemand und jeder. Wer kann sagen, woher solch Gemunkel kommt? Die Gerüchte hören vor der Tür Ihres Arbeitszimmers auf; ich, der ich mit dem Publikum in Fühlung komme, und das Personal, wir hören das wie ein dauerndes Summen. Da sind Fragen, Anspielungen, Stillschweigen. Vor kaum einer Stunde kam der Prokurist des Hauses Solding und Beurke ... Ich habe ihn hinauskomplimentiert, so gut ich konnte ... Aber ...«
»Sollte er wiederkommen, schicken Sie ihn bitte zu mir.«
»Gern, Herr ...«
Das Telephon läutete.
»Wollen Sie, bitte«, sagte Herr Hardant, auf den Apparat weisend.
Le Goutelier hob den Hörer ab und wandte sich zu seinem Chef:
»Herr Beurke ist gerade da.«
»Er soll heraufkommen.«
Herr Hardant lehnte sich an den Kamin und zündete eine Zigarette an; Herr Beurke erschien. Er war leichenblaß. Herr Hardant wies auf einen Sessel:
»Womit kann ich dienen, mein Herr?«
»Herr Direktor, Sie haben einen äußerst erregten Menschen vor sich ... In der Stadt behauptet man, daß die ›Shanghai‹ Schiffbruch erlitten habe, daß die Gesellschaft es wisse und nicht einzugestehen wage.«
Herr Hardant zeigte auf die Depeschen, die sich auf seinem Tisch häuften:
»Da sind die Telegramme, die uns in den letzten vierundzwanzig Stunden zugegangen sind; Sie dürfen sie einsehen, es ist nicht ein einziges darunter, das die mindeste Anspielung auf eine solche Nachricht enthält. Ich füge hinzu, daß, wenn ein solch furchtbares Unglück – was Gott verhüten möge – sich zugetragen hätte, die Gesellschaft es nicht eine Sekunde verschweigen würde. Wenn wir ein Schiff ausrüsten, wenn wir das Kommando einem ehrlichen und erfahrenen Manne anvertrauen, so haben wir alles getan, was menschenmöglich ist, – ich sage das, um im voraus Ihre Einwände, die ich errate, zu widerlegen, – und vor einer Katastrophe sind wir auch nur Menschen, denn unsere Gesellschaft ist eine große Familie, und die Brüderlichkeit auf dem Meere ist kein leeres Wort.«
»Ich begreife, ich begreife ... Aber bitte begreifen Sie nun Ihrerseits, daß die ›Shanghai‹ für zehn Millionen Edelsteine mit sich führt, die mein ganzes Vermögen ausmachen und das meines Teilhabers. Muß man nicht bei dem Gedanken zittern ...?«
Herr Hardant schnitt ihm mit einer heftigen Bewegung das Wort ab. Ein lebhaftes Rot hatte seine Wangen gefärbt:
»Wenn die ›Shanghai‹ für zehn Millionen Edelsteine trägt, so trägt sie doch auch hundertzwanzig Mann Besatzung und zweihundert Passagiere; gestatten Sie mir, Ihnen zu entgegnen, daß das eine das andere wohl aufwiegt, und daß Ihre Sorgen, verglichen mit unseren, wenig bedeuten.«
Der Juwelier senkte den Kopf; Herr Hardant holte tief Atem; sein Gesicht, das einen Augenblick verzerrt war, gewann seine Ruhe wieder, und er fuhr mit beherrschter Stimme fort:
»Im übrigen wiederhole ich nochmals: alles, was man erzählt, ist falsch. Daß das Schiff einen Defekt erlitten hat, eine Havarie, ist möglich, sogar wahrscheinlich, aber von da bis zum Untergang! ...«
»Gott erhöre Sie, mein Herr, zunächst um der guten Leute willen, die an Bord Ihres Schiffes sind, ... und dann für Solding und mich! Wir haben einen Fehler begangen, einen unverzeihlichen Fehler, indem wir unser Gut nur für die Hälfte seines Wertes versichert haben.«
»Das ist ja toll«, murmelte Herr Hardant, nachdem er seinen Besucher hinausbegleitet hatte.
Dann wandte er sich zu seinem Angestellten, der während der ganzen Dauer der Unterredung Akten durchgesehen hatte:
»Haben Sie das gehört, Le Goutelier; was sagen Sie dazu? Ein Haus, das, um einige Kröten zu sparen, nur fünfzig Prozent seiner Fracht versichert? Ja, ja, der Geiz! ...«
Le Goutelier sah« seinen Chef an:
»Glauben Sie diese Geschichte? Solding und Beurke sind doch keine Kinder; sie gelten vielmehr als sehr gerissen. Ich verstehe nichts von Edelsteinen, ich hab' die aber gesehen, – Solding hat sie uns gezeigt, dem Kapitän und mir, bevor sie in den Tresor der ›Shanghai‹ eingeschlossen wurden, – und ich hatte nicht den Eindruck, daß es für zehn Millionen waren. Meiner Meinung nach waren es, im Gegenteil, nur für zwei oder drei Millionen, und sie haben sie für das Doppelte versichert.«
»Sachte, sachte, Le Goutelier, Sie verlieren den Kopf, mein Freund. Zunächst halte ich Solding und Beurke für ehrenhafte Leute; alsdann müßte man, vorausgesetzt, daß sie unehrlich sind, annehmen, sie hätten, damit eine derartige Schiebung gelänge, das Schiff mutwillig zerstört oder durch irgendein anderes Mittel die Sicherheit einer Katastrophe gewonnen ...; alles Dinge, ebenso gräßlich wie widersinnig.«
»Gräßlich schon, widersinnig nicht so sehr, – theoretisch natürlich. – Wie ich vorhin sagte, waren vor der Abreise böse Gerüchte über die ›Shanghai‹ im Umlauf, – übelwollende, blödsinnige Gerüchte, wir wissen es. Nehmen Sie aber an, daß Solding und Beurke daran geglaubt, daß sie sich gesagt hätten: ›Das Schiff wird seine Reise nicht beenden ...‹ Ein unwissender oder mitschuldiger Experte schätzt die Ware auf das Doppelte ihres Wertes; sie zahlen die Prämie, ohne mit der Wimper zu zucken: wenn das Unglück eintritt und das Schiff sinkt, sind sie gemacht; wenn es wohlbehalten in den Hafen einläuft, ... sind nur ein paar Scheine auf Gewinn- und Verlustkonto zu buchen, wie beim Rennen, nicht wahr, hundert gegen eins.«
Herr Hardant biß auf seinen Schnurrbart.
»Tja, aber wenn beim Rennen der Jockei durch einen Trick gewinnt, so ist es nur eine kleine Gaunerei, während hier ein derartiges Spiel ein Verbrechen wäre, und was für eines! ... Nein, nein, das ist sinnlos!«
»Es kann sein, Herr Hardant; ich will mich ja gern täuschen, aber ich mag Geschäftsleute nicht, die plötzlich daherkommen und einem vormachen wollen, daß sie Dummköpfe sind.«
Von unten tönte der wachsende Lärm der Menge, die sich in der Halle und bis auf den Kai drängte. Jeden Augenblick kamen weitere Neugierige hinzu; die einen befragten ihre Nachbarn, standen da, wurden geschoben, getragen von dieser lebendigen Welle; andere versuchten, sich einen Weg zu bahnen. Die letzteren hatten angstvolle Gesichter, heftige oder bittende Bewegungen, und das, was sie sagten, mußte wohl rührend sein, denn die Gruppen öffneten sich vor ihnen.
Das waren Verwandte oder Freunde der Passagiere oder der Besatzungsleute.
Hardant betrachtete dieses Schauspiel, horchte auf dieses Getrampel, das sich wie Meereswellen fortpflanzte. Die Angst, gegen die er seit einer Woche ankämpfte, begann ihn zu überwältigen; die ansteckende Nervosität bemächtigte sich seiner. Zum zweitenmal hob er den Vorhang, ließ ihn wieder fallen, ging im Zimmer hin und her, blieb stehen, ging wieder weiter, hob die Arme zum Zeichen seiner Ohnmacht und murmelte:
»Ihr, mit euren teuflischen Geschichten! ...«
Blieb dann, die Hände in den Taschen, vor seinem Angestellten stehen:
»Nun sagen Sie selbst, Le Goutelier, habe ich mir irgend etwas vorzuwerfen, ja oder nein? War die ›Shanghai‹ in der Verfassung, solche Überfahrt zu unternehmen, ja oder nein?«
Ein Klopfen an der Tür verhinderte die Antwort; Hardant rief: »Herein!« und mit ungeduldiger Stimme:
»Was gibt's schon wieder?«
»Herr Direktor,« sagte der Bürodiener, »Frau Deherche ist da; ich habe ihr gesagt, daß Herr Direktor nicht zu sprechen wäre, sie hat aber so darauf bestanden, daß ich glaubte, ...«
»Bitten Sie die Dame herein.«
Frau Deherche trat ein. Sie war eine junge Frau, hübsch, sehr elegant, viel eleganter als im allgemeinen die Frauen der Übersee-Kapitäne, die doch wahrhaftig keine Millionäre sind.
Obwohl er die Gewohnheit hatte, sich niemals in das Privatleben seiner Offiziere einzumischen, hatte Hardant einmal Deherche durchaus freundschaftliche Vorhaltungen gemacht.
»Ich bestreite nicht,« hatte der Offizier geantwortet, »aber was soll man machen? ... Es ist ein harter Beruf, der Seemannsberuf, hart für uns, und hart für unsere Frauen. Man heiratet, um ein Heim zu haben ... – was wird daraus? – um zusammen zu leben – wieviel Wochen im Jahr kommt es denn vor? Ich hab' mir ausgerechnet: von dreihundertfünfundsechzig Tagen bleibe ich an Land, ich meine bei mir zu Hause, im ganzen fünfzig Tage! Kaum gelandet, denkt man schon an die nächste Fahrt. Wir Männer, wir haben unsere Berufspflichten, die Arbeit während der Überfahrt, das Meer, die fremden Länder, all das, weswegen wir diesen Beruf gewählt haben; aber unsere Frauen? ... Es mag sehr hübsch sein, an der Ofenecke zu warten, die Erziehung eines Kindes zu überwachen; aber es ist sehr traurig, sehr eintönig! Ein bißchen Eitelkeit ist keine große Sünde; meine Frau liebt die schönen Kleider, die schönen Hüte, Schmuck – was kann ich ihr schon für Schmuck bieten; – immerhin, da ich für mich nichts oder fast nichts ausgebe ... Bevor ich heiratete, hatte ich nur eine Liebe: das Meer; dann kamen zwei Leidenschaften, die sie verwischten: meine Frau und mein Junge. Ich mache ihnen das Leben so angenehm wie möglich ...«
Als er Frau Deherche sah, erinnerte sich der Direktor an diese Unterhaltung, und es war ihm unangenehm, daß die junge Frau so elegant war. Doch sofort erwehrte er sich dieses Eindrucks.
Ganz entschieden verriet ihr Kleid das gute Atelier, ebenso die Schuhe und der schwarze Velourhut, der ihr hübsches Gesicht beschattete; muß man denn, weil ein Unglück in der Luft liegt, seine Kleidung verändern, eine armselige Bluse, einen fadenscheinigen Rock anziehen, um anders auszusehen wie sonst? Übrigens lag der jungen Frau jede Absicht, zu gefallen, fern, und sie war vor Angst so erstarrt, daß sie zunächst unfähig war, ein Wort hervorzubringen. Herr Hardant führte sie zu einem tiefen Sessel, in den sie sich fallen ließ.
»O Gott, Herr Direktor, ist es wahr, was man erzählt, daß Sie Nachrichten haben und sie nicht veröffentlichen wollen? Nun sind es schon drei Tage, daß ich weder auszugehen noch eine Zeitung zu öffnen wage vor Angst, zu erfahren, daß ...«
Sie kam nicht zu Ende und verbarg schluchzend das Gesicht in ihren Händen. Herr Hardant entfernte die Hände sanft und erwiderte dann:
»Ein bißchen Ruhe, ein bißchen Mut, liebes Kind.«
Beim Wort »Mut« erhob sie den Kopf.
»Ich verstehe, Herr Direktor, ich habe begriffen. Ich werde all den Mut haben, der nötig ist.«
Er wehrte ab.
»Aber wo! Gott sei Dank, davon sind wir noch weit entfernt! Entweder haben Sie mich falsch verstanden, oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Noch ist nichts verloren. Ich meinte nur, daß Sie, als Tochter eines Seemanns und Frau eines Seemanns, sich nicht so gehen lassen dürfen. Diese Verspätung ist aufregend, dieses Schweigen beunruhigt mich; Sie sehen, ich rede ganz offen mit Ihnen, aber deswegen ein derartiges Unglück als sicher anzunehmen, ja selbst als wahrscheinlich! ...«
Sie faltete ihre Hände, und ihre Wangen röteten sich wieder.
»Ach Gott, mein Herr! ...«
Ihren Kummer vergessend, lächelte sie schon wieder. Der Schmerz paßte nicht recht zu ihrem kleinen Puppengesicht, zu ihren offenen Augen, zu ihrem Mund, der stets zu lächeln bereit war. Sie konnte nur einen Augenblick ernst bleiben, und schon in der nächsten Sekunde war sie wieder heiter und unbesorgt.
Und Herr Hardant erinnerte sich' noch an etwas anderes, was ihm Deherche erzählt hatte: