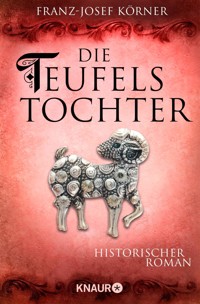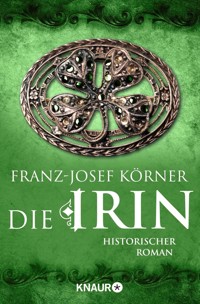
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Irinnen-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein opulenter historischer Roman im mittelalterlichen Europa des 14. Jahrhunderts! Die junge Irin Sinead und ihr Geliebter Colin erleiden auf dem Weg von England nach Irland Schiffbruch. Sinead wird gerettet, jedoch kurze Zeit später von Piraten gefangen genommen. Bei einem Angriff auf das Schiff des böhmischen Königssohns Karl gelingt es ihr zu fliehen. Die Ereignisse überschlagen sich, sie wird unfreiwillig zur Komplizin bei der Entführung des späteren Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dieser Mann wird noch eine größere Rolle in ihrem Leben spielen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Franz-Josef Körner
Die Irin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die junge Irin Sinead und ihr Geliebter Colin erleiden auf dem Weg von England nach Irland Schiffbruch. Sinead wird gerettet, jedoch kurze Zeit später von Piraten gefangen genommen. Bei einem Angriff auf das Schiff des böhmischen Königssohns Karl gelingt es ihr zu fliehen. Die Ereignisse überschlagen sich, sie wird unfreiwillig zur Komplizin bei der Entführung des späteren Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dieser Mann wird noch eine größere Rolle in ihrem Leben spielen …
Inhaltsübersicht
I. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
II. Buch
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
III. Buch
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
IV. Buch
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Nachwort
Personen
I. Buch
1336SILBER
1
Du hast deine Mutter getötet! Das war deine allererste Tat!«
Wenn Seamus, mein irischer Vater, in Suff und Selbstmitleid versank, klagte er mich dieser Ungeheuerlichkeit an. Mutter war kurz nach meiner Geburt im Kindbett gestorben. In seiner Verbitterung über den Tod der vergötterten Frau lud er mir jenen Schmerz auf, den er selbst nicht verwinden konnte.
»Dein erster Atemzug war ihr letzter. Du trägst das Unglück wie eine faule Frucht in dir!«, schrie er, wenn seine Verzweiflung die Liebe zu mir, seiner Tochter, vergiftete. »Das hat mir eine alte Hexe nach deiner Geburt prophezeit. Sie kam daher, hat dich angesehen und gesagt, dass der Tod dich immer begleiten wird.«
Damals verlor er endgültig den Boden unter den Füßen. Seine ganze Kraft verwandte er auf das Erlangen eines fragwürdigen Zustands. Den ewigen Rausch schürte er wie ein alles vernichtendes Feuer, das nie verlöschen durfte, mit Unmengen Schnaps. Dieses Bemühen galt nur einem Ziel: jenes Gleichgewicht zu bewahren, dessen es bedurfte, um der wirklichen Welt so fern wie möglich zu bleiben – ohne dabei vollkommen in Besinnungslosigkeit zu versinken.
»Deine Mutter«, lallte und heulte er wie ein kleines Kind, »war eine sanfte Frau, zu sanft für mich und all das hier!« Seine Rechte beschrieb einen wütenden Halbkreis, und er bemerkte nicht, wie er sich mit jedem weiteren Wort selbst widersprach. »Sie war der Schutz vor meinen verfluchten Sehnsüchten, vor den Geistern und dem ganzen beschissenen Leben!«
Dann fing er an zu schluchzen, und ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Jahrein, jahraus fluchte, weinte und soff er ohne Unterlass, verdammte den Herrgott, die Welt und dann sogar meine Mutter, sie sei eine vermaledeite Buhle, die ihn verlassen habe. Er phantasierte von seinem Traum, noch einmal seine Heimat Irland, die grüne Insel, zu sehen, und wusste selbst nicht, was ihn mehr verzweifeln ließ – der Suff, die Fremde oder der Tod der geliebten Frau.
Oftmals schlang ich meine weißen Arme um ihn, lehnte eine Wange an sein zerstörtes Gesicht und versuchte, ihn zu trösten. Ich ließ mein Haar, das rot war wie die Sonne, die dort unterging, wo das Land seiner Sehnsucht lag, seinen irischen Schädel umrahmen. Ich sang die alten Lieder, bis er vornüberkippte, sein weinerliches Selbstmitleid in besoffenem Schnarchen versank und das kantige Gesicht mit den Narben und Furchen und der zerschlagenen Nase im eigenen Sabber. Dann überließ ich ihn seinen bösen Träumen, seinem Delirium, schob ich mich an den Armlehnen seines Eichenstuhls in die Höhe, und nahm den Heiligenschein meiner Locken von ihm.
Indes, ein Heiliger war er nie gewesen. Lange bevor meine Mutter im Kindbett starb, schaufelte er ihr Grab mit seinen Saufgelagen und Weibergeschichten, mit seinem selbstzerstörerischen Bemühen, die Lebenskerze an beiden Seiten anzubrennen. Er war ein Säufer und Hurenbock von Anfang an – und nur eine einzige Sache änderte er nach dem Tod meiner Mutter: Er hörte auf mit der Herumhurerei. Mit seiner irischen Logik argumentierte er nun: »Das würde sie verletzen.«
In jener Zeit, als er nicht heimisch werden konnte in dem düsteren, von Nebel und Regen überzogenen Cumbrien in England, dessen Menschen er als Feinde beschimpfte, obwohl sie uns herzlich willkommen geheißen hatten – damals trat Seamus wider Willen das Erbe meiner Mutter an. Allein das Gedenken an sie und sein schlechtes Gewissen befahlen ihm zu bleiben. Dieses Land – hügelig, verwinkelt, verwunschen – hasste er mehr als alles auf der Welt nur aus dem einen Grund: Hier war er nicht geboren.
»My little girl!«, flehte er lallend. »Flechte dein Haar! Renn ein Stück, dass ich die Zöpfe um deine Schultern tanzen sehe!« Tränen flossen durch die Furchen seiner Wangen wie Bäche durch zerklüftetes Land. »Lauf über die Hügel, lass deine Zöpfe hüpfen wie Flammenzungen!« Dann fiel er vornüber, schlief ein, schnarchte – und ich flüchtete zur alten Eiche am Ufer des Sees. Ich lehnte meine Wange an den moosbewachsenen Baum. Geduldig lauschte der Stamm meinen Tränen und wiegte seine Äste bedächtig zu meinem Kummer. Das Blätterdach wisperte und versprach mir all jene Dinge, von denen ein Mädchen träumt.
Eines Tages trug mir der Sommerwind schon von weitem ein Lied zu. Ich folgte der Klangspur wie einem geheimnisvollen Zauber, der mich geradewegs zu meinem Baum führte. Dort, am Stamm, lehnte ein Mann. Unverschämt!, dachte ich zunächst, diese Eiche ist angefüllt mit meinen Geheimnissen! Sie kennt all meine Träume, meine verborgensten Wünsche! Verschwinde!, wollte ich dem Fremden an den Kopf werfen – doch da traf mich sein Blick, und ich blieb stehen. Ich runzelte die Stirn, überrascht von der seltsam nüchternen Erkenntnis: Dies ist der Mann, den ich lieben werde, mein ganzes Leben lang.
»Komm zu mir!«, schien der alte Baum zu flüstern, doch es war seine Stimme, die mich umgarnte, um mich herumschlich, dunkel, samtweich, wie Katzenpfoten.
Bald vertauschte ich das Mooskissen am Baumstamm mit seiner Schulter, an die ich mich schmiegte. Er hielt mein Herz in seiner Hand, seine Lippen strichen über meine Haut und kräuselten den Flaum in meinem Nacken wie ein Sommerhauch das Weizenfeld. Ich lernte, dass Liebe etwas anderes sein kann als nur das Ertragen jener bitteren Verzweiflung, die mich mit meinem Vater verband. Endlich schien alles gut. Oft schloss ich die Augen und weinte vor Glück. Und in der Nacht rief ich den Sternen seinen Namen zu:
»Colin! Ich liebe dich!«
Doch gleich darauf flüsterte ich atemlos: »Gütiger Himmel, es wird niemals gutgehen! Eine Irin und ein Engländer!«
In jenen Jahren wäre Seamus wohl jämmerlich krepiert. Sein erschöpftes, kaputtes Leben hätte in der Fremde ein Ende gefunden – besiegelt vom Schnaps und von quälenden Erinnerungen. Doch er war unglaublich zäh und stur. Sein starrsinniger Wille bäumte sich noch einmal auf. Er holte mit dem Becher weit aus, schleuderte ihn wütend gegen die Wand und brüllte: »My little girl! Nimm Abschied von diesem Loch! Wir gehen nach Hause, wir kehren heim!«
Verwirrt, ungläubig rannte ich zu meinem Geliebten. »Colin, Vater geht fort und nimmt mich mit nach Irland! Was soll ich denn tun? Ich kann ohne dich nicht sein!«
Colin nahm mein Gesicht in die Hände. Seine dunklen Augen hielten mich fest. »Ich komm mit dir«, versprach er und schenkte mir ein zuversichtliches Lächeln. Er hielt sein Versprechen. Ohne ein Wort des Abschieds an seine Heimat – oder auch nur ein zweites Hemd – kehrte er seinem Leben den Rücken und ging mit mir, bedingungslos.
Wie von Wahnsinn getrieben oder vom Leibhaftigen verfolgt, zerrte uns Vater zwei Tage gen Westen. »Ins einzige Land! Nach Hause! Ins Paradies!«, wie er uns vorwärtsstürmend wieder und wieder versicherte, ohne zu ahnen, wie nahe er dabei der Wahrheit kam. Und wie zum Hohn, so schien es uns, überflutete die rote Herbstsonne Cumbrien, das sonst meist im Nebel lag.
Unterhalb der Klippen, die urplötzlich schroff zu unseren Füßen abbrachen, grollte düster und drohend das Meer.
»Verflucht, ich habe keinen Schnaps!«, brüllte er gegen den frischen Wind. »Wie soll nur ein Mann seine Heimat finden, wenn es nichts zu saufen gibt!«
»Dort unten!«, rief Colin und deutete auf die Kogge, die dickbauchig, beladen mit Korn und blökenden Schafen, im Schutz des Hafens lag.
»Fett und träge wie eine alte Hure«, schnaufte Vater verächtlich, trat einen Schritt vor und zwei zurück.
»Immerhin ein Schiff!« Ich wagte mich als Erste nach unten. Wir beäugten die Kogge, misstrauisch, auf der Hut, ohne zu wissen, wovor.
Eine Stimme rief: »Kommt an Bord, ihr könnt kein besseres Schiff bekommen, um euer Ziel zu erreichen! Der Ostwind ist günstig.«
»Woher willst du wissen, was unser Ziel ist?« Vaters Stimme klang überraschend nüchtern, ja heiter.
»Einen Iren erkenne ich auf zwei Seemeilen Entfernung«, kam die Antwort. Taue klatschten ins Wasser, schabten am Schiffsrumpf entlang, so dass ich den Wunsch bekam, mich am Rücken zu kratzen. Aus der Dämmerung griffen Hände nach uns, zogen uns an Bord. Die Ankerkette wand sich knirschend und quietschend nach oben, wo wir nun an Deck standen, durchnässt von einem plötzlichen Schauer. Vater zahlte den Preis für die Überfahrt, und wir stachen in See.
Bald drehte der Wind und schwoll zum Sturm an. Die See begann zu toben und trieb uns nach Süden, als wäre Vaters Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, ein unerhörtes Verlangen.
Wir kamen nicht weit. Der Sturm tobte die ganze Nacht, zerriss schließlich das Segel, fällte den Mast. Im tosenden Wind verhallten unsere verzweifelten Gebete um Rettung ungehört, vielleicht, weil Gott uns ankreidete, dass wir in besseren Zeiten auch nie zu ihm gebetet hatten.
Vater nahm einen Strick und band Colin und mich an sich fest. Er stemmte die Beine in die Planken und schleuderte trotzig einen Fluch gegen die wütenden Elemente.
Trotzdem! Das Schiff sank. Es stampfte, ächzte, stöhnte, legte sich zur Seite, als sei es müde. »My little girl!«, brüllte Vater, und als ich das Weiße in seinen Augen sah, wusste ich, dass er den Kampf um mein Leben aufnehmen wollte – um seines ging es ihm schon nicht mehr.
»Vater!« Der Sturm trug meinen Schrei davon. Unsere Köpfe tanzten auf der aufgepeitschten See, gingen unter, kamen wieder hoch.
Nie hätte ich gedacht, dass Colins Kräfte als Erste erlahmen würden. In blinder Panik wühlten seine Arme das Meer auf, schlugen gegen die mächtigen Wellen, die uns verschlingen wollten. Er konnte nicht schwimmen! Doch statt sich an mich zu klammern oder an Vater, verschwendete er mit unsinnigen Schlägen die letzte Lebenskraft, die in ihm steckte, stieß mich von sich, wenn ich ihn festhalten wollte. Die schiere Wut gegen das Meer packte mich!
»Colin!«, schrie ich ihn an und klammerte mich an das Seil, das unsere Schicksale miteinander verband. »Wir werden jämmerlich ersaufen!«
Colin versuchte ein Lächeln. In seinen dunklen Augen sah ich keine Furcht, nur Gewissheit und eine Spur von Schmerz. Sein Kopf tauchte unter, kam kurz wieder hoch. Warum nur tat Vater nichts, warum half er Colin nicht? Da sah ich es! Eine klaffende Wunde an seiner Stirn, Blut in seinem Gesicht. Teilnahmslos trieb er neben uns, die Arme lagen schwer über einem Balken, den das gesunkene Schiff ihm gnädig überlassen hatte.
»Vater!« Ich packte seinen wirren Schopf. Er stierte, lallte. Mit einem Mal musste ich an unsere Kätzchen denken. Eines hatte er herausgesucht, das stärkste aus dem Wurf. Die anderen ersäufte er im Fluss. War dies nun die Vergeltung?, wirbelte der unsinnige Gedanke in meinem Kopf.
Colin trieb ab. Ich klammerte mich an meinem Vater fest und zog an dem Strick, der uns drei sichern sollte. Ich hielt das lose Ende in der Hand.
»Du verdammter Bastard, was tust du!«, schrie ich in die fliegende Gischt, konnte nicht begreifen, was doch so offensichtlich war: Colin hatte beschlossen, dass er mein Leben nur retten konnte, wenn er seins dafür gab!
Meine hilflose Wut wurde zu Raserei. Jenseits der Macht, sie zu bezähmen, hieb ich um mich, tobte gegen die Wellen, ohnmächtig, unfähig, Colin einzuholen. Das Meer riss ihn fort.
»Du gemeiner Feigling!« Ich schrie die Worte gegen den Sturm und die Wogen. Es raste dabei in meinem Kopf: Ich darf dich nicht verlieren! Du musst bei mir bleiben! Was soll ich ohne dich tun?
Vater stierte weiter in die Gischt. Ihm konnte ich ja verzeihen. Er war ein alter, kaputter Mann, von allen und allem verlassen – auch noch von diesem letzten Quäntchen Glück. Wofür sollte er sich abquälen?
»Colin!«, schrie ich noch einmal den geliebten Namen in die Nacht.
Grausam wie die Katze mit der Maus spielte die See mit mir. Nur noch ein kleiner, schwacher Rest von Leben wohnte in mir. Fast all meine Kraft war verbraucht. Das Meer schleifte mich über Klippen, schlug mich auf hartes Gestein, rollte mich über rauhen Sand. Meinen Körper spürte ich schon lange nicht mehr.
Dann, plötzlich, leckten nur noch sanfte Wellenzungen an mir. Sie murmelten, flüsterten: Komm, spiel noch ein Weilchen mit uns! Bleib doch noch hier!
Ich war zu müde. Mit letzter, schier unmenschlicher Anstrengung kroch ich zu Vater, drehte ihn keuchend auf den Rücken. Mit gebrochenem Blick starrte er himmelwärts, wo sich die grauen Wolken jagten. Fahl seine Brust unter dem zerrissenen Hemd. Sie hob und senkte sich nicht mehr. Hier lag er, Seamus, mein Vater, Bewohner von Cumbrien wider Willen, sein Leben erloschen. Als hätte das Schicksal ihn eigenhändig an die Klippen eines noch fremderen Landes geworfen als das, vor dem er geflohen war. Ein altes Bild, schon fast verblasst, tauchte in meiner Erinnerung auf: Damals war ich ein kleines Mädchen, mein Vater groß, stark unverwundbar. Er durchtrennte die Nabelschnur eines Lamms mit einem achtsamen Schnitt, nur ein einziger Tropfen schwarzen Blutes floss, so einfach war es gewesen. Lachend hielt er das meckernde Lämmlein im Arm, reichte es mir.
Nun tat ich es ihm gleich. Ein rascher Ruck durchtrennte den Strick, der uns verbunden hatte, ein Leben lang, so schien es. Ich zog den Siegelring mit der Rose von seinem Finger und steckte ihn auf meinen Daumen. Noch einmal küsste ich seine zerschlagene Stirn, schmeckte das Blut und das Salz seines vollendeten Schicksals. Mein Haar floss wie ein nasses Leichentuch über sein Gesicht und seine Marmorbrust. Dann setzte ich mich auf. Ich wartete, bis das Meer ihn holte.
So geschah es. Die Wellen rollten heran. Sie kosteten von seinem Körper, griffen nun forscher nach ihm, umschlangen ihn schließlich und trugen ihn fort nach Westen, dorthin, wo die Sonne blutrot unterging. Seine Reise hatte geendet wie alles in seinem Leben: im Unglück.
»Vater! Colin!«, schluchzte ich und fluchte in Vaters bester Manier: »Gottverdammt! Zur Hölle!«
Die Wellen liebkosten den Sand.
»Vater!« Meine Stimme ein heiseres Flüstern. Ich wischte das Salz aus meinen Augen. »Du sturer irischer Säufer und Hurenbock. Jetzt kehrst du endlich heim.«
Damals – nach wie vielen Stunden? – fand mich ein anderer alter Mann so sitzend. Er fragte nichts, nahm mich einfach mit, nicht ahnend, was er da auflas.
2
Schined! Schinde! Schande!«
Der wilde Reigen zog sich immer enger um mich. Wirbelnde Körper, klaffende Mäuler, aufgerissene Augen, wie der Inbegriff einer außer Kontrolle geratenen Meute, die ihr Opfer hetzt, stellt und dann …
»Sinead! Mein Name ist Sinead!«
Mein Schrei war mehr von Zorn als von Furcht geprägt. Noch stand ich still, inmitten der Tobenden, meine Augen sprühten Funken, schleuderten Blicke wie Dolche, die einen einzelnen Angreifer hätten zurückweichen lassen. Nicht aber das gute Dutzend Halbwüchsiger, die mich, die Fremde, mit dem untrüglichen Instinkt des Mobs sofort als willkommenes Opfer auserkoren hatten. Was zunächst gewirkt haben mochte wie ein harmloses Spiel, ein dummer Streich vielleicht, den jede »Neue« über sich ergehen lassen musste, geriet nun zur lebensbedrohlichen Hetze.
»Schinde! Schande! Hexe! Roter Teufel!«, skandierte die Meute.
Nun stand ich nicht mehr still. Ich wurde gestoßen, geschlagen, an den Haaren gerissen.
»Ihr verdammtes Pack! Lasst mich in Frieden! Was hab ich euch getan?«
Als Antwort kam nur grölendes Gelächter, grobe Hände stießen nach mir. Mein Zorn wuchs. Ich kratzte, biss, schlug um mich, drosch einem Angreifer das Knie in den Schritt, so dass er aufkreischte, hieb einem anderen die Faust auf den Mund. Die brechenden Zähne rissen meine Knöchel auf, ohne dass ich es spürte. Nun bekam ich es doch mit der Angst zu tun. Verzweifelt wühlte ich nach dem Messer im Stiefel, fand den Griff, zerrte daran.
»Vorsicht! Die Hexe hat ein Messer!«, brüllte einer.
Ich wurde niedergerissen. Schon lange bestand die Meute nicht mehr aus einzelnen Wesen. Der Mob war eine geschlossene Masse, wie eine riesige Bestie, mit Klauen, Fängen, Pranken und keuchendem Atem, der mir heiß ins Gesicht schlug. Meine Wut und meine Verzweiflung wuchsen. Ich verlor das Messer, spürte noch, wie die Klinge meine Handfläche aufschlitzte. Einer hob die Waffe triumphierend in die Höhe. Als sei dies ein Zeichen, hielten alle mit einem Mal inne.
Die plötzliche Stille war beängstigender als die vorangegangene Raserei. Ich hörte nur noch keuchendes Nach-Luft-Ringen. Über mir zitterten die Körper meiner Peiniger. Es schien, als dampften sie, als seien sie gespannt wie Katapulte, die gleich wieder losschnellen würden! Hände pressten mich fest in den Dreck. Je zwei, drei aus der Meute knieten auf meinen Armen und Beinen. Ich war unfähig, mich zu rühren.
Die Augen des Mobs starrten erst mich an, um dann unruhig umherzuflackern, wie auf der Suche nach einer Antwort, was als Nächstes mit mir zu geschehen hätte.
»Ihre Dinger schauen raus«, kam es unschlüssig aus einem roten, pickeligen Gesicht, auf dem noch nicht einmal der erste Flaum spross. Die Runde quittierte es mit nervösem Kichern. Ich sah meine Blöße, war nicht in der Lage, sie zu bedecken.
»Was soll’n wir mit ihr machen?« Die Frage klang dumpf. Über mir kniete der Kerl, der mein Messer hatte. Er fuchtelte damit herum.
»Wir säbeln der rothaarigen Hexe ihre Zotteln ab!«
Der alte Mann fand mich zum zweiten Mal in desolatem Zustand. Grün und blau geschlagen, der Körper zerschunden, das Gesicht wie eine einzige Wunde. Der Wind trieb meine Haarsträhnen wie rote Grasbüschel vor sich her. Mein Kopf war kahl, zerkratzt, blutig; Hautfetzen herausgerissen.
»Oh, Kindchen, was haben sie nur mit dir gemacht?« Das eingefallene Gesicht des Alten, schräg über mir, verdeckte die milchige Herbstsonne. Die herabhängenden Backen, wie die Lefzen eines Hundes, ließen ihn noch trauriger erscheinen. »Weißt du denn, wer es getan hat?«
Ich biss auf meine geschwollenen Lippen und beharrte auf trotzigem Schweigen.
»Ach je!«, begann der Alte jammernd und wiegte den Kopf, als sei mein Leid ihm widerfahren. »Die Welt ist verdorben, ach je, ach je!« Er zog an meiner zerschnittenen Hand, so dass ich aufschrie. Sofort ließ er los, starrte auf meinen Rosenring am Daumen und auf das Blut zwischen seinen gichtigen Fingern. »Du lieber Himmel, das Händchen kaputt! Warum tut einer so was – und noch dazu dein schönes rotes Haar!«
Ich rappelte mich mühsam hoch, sah den gaffenden Blick des Alten und raffte die Kleiderfetzen vor meinem Busen zusammen. Dann folgte ich ihm humpelnd in seine Hütte.
»Ich hatte nur Söhne«, nuschelte er und wies bedauernd auf ein Bündel Kleider zu seinen Füßen.
Ich zog ein schäbiges Paar Beinlinge hervor und hielt es mit spitzen Fingern hoch.
»Naja, da sind ein paar Löcher, Motten und Mäuse, weißt du, ich hab doch nicht gedacht, dass ich das alles noch mal brauche.« Seine wässrigen Augen blickten wie um Vergebung flehend. »Aber es ist besser als nichts, als deine zerrissenen Fetzen.« Ohne Übergang fuhr er fort: »Sind alle gestorben, damals, als das ganze Dorf im Fieber lag, Frau, drei Söhne. Hab sie verscharrt, mit bloßen Händen, der Boden ist hart hier, keine leichte Arbeit!« Wie zum Beweis hielt er mir anklagend seine schwieligen Handflächen unter die Nase.
Ohne eine Antwort zu geben, klaubte ich das löchrige Bündel auf und hob es schützend vor mich.
Der Alte nickte, als habe er verstanden. »Natürlich, bist ja übers Meer gekommen. Verstehst kein Französisch!«
»Doch, ich verstehe«, mahlte meine Zunge schwer, wegen der geschwollenen Lippen und der fremdartigen Sprache, die meine Amme mich einst gelehrt hatte. Mich machten seine Worte wütend, denn schließlich hatte ich den Vater und den Geliebten verloren.
»Ich bin nicht übers Meer gekommen!«, erwiderte ich hilflos lallend, als wäre ich mein Vater in seinem schlimmsten Rausch. »Unser Schiff sank, und ich wäre beinahe wie alle anderen ertrunken!«
»Kindchen, das weiß ich doch«, seufzte der Alte, und wieder klang es, als hätte er dieses Schicksal erlitten.
»Ich möchte mich jetzt anziehen«, rief ich ungeduldig.
Er stand da, kaum eine Armlänge vor mir und ohne erkennbare Absicht, sich zu entfernen. Konnte er wohl ernsthaft glauben, ich würde den Kleiderwechsel vor seinen gierigen Augen vollziehen, die mich erwartungsvoll anblickten?
»Hau endlich ab, damit ich mir die verlausten Lumpen überstülpen kann!«, schimpfte ich nun wenig damenhaft und ohne Respekt vor seinem hohen Alter. Meine englischen Flüche schien er nicht zu verstehen. Mit einer ungeduldigen Handbewegung unterstrich ich mein Ansinnen. Dann endlich, wie ein Hund, der häufig Prügel bezieht, schlich er aus seiner eigenen Hütte.
Für eine Weile wähnte ich mich auf der Sonnenseite des Lebens. Meine Wunden begannen zu heilen, rötliche Stoppeln wuchsen auf meinem Kopf. Der Alte fütterte mich, als gelte es, mich zu mästen. Die Meute, die mich so zugerichtet hatte, machte einen weiten Bogen um mich, vermied es, mir auch nur nahe zu kommen.
»Denen hat man eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht«, bemerkte der Alte gewichtig. Er lief zur Tür und hob witternd den Kopf. »Es liegt Schnee in der Luft.« Er schnupperte nach draußen, dann wandte er sich mir zu. »Der Winter kommt. Ich kann es in all meinen Knochen spüren.«
Es blieb nicht mehr genug Zeit, um über die Erfüllung solcherlei Prophezeiung zu spekulieren. Noch in derselben Nacht wurden alle Dorfbewohner von panischen Schreien geweckt:
»Feuer! Der rote Hahn!«, gellte es durch die Nacht, und bevor die Stimme abbrach, hörte ich noch:
»Hilfe! Überfall!«
Benommen vom Schlaf taumelte ich aus der Hütte, mit den Alarmschreien im Ohr, die ebenso Teil eines bösen Traums hätten sein können. Es waren die Gegensätze, die alles noch schrecklicher machten: der tiefe Schlaf und dieses Erwachen, wie herausgerissen aus dem schützenden Mutterleib direkt in die Hölle. Das Fauchen und Wüten des Feuers inmitten der Stille der Nacht. Das panische Schlagen meines Herzens – und dann – überall der Tod!
Mein erster Impuls, nachdem ich die Hütte verlassen hatte, war es, sofort in ihren vermeintlichen Schutz zurückzukehren. Ich würde einfach den Kopf unter die löchrige Pferdedecke stecken und ausharren, bis das Grauen draußen vorübergezogen war. Doch solche Auswege gewährt das Leben nicht.
Als ich zurückblickte, brannte das Dach schon lichterloh. In das Inferno der Flammen mischten sich die Schreie von Angreifern und Opfern, das Bersten von Holz und das Krachen, wenn ganze Hütten einstürzten. Menschen wurden erschlagen, erstochen, enthauptet, verbrannt. Ziellos, ohne zu wissen, wohin oder warum, begann ich, umherzurennen. Dann, plötzlich, übermannte mich hoffnungslose Ohnmacht, eine Art Lähmung erfasste meinen Körper, meinen Geist. Ich war fassungslos, empfindungslos. Ich stand still.
Erst später, als die Überlebenden zusammengetrieben wurden und man dabei streng, als gelte es, Vieh zu zählen, Frauen, Männer, Kinder und Alte trennte, begann ein vager Gedanke in meinem Kopf zu kreisen. So wie mein Vater sein Leben wohl immer empfunden haben mochte, als die Summe von Unglück, so schien auch mein Dasein auf dieser Welt zusammengesetzt: eine unwiderrufliche Abfolge von Katastrophen.
Trotz aller Panik begann ich zu grübeln.
Ein Einäugiger hatte mich mit einem Stoß in den Rücken unter die zusammengetriebenen Männer befördert, wo ich der Länge nach hinschlug. Dies war mein Blickwinkel, das Gesicht im Dreck, als ich sah, wie die Piraten die Alten und Kinder mit wüstem Gebrüll und Fußtritten davonjagten. Dann, gerade als ich mich anschickte, wieder auf die Beine zu kommen, befahlen sie den Frauen, sich auszuziehen. Jene, die sich weigerten, erschlugen sie, ebenso wie eine Handvoll Männer, die sie beschützen wollten.
Als die Vergewaltigungen begannen, begriff ich erst, warum ich hier gelandet war, in der Gruppe der Männer. Die Piraten hatten mich für einen Jungen gehalten! Ich blickte an mir hinab, tastete mit den Augen über die dreckige, zerrissene Jacke und die lächerlichen Beinlinge, fuhr über meinen stoppeligen Schädel. Meine Misshandlung durch die Dorfjugend Tage zuvor hatte mir das fragliche Glück beschert, nun nicht Teil jener in Abscheu, Verzweiflung und Panik erstarrten Körper zu sein, die unter unseren Blicken geschändet wurden.
Es war ein gespenstisches, fürchterliches Szenario. Immer noch schlugen grelle Flammen in den blauschwarzen Nachthimmel. Vereinzelt erklang ein unterdrückter Schrei, mehr ein gepresstes Seufzen, das im Feuerprasseln fast unterging.
Irgendwann, als wir gefesselt waren, stellte ich mir die Frage, welches Schicksal wohl uns Männern zugedacht war.
Die Schändungen dauerten die ganze Nacht. Dazu grölte und soff die schreckliche Meute ohne Unterlass. Eine Frau, die in hysterische Agonie verfiel, wurde bei lebendigem Leib ins Feuer geworfen.
»Was sie wohl mit uns vorhaben?«, flüsterte ich verzweifelt jenem Mann zu, an den mich die groben Stricke fesselten. Ich spürte den kalten Angstschweiß, der seinen Rücken hinunterlief, an den ich gepresst war. Vielleicht waren es aber auch die Ausdünstungen meiner eigenen Furcht vor den Grausamkeiten, die uns noch bevorstanden.
»Sei still!«, erhielt ich nur die panisch gezischte Antwort, denn zuvor hatten die Piraten gedroht, jeden, der nur einen einzigen Laut von sich gab, ebenso ins Feuer zu werfen wie das arme Weib.
Am Morgen, als die Sonne aufging, lagen die Frauen wie ein Haufen fahler, mit Blut besudelter Leichen im Schlamm. Die Horde der Peiniger steckte die Köpfe zusammen und beriet unter unseren angstvollen Blicken irgendetwas. Plötzlich schienen sie uneins, sie stritten, brüllten, gingen aufeinander los. Doch dann kamen sie zu uns herüber. Wir sahen ihre wüsten Gesichter, gezeichnet von Mord und Totschlag und den Exzessen der vergangenen Nacht. Dann erklärte uns einer grinsend, als sei das alles nur ein großer Spaß, was unser Schicksal sei und welches das der noch lebenden Frauen.
Die Auserwählten mussten Spalier stehen, mit Knüppeln, die man in ihre zitternden Hände gezwungen hatte. Zehn Schritte weiter tat sich eine Grube auf, aus der die Flammen emporloderten. Die Frauen, kaum fähig, sich auf den Beinen zu halten, starrten zu den Männern, diese starrten zurück. Ein jeder schien die schreckliche Entscheidung abzuwägen: den Tod bereiten oder den Tod erleiden. Ich fragte mich, wie ich wohl gewählt hätte, wäre ich zum Henker bestellt worden. Wäre mir der Mut beschieden, hervorzutreten, den Knüppel vor die Füße der Peiniger zu werfen, und damit meinem eigenen Leben ein Ende zu bereiten?
Anscheinend wahllos hatte man die Männer aus unserem Haufen gezerrt, sie mit Stöcken und Holzscheiten versehen und in zwei Reihen aufgestellt. Von denen, die nun bereitstanden, wagte jedoch nur einer die entscheidende Frage:
»Was geschieht, wenn ich es nicht tue?« Der Mann sprach mit bebender Stimme, seine Augen flackerten. Er versuchte, seine Furcht hinter Trotz zu verbergen. Doch sofort ergriffen ihn viele Hände, hoben ihn hoch und schleuderten ihn hinab ins Feuer. Sein Schrei, den endlich die Flammen erstickten, ließ alle anderen endgültig verstummen und erstarren. Die schwärzeste Seite der menschlichen Seele trat in diesem Augenblick zutage. Oh, Colin, du kanntest diese unmenschliche Seite nicht, als du dein Leben für meines gabst! Hier wurde ich Zeuge, wie Männer, um dem Tode zu entgehen, ihre eigenen Frauen vorwärtsprügelten, bis sie am Ende des Spaliers den Boden unter den Füßen verloren und ins Feuer stürzten.
Die Piraten weideten sich mit grinsenden Fratzen an dem Schauspiel.
Ich vermutete, was folgen würde. Auch uns, die sie bisher verschont hatten – auch uns warfen sie nun wohl in die Flammen. Lautlos begannen meine Tränen zu fließen. Colin, mein Geliebter, werden wir denn zusammenfinden, wenn ich auch gestorben bin? Du hast den Tod gewählt, weil du wolltest, dass ich lebe. Siehst du nun, es war alles umsonst.
3
Pierre Roger blickte auf die Gischtfontänen, die der Schiffsbug von den Wellenkämmen riss und wie weiße Wolkenfetzen vorüberfliegen ließ. Er war schlank, groß gewachsen, mit einem schwarzen Haarschopf über der hohen Stirn. Spitze Wangenknochen ließen das gebräunte Gesicht schmal aussehen, die vollen, weichen Lippen wirkten wie ein Widerspruch zu der kühn gebogenen Nase und dem kräftigen Kinn.
Seine dunklen Augen musterten den neben ihm Stehenden. »Du siehst besorgt aus, Karl. Bekümmert dich etwas?«
Der Angesprochene, ein dunkelhaariger junger Mann von etwa zwanzig Jahren, war kleiner, aber von kräftiger Statur. Mühelos balancierten seine Beine das Schaukeln und Stampfen des Schiffes aus. Seine hellen Augen über der breiten Nase waren auf den Horizont gerichtet, wo Himmel und Wasser sich zu berühren schienen. Nachdenklich strich er über seinen kurz geschnittenen Bart.
»Ich hatte einen Traum.«
Pierre Roger hob die Brauen. Er kannte Karl, seit dieser als Siebenjähriger an den Hof des französischen Königs gekommen war. Damals trug er, nach Tradition seiner přemyslidischen Vorfahren noch den Namen Wenzel, auf den ihn seine Eltern, Johann und Elisabeth, im Jahr seiner Geburt im Prager Dom hatten taufen lassen. Pierre Roger, damals Abt des Dominikanerklosters von Fécamps, war am französischen Königshof sein Erzieher und Lehrer geworden. Er liebte Karl – wie dieser fortan genannt wurde, als sei er sein eigener Sohn. Deshalb wusste er auch um seinen tiefen Glauben, der von Zeit zu Zeit Träume und Visionen hervorbrachte, die den Abt manchmal sogar an die Weissagungen in der Bibel erinnerten.
»Erzähl mir von deinem Traum.«
Karls Augen folgten dem blauen Wasserspiel, das am Schiffsrumpf vorbeizog. Nun löste er seinen Blick und sah Pierre Roger direkt an. Dieser war für ihn nicht nur Lehrer oder Freund – für Karl war er eine Vaterfigur, weit mehr sogar als sein leiblicher Erzeuger, Johann, König von Böhmen, der ihn einst in die Fremde geschickt hatte.
»Es war seltsam. Ich träumte, eine riesige Wolke verdunkle zuerst den Himmel, dann das ganze Land. Die Wolke kam immer näher, schien alles zu verschlingen.«
»Eine Heuschreckenplage vielleicht.« Der Abt löste eine Hand von der Reling und legte sie auf Karls Arm. »So etwas gab es schon einmal, erinnerst du dich, du warst ein Knabe von vielleicht neun Jahren. Damals ergriff die Plage das ganze Land, und es sah tatsächlich aus wie eine riesige Wolke, die alles verschluckt. Vielleicht ist dir dieses Bild geblieben und verfolgt dich jetzt im Schlaf.«
»Mag sein.« Karl schüttelte den Kopf, wie um die Erinnerung an den Traum zu verjagen. Er fixierte die dunklen Schemen in der Ferne. Es mochte eine Wolkenbank sein, die der kalte Herbstwind dorthingeschoben hatte, aber vielleicht auch das von unzähligen Buchten zerklüftete Band der Felsenküste, die wie geschaffen war für Piratenverstecke. Seeräuber waren in diesen Gewässern keine Seltenheit, weshalb die französische Galeere von zwei bewaffneten Schiffen als Geleitschutz eskortiert wurde.
»Diese Wolken sind zu weit entfernt, um uns schaden zu können.« Pierre Roger nickte in Richtung der schwarzen Konturen am Horizont, als hätte er Karls Gedanken erraten. »Wolltest du mir nicht erzählen, warum du Paris nach so kurzer Zeit schon wieder verlassen hast?«
Karls Miene verfinsterte sich. »Glaub mir, ich wäre gerne noch viel länger geblieben! Du weißt, wie sehr ich das Universitätsstudium liebe. Aber Vater hat mir eine unmissverständliche Botschaft zustellen lassen.«
Pierre Roger zog die Brauen in die Höhe. »Dein Vater hat dich zurückbeordert?«
»Ja. Allerdings nicht nach Prag, sondern nach Brügge, wo er derzeit weilt. Von dort aus soll ich mit ihm zurückreisen. Seiner Meinung nach habe ich als Herzog von Mähren Wichtigeres zu tun, als meine Zeit mit Unfug wie studieren zu vergeuden.«
Der Abt musste schmunzeln. »König Johann ist in dieser Beziehung eben ein bisschen altmodisch.«
Karl stand der Ärger deutlich ins Gesicht geschrieben. »Er will nicht begreifen, dass Wissen unser höchstes Gut ist! Wie soll man weitsichtig, weise und gerecht agieren, ohne die Lehren Platons oder Aristoteles’ zu kennen – ohne die Psalmen der Heiligen Schrift studiert zu haben. Ohne Thomas von Aquin oder William Occam!«
»Ist es nicht gewissermaßen deinem Vater zu verdanken, dass du überhaupt Zugang zu all diesem Wissen hast?«
»Mein Vater hat mich in meinem vierten Lebensjahr für zwei Monate in einen Kerker sperren lassen, weil ich mich nicht von meiner Mutter fortreißen lassen wollte!«
Pierre Roger legte beruhigend eine Hand auf Karls Schulter. Er verschwieg, dass er die Einkerkerung eines kleinen Kindes – vor allem, wenn es sich dabei um den eigenen Sohn handelte – selbst auch missbilligte. Natürlich musste man in Betracht ziehen, dass sich alle Beteiligten in einer schwierigen Lage befunden hatten. Karl, der erste der drei Söhne Johanns von Böhmen, war als Kronprinz von vorneherein Objekt politischer Intrigen. Um ihn zu schützen, hatte ihn sein Vater aus dem unsicheren Prag auf die Feste Bürlitz bringen lassen.
»Ich habe Mutter bis zu ihrem Tod nicht wiedergesehen.«
Die Bitterkeit in Karls Stimme war unüberhörbar. Der Abt kannte die traurige Geschichte nur allzu gut. Zwischen Karls Eltern war es zu einem unüberbrückbaren Zerwürfnis gekommen. Elisabeth holte den Sohn wieder zu sich und wurde daraufhin von ihrem Mann regelrecht überfallen. Als der kleine Karl sich verzweifelt an die Mutter klammerte und dabei schrie, so laut er konnte, rissen die Schergen des Königs ihn mit Gewalt los. Dann, um den Trotz des Kleinen zu brechen, warf ihn der Vater in das Kellerloch. Die Königin musste fortan wie eine Verbannte leben. Ein Kind nach dem anderen wurde ihr genommen. Es gab wahrhaft glücklichere Ehen im böhmischen Königshaus.
»Ich bitte dich, sei milde mit einem Urteil, was deinen Vater betrifft«, bat Pierre Roger trotzdem. »Er will nur eines für dich, dass du einmal sein Nachfolger auf dem Thron wirst. Glaube mir, er liebt dich über alles.«
»Er hat mich als Siebenjährigen in die Fremde verbannt! Ein wahres Zeugnis tiefer Vaterliebe!«
»Es gehört nun mal zur Tradition deiner Familie, Söhne, die als Thronfolger in Frage kommen, in Paris erziehen zu lassen. Immerhin hat der französische König dich aufgenommen, als wärst du sein eigener Sohn. Unter der Obhut deiner Tante hat er dir in Saint- Germain-en-Laye einen eigenen Haushalt angewiesen und dich mit der Tochter seines Oheims vermählt.«
Karl blickte aufs Meer. Der Wind, gerade noch frisch und böig, schien an Kraft zu verlieren. Nun fuhr Pierre Rogers junger Begleiter fort: »Man hat mir meinen Namen genommen.«
Der Abt musste schmunzeln. »Wenzel konnte in Paris keiner aussprechen. Verzeih mir, aber für einen Franzosen ist das ein wahrhaft zungenbrecherischer Name. Außerdem, du weißt doch, der König ließ dich firmen, und es ist durchaus üblich, als Firmpate dabei seinen eigenen Namen zu vergeben.«
Karl biss sich auf die Lippen. Er war ein Kind in der Fremde gewesen. Und dann – bereits ein Jahr nachdem er nach Paris gekommen war – starb seine Tante, und bald darauf verschied auch der König. Karl hatte sich verloren gefühlt. Obwohl er noch sehr jung gewesen war, hatte er erkannt, dass Philipp nie ein würdiger Nachfolger auf dem französischen Thron sein würde.
Pierre Roger kniff die Augen zusammen. Am Horizont glaubte er, winzige Punkte zu erkennen. Schiffe waren in diesen Gewässern, dem Meer zwischen England und Frankreich, gewiss keine Seltenheit, auch wenn die Zeiten gefährlich waren. Ein Krieg zwischen den beiden Ländern drohte als Folge eines ständig schwelenden Konflikts.
Als der Abt die schwarzen Punkte wieder aus den Augen verloren hatte, antwortete er: »Sowohl deinen Zieheltern als auch deinem leiblichen Vater hast du viel zu verdanken. Du bist gebildet wie kein anderer in deinem Alter, sprichst fünf Sprachen fließend. Das alles konntest du nur lernen, weil du frühzeitig das Nest verlassen hast.«
»Als ich noch nicht einmal flügge war!«, stieß Karl hervor und fügte zornig hinzu: »Du hast recht, ich spreche fünf Sprachen fließend – bis auf meine eigene Muttersprache. Die muss ich erst noch mühsam lernen. Und dabei achtgeben, dass mich das Volk, das ich regieren soll, nicht auslacht, wenn meine Zunge über die einfachsten Worte stolpert!«
Auf Pierre Rogers Lippen zeichnete sich ein feines Lächeln ab. Karl, eher ruhigen Gemüts, war selten so impulsiv wie jetzt. Zumeist versteckte er seine Gefühle hinter freundlicher Zurückhaltung. Doch wenn das Gespräch auf seinen Vater kam, zeigte sich rasch, wie sehr ihn das Thema aufwühlte. Um Karl zu besänftigen, fragte der Abt schnell:
»Erzählst du mir, mit welchen Studien du dich diesmal beschäftigst? Bestimmt hast du wieder die interessantesten Dinge gelernt.«
Aber Karl schien nicht geneigt, so rasch das Thema zu wechseln. Sein Gesichtsausdruck blieb finster. »Ich habe die Divina Comedia von Dante Alighieri, dem Florentiner, gelesen. Auf dem Weg durch seine Hölle, sein Fegefeuer und den Himmel bin ich einigen meiner Ahnen begegnet.«
»Dantes Bewunderung für deinen Großvater, Kaiser Heinrich VII., ist wohlbekannt.«
Nun hellte sich Karls Miene doch auf, und statt Ärger schwang Begeisterung in seiner Stimme mit: »Du hast die Göttliche Komödie auch gelesen?«
Pierre Roger nickte. »Natürlich. Dein Großvater Heinrich ist der einzige Kaiser, dem Dante in seinem Welttheater einen Sitz im Himmel gewährt, gleich neben dem Platz, den er sich wohl selbst erhoffte.«
Karl grinste. »Nicht ganz so gut erging es Rudolf von Habsburg, den hat er ins Purgatorio bestellt –«
»Ebenso wie den ›König aus dem Land, dessen Wasser alle mit der Elbe nach Norden fließen‹. Der sitzt ebenfalls im Fegefeuer.«
»Du kennst die Comedia mindestens genauso gut wie ich!«, warf Karl begeistert ein. »Damit hat er natürlich Ottokar gemeint, den Besiegten von Dürnkrut! Und auf wen spielt er an, wenn er schreibt: ›den Wollust freut und Nichtstun‹?«
»Wenzel II., deinen anderen Großpapa, natürlich«, erwiderte Pierre Roger, dem dieses Spiel gefiel, ohne zu zögern. »Den mochte er wohl auch nicht so gern.«
Karl strahlte. Er liebte solcherlei gelehrte Diskurse über alles. Und mit niemandem ließen sie sich besser führen als mit Pierre Roger.
»Wen oder was hast du außer Alighieri noch studiert?«, wollte dieser nun wissen.
»Ich habe einen Teil meiner Zeit über neuem Kartenmaterial verbracht. Es ist unglaublich! Jeder Herrscher sollte mehr über die Geographie wissen! Diese Wissenschaft verleiht der Welt ein völlig anderes Gesicht. Sie gewährt einem Einblicke gleichsam von oben, vom Himmel her, als wäre man ein Vogel und könnte fliegen. Flüsse, Städte, Meere. Alles sieht man plötzlich im Zusammenhang. Nicht aus jener jämmerlichen Perspektive einer Ameise, die am Boden krabbelt.«
»Erkläre mir, warum solche Einblicke besonders für Fürsten wichtig sind«, sagte Pierre Roger mit der Strenge des Lehrmeisters, der seinen Schüler auf die Probe stellt.
»Aus strategischen Gründen! Habe ich alle Wege, Grenzen und Hindernisse vor Augen, sehe ich auf einen Blick, wo die Schwachstellen liegen. Ich kann Burgen und Festungen dort errichten, wo es wichtig ist, kann mit Straßen und Brücken die fehlenden Verbindungen herstellen.«
Pierre Roger genoss die Begeisterung seines Schützlings, die blitzenden Augen, die Funken zu sprühen schienen, das energisch vorgereckte Kinn. Er spürte in diesem Augenblick, Karl würde seinen Weg gehen, sei er auch noch so steinig. Er ermunterte ihn, fortzufahren.
»Ich verstehe. Aber erzähl doch weiter. Was hat dich noch interessiert?«
Die Rufe der Besatzung, die das Großsegel einholte, erklangen. Der Wind war vollständig eingeschlafen, und das Schiff dümpelte in der Flaute. Ruderblätter klatschten aufs Wasser, unrhythmisch zunächst, dann fanden sie den Gleichklang, und die Galeere nahm wieder Fahrt auf. Karls Blick war in die Ferne gerichtet. Er schien nachzudenken.
»Ich glaube, wir stehen am Anfang eines neuen Zeitalters«, sagte er schließlich vorsichtig, als bereue er beides, seinen zuvor gezeigten Ärger sowie die Begeisterung für seine Studien. »Mir ist klargeworden«, fuhr er fort, »dass es nun zu gelingen scheint, die Naturwissenschaften von der Philosophie zu trennen. Endlich wird nicht mehr nur gemutmaßt und spekuliert, wie die Zusammenhänge in unserer Welt sein könnten – alles wird untersucht, erforscht, wie es ist! In der Bibliothek der Universität gibt es unglaubliche Schätze – allein über Astronomie! Natürlich wusste ich bereits, dass die Sterne keine fernen, unerreichbaren Lichtpunkte sind, die unser Herr irgendwo am Firmament aufgehängt hat. Aber noch nie habe ich zum Beispiel so viel über den Mond erfahren. Man erzählt den Kindern die Mär vom Mann im Mond. Aber es scheint sich um Gebirge zu handeln, ähnlich beschaffen wie unsere auf der Erde!«
»Du darfst dabei nur Ihn nicht vergessen!«, warf Pierre Roger besorgt ein und folgte Karls Blick zum Horizont. »Unseren Herrn, der all diese Wunder erschaffen hat. Die neuen Einsichten sind ein zweischneidiges Schwert, glaube mir. Wir Menschen müssen bescheiden bleiben. Wir dürfen nicht glauben, wir könnten die Geheimnisse der Schöpfung ergründen. Wissen ist wie Feuer – es spendet Wärme, kann uns aber auch vernichten.«
Karl winkte unbekümmert ab. »Was macht es schon, wenn man sich einmal die Finger verbrennt! Der kleine Schmerz ist nichts, verglichen mit dem berauschenden Gefühl, das einen beim Erkennen logischer Zusammenhänge überkommt, die man zuvor nur als rätselhafte Wunderwerke bestaunen konnte.«
»Ich wiederhole, es sind Gottes Wunderwerke, von denen du sprichst!« Pierre Roger sprach leise, aber mit unüberhörbarem Tadel.
»Ich werde die Werke unseres Herrn niemals in Frage stellen«, lenkte Karl ein. »Du kennst meinen Glauben, es liegt mir fern, die neuen Wissenschaften über Gott zu erheben. Gerade das Gegenteil meine ich! Erst das Studium der Summa theologicae von Thomas von Aquin und die Schriften seines Lehrers, Albertus Magnus, haben mir klargemacht, wie sich alles theologische, philosophische und wissenschaftliche Bemühen im Zusammenhang sehen lässt. Wie es systematisierbar ist. Alles ist hierarchisch angeordnet, von der Pflanze, dem Tier, dem Menschen über die Engel bis hin zu Gott. Der Glaube wird dadurch nur tiefer, weil er das Kindhafte verlässt. Verstehst du?«
Der strenge Ausdruck blieb auf dem Gesicht Pierre Rogers wie ein Schatten. Um ihn milder zu stimmen, fügte Karl hinzu:
»Bestimmt weißt du, dass Thomas von Aquin den leiblichen Genüssen sehr zugetan war. Aber wusstest du auch, dass er dadurch so dick wurde, dass er ein Halbrund aus seinem Schreibtisch sägen ließ, um seinen gewaltigen Bauch unterzubringen?«
Pierre Roger nickte: »Ja, das ist allgemein bekannt. Auch die Dominikanermönche, deren Orden er angehörte, orientierten sich zunehmend am Diesseits.« Nun wies er nach Backbord und sagte, ohne weiter auf das Thema einzugehen: »Dort sind doch Schiffe. Hast du sie bemerkt?«
Karl hob eine Hand über die Augen und beschirmte sie gegen die tief stehende Sonne. »Ja. Fünf an der Zahl. Meinst du, es sind Engländer?«
»Schwer zu sagen. Ich kann noch keine Flaggen erkennen.«
Karl kniff die Augen zusammen. »Jedenfalls sind es keine Handelsschiffe. Es sind schnelle Galeeren. Seltsam wenn es Engländer wären, so nahe an der französischen Küste.«
Roger musste seinem Schützling zustimmen. Dass diese Schiffe dort am Horizont segelten, war eigenartig. Handelte es sich um den Teil einer englischen Flotte – eine Vorhut vielleicht? Pierre Roger war bereit, Wetten darauf abzuschließen, dass Edward III., König von England, früher oder später mit Gewalt versuchen würde, sich das zu holen, was er als seinen rechtmäßigen Anspruch ansah: den französischen Thron.
»Ich glaube nicht, dass es Engländer sind.« Pierre Roger runzelte nachdenklich die Stirn. Der Engländer würde nach einem Grund für einen Angriff auf Frankreich nicht erst lange suchen müssen. Den hatten ihm die Franzosen durch ihr System der Erbmonarchie selbst geliefert. Pierre Roger hatte in einer derartigen Familienpolitik schon immer eine große Gefahr gesehen. Es konnte grundsätzlich zu Konflikten führen, wenn in einem Königshaus die direkte Erblinie ausstarb, denn die verschiedensten Fürsten aus aller Herren Länder würden dann versuchen, irgendwelche Ansprüche auf den Thron geltend zu machen. Oft waren langwierige Kriege mit unendlichem Elend die Folge. Leider Gottes war gerade diese Situation in Frankreich eingetreten. Obwohl niemand damit rechnen konnte, waren – als gäbe es tatsächlich böse Launen des Schicksals – alle potenziellen Thronfolger im Alter von zwei, fünf und sechs Jahren gestorben. Philipp VI. aus dem Geschlecht der Valois wurde eiligst die Krone aufgesetzt, aus Verlegenheit sozusagen, weil er durch eine Seitenlinie mit der Königsfamilie verwandt war. Für Pierre Roger gab es keinen Zweifel, dass der Engländer Edward, der auf Umwegen ebenfalls verwandtschaftliche Ansprüche geltend machen konnte, nur auf den richtigen Zeitpunkt wartete. Er würde angreifen. Irgendwann. Aber natürlich nicht mit nur einer Handvoll Schiffen. Edward würde mit einer ganzen Flotte aufkreuzen.
Pierre Roger richtete sich auf. »Es sind keine Engländer«, wiederholte er nun finster. »Es sind Piraten. Ich hoffe, sie haben es nicht auf uns abgesehen!«
4
Wenn ich eines von meinem Vater gelernt habe, dann das Fluchen. In meinem kahlgeschabten Kopf brauten sich die wüstesten Verwünschungen zusammen. Die drei Sprachen, derer ich mächtig war, vermischten sich zu einer stillen, von Angst unterdrückten Hasstirade auf unsere Peiniger. Daneben formierte sich ein neuer Gedanke, der nun durch meine zusammengepressten Lippen zischte:
»Schiffe! Nicht schon wieder!«
Es waren fünf an der Zahl, genau eine Handvoll, die mit hängenden Segeln im natürlichen Hafenbecken dümpelten. Vor und hinter den Masten, beinahe ebenso hoch, fielen mir Konstruktionen auf, bei denen es sich um Katapulte handeln musste, mit denen man wohl Furchtbares anrichten konnte.
In diesem Augenblick lösten sich von den Bordwänden marode Beiboote. Ruderblätter schlugen aufs Wasser und trieben die Kähne uferwärts. Die Ketten an meinen Füßen klirrten, und ich schlug der Länge nach hin, als mein Vordermann unversehens lostrottete, stumpf, mit gesenktem Kopf wie ein Stück Vieh. Zwei, drei Peitschenhiebe brachten mich wieder auf die Beine, ein weiterer ließ mich hinter meinem Leidensgenossen herstolpern. Man hatte uns mit Fußfesseln in kleinen Gruppen zusammengekettet – dieses Aneinandergebundensein erinnerte mich an meine letzte Schiffsreise. Und deren Ende!
Mit Hieben und wüstem Gebrüll scheuchten uns die Piraten durch das hüfttiefe Wasser zu den Booten, die nun dalagen, als lauerten sie auf etwas. Sie nahmen uns die Ketten zunächst wieder ab, damit wir hineinklettern konnten.
Ich krabbelte ins zweite Boot, wo ich ein Ruder in die Hand gedrückt bekam. Es wog schwer, fühlte sich kantig an, unheilvoll. Der Steuermann, ein erstaunlich gut aussehender Kerl mit dunklen Glutaugen und einer Narbe, die ihn eher schmückte als verunzierte, lenkte das Boot zu einer Galeere, die mir als die heruntergekommenste der fünf erschien – ein Seelenverkäufer. Das ganze Schiff ächzte, als ich auf Deck gehievt wurde, es knarrte und knurrte wie ein böser Hund. Das Wasser rann von meinen zerlumpten Kleidern auf die von der Feuchtigkeit und vom Salz aufgeworfenen Planken, die vor Dreck und Unrat nur so strotzten. Erst starrte ich ins Ungewisse und dann, als meine Augen den Haufen Piraten sahen, der wohl zu unserem Empfang bereitstand, senkte ich meinen Blick.
Wieder trieben sie uns zusammen wie eine Herde Schafe. Die schrecklichen Bilder der Nacht, die Angst, Durst und Hunger – all dies hatte jeden Gedanken an Widerstand längst erstickt. In den Mienen meiner Mitgefangenen las ich nur Resignation, Spuren von Entsetzen und Panik. Mein eigenes Gesicht spiegelte wohl nichts anderes wider.
Den Piraten indes schien es noch nicht genug. Mit Peitschenhieben, Stockschlägen und wüsten Drohungen stießen sie uns die steile Treppe hinab, die unter Deck führte. Hier lagen, auf grob zusammengezimmerten Bänken, an die man uns kettete, die Ruder bereit. Ich starrte auf die eisernen Fesseln, die mich gnadenlos mit dem Schicksal des Schiffes verbanden. Das Holz des Riemens drückte hart auf meinen Schoß. Schon jetzt beherrschte nur eine Frage mein Denken: Was, wenn das Schiff untergeht? Doch die Antwort war sonnenklar: Es würde mich mit hinabnehmen, auf den Grund des Meeres.
»Wo bringen sie uns hin?«, flüsterte ich heiser meinem Nebenmann zu.
»Ach Kindchen, nirgendwohin«, kam die müde Antwort. Grenzenlos erstaunt spähte ich nach rechts. Kein anderer saß da als jener alte Mann, der mich gefunden und aufgenommen hatte. Nun jedoch war sein Zustand beklagenswert, die Haare versengt, im Gesicht eine Mischung aus Asche und Blut. Die Augen stumpf, leer, so kauerte er zusammengesunken auf der niedrigen Bank, die seinem krummen Rücken keinen Halt bot. Leichenblasse Finger hielten das Ruder umklammert, als sei es sein einziger und letzter Halt. Der Tod, so schien es, hockte bereits wie eine schwarze Krähe auf seinen Schultern.
»Was meinst du – nirgendwohin?«, zischte ich.
Er schüttelte müde den geschundenen Kopf. »Es gibt keinen bestimmten Ort, kein bestimmtes Ziel.«
»Was dann?«
»Es sind Piraten! Sie befahren das Meer auf der Suche nach Beute.«
»Beute?«
»Ja, Kindchen! Schiffe. Seeräuber entern Schiffe, töten die Besatzung und rauben die Ladung.«
»Und wir? Was haben wir damit zu schaffen?«
»Wir sind ihre Rudersklaven. Dazu haben sie uns gefangen.«
Ich schwieg. Nun schien das Holz auf meinen Knien noch schwerer zu wiegen. Ich betrachtete es mit gerunzelter Stirn, strich nachdenklich darüber. Eigentlich fühlte es sich gut an. Der Riemen war im Laufe der Jahre gewiss von vielen Händen bewegt worden, grau-, fast schwarzgefärbt von Schweiß und Blut und glattgeschmirgelt von Schwielen. Wie viele Leben, die längst erloschen waren, hatten wohl daran gelitten, um die Galeere voranzutreiben?
»Und dann? Was geschieht dann mit uns?«, wollte ich jetzt wissen.
Ein Husten schüttelte den Alten, nahm ihm den Atem und krümmte seinen Rücken noch mehr. Mir war, als hörte ich seine Knochen rasseln. Es dauerte eine Weile, bis er wieder in der Lage war,, zu sprechen. »Dann, was meinst du mit dann?«, keuchte er endlich.
»Danach! Wenn sie ihre Beute gemacht haben – das Schiff geentert, die Leute getötet und die Ware geraubt?«, stellte ich meine Frage präziser.
Der Alte versuchte ein Lachen. Es kam heraus wie ein heiseres Husten. »Kindchen, es gibt kein danach. Es wird immer so weitergehen. Bis irgendjemand das Schiff versenkt. Dann ist es aus mit uns.« Er hustete erneut. »Um mich ist es nicht schade, bin jetzt schon mehr tot als lebendig. Aber um dich, Kindchen, es ist ein Jammer, du bist noch so jung …«
»Hör auf!«, ächzte ich und dachte entsetzt an das nasse Grab, das unter den Schiffsplanken lauerte. »Ich will noch nicht sterben!« Der Tonfall meiner Stimme wurde trotziger: »Ich werde nicht sterben!« Wie um mir selbst Gewissheit zu geben, schüttelte ich heftig den Kopf. Dabei fiel mein Blick auf die fellbezogene Trommel, hinter der jetzt jener Seeräuber aufmarschierte, der schon den Nachen gelenkt hatte. Er war wirklich eine stattliche Erscheinung, groß, dunkel, aber gefährlich. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, flüsterte ich:
»Wie kommt es, dass du hier bist? Haben sie nicht die Kinder und Greise in den Wald gejagt?«
»Ich brachte es nicht übers Herz, mich trotz ihrer Grausamkeiten zu verstecken«, antwortete mein Nebenmann. »Also bin ich zurückgelaufen, und sie haben mich zu den anderen Männern gesteckt. Es ist besser so.« Er runzelte die Stirn und sah mich an. »Aber du – ein Mädchen! Mit den Frauen haben sie doch was anderes angestellt.«
»Pst, nicht so laut!«, zischte ich. »Sie halten mich für einen Mann – die Mütze, meine Kleider.«
Der Alte fing an zu kichern. »Was sind das doch bloß für Dummköpfe! Du, und ein Mann! Die müssen blind sein!«
Darauf mochte ich mich nicht verlassen. Nervös zog ich die Jacke über meinem Busen enger zusammen.
Es dauerte nicht lange, bis die Blasen an meinen Händen aufplatzten. Ich leckte das Blut ab und biss die Zähne zusammen. Hinüberschielend sah ich meinen Nachbarn leiden. Er hatte gekämpft und sein Bestes gegeben, aber nun verließ ihn das letzte bisschen Kraft.
Seine Stimme klang heiser und brüchig, als er klagte: »Kindchen, es hat keinen Zweck mehr, ich schaffe es nicht länger.«
»Kein Grund zur Sorge «, beruhigte ich ihn, ohne die Lippen zu bewegen, den Blick geradeaus gerichtet. »Halt dich nur einfach am Ruder fest, den Rest mach ich schon.«
Die misstrauischen Augen des Aufsehers neben dem Trommler fanden mich und ließen mich nicht mehr los. Ich senkte den Blick und versuchte, das Ruderblatt im geschlagenen Takt durchs Wasser zu ziehen. Doch auch ich war müde und am Ende meiner Kraft. Das Ruder verkantete, ich verlor den Rhythmus und fand ihn auch nicht rasch genug wieder. Die Peitsche des Aufsehers knallte. Zuerst in der Luft, dann auf die Planken, dann auf meinen Rücken. Der Schmerz riss mich fast von der Bank. Ich hatte beobachtet, wie das Marterwerkzeug einem Mann, der nicht mehr konnte, den Rücken zerfetzte. Drei Piraten hatten seinen Körper nach oben geschleift und offensichtlich über Bord geworfen. Mein Herz klopfte wie rasend, ich wollte das gleiche Schicksal gewiss nicht erleiden!
»Es wird nicht wieder vorkommen«, stammelte ich voller Angst und riss am Ruder. Ich hörte das Zischen der Peitsche und duckte mich. Doch der Hieb teilte nur die Luft über meinem Kopf.
»Du klingst wie ein Weib«, knurrte der Seeräuber verächtlich und kehrte zurück an seinen Platz.
Einmal, in der Nacht, kam Wind auf. Ich hörte das Knattern der Segel, als er hineinfuhr. Das Pochen der Trommel erstarb, und ich schlief vor Erschöpfung ein.
Als die Pauke mich wieder hochschreckte, lehnte der alte Mann an mir. Zunächst glaubte ich, er sei tot. Gestorben, hier, neben mir auf der Bank, den Kopf zur letzten Ruhe an meine Schulter gelehnt. Doch dann spürte ich seinen ungleichmäßigen Atem, mal hastig, dann wieder ruhig. Ich fühlte mich an Vater erinnert – wie oft hatte er im Suff seinen Schädel so an mich gelegt, sein Speichel, der aus den Mundwinkeln tropfte, mein Hemd benetzt.
Ich zupfte am Ärmel des Alten, zog fester und rüttelte ihn schließlich aus dem Schlaf.
»Wach auf, alter Mann. Wir müssen uns plagen!«
Sein Blick ging starr ins Leere. Ich setzte ihn gerade und schob seine Hände auf das runde Ruderholz. Der Taktschlag der Pauke hatte wieder begonnen, langsam zunächst, um sich dann ständig zu steigern – wie ein Herz, das die Furcht vor irgendetwas zu immer schnellerem Schlagen hetzt. Ich lauschte dem Rhythmus, legte mich in den Riemen und begann, die Arbeit des Alten mitzutun.
Durch die schmalen Sichtluken des Unterdecks fiel fahlgraues Morgenlicht. Die Kälte des kurzen Schlafs ließ mich schaudern und kroch langsam meinen Rücken hinab. Der Hunger nagte an meinen Eingeweiden. Umso gieriger starrte ich auf das Brot, das ein Pockennarbiger verteilte. Das Fass, aus dem er es gezogen hatte, verströmte den Gestank von Schimmel, der sich mit den Ausdünstungen der Rudernden vermischte. Mit zusammengepressten Lippen versuchte ich, den Ekel zu überwinden. Ich war es nicht gewohnt, unter so vielen Männern zu sein.
Mit einer Hand rudernd, teilte ich das harte Brot. Ich stemmte es unter einen Fuß und hebelte mit den Fingern. Endlich brach es, ich reichte die eine Hälfte dem Alten und flüsterte: »Hier, iss! Damit du wieder zu Kräften kommst.«
Er starrte immer noch vor sich hin und bewegte kaum die aufgeplatzten Lippen, als er erwiderte: »Behalte es. Es lohnt die Mühe nicht. Ich bin doch schon so gut wie tot.«
»Von ein bisschen Rudern stirbt man nicht gleich«, widersprach ich streng und schob das Brot in seinen Mund. Sofort begannen seine Kiefer zu mahlen. Seine Zähne schienen noch kräftig, es krachte, als sie das steinharte Brot zermalmten.
»Na, bitte«, murmelte ich und schob das übrige Stück gierig in meinen Mund. Der Hunger ließ den schimmligen Kanten besser schmecken als frisches Brot, bestrichen mit dem süßesten Honig.
Wenn ich früher über den Tagschlaf meines besoffenen Vaters wachte, damit er nicht an seinem eigenen Erbrochenen erstickte, vertrieb ich mir oft die Zeit, indem ich mit Augen und Gedanken dem Lauf der Sonne folgte. Der spitze Wipfel einer hohen Fichte diente als Zeiger für den kreisförmig um den Baum herumwandernden Schatten, der zunächst kürzer wurde und dann, wenn die Sonne den Zenit überschritten hatte, wieder länger
Hier, angekettet als Rudersklavin neben einem Greis, der die Riemen kaum mehr selbst bewegen konnte, mit dem Hunger in den Eingeweiden und der Angst und Verzweiflung im Herzen – hier fand ich für das Fortschreiten des Tages folgendes Maß: die schiffseigene Sonnenuhr. Das Licht fiel durch die hochgesetzten Sichtluken des Unterdecks und warf die Schatten der Rudernden auf die schmutzigen Planken des Mittelgangs – je kürzer die Schatten wurden, desto näher rückte, so nahm ich an, die Mittagsstunde. Dann, als die Sonne hoch über dem Schiffsbug stehen musste, also zur Mitte des Tages, verschwand sie für eine Weile. Meine Beobachtungen sah ich darin bestätigt, dass zu diesem Zeitpunkt die Wachen wechselten. Der Pockennarbige ging an Deck und wurde von dem gutaussehenden Seeräuber ersetzt. Der stellte sich breitbeinig neben den Trommler, bleckte grinsend sein ebenmäßiges Gebiss und ließ wohlgelaunt seine dunklen Glutaugen funkeln. Dieser hübsche Kerl hatte sich bei den Vergewaltigungen durch besondere Brutalität hervorgetan – das sollte ich nicht vergessen, wie nett auch immer er anzusehen war.
Er musste meinen Blick bemerkt haben, denn er runzelte die Stirn und schien nachzudenken, ohne allerdings zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Fortan versuchte ich zu vermeiden, dass unsere Blicke sich kreuzten. Stattdessen studierte ich wieder den Lauf der Sonne. Denn tatsächlich, nun, nach Überschreiten des Scheitelpunktes, setzte sich das Licht- und Schattenspiel auf der anderen Seite des Galeerenbodens fort.
Als ich dies flüsternd dem Alten mitteilte, schüttelte der nur den Kopf und brummte:
»Warum, glaubst du, sollten wir geradeaus fahren?«
»Nun, warum nicht?«
»Weil es hieße, die Piraten steuern ein genaues Ziel an. Sie suchen aber nach Beute. Also denke ich, wir kreuzen mal hierhin, mal dorthin.«
Das leuchtete ein. Trotzdem glaubte ich an meine Beobachtung. Ich blinzelte dem Alten zu und bemerkte vorsichtig: »Egal. Dir scheint es jetzt viel besser zu gehen.«
Sofort wurden seine Bemühungen, mir beim Rudern zu helfen, wieder schwächer. »Ach, Kindchen, nein, gewiss nicht«, jammerte er und stöhnte. »Mein Herz schlägt nur noch schwach, und ich bin schon froh, wenn ich den morgigen Tag erlebe!«
»Das wirst du«, versicherte ich grimmig und ließ meine Zähne knirschen, als ich versuchte, den zusätzlichen Widerstand des Ruderblattes zu überwinden.
Rot wie Blut tastete sich die Abendsonne durch die Luken zu meiner Rechten. Ich war erschöpft, der Hunger brannte noch schmerzhafter als meine Glieder. Außer jenem schimmeligen Kanten Brot am Morgen hatten wir nichts mehr bekommen.
Plötzlich brach über uns an Deck Unruhe aus. Wir hörten lautes Schreien, das Poltern von genagelten Stiefelsohlen auf den Schiffsplanken, und dann erhöhte die Pauke, die den Ruderschlag vorgab, ihr forderndes Pochen um beinahe das Doppelte.
»Was ist da oben los? Was geschieht da?«, flüsterte ich ängstlich, von einer schlimmen Vorahnung geplagt.
Der Alte hustete. »Das hört sich ganz nach einem Angriff an. Wir müssen schneller rudern. Das heißt, sie wollen ein anderes Schiff einholen. Sie bereiten sich auf ein Seegefecht vor.«
Sofort kroch die Angst wie Eis meinen Rücken hinunter. Meine Hände auf dem Riemen begannen zu zittern. Ich blickte auf die eisernen Fußfesseln und versuchte, die Furcht niederzukämpfen.
»Meinst du, wir gewinnen?« Meine Stimme klang kläglich.
»Hoffen wir es, Kindchen, hoffen wir es.« Die Antwort trug nicht zu meiner Beruhigung bei.
»Hoffen!«, keuchte ich, »das reicht mir nicht!«
Der Seeräuber, der uns beaufsichtigte, löste sich von seinem Platz. Er lief von einem zum anderen und rüttelte an den Ketten.
»Was macht er?«, zischte ich. »Löst er die Fesseln, damit wir uns retten können, wenn das Schiff versenkt wird?«