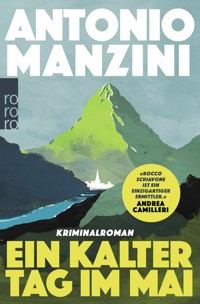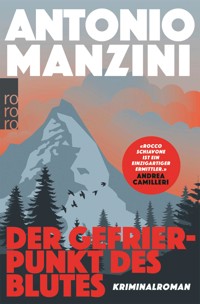9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rocco Schiavone ermittelt
- Sprache: Deutsch
Rocco Schiavone ist nicht gerade das, was man einen vorbildlichen Polizisten nennen würde. Er ist unverschämt, er verabscheut seinen Beruf - und es ist keine gute Idee, ihn vor seinem morgendlichen Joint anzusprechen. Seit der Römer in das verschneite Aosta-Tal strafversetzt wurde, ist seine Laune so düster wie der Himmel über den Bergen. Doch als eine junge Frau erhängt in ihrer Wohnung aufgefunden wird, ist Roccos Spürsinn geweckt. An Selbstmord glaubt er nicht: Blaue Flecken und Schürfwunden legen nahe, dass Ester Baudo gequält wurde. Ein Fall, der dem Ermittler unter die Haut geht. Und ihn zwingt, sich dem zu stellen, was er am meisten fürchtet: seiner Vergangenheit. «Eine außerordentliche Ermittlerfigur!» Andrea Camilleri
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Antonio Manzini
Die Kälte des Todes
Kriminalroman
Über dieses Buch
Er ist zynisch. Er ist brillant. Und er hat nichts zu verlieren.
Rocco Schiavone ist nicht gerade das, was man einen vorbildlichen Polizisten nennen würde. Er ist unverschämt, er verabscheut seinen Beruf - und es ist keine gute Idee, ihn vor seinem morgendlichen Joint anzusprechen. Seit der Römer in das verschneite Aosta-Tal strafversetzt wurde, ist seine Laune so düster wie der Himmel über den Bergen. Doch als eine junge Frau erhängt in ihrer Wohnung aufgefunden wird, ist Roccos Spürsinn geweckt. An Selbstmord glaubt er nicht: Blaue Flecken und Schürfwunden legen nahe, dass Ester Baudo gequält wurde. Ein Fall, der dem Ermittler unter die Haut geht. Und ihn zwingt, sich dem zu stellen, was er am meisten fürchtet: seiner Vergangenheit.
«Eine außerordentliche Ermittlerfigur!» (Andrea Camilleri)
«Unkorrekt und jähzornig, mit einer Neigung zu Handgreiflichkeiten und einer Schwäche für die Frauen: Rocco ist etwas ganz Besonderes.» (La Repubblica)
«Auf diesen Ermittler wollen wir nicht mehr verzichten.» (La Lettura)
«Hat das Zeug zum Serienstar.» (Più)
Vita
Antonio Manzini, geboren 1964 in Rom, ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Mit «Der Gefrierpunkt des Blutes», dem Auftakt zur Krimireihe um den charismatischen Ermittler Rocco Schiavone, gelang ihm in Italien auf Anhieb der Sprung auf die Bestsellerliste.
Weitere Veröffentlichung: Der Gefrierpunkt des Blutes
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel «La Costola di Adamo» bei Sellerio Editore, Palermo.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La Costola di Adamo» Copyright © 2014 by Sellerio Editore, Palermo
Redaktion Petra Müller
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung TeddyandMia/Shutterstock
ISBN 978-3-644-53521-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Danksagung
Für Onkel Vincenzo
Für einen Mann gibt es viele Jahreszeiten, während eine Frau nur das Recht auf den Frühling hat.
JANE FONDA
Freitag
Mitte März sandte die Sonne bereits erste Strahlen als Vorboten des nahenden Frühlings. Strahlen, die noch zart und ein wenig flüchtig waren, jedoch die Welt in ein buntes Licht tauchten und Hoffnungen weckten.
Aber nicht in Aosta.
Es hatte bis tief in die Nacht geregnet; noch um zwei Uhr waren dicke, mit Schnee vermischte Tropfen auf die Stadt niedergegangen. Dann war es kälter geworden, der Schnee hatte sich durchgesetzt und bis sechs Uhr früh, in feinen Flocken fallend, Straßen und Bürgersteige komplett zugedeckt. Im Morgengrauen hatte das Licht zart und zögernd die weiße Stadt enthüllt, während letzte verspätete Schneeflocken spiralförmig auf die Bürgersteige hinabschwirrten. Die Berggipfel waren wolkenverhangen, und die Temperatur lag bei ein paar Grad unter null. Dann hatte sich plötzlich ein tückischer Wind erhoben, war wie eine Schar betrunkener Kosaken in die Stadt eingefallen und hatte rücksichtslos an den Menschen und allem anderen gezerrt, was sich in den Straßen befand.
In der Via Brocherel nur an allem anderen, denn die Straße war menschenleer. Das Parkverbotsschild wankte, und die Zweige der am Straßenrand gepflanzten jungen Bäume knirschten wie die Knochen eines Arthrosekranken. Der noch lose Schnee wirbelte umher, und hier und dort krachte ein lockerer Fensterladen gegen eine Hauswand. Und die Böen, die über die Dächer fegten, bliesen Wolken aus pulverisiertem Eis zur Erde hinab.
Als Irina von der Via Monte Emilius in die Via Brocherel einbog, schlug ihr der eisige Wind ins Gesicht. Ihr zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar wurde nach hinten geweht, und sie kniff die blauen Augen zusammen. Hätte man sie in diesem Moment fotografiert, hätte sie ausgesehen wie eine Verrückte im Geschwindigkeitsrausch, die ohne Helm Motorrad fuhr.
Dennoch empfand sie den plötzlichen Windstoß eher wie eine Streicheleinheit. Sie schloss nicht einmal den Kragen ihrer grauen Wolljacke, denn für jemanden, der im weißrussischen Lida, in der Nähe der litauischen Grenze, geboren war, war dieser Wind nicht mehr als eine frühlingshafte Brise. In ihrer Heimat stapfte man um diese Jahreszeit bei zehn Grad minus durch meterhohen Schnee.
Irina ging in ihren falschen Hogan-Stiefeln eilig voran und lutschte ein Honigbonbon, das sie sich nach dem Frühstück in der Bar gekauft hatte. Sie liebte das italienische Frühstück. Cappuccino und Cornetto. Die Geräusche der Kaffeemaschine, die die Milch erhitzte und aufschäumte, bevor sie sich mit dem schwarzen Kaffee mischte und schließlich noch mit ein wenig Kakaopulver bestäubt wurde. Und das noch warme, knusprige, süße im Mund schmelzende Hörnchen. An das Frühstück in Lida mochte Irina nicht einmal denken. Den unsäglichen Hafer- oder Gerstenbrei, dazu Kaffee, der nach Erde schmeckte. Und dann die Gurken, deren sauren Geschmack sie am frühen Morgen nicht ertragen konnte. Ihr Großvater hatte sie mit Schnaps hinuntergespült, während ihr Vater die Butter wie eine Süßspeise direkt vom Teller aß. Als sie das Ahmed erzählt hatte, hatte er sich kaputtgelacht. «Butter? Mit dem Löffel?», hatte er gefragt und beim Lachen seine strahlend weißen Zähne entblößt, um die Irina ihn so beneidete. Ihre waren eher gräulich. «Das liegt am Klima», war Ahmeds Meinung. «In Ägypten ist es warm, und die Zähne sind weiß. Je kälter es ist, desto dunkler werden sie. Es ist genau andersherum als mit der Haut. Ihr habt nicht genug Sonne. Dafür esst ihr die Butter mit dem Löffel.» Er hatte sich ausgeschüttet vor Lachen.
Irina liebte ihn. Sie liebte es, wie er roch, wenn er vom Markt zurückkam. Er duftete nach Äpfeln und Kräutern. Sie liebte ihn, wenn er, Richtung Mekka gewandt, betete, wenn er Süßes aus Honig für sie zubereitete, wenn sie sich liebten. Ahmed war freundlich und aufmerksam, betrank sich nicht, und sein Atem roch nach Minze.
Und nun war ihre Beziehung an einem entscheidenden Punkt angekommen. Ahmed hatte sie gefragt.
Ob sie ihn heiraten wollte.
Allerdings gab es da ein organisatorisches Problem. Um kirchlich heiraten zu können, müsste Irina zum Islam konvertieren oder Ahmed zum orthodoxen Glauben. Aber das war nicht möglich. Sie konnte ihren Eltern schlecht sagen: «Hey Leute, ab morgen werde ich Gott Allah nennen!» Genauso wenig wie Ahmed seinen Vater in Fayum anrufen konnte, um ihm mitzuteilen: «Übrigens, Papa, ab morgen bin ich orthodox!» Obendrein befürchtete Ahmed, dass sein Vater nicht einmal wüsste, was das hieß, und es wahrscheinlich für eine ansteckende Krankheit halten würde. Daher dachten Irina und Ahmed an eine standesamtliche Hochzeit. Sie würden sich schon irgendwie durchmogeln. Zumindest solange sie noch in Aosta waren. Und dann würde Gott, Allah oder wer auch immer für sie entscheiden.
Inzwischen war Irina beim Haus Nummer 22 angekommen. Sie nahm den Schlüssel heraus und öffnete die Haustür. Wie schön es hier war! Die Marmortreppe und das polierte hölzerne Geländer. Nicht wie bei ihr zu Hause, mit den kaputten Fliesen und den feuchten Flecken an der Decke. Hier gab es sogar einen Aufzug. In ihrem Haus natürlich nicht. Dort musste sie zu Fuß hinauf in die vierte Etage. Und andauernd war eine Stufe kaputt oder wackelte, wenn sie nicht sogar komplett fehlte. Ganz zu schweigen von der Heizung, die ständig Geräusche von sich gab und nur funktionierte, wenn man ihr einen Tritt verpasste. Wie gern würde sie in einem solchen Haus wohnen! Mit Ahmed und seinem Sohn Helmi, der schon achtzehn Jahre alt war und nie ein Wort Arabisch gelernt hatte. Helmi. Wie sehr hatte sie sich bemüht, nett zu ihm zu sein. Doch es hatte nichts gebracht. «Du bist nicht meine Mutter! Kümmer dich um deinen Kram!», hatte er geschrien.
Irina schluckte und lächelte müde. Und dachte an die Mutter des Jungen. Die zurück nach Ägypten gegangen war, nach Alexandria, um im Geschäft von Verwandten zu arbeiten, und die von ihrem Sohn und ihrem Mann nichts mehr wissen wollte. «Helmi» war das arabische Wort für «Ruhe». Der Gedanke ließ Irina lächeln. Einen weniger passenden Namen konnte es für den Jungen nicht geben. Helmi schien ständig unter Strom zu stehen. Er war dauernd unterwegs, kam nicht zum Schlafen nach Hause, war in der Schule eine Katastrophe, und zu Hause machte er alles schlecht. «Du Versager!», beschimpfte er seinen Vater. «Stehst dir jeden Tag auf dem Markt die Füße platt. So werde ich nicht enden! Eher hol ich mir ‘ne Oma ins Bett!»
«Meine Arbeit ist dir nicht gut genug? Was willst du denn stattdessen machen?», brüllte Ahmed zurück. «Hoffst du auf den Nobelpreis?», meinte er in ironischer Anspielung auf die katastrophalen schulischen Leistungen seines Sohnes. «Du wirst als Arbeitsloser auf der Straße landen! Aber das ist kein Beruf, mein Lieber.»
«Immer noch besser, als Äpfel zu verkaufen oder bei anderen den Dreck aufzuwischen wie deine Putze hier!», sagte Helmi mit einem abschätzigen Blick auf Irina. «Ich werd richtig Kohle machen, während du irgendwann arm sterben wirst. Aber keine Sorge, den Sarg bezahl ich dir!»
Die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn endeten für gewöhnlich damit, dass Ahmed Helmi eine Ohrfeige verpasste, der daraufhin türenknallend das Haus verließ, sodass der Riss in der Wand, der ohnehin schon fast die Decke erreicht hatte, noch ein Stückchen weiter nach oben wanderte. Irina war sich sicher, dass der nächste Streit Wand und Decke zum Einsturz bringen würde, schlimmer als beim Erdbeben 2004 in Vilnius.
Die Aufzugtüren gingen auf, und Irina wandte sich nach links in Richtung der Wohnung mit der Nummer 11.
Das Schloss öffnete sich nach der ersten Schlüsselumdrehung. Seltsam, sehr seltsam, dachte Irina. Normalerweise war mehrfach abgeschlossen. Sie kam dreimal pro Woche zu den Baudos, und im vergangenen Jahr hatte sie Signor Baudo kein einziges Mal zu Hause angetroffen. Um zehn Uhr morgens war er längst bei der Arbeit; auch freitags verließ er schon am frühen Morgen das Haus, weil er mit dem Fahrrad fuhr. Und die Signora kam normalerweise erst pünktlich um elf vom Einkaufen zurück. Irina hätte die Uhr danach stellen können. Nun schien sie aber zu Hause zu sein. Vielleicht hatte sich Signora Ester die Darmgrippe eingefangen, die in Aosta gerade heftiger wütete als eine Pestepidemie im Mittelalter. Irina trat ein und brachte einen Schwall kalter Luft mit. «Signora Ester, ich bin’s, Irina! Es ist eisig draußen … Sind Sie zu Hause?», rief sie und legte den Schlüssel auf der Garderobe ab. «Sind Sie nicht zum Einkaufen gegangen?» Ihre heisere Stimme, die sie den zweiundzwanzig Zigaretten am Tag verdankte, hallte von den getönten Scheiben in der Eingangstür zurück.
«Signora?»
Sie zog die Schiebetür zum Wohnzimmer zur Seite und trat ein.
Unordnung. Auf dem Couchtisch vor dem Fernseher stand noch das Tablett mit den Resten des Abendessens. Hühnerknochen, eine ausgepresste Zitrone und etwas Grünliches, Spinat vielleicht. Auf dem Sofa eine zusammengeknüllte smaragdgrüne Decke und ein Dutzend Zigarettenkippen im Aschenbecher. Irina dachte, dass die Signora sicher mit Fieber im Bett lag und Patrizio, ihr Mann, sich am Vorabend das Spiel im Fernsehen angesehen hatte. Ansonsten stünden sicher zwei Teller auf dem Tisch, seiner und der von Signora Ester. Die Seiten des Corriere dello Sport waren gleichmäßig auf dem Teppich verteilt, und auf dem hellen antiken Tisch waren zwei runde Glasabdrücke zu sehen. Kopfschüttelnd betrachtete Irina das Durcheinander. «Signora, sind Sie da? Sind Sie im Bett?»
Keine Antwort.
Sie sammelte Aschenbecher und Flaschen ein und balancierte sie auf einem Tablett in die Küche, blieb aber dann auf der Schwelle stehen. «Was ist das …?», sagte sie halblaut zu sich selbst.
Die Türen der Anrichte standen sperrangelweit offen. Scherben von Gläsern und Tellern lagen am Boden neben Nudelpaketen und Tomatendosen. Geschirrtücher, Besteck und Papierservietten waren kreuz und quer auf den Fliesen verteilt. Unter den halb offenstehenden Kühlschrank waren Orangen gerollt. Die Stühle waren umgeworfen, der Tisch an die Wand geschoben worden, und aus der zerbrochenen Küchenmaschine auf dem Boden quollen Kabel und andere Elektroteile hervor.
«Was ist das denn?», rief Irina aus. Sie stellte das Tablett ab und rief noch einmal: «Signora Ester! Signora Ester, was ist denn hier passiert?»
Wieder keine Antwort.
Sie sah im Schlafzimmer nach, fand aber dort nur ein zerwühltes Bett vor. Das Laken und die Decke lagen zerknüllt am Boden. Der Schrank stand offen. Irina eilte in die Küche zurück. «Aber, was …?» Mit dem Fuß stieß sie an einen Gegenstand. Sie sah zu Boden. Ein in seine Einzelteile zerschmettertes Handy.
«Einbrecher!», schrie sie und erstarrte vor Schreck, als spürte sie eine kalte, bedrohliche Messerklinge im Rücken. Dann stürzte sie davon. Bis sie über den antiken afghanischen Teppich stolperte, hinfiel und mit dem Knie auf den Fliesen aufschlug.
Knacks!
Ein dumpfes Geräusch in ihrem Knie, gefolgt von einem stechenden Schmerz, der ihr direkt ins Gehirn fuhr. «Aahh!», stieß sie zwischen den Zähnen hervor und stand, sich das Knie haltend, mühsam auf. Hastig wandte sie sich zur Wohnungstür, sicher, dass ihr ein paar bedrohliche Männer mit schwarzen Sturmmützen im Gesicht und spitzen Reißzähnen bereits dicht auf den Fersen waren. Sie konzentrierte das gesamte Adrenalin in ihrem Körper und humpelte aus der Wohnung der Baudos. Mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Sie keuchte und blickte auf ihr Knie hinunter. Die Strumpfhose war gerissen, und ein paar Tropfen Blut verschmutzten ihre weiße Haut. Sie leckte sich zwei Finger an und rieb über die Wunde. Der brennende Schmerz war nun dumpf und anhaltend, aber erträglicher. Dann ging ihr auf, dass sie hier, im Treppenhaus, keineswegs in Sicherheit war. Wenn die Einbrecher noch in der Wohnung waren, brauchten sie nur die Tür zu öffnen und mit einem Brecheisen oder einem Messer über sie herzufallen. Sie hinkte die Stufen hinab und schrie dabei: «Hilfe! Einbrecher! Einbrecher!»
Als sie im zweiten Stock an die Türen hämmerte, öffnete niemand. «Hilfe! Einbrecher! Helfen Sie mir!»
Sie hetzte weiter die Treppe hinab. Gern hätte sie zwei Stufen auf einmal genommen, was ihr schmerzendes Knie jedoch nicht zuließ. Sie klammerte sich an das schöne hölzerne Geländer und dankte Gott, dass sie die falschen Hogans mit den Gummisohlen trug. Mit Ledersohlen auf der Marmortreppe wäre sie die Stufen wahrscheinlich auf dem Hintern hinuntergerutscht. Sie hämmerte auch an die Türen im ersten Stock, klingelte Sturm und trat sogar dagegen, doch niemand machte auf. Aus einer der Wohnungen schallte ihr lediglich hysterisches Hundegebell entgegen.
Ein Totenhaus, dachte sie.
Schließlich öffnete sie die Haustür und stürzte auf die Straße. Die noch immer wie ausgestorben dalag. Es gab nicht mal ein Geschäft oder eine Bar, von wo aus sie jemanden hätte anrufen können. Der Himmel war dunkelgrau, und kein Auto war unterwegs. Um zehn Uhr morgens schien in der Via Brocherel die Zeit stehengeblieben zu sein, alles wirkte wie erstarrt, und außer ihr war keine lebende Seele zu sehen.
«Hilfe!», schrie sie aus vollem Hals.
Dann tauchte, wie durch ein Wunder, an der Straßenecke ein mit einem dicken Schal vermummter alter Mann auf, der eine kleine Promenadenmischung an der Leine führte. Irina eilte ihm entgegen.
Paolo Rastelli, pensionierter Maresciallo des Heeres, Einberufungsjahrgang 1939, blieb mitten auf dem Gehsteig stehen. Eine Frau ohne Mantel, mit wirrem Haar und Blutspuren am Knie, stürzte ihm hinkend entgegen, wobei sie nach Luft schnappte wie ein Fisch auf dem Trockenen. Sie rief etwas. Doch der Maresciallo konnte sie nicht hören. Er sah nur ihren weit aufgerissenen, hastige Worte formenden Mund. Also beschloss er, das Hörgerät einzuschalten, das er am rechten Ohr trug und jedes Mal ausstellte, wenn er mit Flipper Gassi ging. Flipper, eine Kreuzung aus einem Yorkshireterrier und zweiunddreißig anderen Rassen, war explosiver als ein Reagenzglas mit Nitroglyzerin. Ein vom Wind aufgewirbeltes Blatt, ein gurgelndes Rohr oder einfach die wirre Phantasie des bereits vierzehn Jahre alten Mischlings reichten aus, um ihn in ein schrilles, heiseres Bellen ausbrechen zu lassen, das dem pensionierten Maresciallo noch unangenehmer war als das Quietschen eines Nagels über eine Schiefertafel. Kaum eingeschaltet, jagte das Hörgerät ihm eine Art Elektroschock ins Gehirn. Dann erkannte er, wie zu erwarten gewesen war, in dem markerschütternden plötzlichen Lärm Flippers durchdringendes, aufgeregtes Gebell, und schließlich konnte er aus dem weit aufgerissenen Mund der Frau die Worte entnehmen, die zusammengesetzt folgenden Sinn ergaben: «Hilfe! Helfen Sie mir! Einbrecher!»
Flipper, der auf dem rechten Auge kaum noch etwas sehen konnte, während das linke schon seit Jahren blind war, bellte nicht die Frau an, sondern ein im Wind wankendes Schild auf der anderen Straßenseite. Paolo Rastelli blieb eine Reaktionszeit von nur wenigen Sekunden. Er blickte hinter sich, doch es war niemand zu sehen. Nach seinem Handy zu greifen und die Polizei zu rufen war nicht mehr möglich, denn die Frau war nur noch wenige Meter von ihm entfernt und rannte, als wäre der Teufel hinter ihr her. Dabei schrie sie immer noch ununterbrochen: «Hilfe! Helfen Sie mir!» Er konnte vor dieser Rachegöttin mit dem strohblonden Haar fliehen, doch hätte er davon erst noch seine genagelte Hüfte und sein altersbedingtes Lungenemphysem überzeugen müssen. Daher stand er stramm wie damals als einfacher Soldat bei der Bewachung des Munitionsdepots, in Erwartung seines unabwendbaren schrecklichen Schicksals, und verfluchte Flipper und dessen schwache Blase, die ihn gezwungen hatten, sein Rätselheft wegzulegen und die Wohnung zu verlassen.
Als der Wecker klingelte, war es genau zwanzig vor acht. Vicequestore Rocco Schiavone, der seit einem halben Jahr in Aosta zu Hause war, stand auf und ging wie jeden Morgen als Erstes zum Schlafzimmerfenster. Gespannt wie ein Pokerspieler, der die Karten für die letzte Runde in die Hand nimmt, schob er den schweren Vorhang zur Seite, in der vagen Hoffnung auf einen Sonnenstrahl aus Richtung Himmel.
«Scheiße», murmelte er. Auch an diesem Freitag war die Wolkenschicht so dicht geschlossen wie der Deckel eines Schnellkochtopfs. Auf dem Gehsteig lag Schnee, und die vorübereilenden Passanten trugen noch immer Schal und Mütze. Sag bloß, denen ist kalt!, dachte Rocco.
Das tägliche Ritual: duschen, die Espressokapsel in die Maschine, rasieren. Vor dem Schrank zögerte er nicht bei der Auswahl der Kleidung. Genau wie am Vortag, am Tag davor und wahrscheinlich an allen kommenden Tagen griff er zu einer braunen Cordhose, einem Shirt, innen Baumwolle, außen Wolle, Strümpfen aus einem Wollgemisch, einem karierten Flanellhemd, einem Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt, einem grünen Cordjackett und zu den unvermeidlichen Clarks. Kurz überschlug er im Kopf, dass ihn die sechs Monate in Aosta inzwischen neun Paar Schuhe gekostet hatten. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, über eine Alternative nachzudenken. Aber bisher hatte er noch keine gefunden. Vor zwei Monaten hatte er sich ein Paar Thermostiefel gekauft, als er wegen eines Falles ins Skigebiet Champoluc musste, aber hier in der Stadt kamen diese Betonklötze nicht in Frage. Er zog seinen Lodenmantel über und verließ das Haus, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Wie jeden Morgen war sein Handy ausgeschaltet. Denn das tägliche Morgenritual bestand nicht nur darin, sich anzukleiden und das Haus zu verlassen. Bevor er den Tag beginnen konnte, waren noch zwei fundamentale Dinge zu erledigen: das Frühstück in der Bar auf der Piazza und sein morgendlicher Joint am Schreibtisch.
Das Betreten der Questura war der heikelste Moment. Noch mit den Gedanken an die letzte Nacht beschäftigt und mit einer Laune, die so düster war wie der Himmel über der Stadt, schlich Rocco unauffällig wie eine Schlange im hohen Gras durch die Gänge. Er musste unbedingt jegliche Begegnung mit Agente D’Intino vermeiden. Nicht schon um halb neun, nicht am frühen Morgen! Er hasste den aus der Provinz Chieti stammenden Agente vielleicht noch mehr als das ungemütliche Klima im Aostatal. Ein Mann, der es in seiner Unfähigkeit regelmäßig fertigbrachte, seine Kollegen lebensgefährlich zu verletzen, jedoch nie sich selbst. Dem es gelungen war, Agente Casella auf dem Parkplatz der Questura mit dem Auto rückwärts über den Haufen zu fahren, sodass dieser ins Krankenhaus musste. Der einen von Roccos Zehennägeln auf dem Gewissen hatte, weil er einen Karteikasten hatte darauffallen lassen. Und der in seiner Manie, alles aufzuräumen, beinah Agente Deruta vergiftet hatte, weil er das Bleichmittel in eine leere Olivenölflasche gefüllt hatte. Rocco hatte D’Intino bereits mehrfach gedroht und den Questore dahingehend bearbeitet, für diesen Unglücksraben einen Posten in irgendeinem Commissariato jenseits der Abruzzen zu suchen, wo er besser aufgehoben wäre.
An diesem Morgen begegnete er zum Glück niemandem. Der Einzige, der ihn begrüßt hatte, war der Kollege Scipioni am Eingang. Doch der hatte sich auf ein müdes Lächeln beschränkt und den Blick gleich wieder auf die Briefe gesenkt, die er gerade überprüfte. Rocco erreichte sein Büro, setzte sich an den Schreibtisch und zündete sich einen schönen, dicken Joint an. Als er ihn im Aschenbecher ausdrückte, war es kurz nach neun. Nun war es an der Zeit, das Handy einzuschalten und den Tag zu beginnen. Sofort avisierte ihm der Hinweiston den Empfang einer SMS.
Wirst Du Dich irgendwann dazu durchringen, wenigstens eine Nacht bei mir zu verbringen?
Sie war von Nora. Der Frau, mit der er eine Bettgeschichte hatte, seit er von Rom nach Aosta versetzt worden war. Eine lockere Beziehung gegenseitigen Entgegenkommens, die inzwischen einen kritischen Punkt erreicht hatte, da Nora auf etwas Festes drängte. Eine Sache, zu der Rocco nicht bereit war. Für ihn war es gut so, wie sie es bisher gehalten hatten. Er brauchte keine Lebensgefährtin. Die Frau seines Lebens war Marina, und sie würde es für immer bleiben. Für eine andere war da kein Platz. Nora war wunderschön und machte seine Einsamkeit erträglicher. Aber das war noch lange kein Grund, gleich mit ihr vor den Altar zu treten. Das tat man, weil man mit dem anderen Menschen zusammen sein wollte. Und diesen Weg war er vor Jahren bereits gegangen, mit den besten Absichten. Er hätte sein ganzes Leben mit Marina verbracht, daran gab es nichts zu rütteln. Aber manchmal liefen die Dinge nicht so, wie sie sollten, zerbrachen, gingen kaputt und waren nicht mehr zu reparieren. Doch das war nebensächlich. Rocco gehörte zu Marina, und Marina gehörte zu Rocco. Alles andere war wie welkes Laub, wie unnötige Verzweigungen, die gestutzt gehörten.
Während Rocco Noras Gesicht vor sich sah, ihren wohlgeformten Körper, ihre schlanken Fesseln, fiel ihm siedend heiß wieder ein, was sie ihm am Vorabend mitgeteilt hatte, als sie im Bett in seinen Armen lag. «Morgen werde ich dreiundvierzig und bin die Königin des Tages. Also musst du dich gut benehmen!» Dann hatte sie ihm ein strahlendes Lächeln geschenkt und dabei ihre perfekten weißen Zähne gezeigt.
Rocco hatte nicht aufgehört, sie zu küssen und ihre vollen, runden Brüste zu massieren, war aber in Gedanken beim nächsten Tag. Er würde ihr ein Geschenk kaufen, sie vielleicht sogar zum Essen ausführen müssen und dadurch das auf den Freitag vorgezogene Spiel Rom gegen Inter Mailand verpassen.
«Kein Parfüm», hatte sie ihn gewarnt. «Ich hasse Tücher jeder Art genauso wie Pflanzen. Ohrringe, Armbänder und Ketten kaufe ich mir selbst, Bücher auch. Von CDs reden wir erst gar nicht. Nun weißt du zumindest, was du mir nicht schenken solltest, wenn du mir meinen Geburtstag nicht verderben willst.»
Welche Art von Geschenk blieb dann noch? Nora hatte ihn in eine Krise gestürzt. Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke zu machen gehörte zu den Dingen, die Rocco am meisten hasste. Er würde jede Menge Zeit damit verlieren, sich etwas einfallen zu lassen und wie ein Idiot lustlos durch Geschäfte zu streifen. Aber wenn er weiterhin diesen wunderbaren Körper genießen wollte, brauchte er einen rettenden Einfall. Und er brauchte ihn heute, denn Noras Geburtstag war heute.
«Was für eine Scheiße!», sagte er gerade halblaut, als es an der Tür klopfte. Rocco stürzte zum Fenster und riss es auf. Er schnüffelte wie ein Hund, bis er davon überzeugt war, dass der Cannabisgeruch sich einigermaßen verzogen hatte, dann rief er: «Herein!», und Ispettrice Caterina Rispoli trat ins Zimmer. Die als Erstes in die Luft schnupperte und ein seltsames Gesicht machte. «Was ist das für ein Geruch?»
«Ich habe mir einen Rosmarinwickel gegen die Erkältung gemacht», antwortete er.
«Aber Sie sind doch gar nicht erkältet.»
«Weil ich mir Rosmarinwickel mache. Deshalb.»
«Rosmarinwickel? Davon hab ich noch nie gehört.»
«Naturheilkunde, Caterina, eine tolle Sache.»
«Meine Großmutter hat mir geraten, Eukalyptusblüten dafür zu nehmen.»
«Wofür?»
«Die Wickel.»
«Auch meine Großmutter hat mir zu Wickeln geraten.»
«Mit Rosmarin?»
«Nein, Frauen um den Finger. Könntest du mir jetzt bitte endlich sagen, warum du hier bist?»
Caterina, die gerade noch die schön geschwungenen Augenbrauen hochgezogen hatte, hatte sich sofort wieder unter Kontrolle. «Uns liegt eine Anzeige vor, der wir vielleicht auf den Grund gehen sollten …» Sie hielt Rocco ein Blatt Papier unter die Nase. «Angeblich ist in den Grünanlagen am Bahnhof nachts immer jede Menge los. Bis drei Uhr morgens.»
«Prostitution?», fragte Rocco.
«Nein.»
«Drogen?»
«Ich denke, ja.»
Rocco hatte einen Blick auf die Anzeige geworfen. «Wir sollten der Sache nachgehen …» Dann kam ihm ein hervorragender Gedanke, der den Tag doch noch zum Guten wenden konnte. «Schick mal die beiden Clowns her!»
«Wen?», fragte Caterina.
«D’Intino und Michele Deruta.»
Die Ispettrice nickte und verließ den Raum. Rocco schloss das Fenster. Es war eiskalt im Zimmer. Doch das, was ihm gerade eingefallen war, versetzte ihn derart in freudige Erregung, dass er die Kälte gar nicht spürte. Keine fünf Minuten später betraten D’Intino und Deruta in Begleitung von Caterina Rispoli den Raum.
«D’Intino und Deruta», begann Rocco ernst. «Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, die sehr viel Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein erfordert. Fühlt ihr euch dem gewachsen?»
Deruta lächelte, wobei er in dem Versuch, seine hundertzehn Kilo Körpergewicht auf seinen Füßen mit der Schuhgröße achtunddreißig zu balancieren, leicht hin und her wankte. «Sicher, Dottore.»
«Absolut sicher sogar», bestätigte D’Intino nachdrücklich.
«Also aufgepasst. Es geht um eine Überwachungsaktion. Eine nächtliche Beschattung.» Die beiden Agenti hingen an seinen Lippen. «In den Grünanlagen am Bahnhof. Wir vermuten, dass dort mit Drogen gehandelt wird. Koks oder Heroin, wir wissen es nicht.»
Deruta sah D’Intino aufgeregt an. Endlich eine Aufgabe, die ihren Fähigkeiten entsprach!
«Sucht euch einen Beobachtungsposten, wo euch niemand sieht. Lasst euch die Kamera geben und macht jede Menge Fotos. Ich will wissen, was da los ist, wie viel von dem Zeug sie verkaufen, wer die Dealer sind. Ich will Namen! Verstanden?»
«Natürlich», sagte D’Intino.
«Aber ich muss ja noch in die Bäckerei von meiner Frau», wandte Deruta ein. «Sie wissen ja, dass ich nachts oft dort aushelfe. Auch letzte Nacht habe ich …»
Schnaubend erhob sich Rocco und unterbrach ihn.
«Michele! Es ist ganz wunderbar, dass du deiner Frau am Ofen zur Hand gehst und dir so doppelte Arbeit aufhalst. Aber du bist nun mal in erster Linie Polizist und nicht Bäcker!»
Deruta nickte.
«Ispettrice Rispoli wird das Ganze koordinieren.»
An dieser Nachricht hatten Deruta und D’Intino zu schlucken. «Aber warum sie? Immer darf sie koordinieren!», wagte D’Intino einzuwenden.
«Erstens ist Rispoli Ispettrice, hat also einen höheren Rang als ihr. Zweitens ist sie eine Frau, weswegen ich ihr eine so gefährliche Aufgabe nicht zumuten will. Und drittens, und das ist das Entscheidende, wird es so gemacht, wie ich es sage, D’Intino, ansonsten trete ich dir so in den Hintern, dass du wieder in Chieti landest, verstanden?»
D’Intino und Deruta nickten unisono. «Und wann soll es losgehen?»
«Heute Abend. Und jetzt könnt ihr erst mal gehen, denn ich habe noch etwas mit der Kollegin Rispoli zu besprechen.» Diese hatte dem Ganzen, etwas abseitsstehend, schweigend zugehört. Als die beiden Herren den Raum verließen, warfen sie ihr einen wütenden Blick zu.
«Dottore, so kriege ich Schwierigkeiten mit den beiden.»
«Keine Panik, Rispoli, die gehen uns jetzt nicht mehr so schnell auf die Eier. Als Gegenleistung bräuchte ich von dir einen Rat. Bitte setz dich.»
Caterina gehorchte.
«Ich muss ein Geschenk besorgen.»
«Geburtstag?»
«Genau. Folgende Koordinaten: Frau, dreiundvierzig Jahre, gut in Form, verkauft Brautkleider, ist aus Aosta, hat Geschmack und ist finanziell recht gutgestellt.»
Die Ispettrice dachte eine Weile nach.
«Eine sehr gute Freundin?»
«Das geht dich nichts an.»
«Verstanden.»
«Keine Tücher, Pflanzen, Bücher, Parfüms, CDs und keinen Schmuck.»
«Ich muss mehr wissen. Geht es um Nora Tardioli? Die mit dem Geschäft im Zentrum?»
Rocco nickte schweigend.
«Herzlichen Glückwunsch, Dottore, ein guter Fang.»
«Danke, aber wie gesagt: Das geht dich nichts an.»
«Wie weit wollen Sie denn gehen?»
«Eigentlich keinen Schritt weiter. Warum?»
«Ansonsten wäre vielleicht ein Diamantring angesagt.»
«Das ist eindeutig zu weit. Ich habe nicht vor, mich auszuliefern.»
Caterina lächelte. «Ich denke darüber nach. Hat sie irgendwelche Hobbys?»
«Keine Ahnung. Sie geht gern ins Kino, aber eine DVD wäre vermutlich nicht das Richtige. Sie geht zweimal in der Woche schwimmen und dreimal ins Fitnessstudio. Sie macht Skilanglauf, und mit dem Fahrrad fährt sie auch.»
«Das klingt eher nach Josefa Idem.»
«Jetzt ist es …», Rocco sah auf die Uhr, «… Viertel nach zehn. Glaubst du, bis heute Mittag fällt dir etwas ein?»
«Ich versuch’s.»
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, und Agente Italo Pierron stürzte herein. Er war neben Caterina Rispoli der einzige Kollege in der Questura, den Rocco des Polizeiberufs für würdig erachtete. Nur er durfte das Büro des Vicequestore betreten, ohne anzuklopfen, und außerhalb des Dienstgebäudes war es ihm erlaubt, seinen Chef zu duzen. Er nickte Caterina zu.
«Dottore?»
«Italo, was ist los?» Der junge Agente war blass und wirkte beunruhigt.
«Es ist dringend.»
«Ich höre.»
«Wie es aussieht, sind in der Via Brocherel, in der Wohnung eines Ehepaars namens Patrizio und Ester Baudo, Diebe eingesperrt.»
«Eingesperrt?»
«Gerade hat ein gewisser Paolo Rastelli angerufen, ein pensionierter Maresciallo, der halb taub ist. So habe ich ihn jedenfalls verstanden, während im Hintergrund die ganze Zeit eine Frau schrie: ‹Sie sind noch drin! Sie haben alles verwüstet, und sie sind noch drin!›»
Rocco nickte. «Dann mal los.»
«Soll ich auch mitkommen?», fragte Caterina.
«Lieber nicht. Ich brauche dich hier.»
«Verstanden.»
Während sie mit ausgeschalteter Sirene über die Kreuzungen jagten, nahm sich Rocco eine Zigarette aus Italos Päckchen, ohne den Blick von der perfekt geräumten Straße zu heben. «Funktioniert richtig gut, der Winterdienst hier. In Rom reichen zwei Schneeflocken, und das Verkehrschaos ist größer als zu Beginn der Sommerferien.» Er zündete sich die Zigarette an. «Kannst du dir nicht endlich mal ein Päckchen Camel kaufen? Ich hasse diese Chesterfields.»
Italo nickte. «Ich weiß, Rocco, aber ich mag sie nun mal lieber.»
«Pass auf, dass du nicht gegen eine Mauer rast oder eine alte Frau über den Haufen fährst.»
Italo bog in den Corso Battaglione Aosta ein, schaltete einen Gang höher, überholte einen Lieferwagen und schoss davon.
«Wenn du nicht bei der Polizei wärst, wärst du bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter unschlagbar.»
«Wie kommst du jetzt darauf, Rocco? Hast du konkrete Pläne?»
Beide lachten.
«Weißt du was, Italo? Ich finde, du solltest dir einen Bart wachsen lassen, zumindest so einen kleinen Spitzbart.»
«Meinst du? Daran habe ich auch schon gedacht. Um meine dünnen Lippen zu kaschieren.»
«Genau. Dann würdest du nicht mehr ganz so aussehen wie ein Mauswiesel.»
«Ich sehe aus wie ein Mauswiesel?»
«Hab ich dir das noch nie gesagt? Mir sind schon mehrere Leute aufgefallen, die so aussehen, aber noch nie jemand bei der Polizei.»
Sie arbeiteten nun seit sechs Monaten zusammen, kannten sich inzwischen gut und wussten, wie der andere zu nehmen war. Rocco mochte Italo, und er vertraute ihm, seit sie vor einer Weile zusammen eine Ladung Marihuana aus einem holländischen Lastwagen nicht ordnungsgemäß konfisziert, sondern lukrativ weitergeleitet hatten. Seitdem waren sie um einige tausend Euro reicher. Italo war noch jung und aus dem gleichen Grund bei der Polizei gelandet wie der Vicequestore selbst: per Zufall. In dem schicksalhaften Moment, als Rocco Schiavones Schulkameraden sich bewaffnet auf der Straße behaupten mussten, hatte er zufällig die Uniform gewählt. Weiter nichts. Für ihn, der Anfang der sechziger Jahre in einer Arbeiterfamilie in Trastevere aufgewachsen war, wo jeder das Gefängnis auch schon mal von innen gesehen hatte, gab es nur diese beiden Möglichkeiten. Wie damals, als sie noch Kinder waren und beim Kloster Räuber und Gendarm gespielt hatten. Ganz einfach. Rocco war bei den Gendarmen gelandet und die anderen, Furio, Brizio, Sebastiano und Stampella, bei den Räubern. Aber Freunde waren sie noch immer.
«Wie kommen Diebe dazu, sich in einem Haus zu verbarrikadieren, Italo? Das ist schließlich keine Bank mit Geiseln und so.»
«Das habe ich auch nicht verstanden.»
«Ich meine, wenn nur ein halbtauber alter Mann und eine Frau zu überwältigen sind, hätten die Diebe denen doch nur eins überzuziehen brauchen und abhauen können.»
«Vielleicht ist der Alte bewaffnet. Er ist immerhin ein ehemaliger Maresciallo.»
«Das ist doch Blödsinn!», meinte Rocco mit Blick auf die Straße, wo die Autos dem von Italo gesteuerten BMW hupend Platz machten.
«Meinst du nicht, wir sollten besser die Sirene einschalten, Rocco? Dann wüssten sie, dass wir von der Polizei sind, und wir könnten durchfahren, ohne dass uns jemand in die Quere kommt.»
«Ich hasse die Sirene.»
Kurz darauf erreichten sie mit hundertzwanzig Stundenkilometern das Haus in der Via Brocherel.
Rocco knöpfte sich den Lodenmantel zu und ging, gefolgt von Italo, zu dem seltsamen Paar hinüber, das sich im Hauseingang aneinanderklammerte. Ein alter Mann und eine strohblonde Frau um die vierzig mit zerrissener Strumpfhose und blutigem Knie.
«Polizei, Polizei!», schrie die Frau, und ihre Stimme mit dem slawischen Akzent hallte durch die ansonsten menschenleere Straße. Lediglich in einigen Fenstern waren ein paar neugierige Gesichter zu sehen. Der andere, der Alte, brachte die Frau sofort mit einer entschiedenen Geste seiner Hand zum Schweigen, als wolle er deutlich machen, dass die weiteren Ausführungen nun Männersache seien. Ein aufgeregter Köter zu seinen Füßen bellte mit hervorstehenden Augen wie verrückt ein Parkverbotsschild an.
«Polizei?», fragte der Mann mit Blick auf Rocco und Italo.
«Was sonst?»
«Normalerweise kommt die Polizei mit Sirene und Blaulicht.»
«Normalerweise geht das andere Leute einen Scheiß an», entgegnete Rocco ernst. «Haben Sie angerufen?»
«Ja. Ich bin Maresciallo Paolo Rastelli. Die Signora hier ist der festen Überzeugung, dass sich in diesem Haus Diebe verbarrikadiert haben.»
«Wohnen Sie hier?»
«Nein», antwortete der Maresciallo.
«Dann wohnen Sie hier?», wandte sich Rocco an Irina.
«Nein, ich bin die Putzfrau. Irina Oligova. Ich komme montags, mittwochs und freitags», erklärte sie.
«Ruhig!», rief der Alte dem Hund zu und zog fest an der Leine, sodass dem offenbar blinden Tier die Augen noch weiter aus den Höhlen traten.
«Entschuldigen Sie, Commissario, aber dieses ständige Bellen macht mich wahnsinnig.»
«Das tun Hunde öfter», meinte Rocco ruhig.
«Bitte?»
«Bellen. Es ist ihnen angeboren.» Er ging in die Hocke und streichelte Flipper, der sofort verstummte, mit dem Schwanz wedelte und ihm die Hand leckte. «Und übrigens: Ich bin kein Commissario. Diese Bezeichnung existiert nicht mehr. Vicequestore Schiavone.»
Irina Oligova schien noch immer völlig aufgelöst. Ihre Haare standen wortwörtlich zu Berge, als seien sie elektrisch aufgeladen, was vielleicht auch an den Kunstfasern ihres blauen Pullovers lag.
«Würden Sie mir den Schlüssel geben?», bat er sie.
«Von der Wohnung?», fragte die Russin.
«Nein, den Schlüssel zu Fort Knox. Natürlich den Wohnungsschlüssel, Herrgott noch mal!», schimpfte der pensionierte Maresciallo. «Wie sollen sie sonst reinkommen?»
Irina senkte den Blick. «Den hab ich drinnen liegenlassen, als ich geflohen bin.»
«Das ist natürlich scheiße», meinte Rocco halblaut. «Na gut, machen wir es anders. In welchem Stock liegt die Wohnung?»
«Da … im dritten!» Irina wies nach oben. «Sehen Sie? Das Fenster dort, mit dem Vorhang, ist das Wohnzimmer, das daneben mit dem geschlossenen Rollladen das Arbeitszimmer. Ganz links ist das Badezimmer, dann …»
«Signora, ich möchte die Wohnung nicht kaufen. Ich wollte nur wissen, welche es ist», unterbrach Rocco sie brüsk. Mit dem Kinn auf die Wohnung im dritten Stock weisend, wandte er sich an Pierron: «Italo, was meinst du?»
«Wie soll ich da denn raufklettern, Dottore? Rufen wir besser den Schlüsseldienst.»
Rocco seufzte, dann sah er die Frau an, die sich inzwischen wieder beruhigt hatte. «Was für ein Schloss hat die Tür?»
«Es sind zwei Schlüssellöcher», antwortete Irina.
Rocco verdrehte die Augen. «Ja, aber was für Schlösser: gepanzert, Zylinder, Doppelzylinder?»
«Ich … ich weiß nicht. Ein Türschloss.»
Rocco öffnete die Haustür. «Aber welche Tür es ist, wissen Sie, oder auch das nicht?»
«Nummer elf», antwortete Irina lächelnd, stolz, den Ordnungshütern endlich einen brauchbaren Hinweis geben zu können.
Italo folgte seinem Vorgesetzten.
«Und was ist mit mir?», fragte der pensionierte Maresciallo.
«Sie bleiben hier und warten auf Verstärkung», rief Rocco ihm zu und hatte kurz den Eindruck, dass der Mann die Hacken zusammenschlug.
Als die Türen des Aufzugs sich öffneten, wandte sich Rocco nach rechts, Italo nach links.
«Komm rüber, Nummer elf ist hier!», sagte Italo.
Der Vicequestore ging zu ihm hinüber und sah sich das Schloss an. «Ein altes CISA-Schloss. Sehr gut.» Er nahm seinen Wohnungsschlüssel aus der Tasche.
«Was hast du vor?», fragte Italo.
«Abwarten.» An Roccos Schlüsselbund hing ein Schweizer Offiziersmesser, das mit den zwölftausend Werkzeugen und Funktionen. Rocco wählte mit Bedacht einen kleinen Schraubenzieher. Dann bückte er sich und machte sich an dem Schloss zu schaffen. Er löste die beiden Schrauben und klappte dann die Nagelfeile heraus. «Siehst du? Man braucht nur einen schmalen Schlitz zwischen dem Holz und dem Schloss …» Er schob die kleine Feile in den Spalt und ruckte ein paarmal an der Tür. «Die ist furniert. In Rom gibt es solche Türen gar nicht mehr.»
«Warum?»
«Weil sie sich kinderleicht öffnen lassen», erklärte Rocco, und im selben Moment schnappte das Schloss auf. Italo grinste.
«Du hast eindeutig den Beruf verfehlt!»
«Das höre ich nicht zum ersten Mal.» Rocco öffnete die Tür. Italo hielt ihn zurück und zog seine Pistole. «Vielleicht hat sich hier ja tatsächlich jemand verbarrikadiert.»
«Warum, zum Teufel, sollte sich hier jemand verbarrikadiert haben? So ein Schwachsinn!»
Ohne zu zögern, betrat er die Wohnung.
Sie gingen durch die Schiebetür ins Wohnzimmer. Italo wandte sich in Richtung Küche, Rocco folgte dem Flur und warf einen Blick auf das zerwühlte Bett im Schlafzimmer. Am Ende des Flurs lag noch ein Zimmer. Die Tür war geschlossen. Italo war bereits wieder bei ihm, als er die Hand auf die Klinke legte. «In der Küche ist niemand. Das totale Chaos, aber keine Menschenseele. Da sieht’s aus wie nach einem Wirbelsturm.»
Rocco nickte, dann riss er die Tür auf.
Dunkelheit.