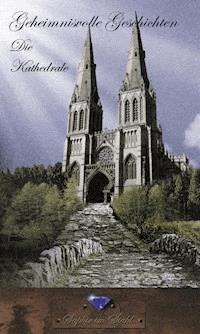
Die Kathedrale E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saphir im Stahl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Geheimnisvolle Geschichten
- Sprache: Deutsch
Auf den Space Days 2012 startete die Ausschreibung mit einem Modell und der Vorgabe, dass diese Kathedrale allein auf weiter Flur steht. Die Autorinnen und Autoren sollten sich ausdenken, warum die Kathedrale dort steht, zur Ruine oder wieder aufgebaut wurde. Vierundzwanzig Autorinnen und Autoren machten sich ihre Gedanken dazu. Heraus kamen ebenso interessante, wie lesenswerte Kurzgeschichten. Manchmal humorvoll, manchmal spannend, dann wieder liebevoll. Die Bandbreite der Geschichten ist recht ausgedehnt. folgen sie den Autorinnen und Autoren in die Welt des gewaltigsten Gotteshauses seiner Zeit. Lernen sie die Geheimnisse der Kathedrale kennen und lösen sie die Rätsel, bevor der Autor das letzte Wort geschrieben hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ebook 013 Die Kathedrale
Erste Auflage 01.10.2013
© Saphir im Stahl
Verlag Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: www.crossvalley-smith.de
Lektorat: Thomas Michalski
Vertrieb: bookwire
ISBN: 978-3-943948-17-2
Herausgeber Erik Schreiber
GeheimnisvolleGeschichten4
Liebe Freunde der Geheimnisvollen Geschichten
Als ich auf den Space Days 2012 mit einem Modell der Kathedrale die Ausschreibung startete, bekam ich viel Lob für die Ideen doch das Ausschreibungsende rückte näher und ich hielt noch nicht genügend Kurzgeschichten in den Händen um ein Buch herauszugeben. So folgte eine Verschiebung des Termins. Und siehe da, es kamen plötzlich mehr Geschichten, als ich benötigte. Die Auswahl der Erzählungen war nicht einfach. Ging es doch hauptsächlich um eine namenlose Kathedrale, aber viele Erzählungen hatten sie nur noch als Beiwerk.
Das Thema war eine Kathedrale neben einem kleinen Fluss, über den eine steinerne Rundbogenbrücke führt. Neben der Kathedrale steht ein kleines Dorf. Es sollte kein Ländername genannt werden und auch keine größere Stadt in der Nähe.
Rätsel und Geheimnisse etwa um diese Kathedrale, gehören sicherlich zu den ältesten Vergnügen des Menschen. Sie sind eine Herausforderung an den Geist, die Lösung zu finden und so den eigenen Intellekt zu befriedigen. Rätselfans gibt es quer durch die Zeiten und so sind auch die Geschichten um die Kathedrale zeitlos. Die Autorinnen und Autoren gaben sich sehr viel Mühe mit ihren Erzählungen. Sie stellen den Leser zu Beginn in eine unbekannte Situation. Er muss die Lage beurteilen und kann doch nicht eingreifen, denn der Autor gab die Richtung bereits vor, der Leser kann nur folgen und gegebenenfalls versuchen, das Rätsel zu lösen, bevor der Autor das letzte Wort geschrieben hat.
Ich freue mich, eine faszinierende Auswahl an Geschichten vorstellen zu dürfen, die in der Historie dieser Kathedrale angesiedelt sind.
Ich wünsche viel Spass mit den Erzählungen.
Bickenbach, 02.09.2013
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Susanne Schollenberger: Das Vermächtnis
Karsten Beuchert: Der Steinmetz
Roselinde Dombach: Tödlicher Sonnenaufgang
Christiane Gref: Der Pilger
Stefanie Grimm: Die Kathedrale des schwarzen Ordens
Andreas Groß: Der Soldat Gottes
Anja Helmers: Ein Fluch der ganz besonderen Art
Volkmar Kuhnle: Der Engel in der Nische
Anja Luderer: Das Meisterstück
Franziska Meersburg: Die dampfbetriebene Kathedrale
Luisa Meißner: Gottesmacht
Daniela Möller: Der Fluch der Kathedrale
Stephan Obermayr: Die Verwandlung
Sonja Oberstein: Lebe!
Fiona Pietrek: Stein auf Stein
Markus Ross: Die Prophezeiung
Pamela Rumpel: Die Kinder der Kathedrale
Tanja Schierding: Verfluchtes Gotteshaus
Anja Sprater: Die Krypta
Sabine Völkel: Der Gott, dem die Seelen gehören
Isabelle Wallat: Schreie in der Dunkelheit
Sabrina Zelezny: Herr dieses Ortes
Harald Zubrod: Von großen und kleinen Dingen
Erik Schreiber: Finden
Biografien
Susanne Schollenberger
Das Vermächtnis
Charlotte fuhr langsam die kurvige Straße entlang und fragte sich zum wiederholten Mal, wie ihr Onkel es in dieser Einöde all die Jahre ausgehalten hatte. In den letzten dreißig Minuten war sie an kaum einem Gebäude vorbeigekommen und an ein Dorf war gar nicht zu denken. Vereinzelnde Höfe und Hütten standen verloren am Waldrand und es sah nicht so aus, als gäbe es einen Supermarkt oder auch nur einen Tante-Emma-Laden. Während der rote Sportwagen, der für diese abenteuerliche Reise genauso ungeeignet schien wie das kurze Kostüm oder die hochhackigen Schuhe von Charlotte, sich über den Hügel schlängelte, dachte sie an die letzten Tage. Ihr Leben war schon lange stressig, das war sie gewohnt, aber die letzten Monate hatten ihr arg zugesetzt. Deswegen freute sie sich auf ein paar Tage Ruhe und Erholung bei dieser mysteriösen Kathedrale, von der sie erst bei der Testamentseröffnung erfahren hatte. Sie hatte Onkel Willy kaum gekannt; ihr Vater war seit Jahrzehnten mit seinem Bruder zerstritten und obwohl keiner mehr so richtig den Grund kannte, wurde der Streit bis zum Tode nicht beigelegt. Umso verwunderter war Charlotte, dass ausgerechnet sie dieses Gebäude geerbt hatte, aber es war eine willkommene Abwechslung, um ihren Arbeitsalltag zu vergessen und all das hinter sich zu lassen. Der Aufbruch gestern war recht spontan und ließ sie, die sonst alles plante, schmunzeln.
Auf dem Hügel angekommen schwand ihre Laune jedoch etwas, denn das, was sie da vor sich im Tal sah, war nicht etwa eine prächtige Kathedrale, sondern eher ein heruntergekommenes baufälliges Gebäude mit zwei in den Himmel ragenden Türmen, die nicht so aussahen, als wenn man sie gefahrlos betreten könnte. Ansonsten wirkte das Bauwerk recht abenteuerlich mit seinen vielen Rundfenstern, die jede Putzfrau hätten verzweifeln lassen, und dem einladenden Tor. Sehr malerisch wirkte aber der blaue Bach mit seiner kleinen Rundbrücke, auch wenn sie sich nicht sicher war, ob sie sich trauen würde, diese mit dem Auto zu überqueren. Hinter der Kathedrale lag etwas abseits ein kleines Dorf, von dem sie annahm, dass es so alt war wie die Kathedrale selbst und in dieser Zeit stehengeblieben war. Sie konnte von hier oben nicht viel erkennen, aber hoffte, dass es dort wenigstens eine Backstube oder Gaststätte gab. Schon verspürte sie ein leichtes Hungergefühl.
Vor der Brücke angekommen, hielt sie erstmal an und ging den Rest zu Fuß, wobei sie die Stöckelschuhe lieber in die Hand nahm. So stolz sie eben noch über ihre Spontanität gewesen war, hätte sie doch planbarer packen sollen. Ihre Garderobe passte so gar nicht in diese einfache Gegend.
Auf der anderen Seite des Flusses blieb sie kurz vor dem Tor stehen und atmete ein paarmal tief durch. Dies alles gehörte ihr, dachte sie voller Ehrfurcht und verdrängte damit die kleine Stimme aus dem Hinterkopf, die sie vor den Kosten warnte, welche dieses Gemäuer mit sich bringen würde. Sie schloss das Tor auf und schaute sich um. Bei dem Anblick der eingestaubten und dunklen Zimmer musste sie unwillkürlich an gruselige Gespenstergeschichten aus der Kindheit denken. Nachdem die Fenster allerdings geöffnet waren und die Sonne ein helles Licht spendete, waren die Geister auch schon vertrieben. Dazu war sie viel zu sehr Realistin. Sie beschloss, sich erstmal einen kleinen Teil des Hauses anzusehen und ging in den südlichen Flügel. Dort suchte sie sich ein kleines Zimmer mit einfachen, aber sehr schönen Möbeln und packte ihren Koffer aus.
Dass sie die ganze Zeit über vom Hügel aus beobachtet wurde, bemerkte sie nicht.
Zum Glück hatte sie wenigstens an etwas Proviant gedacht und so kochte sie sich in der rustikalen Küche erstmal ein Abendessen, dankbar, dass ihr Onkel ihr ein wenig Brennholz für den Ofen hinterlassen hatte, denn jetzt in der Abenddämmerung nach der langen Reise noch Holz zu hacken hätte ihre Kräfte überfordert, denn an Strom war hier nicht zu denken. Der Ofen verbreitete eine wohlige Wärme und sie wurde schnell müde. Sie legte sich, nachdem sie noch ein wenig den Flammen zugeschaut hatte, ins Bett und fiel fast sofort in einen unruhigen Schlaf ...
Lautes Stimmengewirr und Pferdegetrampel erfüllten den Platz, starke schwitzende Männer bauten seit Jahren an dieser Kathedrale, angetrieben von ihrem starken Glauben und dem Wunsch; Gott das prächtigste Gebäude zu bauen, dass die Welt je gesehen hatte. Sie wollten ihm auf diese Weise danken, dass er ihr Dorf im Krieg verschont hatte, ihre Frauen nicht dem Feind zum Opfer gefallen waren und sie in Frieden mit ihren Familien leben durften. Auch wenn es anstrengend war und oft übermenschliche Kräfte kostete, kamen immer mehr Männer hinzu und halfen mit.
Charlotte beobachte im Traum fasziniert die Männer und schwenkte dann den Blick zu den Frauen in ihren einfachen, aber wunderschönen Kleidern, die so zufrieden aussahen wie es Charlotte nur selten sah. Kleine Kinder spielten am Bach und lachten, während sie sich nass spritzten ... aber auf einmal wurde Charlotte unruhig, irgendein Gefühl zwang sie, sich umzudrehen und dann sie es: Auf dem Hügel waren hunderte Krieger aufgestellt und warteten nur noch auf das Kommando ihres Anführers. Noch bevor Charlotte schreien und so die Dorfbewohner warnen konnte, wachte sie schweißgebadet auf.
Im ersten Moment hatte sie keine Ahnung, wo sie war, aber dann fiel ihr alles wieder ein. Schaudernd dachte sie an den Traum, der so friedlich begann und dann so bedrohlich endete. Sie hatte die Kathedrale in ihrem Aufbau gesehen, daran bestand kein Zweifel. In welchem Jahrhundert sie sich dabei befunden hatte, wusste sie nicht, aber das wollte sie durch Recherchen herausfinden.
Nach dem Frühstück, welches aus dem Reiseproviant des Vortages und einem heißen Tee bestand, ging sie durch das alte Gemäuer und machte im Kopf schon eine Bestandsaufnahme. Vieles war dem Laufe der Zeit zum Opfer gefallen und durch die Witterung zerstört, ein Teil der Türme sah aus wie zerbombt und Fenster und Türen waren teilweise zerspilttert. Von einem Zimmer aus ging es eine steile dunkle Treppe in die Tiefe. Sie schnappte sich ihren Rucksack, in dem sich allerlei Krimskrams befand, nahm eine Taschenlampe heraus und schritt mutig die Treppe hinab.
Matthew kam auch an diesem Tag wieder durch den Wald auf den Hügel und sah lange auf die Kathedrale. Seit er SIE gestern in dem roten Flitzer gesehen hatte, die langen Haare zu einer viel zu strengen Frisur hochgesteckt, konnte er an nichts anderes mehr denken. Sie kam ihm so wahnsinnig vertraut vor und er malte sich aus, wie ihre Haare offen im Wind flatternd aussehen würden, wie sie ihr hübsches Gesicht umspielen würden und sie dabei lächelnd versuchte, sie immer wieder aus ihrem Gesicht zu streichen. Er fand sie wunderschön und ihm wurde bewusst, dass sie es war, die er seit einer Ewigkeit vergeblich suchte. Endlich glaubte er am Ziel seiner Träume zu sein, endlich schien die Reise beendet. So viele Jahre war Matthew immer und immer wieder diesen Hügel hinauf gelaufen, dorthin wo er vor etlichen Jahren sein Herz verloren hatte.
Wie Charlotte es geahnt hatte, gab es natürlich kein Licht im Keller, aber an den Wänden befanden sich viele Kerzenständer mit zum Teil abgebrannten und zum Teil neuen Kerzen. Obwohl sie nicht rauchte, hatte sie immer ein Feuerzeug in ihrem Rucksack und schon bald erhellte flammendes, flackerndes Licht die Flure. Charlotte öffnete eine Tür und befand sich in einer Galerie und Bücherei mit hunderten Büchern in den Regalen und Gemälden an den Wänden. Neugierig studierte sie die Bilder und erschrak, als sie an Szenen aus ihrem Traum erinnert wurde ... die Kleider der Frauen, die spielenden Kinder, die hart arbeitenden Männer ... all das was sie hier sah war ihrem Traum entsprungen, als hätte sie es aus der Erinnerung selbst gemalt. Etwas verwirrt schaute sie sich im Raum um und nahm ein dickes Buch aus dem Regal, auf dessen Einband das Bild ihrer Kathedrale prangte. Sie nahm sich vor, abends ein wenig darin zu lesen und stieg die Treppe wieder nach oben. Draußen angekommen atmete sie tief die frische klare Luft ein und beschloss, bei einem Spaziergang die Gegend zu erkunden. Hätte sie diesen Teil des Kellers gestern schon erkundet, hätte sich der Traum und die Verbindung zu den Bildern leicht erklären lassen, aber so war es ihr fast unheimlich. Als sie auf der kleinen Brücke über dem Bach ankam, schaute sie eine Weile dem Wasser zu und es war, als gingen ihre Gedanken mit dem Lauf des Baches auf Reise. Sie stellte sich vor, wie ihr Onkel hier hatte leben können und womit er sich den Tag vertrieben hatte. Sicher, es gab viel zu tun und man konnte sich in der Dorfkneipe, die sie inzwischen erspäht hatte, das eine oder andere Bier schmecken lassen, aber so allein in diesem rieseigen Gemäuer war doch bestimmt sehr einsam. Sie wusste einfach viel zu wenig von Onkel Willy. Wie leicht lebte sie dagegen in der Großstadt, mit allem Komfort, auf den ihr Onkel freiwillig verzichtet hatte. Es war jammerschade, dass sie ihn nie kennengelernt hatte. Manchmal verfluchte sie den Dickschädel ihres Vaters, der so unversöhnlich den Kontakt verweigert hatte. Charlotte hätte so viele Fragen gehabt.
Matthew hielt den Atem an, als er sie so verloren und zerbrechlich mit zerzausten Haaren und traurigem Blick auf der Brücke stehen sah. Er wünschte sich nichts mehr auf der Welt, als zu ihr zu gehen und sie tröstend im Arm zu halten, aber noch war der passende Zeitpunkt nicht gekommen. Er hatte Jahrhunderte auf diesen Augenblick gewartet, es kam auf ein paar Tage nicht an. Und trotzdem, sein Herz schrie nach ihr. Er konnte sie fast körperlich spüren, stellte sich vor, wie gut sie roch, wie sie sich seufzend an ihn schmiegen würde, wie ihre Küsse schmecken würden ...
Nachdem Charlotte eine Weile gelaufen war, begegnete ihr ein altes Ehepaar und sie war froh, endlich mal wieder mit jemandem reden zu können. Außerdem sahen die beiden so liebenswert aus und erinnerten Charlotte an ihre eigenen Großeltern, sodass sie das Gefühl hatte, ihnen sofort vertrauen zu können. Auf ihre Menschenkenntnis konnte sie sich bisher immer verlassen und so stellte sie sich gleich vor: „Guten Tag, mein Name ist Charlotte Darsen, ich bin die Nichte von Wilhelm Darsen. Mein Onkel hat mir die Kathedrale vermacht und nun bin ich gestern angekommen, um mir das Schmuckstück mal anzusehen.“ Der Mann nickte ihr freundlich zu:
„Freut uns, Sie kennenzulernen, Miss Darsen, ich bin Wolter Gibson und das ist meine Frau Emma. Wir haben Ihren Onkel gut gekannt und wenn wir Ihnen irgendwie behilflich sein können, sprechen Sie uns ruhig an, wobei meine körperlichen Tätigkeiten die besten Jahre hinter sich haben.“ Seine Frau lachte und meinte, er solle mal nicht übertreiben, um ein paar Handgriffe zu tätigen reiche seine Kraft schon noch aus. Mit der Einladung für den, wie Wolter sagte, besten Kirschkuchen des Landes, verabschiedete sie die Gibsons und Charlotte ging langsam zurück. Sie freute sich über die Bekanntschaft und auch auf den versprochenen Kirschkuchen, wie sie hungrig und müde feststellte. Mit dem Buch aus der Bibliothek verzog sie sich nach dem Abendessen, dass aus einer Dosenmahlzeit bestand, ins Bett. Morgen musste sie dringend nach einer Einkaufsgelegenheit Ausschau halten. Schon nach ein paar Seiten fielen ihr die Augen zu.
Dieses Mal war sie nicht nur eine Zuschauerin, sondern mitten im Geschehen dabei. Und trotzdem sah sie die Szene von oben. Sie stand an einer kleinen Feuerstelle mit einem großen Kessel und rührte die Mahlzeit für die Männer. Das Kleid an ihrem Körper stand ihr sehr gut, betonte ihre schlanke Taille und den üppigen Busen, ihre Haare waren locker zusammengebunden und einzelne Strähnen fielen in ihr verschwitztes Gesicht, welches ihre Wangen rot glühen ließ. Sie war mit sich und der Welt zufrieden. Gleich konnte sie die Männer zum Essen rufen, sie für die harte Arbeit am Bau der Kathedrale etwas belohnen. Sie war stolz auf ihren Vater, der Vorabreiter und Planer war und so viele Männer hatte motivieren können. Aber noch bevor sie mit dem Kochen fertig war, überkam sie genau wie gestern das Gefühl, auf den Hügel zu sehen und wieder sah sie die Krieger auftauchen. Sie schrie auf und packte die Kinder, rief den Frauen zu, sich in Sicherheit zu bringen und rannte Richtung Eingang der Kirche.
Wieder wachte sie verschwitzt und irritiert auf, wankte ins Badezimmer und ließ kaltes Wasser über ihr Gesicht laufen. Mit einem Blick auf die Uhr stellte sie fest, dass es erst kurz nach Mitternacht war, aber an Schlaf war erstmal nicht zu denken und so setzte sie sich an den Ofen und trank einen Tee. Lange blieb sie so sitzen und dachte über die Träume nach. Hatten sie was zu bedeuten oder lag es an den vielen neuen Eindrücken? Hatte sie in einem früheren Leben am Bau mitgewirkt? Hatten ihre Vorfahren hier gelebt? Sie merkte wieder einmal, dass sie viel zu wenig über ihre Familie und deren Stammbaum wusste. Irgendwann schlief sie im Sessel ein und wachte erst wieder auf, als die Sonne schon hell ins Zimmer schien.
Nach dem Einkauf im einzigen kleinen Laden und einem üppigen Frühstück beschloss Charlotte zu den Gibsons zu gehen, um mehr über Onkel Willy zu erfahren. „Guten Morgen meine Liebe, wie schön, Sie zu sehen“, wurde sie strahlend von Emma begrüßt. Auch Wolter schien sich ehrlich zu freuen und sie nahmen auf der kleinen Veranda vor dem Haus der Gibsons Platz. Nachdem der Tisch schnell mit Kuchen und Kaffee gedeckt wurde, fragte Charlotte: „Ich wollte Sie bitten, mir etwas über meinen Onkel zu erzählen. Leider haben wir uns seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen und ich bedauere sehr, ihn nicht schon viel früher in dieser Idylle besucht zu haben. Ich fühlte mich von der ersten Nacht an seltsam vertraut mit der Gegend.“ Emma lachte und sagte:
„Das ist schon komisch, als Ihr Onkel vor zwanzig Jahren hierher kam, sagte er fast das Gleiche. Er war vom ersten Augenblick in die Kathedrale verliebt und hat sie erworben. Aus finanziellen Gründen konnte sie nicht mehr erhalten werden und stand kurz vor dem Abriss. Ihr Onkel war immer der festen Überzeugung, dass seine Vorfahren beim Bau dabei waren, konnte dies aber nie beweisen. Er erzählte von seltsamen Träumen und davon, dass er lange recherchieren und suchen musste, um das Kirchengebäude zu finden, dass er nur aus seinen Träumen und selbst angefertigten Zeichnungen kannte. Da er eine beachtliche Summe im Lotto gewonnen hatte, konnte er sich diesen Traum leisten und er hatte ja auch Erfolg. Er lebte lange Jahre mit seiner späteren Frau Betsy in einem Teil der Kathedrale. Aber nach deren Tod fehlte ihm oft die Kraft, weiter zu sanieren, er wurde depressiv und ging nur noch selten ins Dorf.“ Emma seufzte, es war ihr anzumerken, dass ihr Onkel Willys Geschichte naheging. Im Dorf hielt man eben ganz anders zusammen als in der Stadt, das wurde Charlotte schlagartig klar. Nun ergriff Wolter das Wort:
„Dein Onkel – ich darf doch du sagen?“ Charlotte nickte. „Er hat oft von dir erzählt. Er war untröstlich, wie stur dein Vater war, dass er jeden Kontakt ablehnte. Er hat jahrelang gehofft, dich kennenzulernen, kannte aber deine Adresse nicht. Als es ihm immer schlechter ging, bat er uns, falls du je kommen würdest, dir zu sagen, dass er möchte, dass du sein Erbe fortsetzt und dich um die Sanierung kümmerst. Geld ist leider nicht mehr viel da und es ist eine große Bitte, aber es schien ihm sehr wichtig zu sein, dass du ein wenig Zeit in der Kathedrale verbringst.“ Charlotte atmete tief ein. Ihr Onkel schien also die gleichen Träume gehabt zu haben wie sie und auch er hatte ihre Vorfahren damit in Verbindung gebracht. Was hatte all das zu bedeuten? Nach dem dritten Stück Kirschkuchen, der wirklich vorzüglich schmeckte, verabschiedete sie sich und ging nach nachdenklich zurück.
Matthew sah ihr nach wie sie den Weg entlanglief.
Zuhause angekommen ging Charlotte das Wagnis ein, einen der beiden Türme zu besteigen, was nicht ganz einfach war da viele Stufen kaputt waren. Mit meinen Stöckelschuhen hätte ich dies nie geschafft, dachte sie schmunzelnd und war froh über die Sportschuhe an ihren Füßen, die ihr, wie sie plötzlich feststellte, auch besser standen. Überhaupt fühlte sich ohne ihre engen Kostüme, ihr Make-up und all den unnützen Kram viel freier und attraktiver, was sicher auch an der frischen Luft und ihren rosigen Wangen lag. Sie war einfach glücklich und das sah man ihr an.
Oben angekommen, schaute sie voller Ehrfurcht in die Ferne und staunte über die Weite, die sie erblickte. Sie fühlte sich wie im Märchen. Als sie links Richtung Waldrand sah, erblickte sie einen jungen Mann, der lässig an einen Baum lehnte und ihr kurz zuwinkte, bevor er plötzlich verschwand. Für einen kurzen Moment dachte Charlotte, sie hätte es sich nur eingebildet und blinzelte gegen die Sonne, konnte aber niemanden entdecken. Erst jetzt bemerkte sie ihr seltsames Herzklopfen und ein vertrautes und doch unbekanntes Gefühl. Verwirrt drehte sie sich um und verließ den Turm.
Diesmal freute sie sich auf die Nacht und ihre Träume und konnte kaum einschlafen, so erregt war sie.
Nachdem die Menschen in die Kathedrale geflüchtet waren, schlossen sie das Tor und bezogen an den Fenstern und Öffnungen Stellung, um sich zu verteidigen. Es wurde ein langer und verlustreicher Kampf, aber am Ende siegten die Dorfbewohner und die Krieger zogen ab. Charlotte sah sich selbst aus der Kathedrale rennen, auf einen verletzten Krieger zu, der blutend am Boden lag. Und obwohl dieser Mann sie soeben noch bekämpft hatte, wusste sie doch, sie würde ihm helfen. Er sah sie schwach mit den schönsten Augen an, die sie je gesehen hatte und lächelte matt. In diesem Augenblick glaubte sie an die Liebe. Sie rief ein paar Männern zu: „Los, schnell, helft mir, ihn in mein Zimmer zu bringen, und bringt mir Wasser, Tücher und Decken!“
Die Männer zögerten nur kurz und schon waren sie dabei zu helfen. Ein paar Frauen kochten eine stärkende Suppe, andere wuschen seine Wunden und verbanden sie.
Nach zwei Tagen Pflege schlug der Krieger die Augen auf, lächelte Charlotte, die die ganze Zeit an seinem Bett Wache gehalten hatte, an und flüsterte: „Danke, meine schöne Retterin. Ich stehe tief in deiner Schuld.“
Charlotte schluckte und sagte: „Ich weiß nicht, warum ihr uns angegriffen habt, aber ich möchte nicht mehr sinnlos kämpfen.“
Der Mann schluckte zweimal und sagte schwach: „Ich bin übrigens Matthew und ich verspreche dir, wir werden euch nicht mehr angreifen. Mein Vater begann diesen Krieg und ich sollte nach seinem Tod seinen Kampf gewinnen, aber es wurde mir schnell klar, wie sinnlos meine Soldaten gestorben sind und wie viel Leid wir über so viele Familien gebracht haben."
„Charlotte“, stellte sie sich vor und ehe sie darüber nachdachte, beugte sie sich über ihn und küsste ihn zart auf seine Lippen. Verlegen stand sie auf und verließ eilig das Zimmer, ehe Matthew etwas erwidern konnte.
Von nun an wurde er von anderen Frauen gepflegt und so sehr er Charlotte auch suchte, sie blieb verschwunden, er bekam einfach keine Auskunft über ihren Verbleib.
Nach drei weiteren Tagen konnte er die Kathedrale verlassen und trat schweren Herzens seinen Heimweg an. Nur einmal blickte er sich wehmütig um und beschloss, den Leuten im Dorf einen größeren Geldbetrag zu spenden, damit sie sich bessere Werkzeuge zulegen konnten, um schneller voran zu kommen.
Charlotte sah er nie wieder, konnte sie aber auch nicht vergessen.
Als Charlotte am Morgen erwachte, lag sie entspannt und zufrieden im Bett und dachte über ihren Traum nach. Wusste ihr Onkel, aus seinen Träumen, von ihr und Matthew, hatte er ihr deswegen die Kathedrale vererbt und wollte, dass sie einige Zeit dort lebte? Sie bereute zum zigsten Male, nicht mit ihm geredet zu haben, doch nun war es zu spät. Während sie langsam aufstand, wurde ihr bewusst, dass sie viel mehr über das geheimnisvolle Pärchen von damals wusste als ihre Träume preisgegeben hatten. Damals konnte Charlotte ihrer Liebe nicht nachgeben, war erschrocken über die Heftigkeit ihrer Sehnsucht und rannte davon, weil ihr Ehemann gerade mal vor einem Jahr einer heimtückischen Krankheit zum Opfer gefallen war und auch wenn es nicht ihre große Liebe war, hatte sie ihn doch geachtet und respektiert und nun fühlte sie sich wie eine Verräterin.
Langsam dämmerte es Charlotte, dass sie ihre Vergangenheit erlebte und auch wenn es ihr etwas Angst machte, so fühlte es sich doch spannend und richtig an. Sie gehörte hierher, das war deutlich zu spüren.
Nach dem Frühstück ging sie ein Stück spazieren und machte auf der Brücke halt. Gedankenverloren schaute sie dem Wasser zu, wie es unaufhörlich weiter plätscherte und hatte plötzlich Tränen in den Augen. Sie war so in ihre Welt versunken, dass sie den Mann, der sich neben sie stellte, erst bemerkte, als er leicht ihre Schulter berührte. Erschrocken fuhr sie herum und war erstmal sprachlos, als sie dem Mann ihrer Träume gegenüber stand. Dieser lächelte sie nur geheimnisvoll an und flüsterte schließlich:
„Ich habe dich so lange gesucht, du glaubst nicht, wie froh ich bin, dich endlich gefunden zu haben.“
Endlich fand auch Charlotte ihre Sprache wieder und stammelte: „Ich kenne dich aus meinen Träumen, die ich erst habe, seit ich hierhergekommen bin. Aber wie kann das sein, woher kommst du so plötzlich und wer bist du wirklich?“
Er fand sie so verwirrt noch schöner als je zuvor und flüsterte: „Weißt du denn nicht, dass die wahre Liebe den Tod überdauert? Ich konnte dich nie vergessen und wusste, dass ich dich eines Tages finden würde. Meine Suche hat nun endlich ein Ende.“
Matthew machte auf Charlotte sofort einen derart vertrauten Eindruck und sie spürte schon jetzt das unbändige Verlangen, ihn zu berühren, zu küssen und ihn nie mehr loszulassen, dass sie liebevoll seine Hand nahm, um ihn in die Kathedrale zu führen. Sie wusste, dass dies ein Neuanfang war, bei dem sie beide eine Lösung finden würden, ihr Erbe zu retten.
Karsten Beuchert
Der Steinmetz
Franz Faber tauchte aus der bodenlosen Dunkelheit auf und öffnete die Augen. Alle standen sie um ihn herum, die Menschen, mit denen er die letzten Monate zusammengearbeitet hatte: die anderen Steinmetze, die Maurer, die Zimmerleute. Dass auch der Priester und der Medikus anwesend waren, hätte ihm klar sein müssen, wenn seine Gedanken noch klar funktioniert hätten. Sogar der Bauherr schaute auf ihn herab. Den Mienen der Umstehenden und der darin geschriebenen Aussichtslosigkeit entnahm er, welche Schmerzen er wohl spüren müsste. Allein, er fühlte nichts. Nur vage Erinnerungen hatte er an die Momente vor der Dunkelheit: Hoch oben hatte er auf dem Gerüst gestanden, um etwas essenziell Wichtiges zu erledigen. Irgendetwas Bedrohliches war passiert. Und jetzt lag er unten am Boden der Dombaustelle. Etliche Meter musste er gestürzt sein, und bewegungsunfähig, wie er war, konnte er nicht ermitteln, ob er auf Grasboden oder auf Bruchsteinen aufgeschlagen war. Das Einzige, das er bewegen konnte, waren seine Augen, und allein diese Tatsache sprach Bände. Sein Blick verlor den Fokus auf die Menschen und fixierte die Schatten im Hintergrund, während seine Gedanken Monate zurückwanderten ...
Bei weitem der Jüngste unter den Steinmetzen war er, Franz Faber, vom Naturell eher ein Künstler denn ein Handwerker und aufgrund seiner außergewöhnlichen Begabung vom Bauherrn persönlich eingeladen – und entsprechend misstrauisch von den älteren Kollegen beäugt. Regelmäßig ging der Baumeister durch die Reihen seiner Angestellten und hielt sich dabei nicht zurück, durch Kopfschütteln bis hin zu kritischsten Anmerkungen sein Missfallen an der in seinen Augen unzureichenden Arbeit kundzutun – um dann häufig bei ihm, Franz Faber, stehen zu bleiben und sogar wohlwollend zu verweilen, um ihm bei seinem Werke zuzuschauen. Diese Achtungsbezeugung machte ihn zwar in einer Weise unangreifbar, schloss ihn aber gleichzeitig weitgehend von der verschworenen kollegialen Gemeinschaft aus. Zunehmend fühlte Franz Faber das quälende Alleinsein, zumal er im Zuge dieser Entwicklung in der gesamten Dombauhütte als Außenseiter behandelt wurde – ein Umstand, der durch die Anerkennung seines Lohnherren nur unzureichend kompensiert wurde und der ihn in lange nächtliche einsame Wanderungen trieb. Und in immer tiefere und subtilere Versenkung in die Kunst der Arbeit, die seine Hände verrichteten.
Waren die von ihm verfertigten Werkstücke schon zu Beginn seiner Tätigkeit herausragend gewesen, so erreichten sie im Laufe der vergehenden Wochen immer höhere Brillanz und fast Perfektion – mit der Folge, dass Franz Faber deutlich kompliziertere und wichtigere Aufgaben übertragen bekam. Vollendetes Ebenmaß kennzeichnete seine Schlusssteine der zu errichtenden Bögen und Gewölbe, und wären sie grün statt steinfarben gewesen – man hätte die floralen Verzierungen, die einige der Werkstücke benötigten, für gewachsen statt gemeißelt halten können.
Mancher hätte sich in solcher Situation möglicherweise in Hochmut und Arroganz geflüchtet und die herrschaftliche Nähe des Bauherrn gesucht – nicht jedoch Franz Faber. Kaum noch nahm er wahr, was um ihn herum vorging, wenn seine Hände wie in automatischem Fluss jedem Stein das Höchste entlockten, das dieser zu geben bereit war – weder das achtungsvolle Stehenbleiben des Vorgesetzten schien in diesen Situationen Bedeutung zu haben, noch die zunehmend ablehnenden Mienen der Kollegen.
Der Druck auf die Arbeiter erhöhte sich, als einige von ihnen für den Bau eines Brunnens abgezogen wurden, der kurzfristig in die Pläne der Kathedrale aufgenommen worden war. Eines Tages verweilte der Baumeister noch länger als sonst üblich bei Franz Faber, offensichtlich in Gedanken versunken. Ein paar kurze Erwägungen erlaubte sich der Steinmetz, während seine Hände routiniert weiterarbeiteten – sollte auch er zum Brunnenbau abkommandiert werden? Und das, obwohl etliche Fensterbögen auf ihre Vollendung warteten? Schließlich ging der Baumeister wie üblich ohne ein Wort weiter. Franz Faber atmete auf und setzte die Arbeit an den Scheitelsteinen fort.
Der Bau schritt voran, doch die Miene des Baumeisters verdüsterte sich immer mehr, wenn er die Ergebnisse seiner Steinarbeiter kontrollierte – kein Wunder, denn die in seinen Augen sowieso unzureichende Qualität litt zusehends unter dem ansteigenden Druck auf die Belegschaft. Der einzige, der in weiterhin zunehmender Brillanz ein vollendetes Meisterstück nach dem anderen ablieferte, war Franz Faber.
Wieder einmal verharrte der Baumeister bei seinem besten Arbeiter und schaute diesem bei seiner Tätigkeit zu. Diesmal handelte es sich nicht um einen besonders prominenten Stein im Plan der Kathedrale, der bearbeitet wurde, da Franz Faber auch wieder weniger kunstvolle Aufgaben übernehmen musste, damit die gesamte Arbeit geschafft würde. Kein Murren war aus seinem Mund zu vernehmen gewesen, und er bearbeitete auch die unwichtigsten Steine mit einer Sorgfalt, als würde er das Fundament des Bischofssitzes verfertigen. Und siehe – verließ ein solcher Stein die Werkbank des Franz Faber, dann war es, als würde auch diesem jene geometrische Klarheit innewohnen, die dem Bauherrn für die gesamte Kathedrale vorschwebte.
Der Baumeister wandte sich ab und setzte an, die Reihe der Steinmetze weiter abzuschreiten. Franz Faber fuhr in seinem Werk fort – als plötzlich in seinem Augenwinkel ein Schatten in einem halbfertigen Kathedralenfenster auftauchte, der dort nicht hingehörte. Es gab viel Bewegung auf der Baustelle, ganz abgesehen von den hier arbeitenden Menschen – kopfruckelnde Tauben, hüpfende Krähen und huschende Eichhörnchen. Sie alle warfen Schatten, genau wie die Bussarde, die von Zeit zu Zeit neugierig über der Baustelle kreisten. Und doch, etwas war anders an diesem Schemen, so schnell er auch aufgetaucht und wieder verschwunden war – so ungewöhnlich, dass Franz Faber für einen winzig kleinen Moment abgelenkt wurde. Das Steinbeil traf nicht, wie es sollte, und statt die Furchen der Vorarbeiten zu glätten, schlug es eine neue Scharte in den zu bearbeitenden Stein.
Franz Faber hielt inne. Etwas Derartiges war ihm seit seinen frühen Gesellentagen nicht passiert. Ungläubig starrte er auf den Stein vor sich, nicht in der Lage, das eben Geschehene zu fassen und einzuordnen, das ihn aus Fluss und Trance seiner perfekten Arbeit gerissen hatte. Minutenlang saß Franz Faber so, paralysiert und unfähig, sich zu rühren. Der Baumeister setzte ungerührt und ob der anderen Steinmetze kopfschüttelnd seinen Weg fort – offensichtlich hatte er den Zwischenfall nicht bemerkt.
Etwas Hartes prallte an Franz Fabers Kopf und riss ihn aus der Erstarrung. Mit glasigen Augen blickte er sich um – und direkt ins hämisch grinsende Gesicht desjenigen seiner Kollegen, der gerade einen Kiesel nach ihm geworfen hatte und nun auffordernd auf jenen Stein deutete, der vor ihm, Franz Faber, lag und bearbeitet werden wollte. Schwer schluckend machte er sich wieder an die Arbeit, während ein kleiner Blutstropfen aus der Stelle über seiner Schläfe sickerte, an der ihn der Kiesel getroffen hatte.
Doch so sehr er sich bemühte – die von ihm selbst geschlagene Scharte war einen Deut zu tief, als dass er sie vollständig hätte glätten können, ohne die Passgenauigkeit des Steins zu beeinträchtigen. Vorsichtig schaute er sich um, ob eine weitere Maßregelung seitens eines Kollegen drohen mochte. Doch diese waren inzwischen völlig mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Er, Franz Faber, würde entgegen seinen Prinzipien einen unvollkommenen Stein in den Bau der Kathedrale geben – oder er würde einen neuen für genau diese Stelle behauen müssen. Für die zweite Variante blieb in der aktuellen Situation keine Zeit. Und realistisch betrachtet war der Stein in jedem Fall besser als die durchschnittliche Arbeit, die seine Kollegen ablieferten. Bloß eben nicht vollkommen. Schweren Herzens und mit einem unwohlen Gefühl im Bauch legte er den Stein für die Maurer bereit. Als er ihn auf der Ablage zurechtrückte, fiel die tiefe Abendsonne auf die beschädigte Seite. Einen Moment lang glaubte Franz Faber Asch zu erkennen, die erste Rune, das Zeichen des Anfangs – ein Symbol, das er als gläubiger Christ eigentlich nicht entziffern können durfte, und dessen Kenntnis seinen melancholischen Wanderungen und vor allem seiner Neugier für die geheimnisvollen alten Relikte der Umgebung geschuldet war. Erschrocken wich er zurück, und sicherheitshalber schlug er ein Kreuz. Die Abendsonne traf seine Augen, er blinzelte, und als er wieder klar sehen konnte, zeigte der Stein lediglich die mühsam vertuschten Spuren der beigefügten Scharte. Schwer seufzend begab sich Franz Faber zurück an seine Arbeit und stellte ein paar weitere Steine fertig, bevor er müde sein Tagewerk beendete und sich in einen nicht ganz entspannten Feierabend zurückzog.
Wider Erwarten schlief er recht gut, und am nächsten Morgen schien alles wie gewohnt. Der Kollege, der den Kiesel geworfen hatte, schien den Vorfall vergessen zu haben und widmete sich seiner Arbeit sowie den üblichen Scherzen unter den Handwerkern. Der Bauherr kam auf seinem Kontrollgang vorbei und verweilte kurz. Nur Franz Faber merkte, dass nicht alles exakt so war wie zuvor: Sein Schlag war minimal zögerlicher, das Auftreffen der Werkzeuge einen Deut ungenauer, sein Vorankommen insgesamt einen Tick langsamer – und den Ergebnissen seiner Arbeit fehlte ein kaum wahrnehmbarer Teil des Leuchtens, das sie über die letzten Wochen ausgezeichnet hatte. Nicht, dass es außer ihm selbst irgendjemand bemerkt hätte – und dennoch hinterließen diese Kleinigkeiten in ihm das zermürbende Gefühl, seinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen.
Ein paar Tage gingen ohne besondere Vorkommnisse ins Land und Franz Faber hoffte auf Rückkehr zu alter Form. Ein weiteres Mal senkte sich die Abendsonne herab, der größte Teil des aktuellen Tageswerks war vollbracht. Einer der letzten zu bearbeitenden Steine lag vor ihm. Ein Sonnenstrahl fiel in sein Auge, und reflexartig blickte er zur Seite und in das halbfertige Fenster der Kathedrale. Da! Dort war er wieder, der Schatten, der dort nicht hingehörte! Mechanisch, als könnten sie nicht aufhören, fuhren seine eigentlich genialen Hände fort, den Stein zu bearbeiten. Halb geblendet, wie er war, sah er nicht, was sie taten, doch seine Ohren verrieten ihm über den Klang ungenauer Schläge, dass es nichts Gutes sein konnte. Seine Augen erholten sich. Der Schatten war verschwunden – wenn er denn jemals wirklich existiert hatte. Zögerlich blickte Franz Faber auf den vor ihm liegenden Stein. Tiefe Kerben verunzierten die Seite, die eigentlich möglichst glatt sein sollte. Es würde eine gute Zeit an Arbeit bedeuten, dies wieder zu korrigieren. Ein weiterer Sonnenstrahl traf den Stein. Franz Faber erstarrte. Klar sah er vor sich drei Schriftzeichen, die er nicht entziffern konnte, die er aber von den heidnischen Monolithen der Umgebung her kannte. Der Sonnenstrahl erlosch, und auf dem Stein verblieben nichts als verunzierende Kerben. Franz Faber wischte sich über die Augen, blinzelte und betrachtete sein Werkstück genauestens. Keine Runen. Ein weiterer Kreuzschlag, dann machte er sich seufzend an die Arbeit, die Scharten dieses Tages auszubessern – in dem Wissen, dass dies erneut nicht vollständig möglich sein würde, sodass mit Sicherheit kleine Spuren zurückbleiben mussten.
In der folgenden Nacht begannen die unruhigen Träume, die seine nächtlichen Wanderungen thematisierten – doch fühlte Franz Faber nichts von der Friedlichkeit, die über seinen realen Nachtspaziergängen gelegen hatte. Durch dunkelste Wälder führten ihn seine Träume, vorbei an gierig schmatzenden Mooren und immer wieder durch dichtes dorniges Gestrüpp, wobei er ständig das Gefühl hatte, etwas ganz Bestimmtes zu suchen, das sich seinen Nachforschungen jedoch konsequent entzog. Schließlich brach ein neuer Tag an, und mit ungewohntem Zögern näherte Franz Faber sich seinem Arbeitsplatz. Noch reservierter als sonst erwiderte er die Morgengrüße der Kollegen. Letztlich hatte er noch nie zu unterscheiden gewusst, ob ihm ein Mensch neutral oder feindlich gegenüber stand, oder ob ihm jemand wider Erwarten doch wohlgesonnen sein mochte – was in Gesellschaft von Menschen ein generelles Gefühl der Unsicherheit hinterließ. Aktuell schien ihm seitens der Kollegen eine zunehmende persönliche Feindseligkeit entgegenzuschlagen, und Franz Faber sah sich außerstande zu unterscheiden, ob dies real war oder ob nur die aktuelle Verunsicherung seine Wahrnehmung überlagerte.
Er nahm seinen Platz unter den Steinmetzen ein, versuchte aber gleichzeitig, so weit wie möglich von seinen Nachbarn abzurücken. Argwöhnisch schielte er zur Seite – und auch nach oben, in Sorge, ob ihm nicht erneut ein merkwürdiger Schatten erscheinen wollte. Doch nichts Ungewöhnliches regte sich.
Wolken zogen über den Himmel und verdichteten sich, und für ein paar Tage versteckte sich die Sonne hinter den wabernden grauen Schleiern. Die Routine kehrte in die Arbeit des Franz Faber zurück – nicht aber die kreative Leichtigkeit, die sie früher ausgezeichnet hatte.
Übel waren jedoch die Nächte – kaum eine verbrachte er noch ohne düstere und verstörende Träume, in denen er sich regelmäßig auf der Suche nach etwas Wichtigem fand, von dem er nicht wusste, um was es sich handelte. Und doch hatte er von Nacht zu Nacht das Gefühl, näher zu kommen – was allerdings auch keine Erleichterung hervorrief, wenn er jeden Morgen wie gerädert aufwachte.
Die Wolken verzogen sich und blau strahlte der Himmel über der wachsenden Kathedrale. Mit einem Teil seiner Aufmerksamkeit beobachtete Franz Faber argwöhnisch seine Kollegen, den Baumeister bei seinem Rundgang, die sonstigen Bewegungen auf der Dombaustelle – und das verdächtige Fenster. Nichts Merkwürdiges passierte, doch entspannen konnte Franz Faber sich nicht, und seine weiterhin fleißigen Hände gaben den unterschwelligen Stress an seine Werkstücke weiter. Frustriert beobachtete er die stetig abnehmende Qualität der von ihm bearbeiteten Steine, und seine Gedanken begannen, um dieses Thema zu kreisen – und diese Unaufmerksamkeit tat wiederum seiner Arbeit keinen Gefallen. Von ihm selbst abgesehen schien jedoch weiterhin niemand diese Veränderung wahrzunehmen. Und vielleicht, so überlegte er, war von außen auch gar nichts zu bemerken – war er vor Wochen noch in den kreativen Fluss seiner Arbeit versunken gewesen, so war er jetzt verloren im Kreisen seiner Gedanken. Und währenddessen verrichteten seine Hände ihre Arbeit und produzierten ein gut gearbeitetes Werkstück nach dem anderen – bloß von Vollkommenheit konnte keine Rede mehr sein.
Ein schwarzer Schatten kreuzte sein Blickfeld und Franz Faber schreckte aus seinen Gedanken. Sein Blick folgte dem Schemen, der sich als Krähe herausstellte, die gerade eben gestartet war. Erleichtert wollte er sich wieder auf sein Werkstück konzentrieren, da wurde ihm bewusst, dass die Krähe genau auf das fragliche Kathedralenfenster zusteuerte. Sein Blick blieb am Vogel haften. Kurz bevor dieser auf dem Sims landen konnte, schien sich etwas vor ihm zu verdichten und zu verdunkeln. Die Krähe stoppte ihren Anflug und schien in der Luft zurückzuweichen, und Franz Faber erstarrte – bis auf seine Hände, die in ihrer Tätigkeit fortfuhren. Der Schatten! Da war er wieder! Das Geräusch seiner Arbeit begann erneut völlig falsch zu klingen, und Franz Faber blickte hinunter auf das Steinbeil, das ein weiteres Mal unbeabsichtigte Furchen in den Stein schlug. Im Licht der untergehenden Sonne zeichneten sich erneut ihm unbekannte Runen ab. Panisch ruckte sein Blick nach oben zum Fenster – der Schatten war verschwunden – und wieder zurück zum Stein, der nur noch eine schartig verunzierte Fläche zeigte. Mit Mühe unterdrückte Franz Faber den Impuls, das Steinbeil von sich zu schleudern und fluchtartig die Baustelle zu verlassen – und nur mit großer, bewusster Anstrengung fand er zu einer Routine zurück, mit der er den Arbeitstag halbwegs passabel abschließen konnte.
Unruhig wälzte er sich auf seiner Bettstatt hin und her, unfähig einzuschlafen. Eines war klar: So konnte es nicht weitergehen. Irgendwann musste es auch dem ihm zugeneigten Baumeister auffallen, dass seine Arbeit bei Weitem nicht mehr den Standard seiner Anfangszeit erreichte. Indem er all seinen Mut zusammennahm, fasste Franz Faber einen Entschluss: Er würde alles daran setzen, den mysteriösen Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Wie genau er dies bewerkstelligen wollte, war ihm jedoch noch nicht klar – anvertrauen konnte er sich jedenfalls mit seinen Beobachtungen und Sorgen niemandem. Im gedanklichen Ringen um einen möglichen Ansatz schlief er schließlich ein. Ein fahler Mond beleuchtete matt die dunklen Traumwälder, durch die er wanderte, und einen sicheren Pfad durch die gierig schmatzenden Moore. Als er begann, sich durch das Dornengestrüpp einen Weg zu bahnen, konnte er dessen Ende bereits erkennen. Schließlich fand er sich am Fuß eines Hügels – und hoch oben auf diesem gewahrte er einen runenverzierten, aufgerichteten Menhir. Zu weit war dieser entfernt, um die Schriftzeichen entziffern zu können. Und doch strahlte dieser Ort eine merkwürdige Vertrautheit aus, gerade so, als sollte er ihn kennen. Mit neuem Vertrauen in seine traumwandlerischen Fähigkeiten machte Franz Faber sich auf den Weg den Hügel hinauf. Doch dichtes Unterholz erschwerte das Vorankommen, und ehe er einen relevanten Aufstieg schaffen konnte, sank er in traumlosen Tiefschlaf, aus dem er zumindest erholter als seit Langem erwachte.
Weitere Wochen zogen ins Land, und Franz Faber konnte genügend Routine aufbringen, um zumindest eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. In unregelmäßigen Abständen erschien in seinem Augenwinkel der Schatten im Kathedralenfenster, und jedes Mal in diesen Momenten schlugen seine weiterarbeitenden Finger Scharten in die Steine, die unter bestimmtem Lichteinfall wie Runen wirkten. Fast gewöhnte sich Franz Faber an diese Situation – niemand schien die verminderte Qualität seiner Arbeit zu bemerken oder wichtig zu nehmen, und der Schatten – was auch immer er war – hatte bisher keinerlei Anstalten unternommen, ihm in irgendeiner Weise zu schaden. Von dem Erschrecken, das sein Erscheinen immer noch auslöste, einmal abgesehen. Auch eine verstohlen durchgeführte Sichtung des fraglichen Fensters brachte keine weiteren Erkenntnisse. Von Nahem betrachtet schien es sich in keiner Weise von anderen der im Wachsen befindlichen Kathedrale zu unterscheiden.
Also setzte Franz Faber vor allem auf seine Träume, die ihm anscheinend tatsächlich etwas mitteilen wollten. Jede Nacht aufs Neue näherte er sich in seinen bewussten Schlafphasen dem geheimnisvollen Hügel, und von Mal zu Mal kam er dem Runenstein näher.
Parallel dazu nahm er seine nächtlichen Wanderungen wieder auf, die er ausgesetzt hatte, als sie zu sehr von den Eindrücken seiner Alpträume überlagert gewesen waren. Etwas trieb ihn dazu, dass er herausfinden wollte, warum ihm seine wiederkehrende Traumlandschaft so vertraut vorkam.
Schließlich hatte er – von dem ersten Stein mit Asch abgesehen – sieben Werkstücke in den Bau der Kathedrale gegeben, die unter gewissem Lichteinfall je drei Runen zu zeigen schienen. Jedes Mal war der Schatten kurz zu erahnen gewesen, und weiterhin schien von ihm keine direkte Bedrohung auszugehen.
Dennoch fühlte sich der Abend, der auf die Erstellung des siebten runenbelasteten Steins folgte, anders an. Eine innere Unruhe befiel Franz Faber – ein Drang hinauszugehen, als würde ihn etwas ziehen, als würde ihm etwas seine Führung anbieten.
Ungeduldig machte er sich auf den Weg, kaum dass die Dämmerung hereingebrochen war, tiefer und weiter hinein in den Wald als jemals zuvor. Oder täuschte er sich mit dieser Annahme? Hatte es nicht jene Nacht gegeben, ziemlich zu Anfang seiner Zeit als Steinmetz an der Dombauhütte, als ihm die quälende Einsamkeit des Ausgeschlossenseins zum ersten Mal in voller Tiefe bewusst geworden war – hatte es nicht diese Nacht gegeben, in der er einfach nur gewandert und gelaufen war, ohne Orientierung und fast ohne Unterlass, bis er durch welche Fügung auch immer bei Anbruch des Morgengrauens wieder an der Baustelle angelangt war? Und hatte er nicht in jener Nacht eine einzige Rast eingelegt, hoch auf einem Hügel, beschienen vom hellen Licht des vollen Mondes und gelehnt an einen moosig überwachsenen Hinkelstein?
Weiter und weiter schritt Franz Faber, und der ominöse Zug führte ihn einen Weg, den er bewusst niemals wiedergefunden hätte, bis er schließlich am Fuß des Hügels stand, den er schon einmal real besucht und in seinen Träumen vergeblich zu besteigen versucht hatte.
Etwas Besonderes strahlte dieser Ort aus, eine Aura, die er in seiner Einsamkeit vor ein paar Monaten nicht hatte wahrnehmen können. Möglicherweise hatten ihn auch erst seine Träume für diese Eigentümlichkeit empfänglich werden lassen.
Langsam stieg er den Hang empor, und mit etwas glitschigem Moos und bloß einigen Beerenranken gab es genauso wenige Hindernisse, wie bei seinem ersten Besuch. Schließlich erreichte er die Kuppe des Hügels und den darauf stehenden Monolithen, an dem er in jener Nacht in tiefer Erschöpfung geruht hatte. Moos und Flechten überdeckten die gesamte Oberfläche, während das Äquivalent aus seinen Träumen wie gerade frisch errichtet gewirkt hatte. Und dennoch gab es keinen Zweifel, dass dies der Ort war, den er im Schlaf vergeblich zu erreichen versucht hatte.
Bedächtig ging Franz Faber in die Knie und begann, mit zittrigen Fingern den Bewuchs zu entfernen. Zeichen um Zeichen wurde sichtbar, bis die Ritzungen sich zu einem Runentext zusammenfügten, den er gut kannte, ohne ihn zu verstehen – hatte er ihn doch selbst in die Steine geschlagen, die inzwischen in den Mauern der Kathedrale verbaut worden waren. Sieben mal drei Runen – insgesamt 21 Zeichen, was zudem eine Quersumme von drei ergab. Franz Faber hatte von Zahlenmystik genauso rudimentäre Ahnung wie von Runen, und doch reichte diese Kombination aus, um ihm Schauer über den Rücken laufen zu lassen, handelte es sich doch mit ziemlicher Deutlichkeit um einen Text, der mit Schicksal, Harmonie und magischem Aufstieg zu tun hatte – und den zu übersetzen und zu verstehen er keine Chance hatte.
Benommen wandte er sich ab, und wie beim ersten Besuch an diesem Ort fanden seine Füße ohne sein bewusstes Zutun den Weg zurück zur Dombauhütte, wo er in einen kurzen, aber tiefen und traumlosen Schlaf fiel. Als er erwachte, hätte er nicht mehr eindeutig bestimmen können, ob der erfolgreiche Besuch beim Runenstein auf dem Hügel tatsächlich oder nur in einem weiteren Traum stattgefunden hatte.
Erneut vergingen etliche gleichförmige Tage, und Franz Faber versuchte, über diese Routine zu qualitativ hochwertiger Arbeit zurückzufinden – und alles zu vergessen, was mit Runen, moosüberwachsenen Menhiren und plötzlich auftauchenden Schatten zu tun haben mochte. Wenn er die Vorgänge der letzten Wochen ernst nahm, dann war der in seine Werkstücke geschlagene Text vollständig, gemessen an dem, den er auf dem Runenstein gesehen hatte. Außerdem hatten die dunklen Träume spontan aufgehört, und im Licht der täglichen Arbeit betrachtet schien alles damit Zusammenhängende nur unwirklich.
Die gemauerte und verzierte Fassung des fraglichen Kathedralenfensters war fast fertiggestellt. Es fehlte lediglich der Keilstein, der den Bogen stabilisieren würde. Kaum verwundert nahm Franz Faber den Auftrag des Baumeisters an, der ihm die Ausarbeitung dieses zentralen Elements zuwies. Was auch immer der Bauherr sich dabei gedacht haben, und was auch immer dieses Fenster auszeichnen mochte: Als Franz Faber die Skizzen zu Gesicht bekam, war klar, dass dies ein besonderer Stein werden musste. Und nach langen Wochen voll quälender Unvollkommenheit würde er mit diesem Schlussstein sein eigenes Meisterwerk abliefern!
Schließlich war der Stein so behauen, dass er perfekte Passgenauigkeit aufwies. Lediglich ein paar Ornamente waren noch auszuarbeiten. Franz Faber fühlte sich bereit für den erfüllenden Genuss der künstlerischen Vollendung und maß das fast fertige Fenster mit einem langen Blick, um ihm seine innere Harmonie zu entlocken. Doch plötzlich schien sich dessen Hintergrund zu verdunkeln, und Franz Faber fühlte einen kühlen Luftzug, als würden Fensterflügel mit Schwung zugeschlagen. Der Schatten! Er war zurückgekehrt! Franz Faber wich einen Schritt zurück und stolperte über eine Unebenheit. Mit ausholenden Armbewegungen versuchte er, sein Gleichgewicht zu halten, und das Steinbeil traf empfindlich den perfekt vorbereiteten Scheitelstein. Im Licht der sinkenden Sonne erkannte Franz Faber Ziu, die letzte Rune, das Zeichen von Ende und Abschluss. Instinktiv schlug er ein Kreuz, doch es beruhigte ihn nicht. Als er den Blick nach seinem Straucheln hob, war von einem Schatten im Fenster nichts mehr zu erkennen.
Wie in Trance beendete Franz Faber seine Arbeit am Schlussstein des Fensterbogens und legte ihn für die Maurer bereit. Mit einem abschließenden traurigen Blick auf sein Werk verließ er die Baustelle: Was sein Meisterstück hatte werden sollen, hob sich für seine eigene Wahrnehmung kaum von der Menge der anderen Steine ab, die ebenfalls auf ihre Weiterverwendung warteten.
In tiefer Erschöpfung fiel Franz Faber bald in unruhigen Schlaf, nachdem er sich niedergelegt hatte, und der Traum ließ nicht lange auf sich warten. Unzweifelhaft handelte es sich um denselben Wald, den er nicht allzu lange zuvor in düsterer Dunkelheit liegen gesehen hatte. Doch was mochte damit geschehen sein? Helllichter Tag herrschte in seinem Traum, statt dräuender Moore luden muntere Bäche zum Baden ein, und aus fast jedem Baum grüßte ihn eine Nymphe. Ein gangbarer Pfad führte durch den Wald hin zum nahen Hügel, auf dem in aller Klarheit der Runenstein prangte. Unterholz gab es wohl, doch behinderte es den Weg nicht. Während sich Franz Faber noch staunend umschaute, teilte es sich, und ein gehörntes und bockshufiges Wesen trat auf ihn zu, das er in traumsicherem Wissen als Pan identifizierte. Höflich bedankte sich der Hirtengott für die geleistete Unterstützung und reichte ihm einen Becher, dessen alkoholischen Inhalt Franz Faber in einem Zug leerte – woraufhin er in erholsamen traumlosen Tiefschlaf fiel.
Abrupt schrak er hoch, als sein Bewusstsein wieder zu arbeiten begann und versuchte, das im Traum Geschaute mit seiner christlichen Erziehung in Einklang zu bringen. Doch eine gehörnte und bockshufige Teufelserscheinung war zu viel für sein unterschwelliges schlechtes Gewissen. Gesündigt hatte er, als er die heidnisch verunreinigten Steine für den Bau der Kathedrale freigegeben hatte! Mehr noch – direkt dem Teufel zugearbeitet hatte er! Wenn es einen sicheren Weg gab, seine unsterbliche Seele aufs Spiel zu setzen, dann musste es dieser sein. Für eine nachgezogene Beichte war es zu spät. Es konnte nur einen Weg geben, seine Seele vor der ewigen Verdammnis zu retten – er musste wieder gutmachen, was er angerichtet hatte. Er selbst musste in letzter Sekunde den teuflischen Plan vereiteln.
Mit einem Satz sprang Franz Faber aus dem Bett und hastete in der ausklingenden Nacht zur Baustelle. Ohne Rücksicht auf seine Haut und Gelenke erklomm er das Gerüst, von dem aus am Kathedralenfenster gearbeitet worden war. Der Schlussstein war eingesetzt, und er saß fest. Mit den bloßen Händen erreichte er lediglich, dass ein paar kleinere Mörtelstücke abbröselten. Ein Werkzeug musste her! Franz Faber schaute sich um und entdeckte ein Stemmeisen, dass die Maurer achtlos liegen gelassen hatten. Er setzte es an, um den frisch eingesetzten Scheitelstein wieder herauszubrechen.
Die Sonne stieg über die Wipfel des nahen Waldes, und ein früher Sonnenstrahl fiel in sein Auge und blendete ihn. Als er die Lider wieder öffnete, sah er, wie sich direkt vor ihm die Luft verdunkelte und verdichtete. Der Schatten! Zurückgekehrt, um ihn von dem abzuhalten, was er tun musste. Franz Faber holte aus, um das Stemmeisen als Waffe gegen den Schemen zu richten. Der eigene Schwung ließ ihn zurücktaumeln und seine Füße verloren auf dem vom Nachttau glitschigen Holzgerüst den Halt.
Fast drohte Franz Faber erneut das Bewusstsein zu verlieren, als der Schmerz aus seinen zerschmetterten Gliedern sein Bewusstsein erreichte. Doch noch klammerte er sich ans Leben. Sein Blick fokussierte die Schatten im Hintergrund, die von Menschen, Gerüst und Mauern geworfen wurde. Einer der Schatten lebte selbst. Zum ersten Mal sah Franz Faber das Wesen in voller Klarheit, das ihm die letzten Wochen nur schemenhaft erschienen war. Wie ein sehr großer Flughund wirkte es, schwarzpelzig, mit tierischer Schnauze und lederartigen dunklen Flügeln. Als würde es warten, blickte es auf Franz Faber herab – wobei es weder Hunger noch Feindseligkeit und auch nichts Teuflisches auszustrahlen schien. Als Schatten hatte es ihn erschreckt – es jetzt in voller Gestalt zu sehen, löste in Franz Faber keine Furcht aus. Ein Raubtier war es nicht, und anscheinend auch kein Aasfresser. Wie zur Bestätigung führte das Wesen eine Hand zum Mund und biss in eine mitgebrachte Frucht. Während es weiter zu warten schien.
Was mochte es sein? Ein Bote aus einer anderen Zeit und anderen Welt – letztlich ein dunkler Engel? Möglicherweise auch ein Begleiter auf einem nächsten Wegabschnitt?
In plötzlicher Erkenntnis wurde Franz Faber klar, dass er es bald wissen würde. In dem Maß, in dem sein Bewusstsein schwand und der körperliche Schmerz wieder in den Hintergrund trat, fühlte er einen ungeahnten Frieden aufkommen. Ein letztes Mal schloss er die Augen und ließ sich zurück in die Dunkelheit sinken, die ihn bereitwillig umfing.
Versteckt in den Mauern der wachsenden Kathedrale, unsichtbar und unerkannt, warteten die Runen darauf, dass ihre Zeit kommen würde.
Roselinde Dombach
Tödlicher Sonnenaufgang
Vor langer Zeit, damals, als die Menschen noch fest in ihrem Glauben an archaische Gottheiten und deren Macht gefangen waren, vertrauten sie darauf, diese Götter mit Opfern gnädig stimmen zu können. So herrschte vielerorts der barbarische Brauch, bei der Errichtung eines bedeutenden Bauwerkes ein lebendes Wesen in die Fundamente einzumauern.
Üblicherweise handelte es sich dabei um ein Tier.
Doch viele Jahre später, die Zeiten und mit ihnen auch der Glaube der Menschen hatten sich verändert, kam dieses alte Ritual auf grausame Weise erneut zur Anwendung.
Ein ehrgeiziger und gewissenloser Domherr ließ – zu Ehren des Allmächtigen, wie er verkündete – eine Kathedrale errichten. Prächtig sollte sie werden, schöner als je ein ähnliches Werk zuvor. Und damit auch zu späteren Zeiten kein anderer Bau dem seinen gleichen oder ihn gar übertreffen würde, befahl er heimlich, den Baumeister zu töten.
Wie die heidnischen Opfer sollte er lebendig eingemauert werden, nichts würde mehr an ihn erinnern.
Kurz vor Vollendung des Bauwerkes geschah das Verbrechen. Doch der Meister erkannte seine Mörder, und mit seinem letzten Atemzug verfluchte er sie ebenso wie die Kathedrale.
Und sein Fluch überdauerte die Zeiten.
Leon beschattete seine Augen mit der Hand und spähte blinzelnd gegen die tief stehende Sonne. Waren das Türme, die sich dort in einiger Entfernung gegen den Himmel abzeichneten, oder täuschte ihn sein Wunsch nach Anzeichen menschlicher Anwesenheit nur wieder etwas vor?
Seufzend wischte er sich über die Stirn.
Wie lange war er bereits in dieser unwegsamen Einöde unterwegs? Drei Tage? Vier?
Nach dem Ende des Krieges, der so plötzlich über das Land hereingebrochen war und zahllose Menschen um Heim, Hab und Gut und viel zu oft um ihr Leben gebracht hatte, lag die Welt auch für Leon in Scherben.
Als Söldner im Dienste eines der unterlegenen Fürsten hatte er alles verloren. Ohne Ziel zog er in dem verwüsteten Land umher, sich mühsam mit Betteln, gelegentlicher Arbeit und auch Diebstählen durchschlagend. Immer öfter drohte ihn die Hoffnung zu verlassen, und nicht nur einmal hatte er bereits erwogen, sein Dasein mit eigener Hand zu beenden.
Er wusste nicht, aus welchem Grund er das bisher vermieden hatte und darüber nachzudenken gab es seiner Meinung nach keinen Anlass. Vielleicht war das Leben doch noch nicht erbärmlich genug, vielleicht war er auch einfach zu feige oder er fürchtete sich, in ewiger Verdammnis zu enden – letztendlich lief es aufs Gleiche hinaus.
Im Moment beschäftigte ihn jedoch mehr als alles andere der bohrende Hunger, der erbarmungslos in seinen Eingeweiden wütete. Und wenn die hoch aufragenden Umrisse in der Ferne tatsächlich Bauwerke waren, bestand wenigstens eine geringe Hoffnung, dass sich dort Menschen aufhielten. Menschen, die ihm vielleicht ein Stück Brot oder ein paar Rüben geben konnten. Er würde auch gern dafür arbeiten, denn zum Bezahlen hatte er schon lange nichts mehr.
Er trat aus dem Gestrüpp am Waldrand ins Freie und entdeckte schon nach ein paar Schritten von Unkraut überwucherte Wagenspuren, die in Richtung der Silhouette führten.
Scheint der rechte Weg zu sein, dachte er und wanderte los, dabei den schlammigen Pfützen ausweichend, die sich in den tieferen Rinnen gebildet hatten.
Die Sonne war schon fast hinter den Hügeln am Horizont verschwunden, als Leon endlich über eine gemauerte Brücke schritt. Unter ihrem anmutigen Bogen rann ein Flüsschen zielstrebig einem größeren Wasserlauf entgegen, dessen entferntes Ufer in den steigenden Abendnebeln mehr zu erahnen als zu sehen war.
Doch nicht dem Fluss galt die Aufmerksamkeit des Wanderers. Wie magisch angezogen hingen Leons Blicke an dem gewaltigen Bau, der die Landschaft jenseits der Brücke beherrschte.
Eine riesenhafte Kirche, nein, ein Dom, eine Kathedrale erhob sich majestätisch inmitten einiger Häuser und Gehöfte. Im letzten Licht des Tages prunkten üppig verzierte Säulen zu beiden Seiten eines ebenso prächtigen Portals, über dem das bunte Glas eines großen runden Fensters vielfarbig schimmerte.
Zwei Türme ragten in den Abendhimmel, wuchtig und zugleich grazil krönten sie das Gebäude, offenbarten dem atemlos staunenden Betrachter immer neue Einzelheiten kunstvoller Steinmetzarbeiten.
„Sie ist sehr beeindruckend, nicht wahr?“
Heftig erschrocken fuhr Leon herum, doch der Schrecken verflüchtigte sich sofort, als er sah, wer ihn so unerwartet und unbemerkt angesprochen hatte.
Wenige Schritte von ihm entfernt stand ein milde lächelnder, hagerer Mann im Gewand eines Mönches. Beide, der Mönch wie sein Gewand, hatten offenbar schon bessere Zeiten gesehen. Doch das Gesicht des betagten Klosterbruders offenbarte nur Freundlichkeit, die auch in seinen folgenden Worten zum Ausdruck kam.
Er erkundigte sich nicht nach dem Woher oder Wohin, er erwartete auch keine ungefragte Auskunft und erwähnte die Kathedrale ebenfalls nicht mehr, sondern lud Leon einfach in seine Behausung ein, wo, wie er sagte, ein zwar bescheidenes, aber nahrhaftes Mahl bereitstände.
Hungrig verschlang Leon kräftiges Roggenbrot, einen bereits etwas harten Käse und erstaunlich guten Wein, wobei der Mönch den wortreichen Dank seines Gastes bescheiden abwehrte.
Auf dessen Frage, ob nicht noch mehrere Brüder hier zu Hause wären, schüttelte er nur den Kopf. Dabei stand in seinen zerfurchten Zügen eine solch tiefe Traurigkeit, dass der einstige Söldner keine weiteren Auskünfte zu brauchen glaubte.
Der Krieg hatte auch Kirchen, Klöster und ihre Bewohner nicht verschont.
Leon spürte ebenfalls plötzlich Trauer, zu der sich nach dem Essen schnell Müdigkeit gesellte, die auch dem frommen Bruder nicht verborgen blieb.
Er führte seinen Gast in eine Kammer mit einer bescheidenen Lagerstatt und bot ihm eine Gute Nacht.
Doch dann zögerte er und es schien Leon, als ränge er mit Worten und würde noch etwas Wichtiges äußern wollen. Schließlich sprach er: „Hört, ich weiß, dass ein Mensch oft wünscht, in einem Haus Gottes zu beten. Solltet Ihr diesen Wunsch hier verspüren, so bitte ich Euch: Gebt ihm nicht nach! Gott ist überall, nicht nur in einem Bauwerk. Besonders nicht in einem Bauwerk ...“
Nach diesen seltsam kryptischen Worten verließ er den Raum, und bevor Leon weiter über ihre Bedeutung nachgrübeln konnte, überwältigte ihn der Schlaf und ließ ihn in tiefer, tröstlicher Dunkelheit versinken.
Das Erwachen kam, wie so oft, direkt aus einem Albtraum.
Blut, tote und verstümmelte Körper, aufgerissene Augen, die Leon anstarrten und grotesk verzerrte Münder, die alle flüsterten oder schrien: „Das ist dein Werk! Du hast uns getötet, es ist deine Schuld, du bist ein Mörder! Mörder! Mörder!“
Er spürte die Tränen nicht, die unablässig über seine Wangen liefen, kein Wort der Rechtfertigung kam ihm über die Lippen. Schwer atmend, keuchend, hockte er auf der Bettstatt, voller Verzweiflung und immer noch gefangen im Grauen des Nachtmahrs.
Vor dem winzigen Fenster erwachte zögernd ein neuer Morgen, blassgraue Dämmerung vertrieb die Schrecken der Dunkelheit.
Leon schlug die dünne, kratzende Decke zurück und wankte, immer noch etwas benommen, hinaus. Im Vorbeigehen bemerkte er den Mönch, der schlafend auf seinem Lager ruhte.
Leise, um den frommen Mann nicht zu wecken, öffnete er die Tür der Hütte und trat aufatmend ins Freie.
Vor ihm erhob sich dunkel und mächtig die Silhouette der Kathedrale gegen den Himmel.
Ein Hauch von Hoffnung regte sich in Leon. Dies war ein Gotteshaus, erfüllt vom Atem des Allmächtigen. Und wo ließen sich Trost, Gnade und vielleicht gar Vergebung besser finden als hier? Zwar regte sich tief in seinem Geist etwas, eine vage Erinnerung an eine Warnung, doch Leon war noch viel zu fest im Grauen des Traumes und dem festen Glauben an seine Schuld gefangen, um dem schwachen Wispern dieser Gedanken Beachtung zu schenken.
Entschlossen legte er die wenigen Schritte zu dem schweren Eichenholzportal zurück und drückte die Klinke nieder. Lautlos schwang die Pforte auf, ein schwacher Lufthauch wehte nach draußen und vor Leon erstreckte sich das weite Innere der gigantischen Kirche.
Verblüfft verharrte der einsame Gläubige und blickte staunend um sich. Der große, in düsterem Halbdunkel liegende Raum entsprach absolut nicht dem Bild, das er erwartet hatte.
Genaugenommen gab es kaum Gemeinsamkeiten zwischen dieser Halle und einem gewöhnlichen Kirchenschiff. Zwar erhoben sich auch hier hohe Säulen, die einem in großer Höhe kaum erkennbaren Dach zustrebten, doch Säulen und Dach erschienen Leon auf beunruhigende Weise seltsam und außergewöhnlich.
Die Pfeiler, die den Bau stützten, bestanden nicht aus Marmor, Granit oder Porphyr, sie erinnerten vielmehr an knorrige, versteinerte Baumstämme. Sie bildeten auch keine geraden Reihen mit regelmäßigen Abständen, sondern standen wie ein Wald in ungeordnetem Durcheinander und verwehrten Leon den Blick auf ein Zentrum, in dem möglicherweise ein Altar Platz und Gelegenheit für ein Gebet bieten würde.
Weit vorn schimmerte vage Helligkeit, und trotz des anhaltenden Gefühls von Unsicherheit schritt der einstige Söldner darauf zu.
Etliche Säulen versperrten ihm den Weg, und während er ihnen auswich, gewahrte er eine weitere Seltsamkeit: Geschnitzte oder in den Stein gehauene menschliche Köpfe, auch vollständige Figuren zierten jeden Pfeiler. Die Gesichter dieser Menschen zeigten verschiedene Ausdrücke, die meisten aber spiegelten Schmerz und Grauen wider.
Kalte Schauer rannen über Leons Rücken, als er in die toten Augen blickte. Entschlossen schüttelte er die Furcht ab, die mit kalten Fingern nach ihm griff, und tastete sich weiter durch das unheimliche Labyrinth.





























