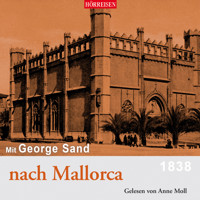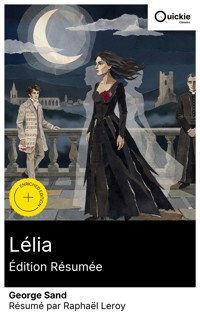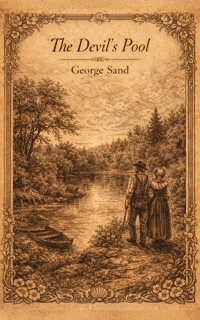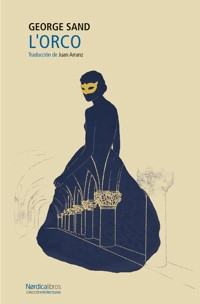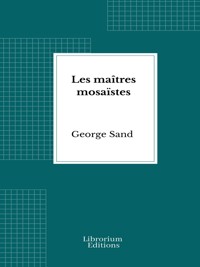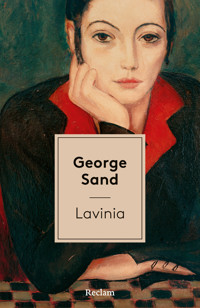Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
George Sand: Die kleine Fadette | Neu editierte 2020er-Ausgabe, in aktualisierter Rechtschreibung und mit erklärenden Fußnoten | Plus ein ausführliches Begleitwort zu George Sand | Franziska, die kleine Fadette, wie man sie nennt, ist ein 16jähriges, burschikoses und etwas verwahrlostes Mädchen, das bei seiner Großmutter aufwächst, einer Kräuterhexe, wie die Leute im Dorf sagen. Fadette hat, wie es scheint, nicht viel zu bieten, denn die meisten unterschätzen ihren scharfen Verstand und ihr Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Währenddessen wachsen, nicht weit entfernt, zwei Bauernburschen, Zwillinge, heran, die trotz allem an der Kleinen Interesse finden und schließlich sogar um sie konkurrieren. Aber das Erstaunliche ist, was mit Fadette in dieser Zeit des Erwachsenwerdens geschieht: Aus ihrem etwas schmuddeligen, unscheinbaren Leben steigt sie auf zur begehrenswerten und wohlhabenden jungen Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Klappentext
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Begleitwort des Herausgebers
Historischer Lexikoneintrag zu George Sand (1837)
Impressum
Fußnoten
Klappentext
Franziska, die ›kleine Fadette‹, wie man sie nennt, ist ein 16-jähriges, burschikoses und etwas verwahrlostes Mädchen, das bei seiner Großmutter aufwächst, einer ›Kräuterhexe‹, wie die Leute im Dorf sagen. Fadette hat, wie es scheint, nicht viel zu bieten, denn die meisten unterschätzen ihren scharfen Verstand und ihr Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Währenddessen wachsen, nicht weit entfernt, zwei Bauernburschen, Zwillinge, heran, die trotz allem an der Kleinen Interesse finden und schließlich sogar um sie konkurrieren. Wer der Sieger ist, steht bald außer Frage. Aber das Erstaunliche ist, was mit Fadette in dieser Zeit des Erwachsenwerdens geschieht: Aus ihrem etwas schmuddeligen unscheinbaren Leben steigt sie auf zur begehrenswerten jungen Frau.© Redaktion eClassica, 2020
Über die Autorin: George Sand (1804–1876), eigentlich Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil, ist eine der bekanntesten und profiliertesten französischen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Sie heiratete schon sehr jung (mit 18 Jahren), doch ihr Mann behandelte sie autoritär und herablassend. Sie trennte sich und wurde im Jahre 1836 geschieden. Künftig tat sie alles dafür, nie wieder von einem einzelnen Mann abhängig zu werden. Die Liste ihrer temporären Lebensgefährten liest sich wie das ›Who is Who‹ der künstlerischen Elite Frankreichs im 19. Jahrhundert. – Die Vielschreiberin war Zeit ihres Lebens ihren männlichen Kollegen (und Liebhabern) an literarischer Produktivität überlegen. Schon in jungen Jahren war ihr ein eigener Lexikoneintrag (hier im eBook enthalten) gewidmet. George Sand gilt wegen ihres unorthodoxen Lebensstils und ihrer einschlägigen Werke als Vorreiterin und Ikone der Frauenbewegung.
Lesen Sie mehr über den Autor im Anhang
Erstes Kapitel
Der Vater Barbeau in la Cosse war ein Mann, der sich keineswegs in schlechten Verhältnissen befand; und dass er Mitglied des Munizipalrates in seinem Ort war, mag als Beweis dafür dienen. Er besaß zwei Grundstücke, deren Ertrag ihn und seine Familie ernährte, und noch darüber hinaus einen Überschuss lieferte. Von seinen Wiesen erntete er tüchtige Fuder Heu, und ausgenommen von derjenigen, welche an den Ufern des Baches lag und durch die Binsen ein wenig beeinträchtigt wurde, war dies Heu als eins von der besten Sorte in der ganzen Gegend bekannt.
Das Haus des Vaters Barbeau war von solidem Bau und mit Ziegeln gedeckt. Es stand in gesunder Lage auf einem Hügel und war mit einem Garten von reichlichem Ertrag und mit einem Weinberg von sechs Tagewerken verbunden. Schließlich befand sich hinter der Scheune noch ein Baumgarten, wie man bei uns zu sagen pflegt, der einen Überfluss von Früchten lieferte, sowohl an Pflaumen und süßen Kirschen, wie auch an Birnen und Vogelbeeren. Sogar die Nussbäume längs der Umzäunungen waren die ältesten und größten auf zwei Meilen weit in der Runde.
Vater Barbeau war ein Mann von tüchtiger Sinnesart, ein sorglicher Familienvater, ohne Neid und Missgunst, ohne seinen Nachbarn und Ortsgenossen je zu nahe zu treten.
Er hatte schon drei Kinder, als die Mutter Barbeau, – jedenfalls, weil sie der Meinung war, dass sie genug hätten, um deren fünf zu ernähren, vielleicht auch, weil es galt sich zu beeilen, da ihr das Alter näher rückte, – sich’s einfallen ließ, ihren Mann mit einem Zwillingspaar, zwei schönen Knaben, zu beschenken. Da die beiden sich einander ähnlich sahen, dass man sie kaum zu unterscheiden vermochte, waren sie auf den ersten Blick als Zwillinge zu erkennen. Die Mutter Sagette, welche sie bei ihrem Eintritt in die Welt in ihrer Schürze auffing, vergaß nicht dem zuerst Geborenen mit ihrer Nadel ein kleines Kreuzchen auf dem Arme zu punktieren. Sie war der Meinung, dass ein als Erkennungszeichen umschlungenes Band oder Halskettchen, leicht verwechselt werden könnte, und so das Recht der Erstgeburt in Gefahr gerate, verloren zu gehen. Wenn das Kind kräftiger geworden sei, müsse man es mit einem Zeichen versehen, das sich nie verwischen lasse, und man verfehlte nicht dies zu tun.
Der Ältere erhielt den Namen Sylvain, woraus man bald Sylvinet machte, um ihn von seinem ältesten Bruder zu unterscheiden, den man ihm als Taufpaten gegeben hatte. Der jüngere Zwilling wurde Landry genannt, und diesen Namen ließ man ihm unverändert, wie er ihn in der Taufe erhalten hatte, weil sein Onkel, der ihm als Pate gedient hatte, von frühester Jugend auf Landriche genannt worden war.
Der Vater Barbeau war ein wenig erstaunt, als er bei seiner Heimkehr vom Markt zwei kleine Köpfe in der Wiege erblickte. »Oh! oh!« sagte er, »da seht einmal, die Wiege ist zu klein. Morgen früh muss ich daran, sie etwas größer zu machen.« Er verstand sich ein wenig auf das Handwerk des Zimmermanns, ohne es erlernt zu haben, und die Hälfte seiner Möbel war von ihm selbst verfertigt. Er wunderte sich nicht weiter, sondern wandte sich lieber seiner Frau zu, die ein großes Glas Glühwein trank, nach dessen Genuss sie sich um so besser befand. – »Du bist so gut im Zuge, Frau,« sprach der Mann zu ihr, »dass ich wirklich meine Kräfte zusammen nehmen muss. Es gilt jetzt zwei Kinder mehr zu ernähren, die wir gerade nicht nötig gehabt hätten. Das will soviel sagen, als dass ich nun ohne Rast noch Ruhe auf unseren Äckern und bei unserem Vieh im Stalle schaffen muss. Aber, sei nur ruhig, Frau; ich werde mit der Arbeit schon fertig werden, wenn du das nächste Jahr nur nicht mit Drillingen heran kommst; das wäre des Guten zu viel!«
Die Mutter Barbeau war dem Weinen nahe, worüber ihr Mann sehr bekümmert wurde. – »Ruhig, ruhig! liebe Frau«, sagte er; »lass dich’s nicht verdrießen. Ich sagte dir’s ja nicht um dir einen Vorwurf zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um dir meinen Dank auszusprechen; diese beiden Kinder sind gesund und wohlgestaltet; am ganzen Körper haben sie nicht einen einzigen Fehler, und ich freue mich darüber.«
»Ach Gott«, sagte die Frau, ich weiß recht gut, dass du mir keine Vorwürfe machen willst; aber ich selbst bin voller Sorgen, da es in der Welt nichts Lästigeres und Unsicheres geben soll, als ein Paar Zwillinge aufzuziehen. Der eine beeinträchtigt den anderen, und fast immer muss einer von ihnen zu Grunde gehen, damit der andere gedeihen kann!«
»Ei, was!« sagte der Vater, »sollte das wirklich so sein? Diese da sind in meinem Leben die ersten Zwillinge, die ich sehe; dergleichen kommt nicht oft vor. Aber, da haben wir ja die Mutter Sagette, die sich darauf verstehen muss, und die uns sagen kann, was man davon zu halten hat.«
Die Mutter Sagette, die sich in dieser Weise dazu aufgefordert sah, erwiderte: – »Lasst’s euch von mir gesagt sein: Diese beiden Zwillinge werden schön und gut gedeihen, und mit Krankheiten nicht mehr zu schaffen haben, als andere Kinder auch. Seit fünfzig Jahren betreibe ich mein Geschäft als Hebamme, und sehe alle Kinder, die im Bezirk geboren werden, leben oder sterben. Es ist also auch nicht das erste Mal, dass ich dabei bin, wenn Zwillinge geboren werden. Zunächst tut’s ihrer Gesundheit keinen Schaden, dass sie einander ähnlich sehen. Es gibt aber auch Zwillinge, die sich ebensowenig gleichen, wie ihr und ich, oft kommt’s auch vor, dass einer von ihnen kräftig und der andere schwach ist: dann geschieht’s, dass der eine lebt und der andere stirbt. Nun betrachtet aber einmal die eurigen! Seht! wie sie beide gleich schön und richtig gebaut sind; als ob sie jeder ein einziger Sohn wären. Im Schoße ihrer Mutter haben sie sich also keinerlei Schaden zugefügt; der eine wie der andere sind sie leicht zur Welt gekommen, ohne ihrer Mutter, oder sich selbst viele Schmerzen verursacht zu haben. Sie sind wunderniedlich und haben kein anderes Verlangen als zu leben. Tröstet euch also, Mutter Barbeau; es wird euch großes Vergnügen machen, wenn ihr seht, wie sie gedeihen. Wenn sie so bleiben, wie sie da sind, wird es außer euch und denjenigen, die sie täglich vor Augen haben, kaum jemanden geben, der sie voneinander unterscheiden könnte, denn noch nie habe ich zwei so vollkommen gleiche Zwillinge gesehen. Man könnte sagen: sie sind wie zwei Feldhühner, die aus demselben Ei gekrochen sind. Da ist alles so niedlich und so gleichartig, dass niemand als die Mama Feldhuhn sie voneinander unterscheiden kann.«
»Das wäre!« ließ sich der Vater Barbeau vernehmen, indem er sich den Kopf kraute; »ich hörte aber sagen, dass Zwillinge mit der Zeit aneinander hängen sollen, dass sie nicht mehr leben können, wenn sie voneinander getrennt werden; dass wenigstens einer von ihnen sich vor Kummer verzehren würde, bis er daran gestorben sei.«
»Das ist die reine Wahrheit«, bestätigte die Mutter Sagette; »aber merkt euch, was eine Frau von Erfahrung euch sagen wird. Vergesst es nicht! denn um die Zeit, in der eure Kinder das Alter erreicht haben, wo sie das elterliche Haus verlassen, werde ich vielleicht nicht mehr in der Welt sein, um euch mit meinem Rat beistehen zu können. Sobald euere Zwillinge anfangen verständig zu werden, seid auf euerer Hut, sie nicht immer beisammen zu lassen, schickt den einen zur Arbeit hinaus, während der andere zu Hause bleibt. Wenn der eine auf den Fischfang geht, schickt den anderen auf die Jagd. Wenn der eine die Schafe hütet, lasst den anderen die Ochsen auf die Weide treiben; gebt ihr dem einen ein Glas Wein zu trinken, so reicht dem anderen ein Glas Wasser, und so umgekehrt. Scheltet oder bestraft sie ja nicht beide zu gleich, lasst sie auch nicht beide gleich gekleidet sein: wenn der eine einen Hut trägt, setzet dem anderen eine Kappe auf; und vor allem achtet darauf, dass ihre Blusen nicht von derselben blauen Farbe sind. Schließlich bietet alles auf, was in eurer Macht steht, sie daran zu verhindern, sich so leidenschaftlich aneinander anzuschließen und sich so zu gewöhnen, dass der eine ohne den anderen nicht mehr sein kann. Ich fürchte sehr, ihr werdet das, was ich euch da gesagt habe, ins eine Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus gehen lassen. Aber, wenn ihr euch nicht danach haltet, werdet ihr es eines Tages bitter zu bereuen haben.«
Mutter Sagette sprach goldene Weisheit, und man glaubte daran. Man versprach ihr, nach ihren Worten zu tun, und entließ sie mit einem schönen Geschenk. Da sie dringlichst empfohlen hatte, die Zwillinge nicht mit derselben Milch zu ernähren, war man darauf bedacht, sich rasch eine Amme zu verschaffen.
Es war indessen im ganzen Ort keine aufzutreiben. Mutter Barbeau hatte in dieser Hinsicht keine Vorkehrungen getroffen, da sie auf Zwillinge nicht gerechnet, und alle ihre anderen Kinder selbst genährt hatte. So geschah es also, dass Vater Barbeau sich auf den Weg machen musste, in der Umgegend nach einer passenden Amme zu suchen. Mittlerweile nahm die Mutter, die ihre Kleinen doch nicht darben lassen konnte, eins nach dem anderen an die Brust.
Bei uns zu Hause sind die Leute nicht eben rasch von Entschluss, und wie reich man auch sein mag, so muss bei jedem Geschäft doch immer etwas gehandelt werden. Man wusste, dass die Barbeaus es bezahlen konnten und war auch der Meinung, dass die Mutter, die nicht mehr in der ersten Blüte stand, unmöglich würde zwei Säuglinge stillen können, ohne sich selbst zu erschöpfen. Die Ammen alle, die Vater Barbeau auftreiben konnte, verlangten für den Monat achtzehn Franken, nicht mehr, noch weniger, als sie von einem Bürger gefordert haben würden.
Vater Barbeau wollte nur zwölf bis fünfzehn Franken geben und meinte, dies sei für einen Bauersmann schon viel. Er wandte sich überall hin und knüpfte Unterhandlungen an, ohne jedoch zum Abschluss kommen zu können. Die Sache drängte auch nicht so sehr, denn die beiden noch so kleinen Kinder konnten der Mutter nicht beschwerlich werden. Dabei befanden sie sich so wohl, waren so ruhig, so durchaus keine Schreihälse, dass sie fast nicht mehr Störung im Hause verursachten, als wenn nur ein einziges dagewesen wäre. Sobald der eine schlief, schlief auch der andere; auch hatte der Vater die Wiege in passender Weise verändert, und wenn sie beide zu weinen anfingen, wiegte und beruhigte man sie zu gleicher Zeit.
Endlich war man so weit gekommen, dass Vater Barbeau mit einer Amme einen Kontrakt abschloss, der auf fünfzehn Franken pro Monat lautete; es handelte sich nur noch um die Bewilligung eines Nadelgeldes von hundert Sous, als seine Frau plötzlich zu ihm sagte: – »Ei was! lieber Mann, ich sehe nicht ein, warum wir jährlich hundertundachtzig, oder gar zweihundert Franken hinauswerfen sollen, als wären wir eine große Herrschaft, oder als ob ich über die Jahre hinaus wäre, meine Kinder selbst nähren zu können. Ich habe mehr Milch, als dazu nötig ist. Unsere Buben sind jetzt schon einen Monat alt, und sieh nur, ob sie nicht dick und rund sind. Die Merlaude, die du dem einen von beiden zur Amme geben wolltest, ist nicht halb so kräftig und gesund wie ich. Ihre Milch ist schon achtzehn Monate alt, und das ist nicht mehr das Richtige für ein so kleines Kind. Es ist wohl wahr, die Sagette hat uns geraten die Zwillinge nicht mit derselben Milch zu nähren, damit sie nicht eine zu große Anhänglichkeit füreinander gewinnen sollten. Aber sie hat uns ja auch gesagt, dass die Kinder beide gleich gut gepflegt werden müssen, weil alles in allem genommen, Zwillinge nicht ganz dieselbe Lebenskraft hätten, wie andere Kinder. Mir ist es lieber, wenn die unsrigen sich künftig zu lieb haben, als wenn eins dem anderen geopfert werden sollte. Und dann, welches von den beiden sollten wir der Amme übergeben? Ich muss dir gestehen, dass ich mich gerade so ungern von dem einen wie von dem anderen trennen würde. Ich kann sagen, dass ich alle meine Kinder sehr lieb hatte; aber ich weiß nicht, wie es kommt, ich meine doch, diese hier wären die niedlichsten und hübschesten, die ich auf dem Arm gehabt hätte. Ich habe für sie eine sogar eigene Empfindung, die mich immer fürchten lässt, ich könnte sie verlieren. Ich bitte dich, Mann, denke nicht mehr an die Amme. Im Übrigen wollen wir alles tun, was die Sagette uns so dringlich empfohlen hat. Wie sollte das nur zugehen, dass Kinder an der Mutter Brust eine zu große Anhänglichkeit füreinander gewinnen könnten. Zur Zeit der Entwöhnung werden sie doch nicht weiter sein, als dass sie höchstens ihre Hand von ihrem Fuß zu unterscheiden wissen.«
»Was du da sagst, Frau, lässt sich hören«, erwiderte Vater Barbeau, indem er seine Frau betrachtete, die noch immer frisch und kräftig war, wie man wenig andere Frauen in ihrem Alter sah. »Wenn nun aber trotzdem, wie die Kinder zunehmen, deine Gesundheit verkümmern würde?«
»Sei unbesorgt deshalb«, sagte Frau Barbeau, »das Essen schmeckt mir noch so gut, als wenn ich erst fünfzehn Jahre alt wäre. Überdies verspreche ich dir, sobald ich fühlen werde, dass es mich erschöpfen könnte, dir dies nicht zu verbergen, und dann wird es noch immer Zeit sein, eins von den beiden armen Kindern aus dem Hause fort zu tun.«
Vater Barbeau fügte sich diesen Vorstellungen um so lieber, da er selbst sehr geneigt war, überflüssige Ausgaben zu vermeiden. Mutter Barbeau nährte ihre Zwillinge ohne zu klagen, und ohne darunter zu leiden; sie war von so trefflicher Konsumtion, dass sie sogar zwei Jahre, nachdem sie ihre Zwillinge entwöhnt hatte, einem allerliebsten Töchterchen das Leben gab, welches in der Taufe den Namen Nanette erhielt, und das gleichfalls von ihr selbst genährt wurde. Dies war jedoch des Guten zu viel, und sie würde Mühe gehabt haben, ihre Aufgabe zu Ende zu führen, wenn nicht ihre älteste Tochter, die gerade ihr erstes Kind hatte, sie von Zeit zu Zeit in ihren mütterlichen Pflichten unterstützt hätte, indem sie ihrer kleinen Schwester die Brust gab.
In dieser Weise wuchs die kleine Familie heran und tummelte sich bald in der Sonne herum: die kleinen Onkels und Tanten mit den kleinen Neffen und Nichten, die sich einander nichts vorzuwerfen hatten, wer von ihnen am meisten lärmte, oder wer verständiger war.
Zweites Kapitel
Die Zwillinge wuchsen munter heran, ohne häufiger von Krankheiten heimgesucht zu werden, als andere Kinder auch; ja sie waren sogar von so sanfter und gutartiger Gemütsart, dass man hätte meinen können, das Zahnen und Wachsen mache ihnen lange nicht so viel zu schaffen, als der ganzen übrigen kleinen Welt.
Sie waren blond und blieben blond, ihr Leben lang. Sie waren von überaus einnehmender Erscheinung, hatten große blaue Augen, schön abfallende Schultern, einen ebenmäßigen Wuchs und eine gute Haltung. Dabei waren sie größer und von kühnerem Vorgehen, als alle ihre Altersgenossen. Die Leute aus der Umgegend, welche durch den Marktflecken la Cosse kamen, blieben stehen, um sie zu betrachten und wunderten sich über ihr gutes Benehmen. Im Weitergehen sagte jeder: »Wie allerliebst die beiden kleinen Buben sind!«
Dies war die Ursache, weshalb die Zwillinge sich beizeiten daran gewöhnten Auskunft zu geben, wenn Fragen an sie gerichtet wurden, und dies keineswegs in verschüchterter oder einfältiger Weise zu tun. Zwanglos begegneten sie jedermann, und statt sich hinter Gesträuch zu verbergen, wie dies die Kinder bei uns zu tun pflegen, wenn sie einen Fremden erblicken, hielten sie jedermann stand, waren immer sehr höflich und antworteten auf alles, was man sie fragte, ohne den Kopf hängen, oder sich dazu nötigen zu lassen. Auf den ersten Blick vermochte man keinen Unterschied zwischen ihnen wahrzunehmen, und man glaubte sie wären einander so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Aber hatte man sie eine Weile betrachtet, dann erkannte man, dass Landry um ein Atom größer und stärker war, dass er ein etwas dichter gewachsenes Haar, eine etwas stärkere Nase und ein lebhafteres Auge hatte. Auch hatte er eine breitere Stirn und eine entschlossenere Miene, und sogar ein Mal, welches sein Bruder auf der rechten, und er auf der linken Wange hatte, trat bei ihm viel deutlicher hervor. Die Leute im Orte wussten sie daher recht gut zu unterscheiden; allein sie bedurften dazu doch eines kurzen Besinnens, und beim Eintritt der Dunkelheit, oder in geringer Entfernung täuschten sich fast alle, umso mehr, da bei den Zwillingen die Stimme von ganz gleichem Klange war; und da sie recht gut wussten, dass sie miteinander verwechselt werden konnten, antworteten sie oft der eine im Namen des anderen, ohne sich die Mühe zu geben dritte Personen über den Irrtum aufzuklären. Selbst Vater Barbeau war es einige Male begegnet, dass er sich irrte. So geschah es, wie die Sagette es vorher gesagt hatte, dass allein die Mutter sich niemals täuschte, mochte es mitten in der Nacht, oder in der größten Entfernung sein, wo ihr Auge die Gestalt ihrer Kinder noch eben zu erreichen, oder ihr Ohr deren Stimme noch zu vernehmen vermochte.
In der Tat, einer war des andern wert; wenn Landry auch etwas fröhlicheren und kühneren Sinnes war, als sein älterer Bruder, so war Sylvinet dagegen von so zutraulicher und sinniger Gemütsart, dass man ihm nicht weniger gut sein konnte, als dem Jüngeren. Während des ersten Vierteljahres war man wohl darauf bedacht zu verhindern, dass sie sich nicht zu sehr aneinander gewöhnen sollten. Drei Monate, das ist eine lange Zeit auf dem Lande, um etwas, das gegen die Gewohnheit ist, zu beobachten. Indessen, auf der einen Seite erkannte man, dass es keine besondere Wirkung hatte, und andererseits hatte der Pfarrer gesagt, die Mutter Sagette sei eine unverständige Schwätzerin, und was Gott durch die Gesetze der Natur angeordnet habe, könnte durch den Menschen nicht wieder aufgehoben werden. Das war einleuchtend und so kam es, dass man allmählich alles vergaß, was man sich zu tun vorgenommen hatte. Das erste Mal, als man bei den Zwillingen die Kinderkleidchen fort ließ, und ihnen Höschen anzog, um sie mit in die Messe zu nehmen, waren diese aus demselben Tuch gefertigt, denn es war ein Unterrock der Mutter, der für die beiden Anzüge hingereicht hatte; auch waren sie von ein und demselben Schnitt, da der Schneider der Ortschaft sich nur auf diesen einen verstand.
Als die Zwillinge heranwuchsen, stellte es sich heraus, dass sie in Bezug auf Farben denselben Geschmack hatten. Als ihre Tante Rosette jedem von ihnen zum Neujahrstag ein Halstuch schenken wollte, wählten sie bei dem hausierenden Händler, der seine Ware auf dem Rücken seines Pferdes von Haus zu Haus führte, sich jeder ein Tuch von derselben Lilafarbe. Die Tante fragte sie darauf, ob sie dies täten, weil sie sich dabei dächten, dass sie immer gleich gekleidet sein wollten. Die Zwillinge aber suchten ihre Gründe nicht so weit, und Sylvinet antwortete, dass dies die schönste Farbe sei, und das Tuch das schönste Muster habe von allen die in dem Ballen des Händlers zu finden wären. Gleich darauf versicherte Landry, dass an alle den anderen Halstüchern ihm nichts gelegen sei.
»Und was haltet ihr denn von der Farbe meines Pferdes?« fragte lächelnd der Handelsmann.
»Sehr hässlich!« sagte Landry. »Es sieht aus wie eine alte Elster.«
»Ganz abscheulich!« bekräftigte Sylvinet. »Grade wie eine schlecht befiederte Elster.«
»Ihr seht wohl«, wandte der Händler sich mit verständnisvoller Miene an die Tante, »dass diese Kinder alles mit demselben Auge ansehen. Wenn der eine etwas für gelb hält, was rot ist, wird der andere sofort für rot halten, was gelb ist. Man muss ihnen darin nicht widersprechen, denn es heißt: wenn man Zwillinge verhindern wolle, sich als Abdrücke nach ein und demselben Vorbild zu betrachten, würden sie blöde im Kopf werden und gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollten.«
Der Händler sagte dies, weil seine Tücher von Lilafarbe schlecht gefärbt waren, und er gern zwei davon los werden wollte.
Mit der Zeit ging es mit allen Dingen in dieser Weise fort; und die Zwillinge waren immer ganz gleich gekleidet, sodass die Gelegenheit sie zu verwechseln, noch viel häufiger vorkam. Mochte es nun kindischer Übermut sein, oder mochte es durch die Gewalt jenes Naturgesetzes geschehen, wogegen nach des Pfarrers Ansicht nicht anzukämpfen war, – kurz, wenn der eine von den Zwillingen etwas an seinem Holzschuh zerbrochen hatte, beschädigte rasch auch der andere etwas an dem seinigen, und zwar an dem desselben Fußes. Hatte der eine an seinem Wams oder seiner Mütze etwas zerrissen, so machte der andere ohne Zögern den Riss an den seinigen so genau nach, dass man hätte sagen können, er sei durch denselben Zufall verursacht worden. Wenn die Zwillinge darüber befragt wurden, lachten sie und nahmen eine harmlos verstellte Miene an.
Ob es nun zum Glück oder zum Unglück war: diese Freundschaft nahm mit den Jahren immer mehr zu, und mit dem Tag, da sie zu denken begannen, sagten die beiden Kinder sich, dass es ihnen unmöglich sei, sich am Spiel mit anderen Kindern zu erfreuen, wenn einer von ihnen nicht dabei sei. Wenn der Vater den Versuch machte, den einen seiner Zwillinge den ganzen Tag über bei sich zu behalten, während der andere bei der Mutter blieb, waren die Kinder beide so niedergeschlagen und lässig bei der Arbeit, und blickten so bleich und verkümmert drein, dass man hätte glauben sollen, sie seien krank. Fanden sie sich dann aber am Abend wieder zusammen, dann machten sie sich miteinander Hand in Hand auf den Weg, und waren nicht so bald wieder nach Hause zurückzubringen, so wohl war es ihnen wieder beisammen zu sein; auch grollten sie ihren Eltern ein wenig, ihnen solch ein Entbehren auferlegt zu haben. Man machte eigentlich auch keinen weiteren Versuch mit diesen vorübergehenden Trennungen, denn um die Wahrheit zu sagen, war es unverkennbar, dass Vater und Mutter, ja sogar die Onkel und Tanten, die Brüder und Schwestern eine an Schwäche streifende Vorliebe für die Zwillinge hatten. Sie waren stolz darauf, wegen der Schmeicheleien, die sie in Bezug auf diese Kinder zu hören bekamen, und auch, weil dies wahrlich Knaben waren, die sicherlich nichts von Hässlichkeit, Dummheit oder Bosheit an sich trugen. Von Zeit zu Zeit machte es dem Vater Barbeau noch einige Sorge, was schließlich aus dieser Gewohnheit des beständigen Beisammenseins werden sollte, wenn sie einmal das Alter der Reife erlangt haben würden. In Erinnerung an das, was die Sagette gesagt hatte, versuchte er manchmal durch verschiedene Neckereien sie zur gegenseitigen Eifersucht aufzustacheln. Wenn sie zum Beispiel etwas Verkehrtes angestellt hatten, zupfte der Vater Sylvinet an den Ohren, während er zu Landry sagte: »Dir mag es für dieses Mal hingehen, da du sonst meistens der Vernünftigste bist.« Indessen, wenn es Sylvinet heiß um die Ohren wurde, fand er gerade darin seinen Trost, das man wenigstens seinen Bruder verschont hatte, und Landry weinte, als ob er es gewesen wäre, der die Strafe erlitten hatte. Man versuchte es auch damit, das man etwas, nachdem sie beide Verlangen trugen, nur dem einen von ihnen gab; bestand dies aber in irgendeiner Näscherei, so wurde diese sofort unter ihnen geteilt. Oder, war es irgendeine andere artige Spielerei, so nahmen sie dieselbe gemeinschaftlich in Besitz; oder der eine nahm sie an und gab sie abwechselnd dem anderen, ohne einen Unterschied zwischen dem mein und dein gelten zu lassen. Belobte man den einen wegen seines guten Betragens, und nahm dabei die Miene an, als ob man dem anderen die gerechte Anerkennung versagen wollte, so bezeigte dieser seine Zufriedenheit und war stolz darauf, seinen Zwillingsbruder ermuntert und geliebkost zu sehen; ja er schickte sich an, ihn gleichfalls zu streicheln und zu liebkosen. Schließlich wäre es nur eine verlorene Mühe gewesen, hätte man noch weitere Versuche anstellen wollen, sie innerlich oder äußerlich voneinander zu trennen. Gleich wie man Kindern, die man liebt, nur ungern verweisend entgegentritt, selbst dann, wenn es zu ihrem Besten wäre, so machte man es auch bald mit den Zwillingen und ließ die Dinge gehen, wie es Gott gefiel. Höchstens trieb man nur noch ein Spiel mit diesen kleinen Neckereien, ohne dass die Zwillinge sich dadurch täuschen ließen. Sie besaßen eine große Schlauheit, und damit man sie in Ruhe lassen sollte, taten sie einige Male, als ob sie untereinander stritten und sich schlagen wollten. Ihrerseits war dies nur ein Scherz und während sie übereinander herfielen, nahmen sie sich Wohl in Acht, dass keiner dem anderen auch nur im Geringsten weh tun konnte. Wenn irgendein müßiger Gaffer sich wunderte, sie miteinander streiten zu sehen, liefen sie davon, um über ihn zu lachen, und dann hörte man sie plaudern und zwitschern wie ein paar Amseln, die auf demselben Zweig sitzen.
Trotz ihrer großen Ähnlichkeit und dieser außerordentlichen Zuneigung, war es Gottes Wille, der im Himmel und auf Erden nichts vollkommen gleiches erschaffen hat, dass sie ganz verschiedene Schicksale haben sollten, und dann war es zu erkennen, dass sie zwei in der Idee des Schöpfers getrennte Wesen waren, die sich durch ihr eignes Empfindungsvermögen voneinander unterschieden. Vater Barbeaus Familie vergrößerte sich, dank sei’s den beiden ältesten Töchtern, die nicht aufhörten, schöne Kinder in die Welt zu setzen. Sein ältester Sohn Martin, ein schöner und braver Bursche war bei anderen im Dienst; seine Schwiegersöhne arbeiteten tüchtig, aber es war nicht grade immer Überfluss an Arbeit vorhanden. Es hat bei uns hintereinander eine Reihe von schlechten Jahren für die Ernte gegeben, sowohl durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse, als auch durch die Stockungen des Handels; durch diese Verhältnisse war aus der Tasche des Landmannes mehr Geld hinaus geschafft, als wieder herein gebracht worden. Dies war so sehr der Fall gewesen, dass Vater Barbeau nicht mehr die hinreichenden Mittel besaß, seine ganze Familie bei sich zu behalten, und so musste wohl daran gedacht werden, die Zwillinge bei anderen in den Dienst zu geben.
Da war nun der Vater Caillaud von la Priche, der ihm das Anerbieten machte einen von beiden zu nehmen, um seine Ochsen zu führen, denn er hatte einen ansehnlichen Grundbesitz zu bewirtschaften, und seine eignen Söhne waren für jenen Dienst, entweder schon viel zu erwachsen, oder noch viel zu jung. Die Mutter Barbeau geriet in große Angst, als ihr Eheherr zum ersten Mal über diese Angelegenheit mit ihr sprach und empfand großen Kummer darüber. Man hätte denken sollen, es sei ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass ihren Zwillingen ein derartiges Los bevorstehen könne, und dennoch war sie in dieser Hinsicht schon immer in Sorgen gewesen. Indessen, da sie ihrem Mann gegenüber sehr unterwürfig war, fand sie kein Wort der Erwiderung dagegen. Der Vater empfand seinerseits wohl auch große Bekümmernis und leitete die Sache von Weitem ein. Die Zwillinge weinten anfangs und streiften drei Tage lang in Wald und Wiesen umher, ohne sich im Hause blicken zu lassen, als zu den Stunden der Mahlzeiten. Mit ihren Eltern sprachen sie nicht ein Wort darüber, und wenn man sie fragte, ob sie daran gedacht hätten sich zu fügen, erwiderten sie nichts, aber sobald sie allein waren, besprachen sie sich viel untereinander.
Den ersten Tag nach der traurigen Botschaft, verbrachten sie nur mit Klagen, und sie hielten sich umschlungen, wie in der Furcht, dass man sie gewaltsam trennen könnte. Aber Vater Barbeau würde es nicht in den Sinn gekommen sein, so etwas zu tun. Er besaß die Weisheit des Landmannes, die zum Teil in der Geduld besteht und zum Teil in dem Vertrauen auf die heilsame Wirkung der Zeit. Auch waren die Zwillinge am folgenden Morgen, als sie sahen, dass man sie durchaus nicht drängte, und dass man darauf rechnete, die Vernunft würde ihnen schon kommen, in viel größerer Bekümmernis über den väterlichen Beschluss, als Drohungen und Strafen ihnen zu verursachen vermocht hätten, – »Es wird nicht anders sein, als dass wir uns darin fügen müssen«, sagte Landry; »es kommt jetzt nur noch darauf an, wer von uns gehen wird; man ließ uns ja die Wahl, und der Vater Caillaud hat gesagt, dass er uns nicht alle beide nehmen könne.«
»Was liegt mir noch daran, ob ich gehe oder bleibe«, sagte Sylvinet, »da wir uns ja doch trennen müssen. Ich denke nicht einmal darüber nach, dass ich hinaus soll, anderswo zu leben; wenn ich nur dich bei mir behalten könnte, würde ich mich recht gut vom Hause entwöhnen.«
»Das ist leicht gesagt«, erwiderte Landry, »und doch wird es dem, der bei unseren Eltern bleibt tröstlicher zu Mute sein, und er wird, weniger von der Sehnsucht zu leiden haben als der andere, der nichts mehr von alledem sieht, was ihm Trost und Erquickung war: weder seinen Zwillingsbruder, noch seinen Vater und seine Mutter, weder seinen Garten noch seine Tiere.«
Landry sagte dies alles mit ziemlich gefasster Miene; aber Sylvinet war dem Weinen nahe, denn er besaß lange nicht einen so festen entschlossenen Sinn, wie sein Bruder. Die Vorstellung alles, was ihm lieb und teuer war, mit einem Mal verlassen zu müssen, erfüllte ihn mit solchem Schmerz, dass er seine Tränen nicht länger zu bezwingen vermochte.
Landry weinte auch, aber nicht so fassungslos; überhaupt in einer ganz anderen Weise, denn er war stets darauf bedacht, den schlimmsten Teil alles Unangenehmen auf sich zu nehmen, und er wollte sehen, wie viel sein Bruder ertragen könne, um ihm dann alles Übrige zu ersparen. Er wusste recht gut, dass Sylvinet sich mehr ängstigen würde, an einem anderen Ort zu wohnen und in einer fremder Familie zu leben, als er dies tun würde.
»Höre Bruder«, sprach er zu ihm, »wenn wir uns zu einer Trennung entschließen müssen, ist es am besten, dass ich gehe. Du weißt ja, dass ich etwas stärker bin, als du; wenn wir von einer Krankheit befallen werden, was beinah immer zu gleicher Zeit geschieht, hast du das Fieber jedesmal etwas mehr als ich. Man sagt, dass wir sterben könnten, wenn man uns trennt. Was mich betrifft, so glaube ich nicht, dass ich sterben würde; aber für dich möchte ich nicht einstehen, und das ist es, weshalb es mir lieber wäre, dich bei unserer Mutter zu wissen, die dich trösten und pflegen kann. Wenn man in der Liebe zwischen uns beiden einen Unterschied macht, was freilich kaum der Fall zu sein scheint, so glaube ich, dass du es bist, den man am liebsten hat, und ich weiß auch, dass du der Hübscheste und Zutraulichste bist. Bleibe du also hier, und ich gehe dann. Wir werden nicht weit voneinander fort sein. Die Ländereien des Vaters Caillaud grenzen an die unsrigen, und wir können uns jeden Tag sehen. Mir wird es angenehm sein, wenn ich mich tüchtig plagen muss; das wird mich zerstreuen, und da ich schneller laufen kann als du, komme ich dann gleich dich aufzusuchen, sobald ich mein Tagewerk beendet habe. Und du, da du nicht so viel zu tun hast, kommst jeden Tag herüber und suchst mich bei meiner Arbeit auf. So werde ich deinetwegen viel weniger Sorge haben, als wenn du aus dem Hause fort gingst, und ich daheim bliebe. Ich bitte dich also, bleibe hier.
Drittes Kapitel
Sylvinet wollte von diesen Vorstellungen nichts wissen. Wenn er auch mit größerer Zärtlichkeit als Landry an seinem Vater, seiner Mutter und an seiner kleinen Nanette hing, so schrak er doch davor zurück seinen lieben Zwilling den schwersten Teil ihres Geschicks auf sich nehmen zu lassen.
Nachdem sie genug herumgestritten hatten, beschlossen sie, das Los, durch Strohhalm ziehen, entscheiden zu lassen, und Landry war es, der den kürzesten Halm zog. Sylvinet war mit dieser Probe nicht zufrieden; er wollte es noch einmal mit dem Werfen eines dicken Sous-Stückes versuchen. Dreimal fiel für ihn die Hauptseite des Gepräges nach oben. Es war also immer für Landry, den das Los zu gehen traf.
»Du siehst nun wohl, Wie das Schicksal es beschlossen hat«, sagte Landry, »und du weißt, dass man dem Willen des Schicksals nicht zuwiderhandeln darf.«
Sylvinet weinte am dritten Tage noch sehr, Landry aber vergoss kaum noch eine Träne. Der erste Gedanke an das Verlassen des väterlichen Hauses hatte ihm vielleicht noch größeren Schmerz verursacht, als seinem Bruder. Er war sich seines Mutes bewusst, und hatte sich nicht einen Augenblick über die Unmöglichkeit getäuscht, dem Willen seiner Eltern zu widerstehen. Aber grade, weil er viel über seinen Schmerz nachdachte, hatte er diesem den Stachel genommen; auch hatte er viele Gründe aufgefunden, die ihm sein Schicksal als eine unabwendbare Notwendigkeit erscheinen ließen. Sylvinet dagegen, der immer nur trostlos war, hatte nicht den Mut gehabt über die Angelegenheit nachzudenken. So war es also gekommen, dass Landry ganz entschlossen war zu gehen, während Sylvinet sich noch nicht einmal in die Notwendigkeit der Trennung gefunden hatte.
Auch hatte Landry überhaupt etwas mehr Selbstgefühl als sein Bruder. Es war ihnen so oft vorgesagt worden, dass sie nie ein ganzer Mann sein würden, wenn sie sich nicht darein finden könnten, voneinander getrennt zu sein. Landry nun, der den Stolz seiner vierzehn Jahre in sich keimen fühlte, wandelte die Lust an zu zeigen, dass er kein Kind mehr sei. Seitdem sie zum ersten Mal ausgezogen waren, auf dem Wipfel eines Baumes ein Vogelnest zu suchen, bis auf den gegenwärtigen Tag, war er es stets gewesen, der bei jeder Unternehmung seinen Bruder überredete und mit sich fort zog. So gelang es ihm denn auch dieses Mal ihn zu beruhigen, und als sie am Abend in das Haus der Eltern zurückkehrten, erklärte er seinem Vater: dass er und sein Bruder bereit seien, sich in das Unvermeidliche zu fügen, dass sie das Los gezogen hätten, und dass er hinaus gehen werde, die großen Ochsen von la Priche zu führen.
Vater Barbeau nahm seine Zwillinge und setzte jeden, obgleich sie schon groß und stark waren, auf eins seiner Kniee und sprach zu ihnen:
»Meine Kinder, ihr steht jetzt im Alter der Vernunft, das erkenne ich an eurer Unterwerfung, und ich bin mit euch zufrieden. Merkt es euch: Wenn die Kinder ihren Eltern Freude machen, sind sie Gott im Himmel wohlgefällig, der sie früher oder später dafür belohnen wird. Ich weiß nicht, wer von euch beiden der erste war, der sich zu unterwerfen bereit war. Aber Gott weiß es und wird ihn dafür segnen, dass er zum Guten gesprochen hat, wie er den anderen dafür segnen wird, dass er sich danach gerichtet hat.«
Darauf führte der Vater seine Zwillinge zur Mutter, damit auch sie ihnen ihr Lob spende. Aber Mutter Barbeau wurde es so schwer ihre Tränen zu unterdrücken, dass sie keines Wortes fähig war, und sich damit begnügen musste, ihre Lieblinge zu umarmen und zu küssen.
Vater Barbeau, der einen guten Verstand hatte, wusste recht gut, welcher von den beiden der mutigste war, und welcher am meisten Anhänglichkeit besaß. Er wollte den guten Willen Sylvinets nicht wieder erkalten lassen, denn er sah wohl, dass Landry für sich selbst ganz entschlossen war, und dass nur eins, der Kummer seines Bruders, ihn wieder zum Wanken bringen konnte. Er ging deshalb vor Tagesanbruch an das Bett der Zwillinge und weckte Landry auf, nahm sich dabei aber wohl in Acht den älteren Bruder, der an dessen Seite schlief, ja nicht anzurühren.
»Auf, mein Junge«, flüsterte er Landry leise zu, »wir müssen uns aufmachen nach la Priche, ehe deine Mutter es sieht, du weißt, sie ist voller Kümmernis, und man muss ihr den Abschied ersparen. Ich selbst will dich zu deinem neuen Herrn führen und dir deine Sachen tragen.«
»Soll ich denn ohne Abschied von meinem Bruder gehen?« fragte Landry. »Er wird mir böse werden, wenn ich ihn so ohne Weiteres verlasse.«
»Wenn dein Bruder aufwacht und dich fortgehen steht, dann fängt er an zu weinen und weckt auch deine Mutter auf, und die Mutter wird noch heftiger weinen, wenn sie euch so betrübt sieht. Komm, Landry, du bist ein mutiger Bursche, du kannst es nicht wollen, dass deine Mutter krank wird. Erfülle deine Pflicht ganz, mein Kind, und gehe still hinaus. Schon heute Abend werde ich deinen Bruder zu dir führen, und da morgen Sonntag ist, kommst du den ganzen Tag zu deiner Mutter auf Besuch.«
Landry gehorchte mit mutiger Fassung und schritt zum Hause hinaus, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Mutter Barbeau hatte nicht so ruhig geschlafen, um nicht alles gehört zu haben, was ihr Mann zu Landry gesagt hatte. Die arme Frau fühlte, dass ihr Mann recht habe; sie rührte sich nicht von der Stelle und begnügte sich damit die Gardine des Bettes ein wenig zu lüften, um Landry fortgehen zu sehen. Das Herz wurde ihr dabei so schwer, dass es sie nicht länger im Bett hielt: sie sprang heraus, um ihn noch einmal zu umarmen; aber, als sie bis zu dem Lager der Zwillinge gekommen war, wo Sylvinet noch im festen Schlaf lag, blieb sie stehen. Der arme Knabe hatte seit drei Tagen, und so zu sagen, seit drei Nächten so viel geweint, dass er völlig erschöpft davon war. Er hatte sogar etwas Fieber, denn er warf sich auf seinen Kissen hin und her, stieß schwere Seufzer aus und stöhnte laut, ohne sich aus dem Schlafe losreißen zu können.
Als die Mutter Barbeau den einzigen Zwilling, der ihr noch verblieb, betrachtete, konnte sie nicht umhin sich zu gestehen, dass dieser es sei, dessen Scheiden ihr noch größeren Schmerz verursachen würde. Er war wirklich der Gefühlvollere von den beiden; mochte es nun sein, dass er von zarterer Konstitution war, oder, dass es in dem von Gott gegebenen Naturgesetz so angeordnet war, dass, wo zwei Personen durch Liebe oder Freundschaft miteinander verbunden sind, die eine immer von größerer Hingabe ergriffen sein wird, als die andere. Vater Barbeau hatte eine Feder mehr Gewicht an Zuneigung für Landry, denn ihm galten Arbeitskraft und Mut mehr als Liebkosungen und zarte Aufmerksamkeiten. Die Mutter empfand eine kaum zu bemerkende größere Vorliebe für den zierlicheren und schmiegsameren ihrer Zwillinge, also für Sylvinet.
Da stand sie nun und betrachtete ihren armen Knaben, der ganz bleich und abgemattet dalag, und sie sagte sich, dass es himmelschreiend gewesen wäre, ihn schon so früh in einen Dienst zu geben. Landry habe eher das Zeug dazu, Mühe und Arbeit auszuhalten, und überdies würden die Liebe und Sehnsucht nach seinem Bruder und seiner Mutter ihm nicht so zusetzen, dass er krank davon werden könnte. Landry ist ein Bursche, der einen großen Begriff von seiner Pflicht hat, fuhr sie in ihren Betrachtungen fort; aber darin liegt es eben, wenn er nicht ein etwas trockenes Gemüt hätte, würde er nicht so entschlossen fortgegangen sein, ohne nur ein einziges Mal den Kopf zu wenden, oder auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Er würde nicht die Kraft gehabt haben, zwei Schritte weit zu gehen, ohne den lieben Gott anzuflehen, ihm Kraft und Mut zu verleihen. Er würde sich an mein Bett geschlichen haben, wo ich lag und so tat, als ob ich schliefe, wenn auch nur, um mich noch einmal anzusehen, und den Zipfel meines Bettvorhanges zu küssen. Mein Landry ist freilich ein richtiger Bursche, der nur verlangt zu leben, sich tüchtig herumzutummeln, zu arbeiten, und der sich nach Ortsveränderung sehnt. Aber dieser hier hat ein Herz, so weich, wie das eines Mädchens; der ist so zärtlich und so sanft, dass man gar nicht anders kann, als ihn lieb haben, wie seinen eigenen Augapfel.
So dachte die Mutter Barbeau und kehrte ins Bett zurück, aber ohne wieder einschlafen zu können. Vater Barbeau und Landry schritten indessen querfeldeinwärts über Wiesen und Triften rüstig dahin in der Richtung nach la Priche. Als sie auf einer kleinen Anhöhe angelangt waren, von der aus man die Häuser von la Cosse, sobald man auf der anderen Seite hinabsteigt, nicht mehr sieht, blieb Landry stehen und blickte zurück. Das Herz wurde ihm schwer, und er setzte sich auf das Farnkraut nieder, unfähig einen Schritt weiter zu gehen. Sein Vater tat, als ob er nichts bemerke, und setzte die Wanderung fort. Nach einer kleinen Weile rief er den Sohn sanft beim Namen und sprach zu ihm.