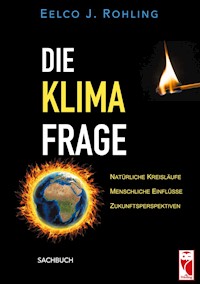
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2015 erreichte der jährliche durchschnittliche Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre erstmals seit drei Millionen Jahren einen Wert von über 400 ppm. Dieser Umstand löste nicht nur bei Klimawissenschaftler:innen kollektive Besorgnis aus, sondern auch bei jenen, die natürliche Klimaschwankungen in prähistorischen Zeiten vor der Einflussnahme des Menschen untersuchen. Diese Menschen sind als Paläoklimatolog:innen bekannt, der Autor des Werkes Eelco J. Rohling is einer von ihnen. Die Klimafrage liefert gut verständliche Hintergrundinformationen zu dieser beunruhigenden Thematik und unterfüttert diese mit anschaulichen Beispielen. Das Werk entstand aus Rohlings drängenden Fragen, ob der moderne Klimawandel nicht nur Teil eines natürlichen Kreislaufes sei, ob die Natur diese Probleme nicht von selbst lösen könne und ob technologische Neuerungen doch nicht als rasches Allheilmittel gegen die klimatischen Missstände ausreichen würden. Das Buch thematisiert in einfacher Sprache weshalb sich das Klima verändert, wie es sich vor der industriellen Revolution auf natürliche Weise veränderte bevor der Mensch als Einflussfaktor an Bedeutung gewann und wie es sich seitdem verändert hat. Im Werk werden das Ausmaß und die Geschwindigkeit der vorindustriellen Schwankungen mit den Werten nach der Industrialisierung verglichen, woraus sich der Einfluss des Menschen ableiten lässt und Prognosen über zukünftige potentielle Entwicklung erarbeitet werden. Schlussendlich evaluiert das Buch, was Mutter Natur eigenständig tun könnte, um mit dem menschlichen Einfluss zurechtzukommen und welche Möglichkeiten wir als Menschen besitzen, ihr dabei zu helfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Mom, Dad, und all die anderen, die mir am Herzen liegen, für ihre Unterstützung, während ich zum Klimawandel geforscht und darüber geschrieben habe. Für meine Mentoren Jan-Willem Zachariasse und Peter Westbroek, die mich von Beginn an auf diesem Weg geleitet haben, und für meine Söhne Ewout und Yarno, voller Hoffnung, dass deren Generation unseren Planeten wieder großartig machen
INHALT
Danksagung
Einleitung
Vergangene Klimata: Wie wir unsere Daten erhalten
2.1 Daten aus dem Eis
2.2 Daten vom Land
2.3 Daten aus den Ozeanen
2.4 Daten über Meeresspiegeländerungen
2.5 Zusammenfassung und Ausblick
Energiebilanz des Klimas
3.1 Die Treibhausgase
3.2 Eine Perspektive ausgehend von Studien über vergangene Klimazonen
3.3 Zusammenfassung und Ausblick
Ursachen des Klimawandels
4.1 Änderungen des Kohlenstoffkreislaufs
4.2 Astronomische Schwankungen
4.3 Große (Super-)Vulkanausbrüche und Asteroideinschläge
4.4 Veränderlichkeit der Sonnenstrahlungsintensität
4.5 Zusammenfassung und Ausblick
Änderungen während des Industriezeitalters
5.1 Direkte Auswirkungen
5.2 Globale Reaktionen und Klimasensitivität
5.3 Meeresspiegeländerung
5.4 Häufige Reaktionen auf die geologische Sichtweise
5.5 Zusammenfassung und Ausblick
Mutter Natur zur Rettung?
6.1 Verwitterung, Wiederaufforstung und Kohlenstoffablagerung
6.2 Voraussetzung für menschliche Eingriffe
6.3 Menschliche Eingriffe bei der Kohlenstoffbeseitigung
Zusammenfassung
Nachwort
Glossar
DANKSAGUNG
Ich bin meiner Familie sehr dankbar dafür, dass sie mein Nichtvorhandensein und die unsoziale Zeit toleriert hat, die ich hinter einem Laptop oder im Traumland in meinem eigenen Kopf verbracht habe. Außerdem danke ich allen Freunden und Kollegen, die mich stets drängten, über die Fachgemeinschaft hinauszugehen, und dann das Projekt mit mir diskutierten, bis die Formalitäten auf das notwendige Maß reduziert waren. Ich werde keine Namen auflisten – ihr wisst alle, wer ihr seid und was ihr beigetragen habt. Ich bin meinen Lektoren, dem Verleger und den Kritikern sehr dankbar für ihre unbezahlbaren Hinweise während des Vervollständigungsprozesses des Manuskripts. Zum Schluss danke ich meinen Eltern und meinem Bruder für ihre uneingeschränkte Unterstützung all meiner Entscheidungen, egal wie irrational sie aussahen, mehr als ein halbes Jahrhundert lang – möge es noch lange so bleiben!
[1]
EINLEITUNG
Im Jahr 2015 überschritt das Jahresmittel des globalen atmosphärischen Kohlendioxidgehalts (CO2) 400 Teile pro Million (ppm; Abbildung 1.1), und wir wissen sehr gut, dass dieser Anstieg durch menschliche Aktivitäten verursacht ist (Abbildung 1.2). Es war das erste Mal nach drei Millionen Jahren, dass solch ein Niveau erreicht worden war. Das Überschreiten dieses Gehalts hat eine weit verbreitete Besorgnis unter Klimawissenschaftlern und nicht zuletzt unter den sogenannten Paläoklimatologen hervorgerufen, die auf dem Gebiet natürlicher Klimaschwankungen zu prähistorischen Zeiten, noch vor dem Menschenzeitalter, arbeiten.
Während der letzten Jahrzehnte haben Forscher wiederholt davor gewarnt, dass CO2-Emissionen, zusammen mit Emissionen anderer Treibhausgase, dabei seien, gefährlich außer Kontrolle zu geraten und dass dringende Abhilfemaßnahmen benötigt würden. Mit der Überschreitung der 400-ppm-Schwelle hat dieser Handlungsdruck einen Höhepunkt erreicht: Bei dem „Conference of Parties 21“-Treffen in Paris – auch bekannt als COP21 oder „2015 Paris Climate Conference“ – wurde eine weitgehende internationale politische Einigung erreicht, um die globale Erwärmung auf ein Maximum von 2°C, und zum Ende dieses Jahrhunderts möglichst auf 1,5°C, zu beschränken. Wenn man dies ausrechnet, schließt dies eine gesellschaftliche Verpflichtung ein, bereits lange vor 2050 mit Null-Netto-Kohlenstoffemissionen zu arbeiten – einhergehend mit der Entwicklung und großskaligen Anwendung von Methoden der CO2-Entfernung im Klimasystem. (Wissenschaftler konzentrieren sich auf Kohlenstoffemissionen (C), wenn sie über Emissionen sprechen, da dies bei der Berechnung von CO2- Änderungen hilft, die durch die Bearbeitung bestimmter Volumen/Massen von fossilen Brennstoff-Kohlenwasserstoffen erzeugt werden.) Natürlich ist die Herausforderung enorm, zumal es, selbst, wenn alle seit der COP21 getroffenen Zusagen umgesetzt würden, der Erwärmung immer noch erlauben würde, etwa 3°C bis zum Jahr 2100 zu erreichen. Aber dessen ungeachtet war die Übereinstimmung bahnbrechend. Es war ein Zeichen der Hoffnung, des Optimismus und internationaler Motivation, den Klimawandel in Angriff zu nehmen.
Abbildung 1.1. Historische Änderungen klimatischer Schlüsselfaktoren. Unten: Jahresmittel der globalen CO2-Gehalte (i). Oben: Durchschnittliche globale Oberflächentemperatur (ii). Im Temperatur-Schaubild zeigt die dicke Linie die langfristige Änderung bei Glättung kurzfristiger Schwankungen. Die Temperatur-Entwicklungen im Laufe der Zeit sind hochgradig ähnlich zwischen sechs unabhängigen Begutachtungen, von denen einige Daten von 1850 an einschließen (iii).
i. https://www.co2.earth/historical-co2-datasets
ii. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
iii. http://berkeleyearth.org/global-temperatures-2017/
Darüber hinaus gibt es Bedenken über die festgelegten COP21-Ziele. Erstens mögen die vorgeschlagenen 2°C- oder 1,5°C-Grenzen für die Vermeidung „gefährlicher“ Klimafolgen gut klingen, aber es gibt keine genaue wissenschaftliche Grundlage, speziell diese Zahlenwerte auszuwählen (Notiz 1). Zweitens, die implizierte „Ende des Jahrhunderts“-Fristsetzung ist ein willkürlicher Zeitpunkt. Es ist nicht so, als ob die laufenden Klimaänderungen zu dieser Zeit stoppen werden, selbst wenn es uns gelänge, alle Emissionen zu stoppen. Stattdessen wird sich die Änderung fortsetzen, da sich bekannte langsame Vorgänge im Klimasystem an die ursprünglichen Störungen anpassen, die in der jüngsten Geschichte beobachtet wurden (Abbildung 1.1). Diese langsamen Prozesse schließen die Erwärmung der Ozeane (zuerst der Oberfläche, dann auch der Tiefsee), was viel mehr Zeit als die Erwärmung über Landmassen benötigt, sowie den Rückgang der globalen Kontinentaleismassen und der Vegetationsänderungen ein.
iv. BP statistical review of world energy, June 2017. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/ corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-worldenergy-2017-full-report.pdf
v. Hansen, J., Kharecha, P., Sato, M., Masson-Delmotte, V., Ackerman, F., Beerling, D., Hearty, P.J., Hoegh-Guldberg, O., Hsu, S.-L., Parmesan, C., Rockstrom, J., Rohling, E.J., Sachs, J., Smith, P., Steffen, K., Van Susteren, L., von Schmuckmann, K., and Zachos, J.C., Assessing „dangerous climate change“: Required reduction of carbon emissions to protect young people, future generations and nature. PLoS ONE, 8, e81648, doi:10.1371/journal.pone.0081648, 2013.
Gleich einem mächtigen Güterzug, der langsam Fahrt aufgenommen hat, werden diese langsamen Prozesse über Zeiträume von Jahrhunderten bis zu Jahrtausenden fortfahren sich zu entfalten, und dabei verursachen, dass die gesamte globale Erwärmung viele Jahrhunderte lang weiterhin zunimmt. Zum Beispiel verursachen langsam ansteigende Temperaturen der Ozeane – die etwa siebzig Prozent der Erdoberfläche bedecken –, dass die globale Durchschnittstemperatur dahin kriecht, während die allmähliche Reduzierung des Eisvolumens dafür sorgt, dass der Planet langsam aber sicher einfallendes Sonnenlicht weniger reflektiert und dadurch weitere Erwärmung verursacht. Vegetationsveränderungen beeinflussen auch das Erdrückstrahlvermögen, sowie den natürlichen Kohlenstoffaustausch mit der Atmosphäre und so weiter. Was wir hier sehen, ist, dass das Klimasystem ein komplexes Biest ist, das Atmosphäre, Ozean und Biosphäre und all die Austauschprozesse zwischen ihnen einschließt. Über noch längere Zeiträume hat das Klimasystem sogar wichtige Austauschprozesse mit ozeanischen Sedimenten, durch Ablagerungen entstandenen Felsen und vulkanischen Prozessen.
Wegen der langsamen Vorgänge wird sich jede Klimareaktion gemessen am Jahr 2100 über die folgenden Jahrhunderte grob verdoppeln, selbst wenn es keine weiteren Emissionen geben würde (Notiz 2). Um die längerfristige Erwärmung unter 2°C zu halten, müssten wir deswegen die Erwärmung auf maximal 1°C bis 2100 begrenzen. Übrigens haben wir den 1°C-Wert bereits 2015 überschritten (relativ zum vorindustriellen Wert; Abbildung 1.1) und fortlaufende Treibhausgasemissionen sowie globale Reduzierungen partikularer Luftverschmutzung werden uns wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrzehnte über den 2°C-Schwellenwert treiben, (Notiz 3). Es scheint, wollen wir wirklich die vereinbarten COP21-Ziele erreichen, dann wird die Kohlenstoffentfernung aus dem Klimasystem unerlässlich sein. Dies könnte mittels natürlicher Prozesse, künstlicher (menschengemachter) Prozesse oder mittels beider zusammen erreicht werden.
Dieses Szenario veranschaulicht, wie viel von der Klima-Debatte in einer sehr einfachen Frage zusammengefasst werden kann: Was entscheidet über natürliche Klimakreisläufe und was kann die Natur in Zukunft tun, versus, was ist die menschliche Einwirkung aufs Klima, und was können wir in Zukunft tun?
Dieses Buch untersucht die Frage aus einer wissenschaftlicher Perspektive auf vergangene Klimata bzw. aus einer paläoklimatischen Forschungsperspektive heraus. Paläoklimatische Forschung ist wesentlich für das Verständnis darüber, was Natur tun kann. Konkret ausgedrückt, benötigen wir paläoklimatische Forschung, um die längerfristigen Folgen von CO2-Gehalten von 400 ppm und mehr zu sehen, da man bis zu drei Millionen Jahre zurückgehen muss, um eine frühere Periode mit solch hohen CO2-Gehalten zu finden. Zusätzlich wirft diese Forschung Licht auf das Ausmaß der gegenwärtigen Problematiken bezüglich Änderungen, die sich ereigneten, bevor es Menschen gab – mit anderen Worten, sie offenbart den Zusammenhang mit natürlichen Kreisläufen, die von menschlichen Einwirkungen überlagert sind. Und schließlich helfen uns paläoklimatische Studien zu verstehen, in welchem Umfang uns die Natur mit der Kohlenstoffentfernung helfen oder nicht helfen kann, indem sie deren zahlreiche diesbezügliche Prozesse sowie deren Handlungszeiträume offenlegen. Auf diese Weise liefern paläoklimatische Studien wichtige Informationen über den Umfang der Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen.
Ich habe etwa dreißig Jahre lang in der Paläoklimatologie gearbeitet, und meine Geschichte ist eine, die die meisten meiner Kollegen wiedererkennen werden. Sobald wir erwähnen, dass wir am Klimawandel aus einer Perspektive von Änderungen arbeiten, die stattfanden, lange bevor der Mensch die Bühne betrat, sind wir einer Flut von Fragen ausgesetzt. Meistens scheinen diese Befragungen darauf abzuzielen, Bestätigungen zu drei in enger Beziehung zueinander stehenden Äußerungen zu erhalten. Diese sind (1), dass Menschen unmöglich das globale Klima ändern können; (2), dass all das, was heute passiert, nur Teil eines natürlichen Zyklus ist; und (3), dass, selbst wenn wir etwas Einfluss hätten, die Natur größere Klimazyklen durchgemacht hat und daher das Problem auf irgendeine Weise lösen wird.
Für mich scheinen diese Fragen auf einer Annahme oder Hoffnung zu basieren, dass sich die Dinge irgendwie von selbst lösen werden. Aber es ist schwierig, genaue Antworten bezüglich der Grundlage dieser Annahme zu erhalten. Es scheint große Verwirrung in den Köpfen darüber zu herrschen, welche Prozesse eine Rolle spielen, wie stark und schnell sie wirken, wie sie zusammenarbeiten und in welchem Größenverhältnis der menschliche Einfluss relativ zu diesen Prozessen steht.
Die erste Quelle der Verwirrung scheint zu sein, dass die Welt solch ein großer Ort ist, dass sich die Bevölkerung nicht vorstellen kann, dass Menschen auch nur vorgeben könnten, sie weltweit zu beeinflussen. Aber dies ist eindeutig ein Fehler. Mit einiger Überlegung werden die meisten verstehen, dass wir einen Rekord an Beeinträchtigung einiger grundsätzlicher Fragen auf globaler Ebene haben. Und für manche von ihnen hat die Erkenntnis, dass dies der Fall ist, zu erfolgreichen Handlungen zur Behebung der Schäden geführt. Ein gutes Beispiel betrifft stratosphärische Ozonkonzentrationen, die infolge der Freisetzung von Kühlmitteln und Gasen, die Spritzmittel unter Druck setzen, reduziert wurden, und unsere UV-Belastung und damit das Risiko von Hautkrebs vergrößerten. Sowie dies erkannt war, wurden weltweite Abhilfemaßnahmen vereinbart und die Situation ist nun dabei, sich zu verbessern. Ein anderes Beispiel ist kommerzieller Walfang. Sowie erkannt war, dass bald kein Wal mehr in den Weltmeeren übrig sein würde, wurden breit gefächerte internationale Maßnahmen unternommen, und nun ist die Zahl der Wale dabei, sich langsam zu erholen. Und dann gibt es den Fall von Bleiverunreinigung durch Zusatzstoffe in Benzin und Lacken. Sowie dies als Problem erkannt war, wurden Alternativen entwickelt und nun ist Bleiverunreinigung stark reduziert. Wenn Sie darüber nachdenken, dann werden Sie mehr gute Beispiele finden, viele mit dem Nachweis, dass kollektive internationale Maßnahmen zu Verbesserungen führen können und werden. Warum sollte es mit dem Klima anders sein?
Eine zweite Ursache für die Verwirrung scheint zu sein, dass die meisten Leute unseren menschlichen Einfluss nicht im richtigen Zusammenhang mit natürlichen Änderungen sehen können. Sie wissen nahezu intuitiv, dass die Natur – vor dem Menschenzeitalter – durch viel größere Extreme gegangen ist als die, über die wir hinsichtlich des modernen Klimawandels sprechen, von Eiszeiten bis hin zu den warmen Klimata mit dichter Vegetation zur Zeit der Dinosaurier. Aber der nächste Schritt, ein Gefühl zu entwickeln für die Relevanz unseres menschlichen Einflusses im Zusammenhang mit diesen weitreichenden natürlichen Änderungen, verlangt einiges an Studium und Mathematik.
Unglücklicherweise sind viele der Kernaussagen, die gründlich studiert werden müssen, breit gestreut in der Literatur, obgleich viele gute Zusammenfassungen mit einiger Mühe gefunden werden können. Die meisten Leute fühlen sich auch – was sehr wichtig ist – unzureichend qualifiziert oder haben einfach nicht den Ehrgeiz, nachzurechnen. Vieles davon kommt daher, dass sich ein Mythos entwickelt zu haben scheint, dass man hochentwickelte Klimamodelle benötigt und alles haargenau verstehen muss, bevor eine sachkundige Meinung erreicht werden kann. Dies ist einfach nicht wahr, solange das Ziel ist, lediglich ein gutes Gefühl für unseren Einfluss zu bekommen (es ist dagegen wahr, wenn auf genaue Vorhersagen abgezielt wird). Das Thema mag im Detail hochkomplex sein, aber das große Ganze ist recht überschaubar. Die meisten Rechnungen, die für einen angemessenen Eindruck benötigt werden, sind nicht komplizierter als jene, die notwendig sind, um die Haushaltskasse auszugleichen.
Aus der Erfahrung bei Feiern, Meetings, Flügen, Zugfahrten und Interviews habe ich gelernt, dass die meisten Leute recht entspannt sind bei einfachen Rechnungen, die das Hauptanliegen eines Arguments zusammen mit einfachsten Schaubildern und Diagrammen illustrieren, die ich für gewöhnlich auf Papierservietten und -tischdecken zeichnete (und einmal auf eine hochwertige Textilserviette). Ich habe lange in Erwägung gezogen, diese Argumente in einem Text auszubreiten, der allen zugängig ist, die offen für eine kleine Herausforderung sind. Es brächte eine Reihe von Aspekten in einen zusammenhängenden, beispielreichen Ablauf und vermiede Details. Dieses Buch ist das Ergebnis.
Die allgemeine, überblicksartige Annäherung, die ich in diesem Buch vornehme, steht ein wenig im Konflikt mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund. Details, Vorbehalte und Ungewissheiten sind wesentliche Grundlage für Studenten und Experten in diesem Gebiet. Folglich haben wir uns daran gewöhnt, diese über all unsere Kommunikationswege zu verbreiten. Aber im Alltag trüben sie nur die Aussage. Die meisten von uns erfassen das Konzept von Motorflügen hinreichend genug, um sich einer Flugreise erfreuen zu können, ohne die verwendete Flugelektronik und die Aerodynamik zu verstehen, und wir überlassen dies gerne den Piloten und Ingenieuren. Auf ähnliche Weise kann sich jeder durch einfache Darstellung des großen Ganzen eine vernünftige und sachkundige persönliche Meinung über die aktuelle Lage des Klimas bilden.
Das große Ganze bezieht sich auf den Zusammenhang von in der Realität gemachten Beobachtungen, die den gesamten Fall und dessen besondere Tragweite unmittelbar darstellen. Dies ist das Niveau, das ich hier suche, während ich die Verwechslung von Modellen und deren verschiedener wissenschaftlicher Grundlagen und Annahmen vermeide, trotz der Tatsache, dass sie absolut notwendig für technische Argumentationen sind. Daher stützt sich dieses Buch stark auf Beobachtungen der Erdgeschichte, die die meisten Menschen intuitiv nachvollziehen können. Es unterrepräsentiert das tiefe Prozessverständnis, das von der Klimamodellierung herrührt, da diese Detailgenauigkeit hier nicht benötigt wird. Dies ist lediglich eine pragmatische Entscheidung – wie man zu sagen pflegt: „Für jeden Topf den richtigen Deckel.“
Dieses Buch zielt darauf ab, den Leser die ganze Reise hindurch zu führen: Von ersten Grundlagen über zentrale Prozesse und langfristigen Beobachtungskontext bis hin zu Auswirkungen. Es gibt viele Texte, die einen oder mehrere dieser Aspekte abdecken, aber nicht viele umfassen die ganze Reise in einer präzisen Weise, ohne zu viele Vorbehalte und Details. Und immer noch wütet die Klimadebatte weiter – und die alten Argumente über die natürliche Veränderlichkeit treten weiterhin auf.
Hier ist also mein Versuch, Sie die ganze Reise hindurch mit leicht verständlichen Ausdrücken, mit minimalen Verkomplizierungen zu führen. Ich füge Diagramme hinzu, die sich, – ähnlich meinen Argumenten – bewusst nur auf die Hauptpunkte konzentrieren, um diese den Diagrammen gemäß zu gestalten, die ich zur Unterstützung meiner Argumente oft auf Servietten zeichne. Ich untermauere den Text und die Diagramme mit Quellenangaben zu anderswo veröffentlichter wissenschaftlicherer und vollständigerer Informationen.
Mein Ziel ist es, Sie, den Leser, zu befähigen, Ihre eigenen sachkundigen Entscheidungen darüber zu fällen, ob wir Maßnahmen hinsichtlich der Treibhausgasemissionen ergreifen müssen. Ich hoffe, dieses Buch wird in einfachen Ausdrücken und mit Beispielen die notwendigen Hintergrundinformationen liefern, um Sie davon zu überzeugen.
Mir persönlich ist klar, dass wir eine kritische Zeit erreicht haben, um Maßnahmen zur Veränderung unserer Gesellschaft zu ergreifen – um unsere Kohleabhängigkeit zu überwinden. Zukünftige Generationen könnten uns weiterhin als umweltschädigende Dinosaurier betrachten, aber ich hoffe, es werden die letzten Menschen sein, die schließlich realisierten, was passieren würde und Maßnahmen ergriffen, um es zu verhindern. Lassen Sie uns schauen, ob Sie am Ende dieses Buches mit mir übereinstimmen oder nicht. Zumindest werden die Argumente für alle sichtbar transparent aufgeführt sein.
Das zentrale Thema, dem wir uns zuwenden werden, ist der wissenschaftlich unbestrittene globale Temperaturanstieg von ungefähr 1°C seit Beginn der Industriellen Revolution vor mehr als 150 Jahren, wobei sich die meiste Erwärmung auf die letzten sechs Jahrzehnte konzentriert (Abbildung 1.1). Mehrere unabhängige Kontrollen der globalen Temperaturänderung stehen in enger Abstimmung (Notiz 4, und iii von Abbildung 1.1), und alle zeigen nahezu Jahr für Jahr rekordverdächtige Hitze in den letzten vier Jahren. Das Jahr 2016 übertraf alle vorhergehenden Jahre weit, dicht gefolgt von den Jahren 2017 und 2015 (Abbildung 1.1). Es lässt sich nicht leugnen, dass es einen starken Erwärmungstrend gibt, obgleich die Erderwärmung mal stagnieren, mal schneller fortschreiten mag wegen Schwankungen der Wärmeverteilung zwischen Atmosphäre und Ozean. Beim Vergleich dieses starken Trends mit CO2-Änderungen über dasselbe Zeitintervall (Abbildung 1.1) ist es einfach, voreilige Schlüsse zu ziehen. Lassen Sie uns das vermeiden: Unser Ziel hier ist es, uns eine unvoreingenommene persönliche Meinung zu bilden. Hierfür werden wir die grundlegenden Abläufe des Klimasystems betrachten und daraus ableiten, was passieren könnte, warum dies der Fall sein könnte, was wir dagegen tun könnten und ob die Natur irgendwelche Mechanismen bereithält, die uns bei der Lösung helfen könnten.
Angesichts der Tatsache, dass paläoklimatische Rekonstruktionen nichts sind, was einem jeden Tag begegnet, beginne ich mit einem Kapitel über die grundlegenden Techniken, die in diesem Wissenschaftszweig verwendet werden.
Dann nähern wir uns dem Problem des Klimawandels über erste Prinzipien an, indem wir die Energiebilanz der Erde betrachten (wieviel Energie kommt hinein gegenüber wieviel geht hinaus), was letztendlich die Oberflächentemperatur des Planeten bestimmt.
Es folgt ein Blick aus einer natürlichen Perspektive auf die Haupttriebkräfte der Änderung in der Energiebilanz der Erde. Wir werden sehen, dass Treibhausgase wie CO2 und Methan (CH4) zwangsläufig bestimmend in dieser Debatte sind.
Dem folgt eine Diskussion darüber, warum sich Klimaänderungen vor menschlicher Aktivität ereignet haben, wie umfangreich diese Änderungen waren, wie schnell die Änderungen stattfanden und wie sich das System erholte. Dies hilft uns zu verstehen, wie schnell natürliche Prozesse jegliche Treibhausgas- und Klima-Probleme „reparieren“ könnten.
Dann schauen wir, was wir über menschliche Einflüsse wissen. Woher wissen wir, dass heutige Treibhausgaszunahmen von uns verursacht worden sind statt Teil eines natürlichen Zyklus zu sein? Wie stark werden sie das Klima beeinflussen? Wie schnell ist der menschliche Einfluss im Verhältnis zu natürlichen Zyklen? Kann die Natur die menschliche Einwirkung verkraften? Kurz, unter der Voraussetzung, dass ein verbessertes Verständnis natürlicher Zyklen vorhanden ist, lautet die zielgerichtete Frage: Scheint es wahrscheinlich zu sein, dass wir nur Teil eines natürlichen Zyklus sind und dass die Natur uns irgendwie retten und dem Problem entgegenwirken kann?
Am Ende eines jeden Kapitels wird ein kurzer Abschnitt stehen, der die Kernpunkte als Grundlage für das nächste Kapitel zusammenfasst.
[2]
VERGANGENE KLIMATA
Wie wir unsere Daten erhalten
De facto ist die Forschung zu vergangenen Klimata bekannt als Paläoklimatologie, und die Forschung zu Ozeanen der Vergangenheit als Paläoozeanographie. Aber sie stehen in sehr dichter Beziehung, und wir werden beide kombiniert diskutieren unter dem Ausdruck Paläoklimatologie. Innerhalb der Paläoklimatologie sind die Interessen auf drei Kernbereiche verteilt.
Der erste Bereich befasst sich mit der Datierung von Nachweisen aus sehr entfernter Vergangenheit und wird als chronologische Studien bezeichnet. Diese Studien sind grundlegend, weil alle Aufzeichnungen vergangener Klimaänderung erfordern, so genau wie möglich datiert zu werden, um sicherzustellen, dass wir wissen, wann sich die untersuchten Klimaänderungen ereigneten, wie schnell sie waren und ob in verschiedenen Komponenten des Klimasystems gesehene Änderungen sich zur selben Zeit oder zu unterschiedlichen Zeiten ereigneten.
Der zweite Bereich befasst sich mit Beobachtungsstudien, wobei die Beobachtungen unterschiedlicher Art sein können. Einige sind direkte Messungen; zum Beispiel Sonnenflecken-Zählungen oder Temperaturaufzeichnungen. Einige sind historisch, schriftliche Aufzeichnungen empirischer Belege wie Berichte über häufiges Vorkommen von gefrorenen Flüssen, Fluten oder Trockenzeiten. Solche Aufzeichnungen sind sehr lokal und oft subjektiv und taugen daher für gewöhnlich nicht als Hauptbelege. Aber sie können große Unterstützung und Bewertung zu Rekonstruktionen anhand anderer Hilfsmittel bieten.
Neben direkten und vereinzelten Daten begegnen wir dem vorherrschenden Nachweis-Typ, der in diesem Wissenschaftszweig Anwendung findet. Dies sind die sogenannten Proxy-Daten oder Proxies. Proxies sind indirekte Messungen, die sich Änderungen in wichtigen Klima-System-Variablen wie Temperatur, CO2-Konzentrationen, Nährstoffkonzentrationen und so weiter annähern (daher die Bezeichnung Proxy). Dieses Kapitel beschreibt kurz einige der wichtigsten Proxies.
Der dritte Bereich innerhalb der Paläoklimatologie befasst sich mit Modellierung. Es benutzt numerische Modelle für Klimasystem-Simulationen und einfachere Kategorien der sogenannten Box-Modelle. Numerische Klimamodelle erstrecken sich von Erdsystem-Modellen, die relativ ungenau sind und deswegen eingesetzt werden können, um Simulationen viele Tausende Jahre lang durchzuführen, bis hin zu sehr komplexen und verfeinerten gekoppelten Modelle, die rechnerisch sehr aufwendig sind und so sehr detaillierte aber nur für kurze Zeitintervalle geeignete Simulationen liefern. Box-Modelle sind viel einfacher und schneller durchzuführen und sie werden am meisten für die Modellierung von Kohlekreisläufen genutzt oder von anderen geochemischen Eigenschaften.
Die verschiedenen Bereiche innerhalb der Paläoklimatologie ergänzen einander und stehen in ständiger Wechselwirkung: Modellergebnisse werden zu den eigentlichen Daten in Bezug gesetzt, und Interpretationen von Beobachtungen werden mit Hilfe von Modellen auf physikalische Stimmigkeit untersucht. Oft sind dort mehrere solcher Zyklen einbezogen, von der ersten Entdeckung von etwas bis zur Präsentation überzeugenderer Rekonstruktionen. Auf diese Weise dringt der Wissenschaftszweig in seiner Erkenntnis allmählich vorwärts. Während der letzten fünfzig bis sechzig Jahre hat der Wissenschaftszweig die Mechanismen hinter dem großen Ganzen der Änderung in vergangenen Klimata erfolgreich identifiziert. Die Arbeit an Verbesserungen und präzisen Verfeinerungen geht weiter.
Die Arbeit wird gemäß einer etablierten Tradition durchgeführt, bei der Ausgangshypothesen formuliert und anschließend kritisch getestet und geprüft werden. Die ursprünglichen Hypothesen werden auf diese Weise abgelehnt oder akzeptiert. Dann folgen Formulierungen neuer Hypothesen, wenn die ursprünglichen abgelehnt wurden oder die Ausgangshypothesen werden verfeinert und auf den neuesten Stand gebracht. Dann startet dieser Arbeitsablauf erneut. Dies ist der normale Vorgang, durch den die Wissenschaft in einer sorgfältigen, kontrollierten und selbstkritischen Weise voranschreitet.
In diesem Buch will ich Modellergebnisse nicht besonders erörtern. Dies sollte nicht als ein Zeichen verstanden werden, dass Modellbildung nicht wichtig sei. Diese Schlussfolgerung würde ein schwerwiegender Fehler sein. Modellbildung ist wesentlich um zu verstehen, wie das System arbeitet, da Modelle physikalisch und chemisch auf viel konsequentere Weise gleichbleibend sind als Interpretationen einzelner Beobachtungen. Aber Modelle können für Nicht-Fachleute auch sehr verwirrend sein wegen der großen Vielzahl an Modellen, die existieren, alle mit verschiedenen Leistungsfähigkeiten und Einschränkungen. Darum habe ich mich dazu entschieden, meine Erläuterungen zu machen, indem ich nur einfache Zahlen nutze und Bezug auf relevante vergangene (Proxy-)Beobachtungen nehme, die sich bewährt haben. In Wirklichkeit, sind viele der Konzepte und Interpretationen, die ich erörtern will, parallel zu beobachtungsbasierter aus modellbasierter Forschungsarbeit hervorgegangen und wurden dadurch verfeinert. Der Weg, den ich gewählt habe, um die Dinge anzugehen, ist einfach, transparent und verständlich zu bleiben. Jede weiterführende Literatur wird sofort erfordern, in Modellstudien einzutauchen. Außerdem bezieht sich meine Hervorhebung empirischer Nachweise (Daten und Proxy-Daten) auf die häufig geäußerte Bemerkung „zeige mir die Daten.“
In diesem Kapitel gebe ich einen Überblick über die Hauptmethoden, durch die wir Daten über Ozeane der Vergangenheit und vergangene Klimata erhalten. Die Auflistung ist nicht vollständig, da es viel mehr an wichtigen Methoden gibt, aber die wichtigsten Herangehensweisen werden präsentiert. Ich umgehe historische Messungen und schriftliche Nachweise von Klimaänderung. Letzten Endes ist für alle recht offensichtlich, wie lange Temperaturmessungs-Zeitreihen der Admiralität oder eines meteorologischen Dienstes erhalten worden sein könnten und wie sie genutzt werden könnten, um etwas über historische Klimazustände zu sagen. Stattdessen konzentriere ich mich auf Proxy-Aufzeichnungen über längere Zeiträume, da sie unsere Erkenntnisse über vergangene Klimata in vorhistorischer Zeit formen.
Die natürlichste Unterteilung von Proxy-Aufzeichnungen für vergangene Klimaänderung ist bezüglich der besonderen Lage (a) aus dem Eis; (b) vom Land; (c) aus den Ozeanen. Ich füge aus zwei Gründen einen speziellen Abschnitt für Rekonstruktionen des Meeresspiegels und des globalen Eisvolumens hinzu. Erstens, weil das Eisvolumen solch ein kritisches Maß des Klimazustands ist und zweitens, weil ich es so mag. Dies ist es, woran ich jeden Tag arbeite.
2.1 DATEN AUS DEM EIS
Die großen kontinentalen Eisschilder in Grönland und der West- und Ost-Antarktis haben lange genug existiert, um relativ ungestörte Aufzeichnungen zu liefern, die sich über sehr lange Zeitspannen erstrecken. Bohrkerne aus dem Grönland-Eisschild haben hochwertige kontinuierliche Klimaaufzeichnungen ergeben, die sich vom gegenwärtigen Tag bis in die Zeit vor nahezu 125 000 Jahren erstrecken. Was die West-Antarktis betrifft, gehen solche Aufzeichnungen etwas weniger als das zurück. Bei der Ost-Antarktis reichen die Aufzeichnungen 800 000 Jahre oder sogar eine Million Jahre zurück (Abbildung 2.1).
Es war für eine sehr lange Zeit von in Eis und Schnee gegrabenen Löchern bekannt gewesen, dass es dort eine deutliche Schichtung gibt, die aus jahreszeitlichen Zyklen der Schneeanhäufung resultiert. Das Gewicht von sich neu anhäufendem Schnee presst ältere Schichten in eine viel kompaktere Form, zunächst Firn und dann Eis genannt. In dem Maße, in dem der Druck tiefer und tiefer im Eisschild zunimmt, werden die jährlichen Schichten dünner und dünner zusammengepresst, bis die unteren Teile der Schichten zu dünn sind, um ausgemacht zu werden.
Wo die verschiedenen Schichten in Eiskernen, die die ganze Dicke (mehrere Kilometer) des Inlandeises durchbohrt haben, erkannt und gezählt werden können, geben sie den Eiskernen sehr genaue Alterseinteilungen, ein wenig wie beim Zählen von Baumringen, aber dann als ein Hinunterzählen von Jung zu Alt. In den unteren Bereichen der Eiskerne, wo die jährliche Schichtung nicht länger erkannt werden kann, wird eine andere Annäherung benötigt. Hier kommt die Eis-Modellbildung ins Spiel. In den oberen Bereichen sind die Eismodelle auf die bestimmten Wiederholungsmuster der Schichten abgestimmt und dann werden sie weiter unten für eine Erweiterung der Altersskala über dem Bereich angewandt, wo die Schichtung nicht länger erkennbar ist. Die Datierung der unteren Teile hat größere Unsicherheitsfaktoren zum Ergebnis als die Datierung in dem Intervall, wo es die Schichtung gibt. Es gibt für diese Anwendung viele unterstützende Techniken wie die Nutzung von Asche-Überbleibseln, gefangen im Eis aus datierten vulkanischen Ereignissen, und der Gebrauch der Aufzeichnungen bestimmter elementarer Isotope, die unter der Wechselwirkung von kosmischer Strahlung mit der oberen Atmosphäre der Erde gebildet werden. Weitere Informationen über diese technischen Methoden erhält man am besten in der geeigneten Fachliteratur (Notiz 6).
In Firn und Schnee gibt es Lufttaschen, die sich weiterhin mit der Atmosphäre austauschen. Aber durch das zusammengedrückte Eis werden die Lufttaschen isoliert und können sich nicht länger mit der Atmosphäre austauschen. Innerhalb des Eises gibt es daher Blasen, die wie Miniatur-Zeitkapseln die konservierte Atmosphäre einer längst vergangenen Zeit enthalten. Diese Blasen können analysiert werden, um detaillierte Daten über vergangene atmosphärische Zusammensetzungsänderungen zu erhalten, einschließlich vergangener Konzentrationen von CO2 und CH4 (Abbildung 2.1) (Notizen 7, 8, 9, 10).
Abbildung 2.1. Wesentliche Klimaindikatoren für die vergangenen 800.000 Jahre. Unten: CO2-Schwankungen während der Eiszeit-Zyklen der letzten 800 000 Jahre, gemessen in eingefangenen Luftbläschen in Eiskernen der Antarktis und der extrem schnelle Anstieg auf 400 ppm seit dem Beginn der Industriellen Revolution (i,ii,iii,iv,v,vi). Erstes Schaubild darüber: Antarktische Temperaturänderungen in Bezug zur Vorindustrialisierung (vii,viii). Zweites Schaubild darüber: Globale Temperaturänderungen vor der Industrialisierung (ix). Oberstes Schaubild: Meeresspiegeländerungen in Bezug zur Vorindustrialisierung (schattiert die Rote-Meer-Methode meiner eigenen Gruppe (x); die durchgehende Linie basiert auf Tiefsee-Isotopen (xi)). Einige Altersunterschiede zwischen Aufzeichnungen kann es als Resultat verschiedener Datierungsmethoden geben. Wo grau schattierte Streifen vorliegen, repräsentieren diese 95 Prozent Vertrauensintervalle; in anderen Worten zeigen sie, wie gut wir das Signal kennen. Einige Studien, wie im obersten Schaubild, versäumen es, diese zu erwähnen.
i. Monnin, E., Indermühle, A., Dällenbach, A., Flückiger, J., Stauffer, B., Stocker, T. F., Raynaud, D. und Barnola, J. M.: Atmospheric CO2 concentrations over the last glacial termination. Science, 291, 112-114, 2001.
ii. Monnin, E., Steig, E. J., Siegenthaler, U., Kawamura, K., Schwander, J., Stauffer, B., Stocker, T. F., Morse, D. L., Barnola, J. M., Bellier, B., Raynaud, D. und Fischer, H.: Evidence for substantial accumulation rate variability in Antarctica during the Holocene, through synchronization of CO2 in the Taylor Dome, Dome C and DML ice cores. Earth and Planetary Science Letters, 224, 45-54, 2004.
iii. Schmitt, J., Schneider, R., Elsig, J., Leuenberger, D., Lourantou, A., Chappelaz, J., Köhler, P., Joos, F., Stocker, T. F., Leuenberger, M. und Fischer, H.: Carbon isotope constraints on the deglacial CO2 rise from ice cores. Science, 336, 711-714, 2012.
iv. Schneider, R., Schmitt, J., Koehler, P., Joos, F. und Fischer, H.: A reconstruction of atmospheric carbon dioxide and its stable carbon isotopic composition from the penultimate glacial maximum to the last glacial inception. Climate of the Past, 9, 2507-2523, 2013.
v. Landais, A., Dreyfus, G., Capron, E., Jouzel, J., Masson-Delmotte, V., Roche, D. M., Prié, F., Caillon, N., Chappellaz, J., Leuenberger, M. und Lourantou, A.: Two-phase change in CO2, Antarctic temperature and global climate during Termination II. Nature Geoscience, 6, 1062-1065, 2013.
vi. Ahn, j. und Brook, E. J.: Siple Dome ice reveals two modes of millennial CO2 change during the last ice age. Nature Communications, 5, 3732, doi:10.1038/ncomms4723, 2014.
vii. Stenni, B., Masson-Delmotte, V., Selmo, E., Oerter, H., Meyer,H., Röthlisberger, R., Jouzel, J., Cattani, O., Falourd, S.,Fischer, H. und Hoffmann, G.: The deuterium excess records of EPICA Dome C and Dronning Maud Land ice cores (East Antarctica), Quaternary Science Reviews, 29, 146-159, 2010.
viii. Parrenin, F., Masson-Delmotte, V., Köhler, P., Raynaud, D., Pullard, D., Schwander, J., Barbante, C., Landais, A., Wegner, A und Jouzel, J.: Synchronous change of atmospheric CO2 and Antarctic temperature during the last deglacial warming. Science, 339, 1060-1063, 2013.
ix. Snyder, C. W.: Evolution of global temperature over the past two millions years. Nature, 538, 226-228, 2016.
x. Grant, K. M., Rohling, E. J., Bronk Ramsey, C., Cheng, H., Edwards, R. L., Florindo, F., Helop, D., Marra, F., Roberts, A. P., Tamisiea, M. E. and Williams, F.: Sea-level variability over five glacial cycles. Nature Communications, 5, 5076, doi: x.1038/ncomms6076, 2014.
xi. Spratt, R. M. und Lisiecki, L. E.: Late Pleistocene sea level stack. Climate of the Past, 12, 1079-1092, 2016.
Mittlerweile kann auch das Eis selbst analysiert werden und drei seiner Eigenschaften haben besondere Wichtigkeit. Die ersten zwei sind bekannt als Sauerstoffisotopenverhältnis und Wasserstoffisotopenverhältnis von gefrorenen Wassermolekülen. Isotope irgendeines Elements sind dahingehend erkennbar unterschiedlich, als dass sie dieselbe Anzahl von Protonen in ihrem Kern haben, aber unterschiedliche Neutronenzahlen. Moleküle (wie H2O) zusammengesetzt aus verschiedenen Isotopen haben daher ganz kleine unterschiedliche Massen. Trotz der winzigen Unterschiede in der Masse, Moleküle mit gewissermaßen leichteren Isotopen sind ein wenig reaktiver als jene mit gewissermaßen mächtigeren Isotopen. Infolge solcher Effekte während Kondensation oder Gefrieren von Wolken-Wasserdampf, um Schnee (Eis) zu bilden, sind die Wasserstoffisotopenänderungen hinlänglich verstandene Aufzeichner der Temperatur, bei der sich der Schnee bildete. Als ein Ergebnis davon geben uns Zeitreihen von Sauerstoff- und Wasserstoffisotopenanalysen von Eiskernen einen detaillierten Einblick in die Änderungen der polaren Temperaturen durch die Zeit (Abbildung 2.1).
Ein kritisches drittes Messverfahren aus Eiskernen betrifft Daten von wind-verblasenem Staub. Diese können auf verschiedenen Wegen erhalten werden, indem man entweder konservierte Staubpartikel oder gelöste Staub-Ionen im Eis betrachtet. Zu Eiszeiten war die Welt unfruchtbarer und trockener (weniger Vegetation) und es gab erhöhte Konzentrationen von in der Atmosphäre herumgeblasenem Staub. Diese Staubfahnen sind bedeutsam für das Klima, da sie natürliches Aerosol repräsentieren, die die Strahlungs-Energie-Bilanz des Klimas beeinflussen. Zusätzlich befruchtet das Eisen in den Staubfahnen die Ozeane und führte dabei zu einer vergrößerten Algenproduktion, die half, den CO2-Gehalt zu verringern, wenn das tote Algenmaterial in die Tiefsee sank.
Es gibt viele zusätzliche interessante und bedeutsame Proxy-Daten von Eiskernen, die wir hier aber nicht benötigen. Eiskern-Studien bieten detaillierte Daten mit guter Alterskontrolle und haben sich so zu einigen der wichtigsten Informationsquellen über Klimaänderungen der letzten 800 000 Jahre entwickelt. Leider gibt es kein gut erhaltenes Eis aus älteren Zeiten.
2.2 DATEN VOM LAND
An erster Stelle stehen bei landbasierten, oder terrestrischen, Aufzeichnungen für die Erforschung vergangenen Klimawandels Stalagmiten in Kalksteingebieten, die aus Calciumcarbonat gemacht sind. Das Tropfwasser, aus dem sie sich entwickeln, entsteht durch die Filtration von Regenwasser durch Spalten im sich darüber befindenden Kalkstein. Die Hauptdaten, die aus Höhlenablagerungen gewonnen werden, betreffen Datierungen, als die Ablagerungen wuchsen (es gab Wasser) und als sie nicht wuchsen (die Höhle war trocken) und Sauerstoffisotopenverhältnisse.
Sauerstoffisotopenverhältnisse von Tropfwasser, die im Calcit (Kalkspat, eines der in der Mineralstruktur unterschiedlichen Calcium-Karbonate (CaCO3))





























