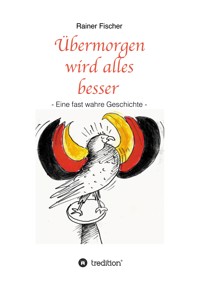Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Knochenmühle" ist ein dystopischer Kurzroman (oder eine "Schauernovelle"): Kannibalismus ist zu einem verbreiteten Phänomen geworden, das den Alltag stark beeinträchtigt, andererseits funktionieren Dinge wie Bürokratie und Wissenschaftschaftsbetrieb. Kevin und Zoë, zwei Polizeianwärter für den gehobenen Dienst, finden auf einem sichergestellten Smartphone Skizzen zu einer Doktorarbeit, die als Ursache der Menschenfresserei einen längst verschwundenen okkulten Orden identifiziert haben will. Sie machen sich auf die Suche nach der Autorin in der Befürchtung, sie sei ermordet und aufgegessen worden. Daneben müssen sie allerdings ihre Ausbildung fortsetzen, Menschenjäger jagen und die Arbeit mit der Geschichte des Ordens lesen. Und ein Entsorgungsproblem lösen. Eine groteske Parodie auf Gott - und die Welt und vor allem ihre Bewohner. So oder so, Dissertationen sind die Hölle!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horrorroman Doom Metal Album Grausamer Witz Road Movie mit autonomem Fahrassistenten Schauernovelle
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Emma-Luise Haustermann
Kurzfassung
Einleitung
Auswirkungen
Kapitel 2
Okkulte Ursprünge – Ordo Hermeticus Poteniæ Altioræ
Inhalte der Glaubenslehre
Kapitel 3
Kapitel 4
Entwicklung nach Hadleigh
Kapitel 5
Kapitel 6
1
Wie lange war es her, dass ich hier gewesen war? Sieben Jahre, zehn Jahre? War ich zehn Jahre alt gewesen oder dreizehn, als mich mein Vater zu der Mühle mitgenommen hatte? In der Erinnerung war ich viel jünger als dreizehn, aber es konnte doch nicht schon zehn Jahre her sein. Waren damals die Zustände schon so chaotisch, dass die Überreste illegaler menschlicher Gelüste von Abfallbetrieben im städtischen Auftrag heimlich zu Pulver zermahlen und in Säcke abgefüllt wurden? Mein Vater war und ist immer noch in der Stadtverwaltung tätig. Er hatte mit einer verwaltungstechnischen Abnahme in der Mühle zu tun, zu der er mich mitnahm, weil an diesem Tag meine Schule wegen der Einrichtung neuer Sicherheitsmaßnahmen kurzfristig für einen Tag schließen musste. Eigenartig, dass ich mich an so viele Details und Zusammenhänge erinnere, aber keine Jahreszahl mehr im Kopf habe.
Die Wände in der Granulata GmbH, wie die Firma damals hieß, waren sauber in hellgrau gestrichen gewesen. Die Mühle, vor allem das Mahlwerk und die Abfüllstation, hatten benutzt, aber gepflegt ausgesehen. Jetzt stand alles seit Jahren still, war verstaubt und schmutzig. Müll und Dreck lagen herum, der Verputz der Mauern war löcherig geworden. Vielleicht war es in den letzten Wochen und Monaten des Betriebs hier nicht mehr so geregelt abgelaufen, vielleicht waren in der Zeit des Stillstandes und der Verbarrikadierung doch Menschen eingedrungen, die sich Schlüssel und Zugangscodes verschafft hatten – so wie wir heute – und hatten was auch immer hier getrieben.
An der Hinterseite war ein von niedrigen Mauern umfasster Bereich, in dem sich damals ein Berg von Knochen stapelte: Schädel, Rippen, Wirbelsäulen, lange Röhrenknochen. Die Knochen waren nicht weiß gewesen, wie ich damals erwartet hatte, sondern gelblich oder bräunlich, wie fettiges Holz. Ursprünglich wurden hier nur Knochen von Schlachttieren entsorgt, die von Schlachthöfen im großen Umkreis hierher gebracht wurden. Sie wurden getrocknet, zermahlen, in Säcke abgefüllt und entweder als Baumaterial oder als Dünger verwendet. Nein, ich glaube, nur als Dünger, bauen konnte man damit wohl nichts.
Eines Tages war herausgekommen, dass menschliche Knochen darunter gemischt worden waren. Die städtischen Reinigungstrupps hatten die Knochen in Parks, Wäldern, an Autobahnausfahrten und Rastplätzen eingesammelt, oder wo immer die Reste verbotener Mahlzeiten weggeworfen worden waren. Für die Einträge ins Sterberegister waren von den Knochen kleine Proben entnommen worden, die durch DNA-Untersuchungen identifiziert wurden. Die Knochen zu beerdigen wurde als zu umständlich und zu teuer angesehen, und jemand aus der Stadtverwaltung war auf die Idee gekommen, sie hier unter den anderen Knochen verschwinden zu lassen. Als das öffentlich bekannt wurde, wurde die Auslieferung des Knochenmehls gestoppt und der Betrieb geschlossen.
Hinter einer verbeulten grauen Stahltür fand ich das Lager wieder. Es war bis oben hin voll mit grauen Säcken, alle waren noch säuberlich auf Paletten gestapelt. In der großen Halle klebten Spinnweben und öliger Staub auf den Maschinen, aber es waren keine Beschädigungen zu erkennen. Als ich mich umdrehte, um nach den elektrischen Installationen zu suchen und zu prüfen, ob die Anlage noch am Stromnetz hing, entdeckte ich einen hellrot leuchten Punkt, der an der Wand auf mich zu wanderte. Ich warf mich zu Boden und riss dabei die Maschinenpistole unter meiner Jacke von ihrem Gurt. Im Liegen feuerte ich auf den Müllcontainer, hinter dem die Quelle des Lichtpunktes liegen musste. Den Schreien nach musste ich zwei »Jäger« getroffen haben.
Bei solchen Schüssen aus dem Hinterhalt werden normalerweise Jagdwehre mit einem Laser-Zielsystem verwendet, um dem Opfer nach Möglichkeit nur mit einen einzigen Treffer in den Kopf aus dem Hinterhalt zu töten. Das war der rote Lichtpunkt, den ich gerade noch rechtzeitig gesehen hatte. Im Gegensatz dazu verwendeten wir Sicherheitsbeamte zur Selbstverteidigung kleine Maschinenpistolen, die unauffällig unter weiter Kleidung getragen, schnell zu Einsatz gebracht werden konnten und den Gegner zuverlässig bekämpften. Es war ja egal, wie zerschossen der Leichnam hinterher aussah. Das blitzartige Reagieren trainierten wir regelmäßig, und heute es hatte mir zum dritten Mal das Leben gerettet. Der wichtigste Punkt der Sicherheitsstrategie war allerdings der Partner, der verdeckt mit Abstand folgen und einem schützen sollte.
»Zoë«, schrie ich. »Schläfst du, oder was ist los?«
»Reg dich ab«, antwortete sie. Meine Partnerin stand in der Tür zur Maschinenhalle. »Eine Sekunde später hätte ich sie außer Gefecht gesetzt, ohne sie zu Hackfleisch zu verarbeiten.« Sie schwenkte ihre Elektroschockpistole.
Zoë besaß Nerven wie Drahtseile. Sie war einige Male im Visier von Jägern gewesen, die sie oder ihr jeweiliger Partner im nächsten Moment erledigt hatten. Jung, sichtbar blondiert, leicht gebräunt, nicht zu mager − sie sah in der Tat verlockend aus.
Mit schussbereiten Waffen durchsuchten wir die übrigen Räumlichkeiten und die Außenanlagen, es hätten ja noch mehr Jäger dort sein können. Draußen fanden wir die Schwachstelle im Zaun, ein Gitter, das nicht befestigt war, durch das die beiden auf das Gelände gekommen sein mussten. Vielleicht hatten sie uns auf das Gelände fahren sehen, vielleicht waren sie auch schon vor uns hier gewesen.
Dann fotografierte Zoë die Gesichter der beiden Jäger oder das, was davon noch zu erkennen war, scannte die Erkennungschips im Nacken und schickte die Daten an die Zentrale. Beide waren jeweils von mehreren Kugeln getroffen worden, die zwei Blechwände des leeren Müllcontainers durchschlagen hatten, dadurch abgeplattet worden waren und häßliche, große Löcher gerissen hatten.
»Hm, die beiden waren Angestellte der Abwasserentsorgung«, meinte sie und reichte mir ihr Smartphone. Auf dem Display sah ich ihre Ausweisfotos, Namen, Alter und die üblichen Angaben. Die Wohnungstüren der beiden würden innerhalb der nächsten Stunde von einem Sondereinsatzkommando aufgebrochen, um Waffen sowie Spuren von Mittätern oder Opfern sicherzustellen.
»Damit hättest du die Zahl der Abwasserentsorger in Wuppertal von neun auf sieben reduziert. Sagt jedenfalls das städtische Personalregister.«
»In Notwehr!«
»Wo ist das Gewehr?«
»Hier.«
Das Unschädlichmachen von Schusswaffen war noch wichtiger als von Jägern, die ja noch zu irgendwas nützlich sein konnten und oft in ihren Berufen schwer zu ersetzen waren, so wie die beiden Kanalarbeiter. Außer dem Gewehr hatten die beiden nur noch Messer bei sich, die wir unzerstört für die Spurensicherung mitnahmen. Das Gewehr wurde der Dienstvorschrift entsprechend im Freien mit einer speziellen Sprengpatrone bearbeitet, die tief in die Mündung des Gewehrs geschoben und gezündet wurde. Danach waren Lauf und Verschluss nicht mehr zu gebrauchen. Die Trümmer des Gewehrs packten wir in unseren Wagen, wir hatten immer Boxen für zerstörte Waffen, Munition oder sonstige Beweistücke dabei.
»Nehmen wir die Leichen mit?«, fragte ich Zoë.
»Auf keinen Fall. Wir könnten gleich mal ausprobieren, was du vorgeschlagen hast. Dafür sind wir schließlich hier.«
Ich kehrte zum Sicherungskasten zurück und drehte die Hauptsicherung ein. Es gelang uns, die Mühle in Betrieb zu nehmen und im Leerlauf zu halten. Dann kamen die beiden Leichen in den Einfülltrichter. Um die Mühle einigermaßen sauber zu halten, kippte ich einen Sack altes Knochenmehl hinterher. Aus der Maschinerie waren nacheinander Knacken, Schmatzen und Brummen zu hören, dann wieder andere Maschinengeräusche. Wie in einer Geschirrspülmaschine schienen sich verschiedene Arbeitsgänge abzuwechseln. Die Mühle arbeitete vollautomatisch. Gemahlen wurde in mehreren Schritten, und schließlich wurde eine Art klumpiges Mehl oder Granulat in Säcke verpackt. Abwässer wurden mit einer Zentrifuge abgetrennt und direkt in die Kanalisation abgeleitet.
Zoë war beeindruckt. Ich zeigte ihr ein Fach, das man seitlich an der Mühle öffnen konnte.
»Metalle, Glas, Keramik und Kunststoffe werden ausgefiltert und hier seitlich ausgeworfen. Früher bei den Knochen waren manchmal noch Metallketten oder anderer Müll dabei, den jemand in die Container geworden hatte, Flaschen oder was auch immer. Die würden später die Feinmahlwerke beschädigen. Bei den Menschenknochen waren manchmal falsche Zähne, künstliche Gelenke oder chirurgische Nägel oder Schienen dabei. Ich glaube, so ist das damals rausgekommen, dass man hier Menschenknochen hat verschwinden lassen. Es gab eine Betriebsprüfung, und dabei kam ein künstliches Hüftgelenk aus dem Sieb.«
Jetzt waren tatsächlich Zahnfüllungen, Gürtelschnallen, zerkratzte Armbanduhren und Ringe darin, außerdem die Erkennungschips. Letztere nahmen wir als Beweisstücke mit, ebenso ihre Rucksäcke.
»Ziel erreicht, würde ich sagen«, stellte Zoë fest.
Eigentlich waren wir nur her gekommen, um zu sehen, ob die Mühle noch funktionstüchtig und an das Stromnetz angeschlossen war. Jetzt hatten wir schon ausprobiert, ob man damit Leichen endgültig ungenießbar machen konnte. Verbrennen war nicht mehr opportun: Erst waren die Betriebsbestimmungen für Krematorien verschärft worden, was Abgase und Partikelausstoß betraf, dann waren wegen der Gasknappheit die Betriebsgenehmigungen für Verbrennungen annulliert worden.
Der Mangel an Polizisten beziehungsweise der erhöhte Bedarf war der Grund, dass Zoë und ich schon Streife fuhren oder andere kleinere Einsätze durchführten. Eigentlich waren wir noch in der Ausbildung für den gehobenen Dienst und saßen an fünf Tagen pro Wochen in Vorlesungen und Seminaren. Jura, Psychologie, Kriminalistik und so weiter. Nachmittags hatte wir oft praktische Ausbildung: Sport, Schießtraining, Spurensicherung. Zwischendurch und am Wochenende sollten wir den Kollegen im Streifendienst aushelfen und Erfahrungen sammeln. Da ich beim Auslosen der Partner im zweiten Semester die Streberin und Sportskanone Zoë erwischt hatte, ließ man uns meistens allein losziehen. Was vielleicht auch an meinem Wagen lag, es waren nämlich fast keine Dienstfahrzeuge übrig. Den kleinen SUV hatte mir mein Vater besorgt, mit diesem besonders leistungsstarken Elektromotor gab es dieses Modell normalerweise nicht.
Manchmal bestand unsere Einsätze darin, wichtige Personen zu schützen oder Objekte, in denen solche arbeiteten. Eines der großen Probleme, die der verbreitete Kannibalismus verursachte, war, das schwer ersetzbare Arbeitskräfte verschwanden, auch solche, die für wichtige Funktionen gebraucht wurden. Wir bewachten Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser.
Natürlich waren junge Menschen besonders begehrt, aber nicht immer leicht zu erwischen, da sie normalerweise schneller und wehrhafter als alte waren oder aber, weil Kinder und junge Mädchen von ihren Angehörigen in der Regel streng überwacht wurden. In unserer überalterten Gesellschaft war Jugend ein seltenes Gut und entsprechend gesichert. Die schwächeren, ungeschützten waren die leichtere, aber unattraktivere Beute: Alte, Kranke und Benachteiligte aller Art.
Die Mittagspause war längst überfällig. Bevor wir zurück in die Akademie fuhren, holten wir unsere Brotdosen und Flaschen aus dem Wagen und suchten ein schattiges Plätzchen.
»Hast du wieder Erdnussbutter drauf?«, fragte Zoë.
»Ja«, antwortete ich. »Und ich möchte nicht tauschen, falls du ein Vollkorn-Sandwich mit veganer Hülsenfrucht-Paste hast.«
»Curry-Kichererbse, und ich möchte auch nicht tauschen. – Was eigentlich wichtiger bei einem Sandwich, das Brot oder der Belag?«
»Was meinst du mit wichtiger?«
»Naja, ist das Brot der wichtigere, nahrhafte Teil, und der Belag ist nur dazu da, einen anderen Geschmack zu liefern, damit das Brot nicht langweilig wird, oder ist das Brot nur die Verpackung für den Belag?«
»Verpackung? Ich würde sagen, es geht ums Brot. Heißt ja schließlich auch Butterbrot.«
»Aber Butter ist Belag.«
»Oder Pausenbrot!« fiel mir noch ein.
»Verpackung, weil man die Butter ja nicht aus der Hand essen kann. Oder Wurst oder Käse, das gibt fettige Finger.«
»Brot kann man auch trocken essen.«
»Ja, aber wenn ich Weißbrot sehe, womöglich noch als Sandwich mit abgeschnittener Rinde, dann ist das nicht mehr weit vom Einwickelpapier entfernt.«
»Das Brot liefert vor allem Kohlenhydrate, also Energie.«
»Der Belag hat mehr Proteine, aber auch Fett gleich noch mehr Energie und deine Erdnussbutter bestimmt auch Kohlenhydrate, weil Zucker drin ist. Außerdem Salz. Das sind mehr Baustoffe als im Brot.«
»Können wir uns darauf einigen, dass beides wichtig ist?«
»Ich wollte nur mal eine andere Meinung dazu hören. Beziehungsweise dich zum Nachdenken bringen.«
Ich stöhnte leise und wollte das Thema wechseln.
»Ist eigentlich etwas in den Rucksäcken, die wir gefunden haben?«, fragte ich.
»Warte mal. Jedenfalls nichts zu essen. Eine Wasserflasche. Irgendwelche Lumpen. Ein Taschenmesser, ein anderes Messer und ein Feuerzeug. Zigaretten. Hier ist ein Smartphone. Teures Stück. Sieht noch ziemlich neu aus.«
»Es ist abgeschaltet. Vielleicht haben die beiden das einem ihrer Opfer abgenommen?«
Normalerweise haben Jäger keine Smartphones dabei, damit sie keine Spuren in den Daten der Mobilfunknetze hinterlassen.
»Das sollten wir mal überprüfen. Ist da noch was in dem anderen Rucksack, das einen Hinweis geben könnte?
Schmuck, Kleidung? Ist da Blut an dem Taschenmesser?«
Wir mussten uns beeilen, um zum Schießtraining am Nachmittag rechtzeitig zurück zu sein. Die Knochenmühle stand in Wuppertal-Oberbarmen, die Akademie war in Düsseldorf. Wir hatten den Vorfall vom Mittag sofort online an die nächste Wache in Wuppertal durchgegeben, mussten aber noch die Erkennungschips und die Trümmer des Jagdgewehrs abgeben und das Protokoll abschicken. Das Protokoll schrieb ein Programm auf Zoës Smartphone. Auf der Rückfahrt diktierte sie in Stichpunkten, was passiert war, und bevor wir zurück waren, war im Landeskriminalamt der fertige Bericht mit allen Daten und Fotos zum Vorgang sowie ihrer elektronischen Signatur eingegangen.
Die Akademie und das Landeskriminalamt lagen direkt nebeneinander. Der Schießstand war im Keller der Akademie. Eigentlich hatte ich heute schon meine Schießübung gehabt, aber das mussten wir dem Ausbilder nicht auf die Nase binden. Die meiste Zeit warteten wir, bis wir endlich wieder dran waren, mit der Laser-Übungspistole auf die Figuren zu schießen, die über den großen Bildschirm huschten. Meine Trefferquote war eigentlich gut, aber der Ausbilder mäkelte an meiner angeblich schlechten Handhaltung herum.
Als das Training endlich zu Ende war, gingen wir ins Informatiklabor. Wir kannten das Labor, weil wir dort schon ein Praktikum absolviert hatten und seit dem die elektronischen Geräte, Datenträger und ähnliches dorthin brachten, die wir im Streifendienst sichergestellt hatte. Von den Technikern trafen wir heute niemanden an, die hatten entweder schon Feierabend oder arbeiteten an Mikroskopen und untersuchten irgendwelche eiligen Beweisstücke, sodass wir kein Problem hatten, einen freien Platz zum Arbeiten zu finden.
Der Akku des Smartphones war in der Tat leer. Während Zoë die SIM-Karte auslas, schloss ich das Gerät an ein Schnellladegerät. Zoë durchsuchte dann die Datenbank, in der alle Mobilfunkdaten zusammengefasst waren.
»Die SIM-Karte gehört einer Emma-Luise Haustermann.«
»Aha. Und wer ist das?«
»Moment, dafür brauche ich das Personenregister der Meldeämter. – Wohnt in Bochum, 25 Jahre alt, Studentin. Hm, in der Vermisstenliste steht sie nicht.«
»Wo studiert sie?«
»In Elberfeld. Warte, ich checke mal die Zugangskontrolle.
– Sie ist seit zehn Tagen nicht mehr in der Uni gewesen.«
»Meinst du, sie haben sie vor zehn Tagen erwischt und – äh – umgebracht?«