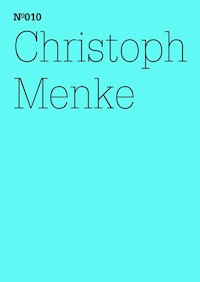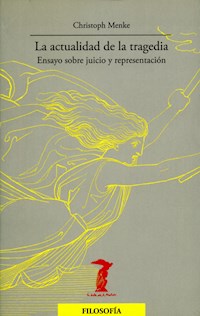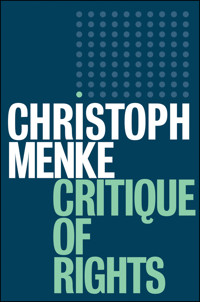16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch nie war die Kunst sichtbarer, präsenter und prägender als heute und noch nie war sie zugleich so sehr ein bloßer Teil der gesellschaftlichen Prozesse: eine Ware, eine Unterhaltung, eine Meinung, eine Erkenntnis, eine Handlung. Die gesellschaftliche Allgegenwart der Kunst geht einher mit dem zunehmenden Verlust dessen, was wir ihre ästhetische »Kraft« nennen können. »Kraft« – im Unterschied zu unseren »vernünftigen Vermögen« – meint hier den unbewussten, spielerischen, enthusiastischen Zustand, ohne den es keine Kunst geben kann. Die philosophische Reflexion auf diesen Zustand führt Christoph Menke zur Bestimmung ästhetischer Kategorien – Kunstwerk, Schönheit, Urteil – und zum Aufriss einer ästhetischen Politik, das heißt einer Politik der Freiheit vom Sozialen und der Gleichheit ohne Bestimmung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Noch nie war die Kunst sichtbarer, präsenter und prägender als heute, und noch nie war sie zugleich so sehr ein bloßer Teil der gesellschaftlichen Prozesse: eine Ware, eine Unterhaltung, eine Meinung, eine Erkenntnis, eine Handlung. Die gesellschaftliche Allgegenwart der Kunst geht einher mit dem zunehmenden Verlust dessen, was wir ihre ästhetische Kraft nennen können.
»Kraft« – im Unterschied zu unseren »vernünftigen Vermögen« – meint hier den unbewußten, spielerischen, enthusiastischen Zustand, ohne den es keine Kunst geben kann. Die philosophische Reflexion auf diesen Zustand führt Christoph Menke zur Bestimmung ästhetischer Kategorien – Kunstwerk, Schönheit, Urteil – und zum Aufriß einer ästhetischen Politik, das heißt einer Politik der Freiheit vom Sozialen und der Gleichheit ohne Bestimmung.
Christoph Menke ist Professor für Praktische Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Letzte Veröffentlichungen im Suhrkamp Verlag: Die Revolution der Menschenrechte. Grundlegende Texte zu einem neuen Begriff des Politischen (stw 1988, hg. zusammen mit Francesca Raimondi), Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie (2008) und Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und Spiel (stw 1649).
Christoph Menke
Die Kraft der Kunst
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-78740-3
www.suhrkamp.de
5Was ich mir selbst Unbekanntes in mir trage,
das macht mich erst aus.
Was ich an Ungeschick, Ungewissem besitze,
das erst ist mein eigentliches Ich.
Meine Schwäche, meine Hinfälligkeit.
Meine Mängel sind meine Ausgangsstelle.
Meine Ohnmacht ist mein Ursprung.
Meine Kraft geht von euch aus.
Meine Bewegung geht von meiner Schwäche zu meiner Stärke.
Meine wirkliche Armut erzeugt einen imaginärenReichtum: und ich bin diese Symmetrie;
ich bin das Tun, das meine Wünsche zunichte macht.
(Paul Valéry, Monsieur Teste)
7Inhalt
Vorbemerkung
Die Kraft der Kunst. Sieben Thesen
I.Ästhetische Kategorien
1. Das Kunstwerk: zwischen Möglichkeit und Unmöglichkeit
2. Die Schönheit: zwischen Anschauung und Rausch
3. Das Urteil: zwischen Ausdruck und Reflexion
4. Das Experiment: zwischen Kunst und Leben
Anhang: Experiment und Institution
II.Ästhetisches Denken
1. Ästhetisierung – des Denkens
2. Ästhetische Freiheit: Geschmack wider Willen
Anhang: Sechs Sätze zur Begriffsstruktur ästhetischer Freiheit
3. Ästhetische Gleichheit: die Ermöglichung der Politik
Textnachweise
Namenregister
9Vorbemerkung
Die Ästhetik als das philosophische Nachdenken über die Kunst fragt nach ihrer Wahrheit: Sie fragt danach, wie sich in der Kunst der menschliche Geist zeigt; was die Existenz der Kunst – nicht dieses oder jenes Kunstwerks – über die Herkunft, die Verfassung und das Schicksal des menschlichen Geistes sagt. So hat Herder Baumgartens Ästhetik die »am meisten philosophische« Weise, »Metapoetik« zu betreiben, genannt, weil es ihr darum gehe, »das Wesen der Poesie aus der Natur des Geistes [zu] entwickeln«, »mit jeder Regel der Schönheit eine Entdeckung der Seelenlehre [zu] tun«.[1] Die Ästhetik denkt in der Betrachtung der Kunst über den menschlichen Geist nach.
Dieses Programm habe ich in Kraft als das einer »ästhetischen Anthropologie« rekonstruiert.[2] Deren Grundthese, die ich im folgenden einleitend zusammenfasse,[3] lautet, daß der menschliche Geist im Widerstreit von ästhetischer Kraft und vernünftigen Vermögen besteht. Dieser Widerstreit ist die Gelingens-, ja die Möglichkeitsbedingung des menschlichen Geistes. So zeigt die Kunst den menschlichen Geist. Darin liegt, so die These in Kraft, die Wahrheit der Kunst.
Hinter der Erläuterung der geisttheoretischen, anthropologischen Wahrheit der Kunst stand in Kraft die Frage zurück, worin der genuin ästhetische Begriff der Kunst besteht.[4] Wie versteht die Ästhetik – im Unterschied vor allem zur Tradition der Poetik – die Kunst? Wenn die Ästhetik darin philosophisch ist, daß sie das Begreifen des Geistes und das Begreifen der Kunst zusammenhält, ohne sie dabei miteinander gleichzusetzen, dann muß die Ästhetik die Doppelgestalt einer ästhetischen Anthropologie, als Lehre vom 10Geist, und einer ästhetischen Theorie, als Lehre von der Kunst, annehmen. Die vier Texte im ersten Teil entwickeln einige Elemente einer solchen ästhetischen Theorie der Kunst. Die drei Texte im zweiten Teil umreißen und führen paradigmatisch vor, wie ein Denken verstanden und vollzogen werden muß, das die ästhetische Erfahrung der Kunst ernst nimmt.
11Die Kraft der Kunst. Sieben Thesen
1. Noch nie in der Moderne gab es mehr Kunst, war die Kunst sichtbarer, präsenter und prägender in der Gesellschaft als heute. Noch nie war die Kunst zugleich so sehr ein Teil des gesellschaftlichen Prozesses wie heute; bloß eine der vielen Kommunikationsformen, die die Gesellschaft ausmachen: eine Ware, eine Meinung, eine Erkenntnis, ein Urteil, eine Handlung.
Noch nie in der Moderne war die Kategorie des Ästhetischen so zentral für das kulturelle Selbstverständnis wie in der gegenwärtigen Epoche, die sich im anfänglichen Überschwang »postmodern« genannt hat und sich nun immer deutlicher als eine nachdisziplinäre »Kontrollgesellschaft« (Deleuze) erweist. Noch nie war das Ästhetische zugleich so sehr ein bloßes Mittel im ökonomischen Verwertungsprozeß – sei es direkt, als Produktivkraft, sei es indirekt, zur Erholung von den Anstrengungen der Produktion.
Die ubiquitäre Gegenwart der Kunst und die zentrale Bedeutung des Ästhetischen in der Gesellschaft gehen einher mit dem Verlust dessen, was ich ihre Kraft zu nennen vorschlage – mit dem Verlust der Kunst und des Ästhetischen als Kraft.
2. Es ist kein Ausweg aus dieser Lage, die Kunst und das Ästhetische als Medien der Erkenntnis, der Politik oder der Kritik gegen ihre gesellschaftliche Absorption in Stellung zu bringen. Im Gegenteil: Versteht man die Kunst oder das Ästhetische als Erkenntnis, als Politik oder als Kritik, so trägt dies nur weiter dazu bei, sie zu einem bloßen Teil der gesellschaftlichen Kommunikation zu machen. Die Kraft der Kunst besteht nicht darin, Erkenntnis, Politik oder Kritik zu sein.
3. Im Dialog mit dem Redner Ion hat Sokrates die Kunst als Erregung und Übertragung von Kraft beschrieben: der Kraft der Begeisterung, des Enthusiasmus. Diese Kraft erregt zuerst die Muse in den Künstlern, und diese übertragen sie durch ihre Werke auf die Zuschauer und Kritiker – so wie ein Magnet »nicht nur selbst die eisernen Ringe [zieht], sondern er teilt auch den Ringen die Kraft mit, daß sie eben dieses tun können wie der Stein selbst, nämlich 12andere Ringe ziehn«. »Eben so auch macht zuerst die Muse selbst Begeisterte, und an diesen hängt eine ganze Reihe Anderer durch sie sich begeisternder.« Der Zusammenhang der Kunst ist ein Zusammenhang der Kraftübertragung. Übertragen wird die Kraft der Begeisterung, der Entrückung, auf den Künstler, Zuschauer und Kritiker: »bis er begeistert worden ist und bewußtlos und die Vernunft nicht mehr in ihm wohnt«.[5]
4. Sokrates hat aus der Einsicht in die Kraft der Kunst die Konsequenz gezogen, daß die Kunst aus dem auf Vernunft zu gründenden Gemeinwesen verbannt werden muß. Gegen diese Konsequenz ist die Kunst von Anfang an auf zwei entgegengesetzte Weisen verteidigt worden. Die eine erklärt die Kunst zu einer sozialen Praxis. Sie behauptet gegen Sokrates, es treffe nicht zu, daß in der Kunst eine Kraft wirke, die bis zur Bewußtlosigkeit begeistert. In der Kunst, also in ihrer Hervorbringung, Erfahrung und Beurteilung, verwirkliche sich vielmehr ein sozial erworbenes Vermögen; die Kunst sei ein Akt praktischer Subjektivität. Das ist der Sinn der von Aristoteles erfundenen »Poetik«, als »Poïétique« (Valéry): der Lehre von der Kunst als Machen, als Ausübung eines Vermögens, das das Subjekt durch Ausbildung, durch seine Sozialisierung oder Disziplinierung erworben hat und nun bewußt auszuüben vermag. Dagegen steht von Anfang an ein anderes Denken der Kunst, das das 18. Jahrhundert auf den Namen der »Ästhetik« taufen wird. Dieses ästhetische Denken der Kunst beruht auf der Erfahrung, daß sich in der Kunst eine Kraft entfaltet, die das Subjekt aus sich herausführt, ebenso hinter sich zurück wie über sich hinaus; eine Kraft also, die unbewußt ist – eine »dunkle« Kraft (Herder).
5. Was ist Kraft? Kraft ist der ästhetische Gegenbegriff zu den (»poietischen«) Vermögen. »Kraft« und »Vermögen« sind die Namen zweier entgegengesetzter Verständnisse der Tätigkeit der Kunst. Eine Tätigkeit ist die Verwirklichung eines Prinzips. Kraft und Vermögen sind zwei entgegengesetzte Verständnisse des Prinzips und seiner Verwirklichung.
13Vermögen zu haben heißt, ein Subjekt zu sein; ein Subjekt zu sein heißt, etwas zu können. Das Können des Subjekts besteht darin, etwas gelingen zu lassen, etwas auszuführen. Vermögen zu haben oder ein Subjekt zu sein bedeutet, durch Üben und Lernen imstande zu sein, eine Handlung gelingen lassen zu können. Eine Handlung gelingen lassen zu können wiederum heißt, in einer neuen, je besonderen Situation eine allgemeine Form wiederholen zu können. Jedes Vermögen ist das Vermögen der Wiederholung eines Allgemeinen. Die allgemeine Form ist stets die Form einer sozialen Praxis. Die künstlerische Tätigkeit als Ausübung eines Vermögens zu verstehen heißt daher, diese Tätigkeit als eine Handlung zu verstehen, in der ein Subjekt die allgemeine Form verwirklicht, die eine spezifische soziale Praxis ausmacht; es heißt, die Kunst als eine soziale Praxis und das Subjekt als deren Teilnehmer zu verstehen.
Kräfte sind wie Vermögen Prinzipien, die in Tätigkeiten verwirklicht werden. Aber Kräfte sind das Andere der Vermögen:
– Während Vermögen durch soziale Übung erworben werden, haben Menschen bereits Kräfte, bevor sie zu Subjekten abgerichtet werden. Kräfte sind menschlich, aber vorsubjektiv.
– Während Vermögen von Subjekten in bewußter Selbstkontrolle handelnd ausgeübt werden, wirken Kräfte von selbst; ihr Wirken ist nicht vom Subjekt geführt und daher vom Subjekt nicht gewußt.
– Während Vermögen eine sozial vorgegebene allgemeine Form verwirklichen, sind Kräfte formierend, also formlos. Kräfte bilden Formen, und sie bilden jede Form, die sie gebildet haben, wieder um.
– Während Vermögen am Gelingen ausgerichtet sind, sind Kräfte ohne Ziel und Maß. Das Wirken der Kräfte ist Spiel und darin die Hervorbringung von etwas, über das sie immer schon hinaus sind.
Vermögen machen uns zu Subjekten, die erfolgreich an sozialen Praktiken teilnehmen können, indem sie deren allgemeine Form reproduzieren. Im Spiel der Kräfte sind wir vor- und übersubjektiv – Agenten, die keine Subjekte sind; aktiv, ohne Selbstbewußtsein; erfinderisch, ohne Zweck.
6. Das ästhetische Denken beschreibt die Kunst mit Sokrates als ein Feld der Kraftentfaltung und Kraftübertragung. Das ästheti14sche Denken bewertet dies aber nicht nur anders als Sokrates, es versteht dies auch anders als Sokrates. Nach Sokrates ist die Kunst bloß die Erregung und Übertragung von Kraft. So aber gibt es keine Kunst. Die Kunst ist vielmehr die Kunst des Übergangs zwischen Vermögen und Kraft, zwischen Kraft und Vermögen. Die Kunst besteht in der Entzweiung von Kraft und Vermögen. Die Kunst besteht in einem paradoxen Können: zu können, nicht zu können; fähig zu sein, unfähig zu sein. Die Kunst ist weder bloß die Vernunft der Vermögen noch bloßes Spiel der Kraft. Sie ist die Zeit und der Ort der Rückkehr vom Vermögen zur Kraft, des Hervorgehens des Vermögens aus der Kraft.
7. Deshalb ist die Kunst kein Teil der Gesellschaft – keine soziale Praxis; denn die Teilnahme an einer sozialen Praxis hat die Struktur der Handlung, der Verwirklichung einer allgemeinen Form. Und deshalb sind wir in der Kunst, im Hervorbringen oder Erfahren der Kunst, keine Subjekte; denn ein Subjekt zu sein heißt, die Form einer sozialen Praxis zu verwirklichen. Die Kunst ist vielmehr das Feld einer Freiheit nicht im Sozialen, sondern vom Sozialen; genauer: der Freiheit vom Sozialen im Sozialen. Sobald das Ästhetische zu einer Produktivkraft im postdisziplinären Kapitalismus wird, ist es seiner Kraft beraubt; denn das Ästhetische ist aktiv und hat Effekte, aber es ist nicht produktiv. Ebenso wird das Ästhetische seiner Kraft beraubt, wenn es eine soziale Praxis sein soll, die sich gegen die entfesselte Produktivität des Kapitalismus ins Feld führen läßt; das Ästhetische ist zwar befreiend und verändernd, aber es ist nicht praktisch – nicht »politisch«. Das Ästhetische als »Gesammtentfesselung aller symbolischen Kräfte« (Nietzsche) ist weder produktiv noch praktisch, weder kapitalistisch noch kritisch.
In der Kraft der Kunst geht es um unsere Kraft. Es geht um die Freiheit von der sozialen Gestalt der Subjektivität, sei sie produzierend oder praktisch, kapitalistisch oder kritisch. In der Kraft der Kunst geht es um unsere Freiheit.
15I.Ästhetische Kategorien
171.Das Kunstwerk: zwischen Möglichkeit und Unmöglichkeit
Es ist eine wesentliche Bestimmung der Kunst, in der Gestalt von Werken zu existieren. Das bedeutet, daß die Kunst eine Weise menschlicher Tätigkeit ist; Kunstwerke sind nicht natürlich. Und daß die Kunst in der Gestalt von Werken existiert, bedeutet weiterhin, daß sie eine Tätigkeitsweise ist, die sich in wie auch immer flüchtigen Objektivierungen darstellt. Der »Mensch als Geist verdoppelt sich«.[1] Im Werk tritt die Tätigkeit »aus sich heraus«, »denn vom Tun frei entlassen als seiende Wirklichkeit, ist die Negativität als Qualität an ihm«.[2] Die Kunst hat Werkcharakter, weil ihre Tätigkeit kein bloßes »Sich-Aussprechen der Individualität« ist:
Das Werk ist die Realität, welche das Bewußtsein sich gibt; es ist dasjenige, worin das Individuum das für es ist, was es an sich ist, und so, daß das Bewußtsein, für welches es in dem Werke wird, nicht das besondere sondern das allgemeine Bewußtsein ist; es hat sich in dem Werke überhaupt in das Element der Allgemeinheit, in den bestimmtheitslosen Raum des Seins hinausgestellt.[3]
Die Kunst existiert in Werken, nicht weil ihre Existenz stets objekt- oder dauerhaft ist, sich also gegenüber der Kunst als einer Tätigkeit – der Hervorbringung und Erfahrung, die sich hier und jetzt vollzieht – verselbständigt (wie die Kritik der Werkkategorie im Namen des ästhetischen Ereignisses und Erlebnisses meint[4]). Die Kunst existiert vielmehr in Werken, weil ihre Tätigkeit in sich negativ oder allgemein ist; negativ, weil sie die Bestimmungsmacht des Natürlichen, bloß Individuellen bricht; allgemein, weil ihre 18Tätigkeit für andere da ist und zu gelten beansprucht. Nicht »Permanenz« definiert das Werk, sondern daß es »in einem öffentlichen Raum zwischen ästhetisch erfahrenden Subjekten lokalisiert ist, ein ›Objekt‹, worauf diese Subjekte im ästhetischen Diskurs sich beziehen und gleichsam zurückkommen können«.[5]
Negativität und Allgemeinheit sind die Bestimmungen der Normativität; Werkhaftigkeit im allgemeinen Sinn – den Hegel gegen die Auffassung der menschlichen Tätigkeit als ein bloßes »Sich-Aussprechen der Individualität« geltend macht – ist ein Kennzeichen ihrer Normativität, ihrer Existenz oder Wirklichkeit für andere. Die erste Antwort auf die Frage, weshalb die Kunst in der Gestalt von Werken existiert, lautet also, daß auch die Kunst in einer Tätigkeit besteht, die in ihrem Vollzug ihre individuelle Quelle überschreitet, um eine öffentliche Wirklichkeit, im Allgemeinen, zu gewinnen. Die Kunst ist werkhaft – das hat nicht den äußerlichen Sinn, daß ihr eine Tätigkeit der Herstellung vorhergegangen ist (die auch lediglich in einem Akt des Hierher- oder Ausstellens bestehen kann). Die Kunst ist vielmehr werkhaft, weil sie die Wirklichkeit einer normativen Tätigkeit ist, weil sie »Geist«[6] ist.
Diese erste Antwort auf die Frage nach dem Werkcharakter der Kunst ist ebenso zutreffend wie unzureichend. Wenn sie als die ganze Antwort genommen wird, verstellt sie den spezifisch ästhetischen Werkcharakter der Kunst. Wer das Kunstwerk als normatives, geistiges Werk definiert, verfehlt es in seinem Wesen.
1. Möglichkeit und Wirklichkeit
Weil die Kunst eine menschliche Tätigkeit ist, die in der Gestalt von Werken existiert, liegt es nahe, im Nachdenken über die Kunst der Form philosophischer Untersuchung zu folgen, die uns für werkhervorbringende, also allgemeine (oder öffentliche oder normative oder geistige) menschliche Tätigkeiten vertraut ist. In dieser 19eingeübten Form ist das philosophische Untersuchen durch einen Zweischritt von Behauptung und Frage definiert. Die Behauptung ist eine Existenzbehauptung – die Behauptung der Existenz jedoch nicht eines Einzeldings, sondern einer Klasse von durch menschliche Tätigkeiten hervorgebrachten Dingen, hier also: von der Klasse der Kunstwerke. Die Existenzbehauptung, mit der das vertraute philosophische Nachdenken über die Kunst beginnt (oder: die Existenzbehauptung, mit der das philosophische Nachdenken über die Kunst vertraut macht), besagt: »Es gibt Kunstwerke.« Die Frage richtet sich auf das, was Dinge dieser Art – Kunstwerke – möglich macht. In vorläufiger Formulierung: Sie richtet sich auf das ermöglichende Potential, das Vermögen, als dessen Aktualisierung die Tätigkeit, die diese Dinge, Kunstwerke, hervorbringt, zu verstehen ist. Die vertraute Weise, das Nachdenken über die Kunst zu beginnen, besteht darin, zuerst zu behaupten: »Es gibt Kunstwerke«, und dann zu fragen: »Wie sind sie möglich?«
Das ist eine wohlbekannte Untersuchungsweise: Es ist die Untersuchungsweise der Philosophie seit Sokrates. Für sie ist wesentlich, das Sein und die Seinsweise von Dingen nicht einfach hinzunehmen, sondern zu befragen oder zu »problematisieren«: in dem Sein und der Seinsweise von Dingen einer bestimmten Art weder eine selbstverständliche Gegebenheit noch ein Wunder zu sehen, das wir bloß anstaunen, sondern (wie man seit Aristoteles sagt) ein »Problem«;[7] etwas also, das wir verstehen oder erklären wollen. Und die Form dieser philosophischen Erklärung besteht darin, daß wir das zum Problem gewordene Wirkliche als die Verwirklichung einer Möglichkeit beschreiben.
Bevor die Logik dieser Verstehensform näher bestimmt werden kann, bedarf es einer Bemerkung dazu, wie der Zweischritt von (Existenz-) Behauptung und (Möglichkeits-) Frage nicht verstanden werden darf: so als ließe sich die Existenz von Kunstwerken mit Gewißheit feststellen, bevor die Frage nach ihrer Möglichkeit beantwortet worden ist. Wenn man die Frage, wie Kunstwerke möglich sind, nicht beantworten kann, dann kann man auch nicht ihre Existenz behaupten. Die Möglichkeit geht der Wirklichkeit voraus: Wenn wir nicht verstehen, wie Kunstwerke möglich sind, können 20wir nicht wissen, ob es sie – das heißt diese Klasse von Dingen – wirklich gibt. Die Frage nach der Möglichkeit der Kunstwerke ist daher zugleich die Frage nach ihrer Wirklichkeit. An die Stelle der bisherigen Formulierung der vertrauten philosophischen Untersuchungsform »Es gibt Kunstwerke. Wie sind sie möglich?« könnte man daher auch diese setzen: »Wir glauben, daß es Kunstwerke gibt. Gibt es sie wirklich?« Die Antwort auf beide Fragen – »Wie sind Kunstwerke möglich?« und: »Gibt es Kunstwerke?« – ist ein und dieselbe.
Das zeigt sich im Blick auf die Fragen, in denen das skizzierte philosophische Untersuchungsprogramm seine uns vertraute Gestalt gefunden hat. Kants Frage in der ersten Kritik lautet: »Wie sind Naturwissenschaften und generell objektives Erkennen möglich?«, und in der zweiten Kritik: »Wie ist moralisches Urteilen oder vernünftige Selbstbestimmung möglich?« Zwar schreibt Kant in der Kritik der reinen Vernunft: »Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, läßt sich nun wohl geziemend fragen: wie sie möglich sind; denn daß sie möglich sein müssen, wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen.«[8] Aber diese Abfolge von Existenzbehauptung und Möglichkeitsfrage täuscht. Denn ob es naturwissenschaftliches Wissen von gesetzesmäßigen Zusammenhängen (und nicht nur Annahmen über mehr oder weniger wahrscheinliche Verknüpfungen) und ob es moralisches Handeln allein aus Achtung vor dem Gesetz (und nicht nur aus mehr oder weniger egoistischen sinnlichen Antrieben) tatsächlich gibt, läßt sich auch nach Kants Verständnis erst dann entscheiden, wenn die Fragen nach der Möglichkeit jenes Wissens und Handelns beantwortet sind; wenn man also weiß, wie solches Wissen und Handeln und damit ob es überhaupt möglich ist. Es scheint zwar, als sei die philosophische Frage nach der Möglichkeit des Wissens von (Natur-) Gesetzen und des Handelns aus Moral (-Gesetzen) nur die Frage danach, wie wir uns etwas erklären können, dessen wirkliche Existenz bereits unbezweifelbar feststeht. In Wahrheit geht es in der philosophischen Frage 21nach der Möglichkeit aber um die Wirklichkeit von Wissen und Moral. Verstehen wir ihre Möglichkeit nicht, dann gibt es sie auch nicht.
Und das gilt auch für die Kunst: Wenn es nicht gelingt, eine Antwort auf die Frage nach ihrer Möglichkeit zu gewinnen und einen überzeugenden Begriff der Kunst zu entfalten, dann wissen wir auch nicht, ob es Kunstwerke wirklich gibt. Die philosophische Frage nach der Möglichkeit der Kunst ist also alles andere als folgenlos; es geht in ihr nicht nur um die Theorie, sondern um die Wirklichkeit der Kunst. Denn es ist das Begreifen, das der Wirklichkeit zugrunde liegt – nicht umgekehrt.
2. Die Unbegreifbarkeit der Kunst
Wie versteht die Philosophie (von Sokrates bis Kant und darüber hinaus) die Frage nach der Möglichkeit, durch deren Beantwortung sie ein Phänomen verstehen will? Wonach fragen wir, wenn wir nach Bedingungen der Möglichkeit fragen – danach, was etwas ermöglicht? Die Philosophie versteht diese Frage als die nach der Möglichkeit des Gelingens. Genauer: danach, wie wir – die dadurch zu »Subjekten« (der Erkenntnis, der Moral, der Kunst) werden – etwas gelingen lassen können.[1]
Das läßt sich so verstehen: Die Akte der Erkenntnis oder der Moral gehören in den Bereich von menschlichen Tätigkeiten, die gelingen oder mißlingen können. Erkenntnis und Moral sind Werke im eingangs erläuterten Sinne Hegels: nicht ein bloßes »Sich-Aussprechen der Individualität«, sondern als eine für ein »allgemeines Bewußtsein« gültig »seiende Wirklichkeit«. »Erkenntnis« und »Moral« sind Gelingensausdrücke; sie bezeichnen die erfolgreichen, gelungenen Ergebnisse von Anstrengungen oder Leistungen (denen Mißlingensformen wie Irrtum oder Egoismus gegenüberstehen). In der philosophischen Frage nach der Möglichkeit geht es darum, was vorausgesetzt werden muß, also welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Vollzug eine Erkenntnis (und 22nicht ein Irrtum) oder eine moralische Handlung (und nicht ein egoistischer Akt) ist – damit ein Vollzug gelingt. Diese Bedingungen ermöglichen das Gelingen, also Erkenntnis oder Moral. Der Begriff der Möglichkeit hat hier einen praktischen, nicht nur einen logischen Sinn: Die Möglichkeit des Gelingens aufzuweisen heißt, diejenigen Potentiale auszumachen, durch die es uns – uns Subjekten – möglich ist, das Gelingen unserer Tätigkeiten (oder das Hervorbringen von Werken) herbeizuführen oder zu gewährleisten. Die Möglichkeit des Gelingens besteht in den Fähigkeiten, durch die wir Tätigkeiten ausführen können. Diese Fähigkeiten sind Vermögen; wer sie hat, vermag etwas – vermag etwas gelingen zu lassen. Die Frage, wie Erkenntnis und Moral möglich sind, versteht die Philosophie also so, daß sie auf die Vermögen führt, durch die wir fähig sind, zu erkennen und moralisch zu urteilen; also etwa, kantisch verstanden, auf Vermögen wie die der Synthetisierung unserer sinnlichen Eindrücke und der Begriffsverwendung zum Klassifizieren von Gegenständen; oder auf das Vernunftvermögen der autonomen Gesetzgebung und Gesetzprüfung im Fall moralischen Urteilens. Die Philosophie versteht die Frage nach der Möglichkeitsbedingung als die Frage nach dem Subjekt und seinen Vermögen. Ein Subjekt zu sein heißt, etwas tun und daher auch es wiederholen, das heißt: ein Werk hervorbringen zu können.
Dieses Verständnis von Philosophie geht auf Sokrates zurück; so begreift sie auch Kant (an dessen Formulierungen ich hier angeschlossen habe). Auf Sokrates geht aber ebenso die Skepsis zurück, ob auch die Kunst in dieser Weise philosophisch erklärt werden kann; ob man in derselben Weise mit Aussicht auf eine Antwort nach der Möglichkeit der Kunst fragen kann, wie Sokrates glaubte, nach der Möglichkeit der Erkenntnis und der Moral fragen zu können. Sokrates’ kritischer Einwand gegen die Kunst besagt nichts anderes, als daß die beschriebene Art der philosophischen Untersuchung nicht auf die Kunst angewandt werden kann: daß also die Kunst nicht verstanden werden kann. Im Gegensatz zur Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis und Moral muß die nach der Möglichkeit der Kunst unbeantwortet bleiben. Die Kunst ist philosophisch unbegreiflich.
Sokrates formuliert dies so:
23Denn alle rechten Dichter alter Sagen sprechen nicht durch Kunst sondern als Begeisterte und Besessene alle diese schönen Gedichte, und eben so die rechten Lieddichter, so wenig die welche vom tanzenden Wahnsinn befallen sind in vernünftigem Bewußtsein tanzen, so dichten auch die Lieddichter nicht bei vernünftigem Bewußtsein diese schönen Lieder, sondern wenn sie der Harmonie und des Rhythmos erfüllt sind, dann werden sie den Bakchen ähnlich, und begeistert, wie diese aus den Strömen Milch und Honig nur wenn sie begeistert sind schöpfen, wenn aber ihres Bewußtseins mächtig dann nicht, so bewirkt auch der Liederdichter Seele dieses, wie sie auch selbst sagen. Es sagen uns nämlich die Dichter, daß sie aus honigströmenden Quellen aus gewissen Gärten und Hainen der Musen pflückend uns diese Gesänge bringen wie die Bienen, auch eben so umherfliegend. Und wahr reden sie. Denn ein leichtes Wesen ist ein Dichter und geflügelt und heilig, und nicht eher vermögend zu dichten, bis er begeistert worden ist und bewußtlos und die Vernunft nicht mehr in ihm wohnt.[2]
Nach Sokrates ist Dichten »göttlicher Wahnsinn und Besessenheit« und damit »jedenfalls […] kein Wissen, kein Können, das über sich selbst und seine Wahrheit Rechenschaft zu geben vermöchte«.[3] Das Dichten, und generell das, was wir »Kunst« nennen, ist für Sokrates keine Kunst: nicht die selbstbewußte, kontrollierte Ausübung eines durch Übungen erworbenen praktischen Vermögens. Dichten geschieht vielmehr in Besessenheit und aus Begeisterung. Daher ist auch der Dichter kein »Subjekt« im zuvor verwendeten Sinn des Ausdrucks: kein Könner; nicht jemand, der durch seine Vermögen etwas gelingen lassen oder ermöglichen kann. Im Dichten ereignet sich ein Verlust der Subjektivität. Deshalb läßt sich das Dichten philosophisch nicht begreifen. Denn weil es keine Leistung in Anwendung subjektiver Vermögen ist, kann seine Möglichkeit nicht eingesehen werden. Die Aussage, daß Dichten in einem Zustand der Begeisterung erfolgt, ist nicht eine andere Antwort auf die sokratisch-philosophische Frage, wie Dichtung möglich ist. Diese Antwort – Dichten geschieht in Begeisterung – ist keine Antwort, sie ist eine Verweigerung der Antwort. Die Antwort, die Sokrates 24auf die Frage nach der Möglichkeit der Kunst gibt, ist, daß diese Frage für die Kunst nicht beantwortet werden kann. Nach Sokrates ist die Kunst unmöglich – und deshalb ist auch ungewiß, ob sie überhaupt existiert: Ist der Wahnsinn der Dichter göttlich oder bloß sinnliche Berauschtheit?
Sokrates’ Antwort, daß die Frage nach der Möglichkeit der Kunst nicht beantwortet werden kann, ist richtig. Man muß sie aber richtig verstehen. Der erste Schritt dazu besteht darin, diese Antwort positiv zu lesen, als die Formulierung eines Paradoxes: Die Kunst ist unmöglich; deshalb ist sie möglich. Die Kunst ist nur möglich, weil sie – im Sinn des bisher erläuterten philosophischen Verständnisses praktischer Ermöglichung – unmöglich ist; es ist ihre praktische Unmöglichkeit, die die Kunst möglich macht.
Diese These soll im folgenden so erläutert werden, daß zunächst mit Valéry gezeigt wird, was dieses Paradox begründet (3.), und sodann mit Nietzsche, wie es zwar nicht aufzulösen, aber »untragisch«, also positiv gelesen werden kann (4.): Die Paradoxie der Kunst ist nicht die Figur ihres Scheiterns, sondern die ihres Gelingens.
3. Das Paradox von Machen und Werk
Paul Valérys Antrittsvorlesung zum Kolleg über Poetik am Collège de France im Jahr 1937[1] verschreibt sich einer Betrachtungsweise der Dichtung, die, so scheint es auf den ersten und auch noch den zweiten Blick, am weitesten in eine Richtung vorangeht, die derjenigen von Sokrates’ Behauptung diametral entgegengesetzt ist. Valéry definiert das Verstehen der Dichtung als »Poietik« – als Lehre vom »Machen«, das sich in einem »Werk« vollendet.[2] Das erinnert daran, wie bereits Aristoteles Sokrates’ Kritik der Dichtung begegnet: eben durch die Etablierung der Theorieform der Poetik, deren Aufgabe es ist, die Tätigkeiten – was man tun muß – zu untersuchen, durch deren Ausübung die Dichtung gelingt.[3] Die Poe25tik versteht die Dichtung »als eine gemachte, vom subjektiven Geist zustande gebrachte Verknüpfung«;[4] nicht jedoch im technischen Sinn – wenn das Machen technisch zu verstehen mit der Annahme einhergeht, diejenige Tätigkeit, in und aus der die Dichtung besteht, in Einzeltätigkeiten auflösen zu können, deren schrittweise Ausführung dichterischen Erfolg garantieren können soll. Daß die Poetik die Kunst von ihrem Machen her betrachtet, heißt vielmehr, daß wir von den Tätigkeiten – deren Ausdruck sie ist – wissen können, weil derjenige, der sie ausführt, der Künstler, von ihnen wissen muß; »außer sich« – wie Sokrates es beschreibt – ist die poetische Tätigkeit unmöglich. In der Theorieform der Poetik kommt das Verständnis der Kunst als Werk eines freien, seiner selbst bewußten Geistes zum Ausdruck.[5]
Valérys Idee einer »Poietik« knüpft an dieses Konzept an, aber zugleich weist er darauf hin, daß zwischen dem dichterischen Machen und dem dichterischen Gelingen, dem Hervorbringen des Werks, eine eigentümliche Spannung herrscht. Diese Spannung deutet sich bereits darin an, daß die »schaffende Tätigkeit« häufig mit »mehr Wohlgefallen, ja sogar mit mehr Leidenschaft [betrachtet wird] als das geschaffene Ding«.[6] Die »schaffende Tätigkeit« führt also nicht zu dem »geschaffenen Ding«, dem Werk als deren Ausdruck im »allgemeinen Bewußtsein« (Hegel), hin – wie die Poetik oder Poietik meint –, sondern von ihm weg. Zwischen dem Machen und dem Werk besteht eine Diskrepanz, ein Abstand, gar eine Kluft, die unüberbrückbar ist: Niemals gelangt man vom Machen 26zum Werk. Das Machen macht das Werk nicht, das Werk ist nicht durchs Machen gemacht.
Diese Einsicht artikuliert Valéry in einer Serie sich zuspitzender Befunde. Der erste Befund lautet, daß die Aufmerksamkeit aufs Machen für den, der etwas zu machen versucht, für den Macher also, das Machen torpediert. Wer darauf achtet, wie er etwas macht, kann nichts mehr machen – er verliert die Fähigkeit der Ermöglichung, des Gelingenlassens:
Zum Beispiel versteht man, daß ein Dichter mit Recht fürchten kann, seine ursprünglichen Fähigkeiten, seine unmittelbare Produktionskraft, durch eine Analyse, der er sie unterzöge, zu stören. Instinktmäßig weigert er sich, sie auf andere Weise zu vertiefen als durch die Ausübung seiner Kunst, und sich ihrer durch rationale Begründungen in umfassenderer Weise zu bemächtigen. Man kann glauben, daß unsere einfachste Handlung, unsere vertrauteste Geste, sich nicht vollziehen ließe, daß die geringste unserer Fähigkeiten uns zum Hindernis werden würde, wenn wir sie uns vor ihrer Ausübung im Geiste vergegenwärtigen und sie gründlich erkennen müßten. Achilles kann die Schildkröte nicht besiegen, wenn er an Raum und Zeit denkt.[7]
Das Machen zu denken, es zu erkennen und zu analysieren heißt, es als Machen zu zerstören. Das Machen kann nicht erkannt werden, es ist unerkennbar; denn gerade wenn wir es erkennen, ist es kein gelingendes Machen. Man kann somit (vielleicht) behaupten, daß aus dem Machen das Werk hervorgeht, aber man kann nicht verstehen, wie es aus dem Machen hervorgeht. Im Nachvollzug des Machens entzieht sich uns das Werk ins Unsinnige, Ungreifbare. Aus der Perspektive des Machens ist das Werk ein Ding der Unmöglichkeit – ein Un-ding.
Damit deutet sich für das Werk der Kunst ein anderes Gesetz der Negativität an als dasjenige, das Hegel für das normative Werk, das mit dem »Sich-Aussprechen der Individualität« brechen muß, um die Tätigkeit des Subjekts »in das Element der Allgemeinheit« hinauszustellen, formuliert hat: das Gesetz ästhetischer Negativität, die die Tätigkeit als wißbare, weil selbstbewußte von ihrem Werk trennt und das Werk über die wißbare, weil selbstbewußte Tätigkeit, der es seine Existenz verdankt, hinausgehen läßt. Während das normative Werk die öffentliche Wirklichkeit einer selbstbewußten 27Tätigkeit – des Sich-Aussprechens des Subjekts, nicht des Individuums – ist, besteht das ästhetische Werk der Kunst nur in der, ja durch die (Selbst-)Überschreitung jeder selbstbewußten Tätigkeit des Subjekts.
In Kurt Leonhards eindringlicher deutschen Übersetzung bringt Valérys Antrittsvorlesung diese Negativität, die das Werk und sein Machen verbindet und trennt, in einer Serie von Un-Wörtern zum Ausdruck, die beschreiben, was und wie das Kunstwerk ist. Zwei Beispiele dafür:
Die Unverhältnismäßigkeit des Werks:
Ein Blick genügt, um ein bedeutendes Monument zu würdigen, seine Schockwirkung zu erleben. Alle Berechnungen des dramatischen Dichters, alle Arbeit, die er daran gewendet hat, seinem Stück Ordnung und jedem Vers eine reine Form zu geben; alle Kombinationen von Harmonie und Orchestrierung, die der Tonsetzer aufgebaut hat; alle Meditationen des Philosophen, die Jahre, in denen er seine Gedanken hinauszögerte, zurückhielt und darauf gewartet hat, eines Tages ihren endgültigen Zusammenhang wahrnehmen und gutheißen zu können; alle diese Glaubensakte, alle diese Wahlakte, alle diese geistigen Umwertungen, innerhalb von zwei Stunden kommen sie endlich als fertige Werke dahin, den Geist des ANDERN, der plötzlich dieser gewaltigen geballten Ladung von geistiger Arbeit ausgesetzt wird, aufzurütteln, zu verblüffen, zu blenden oder zu verwirren. Es ist die Wirkung einer Unverhältnismäßigkeit.[8]
Die Unverhältnismäßigkeit des Werks bedeutet: Nichtentsprechung zwischen dem Tun des Künstlers und dem, was und wie das Werk in seiner Wirkung auf andere ist. Bewirkendes Tun und wirkendes Werk fallen auseinander, das Werk löst sich in seiner Wirkung vom Tun ab und steht in seinem Wirken für sich, aber damit auch unverstehbar da.
Die Unwahrscheinlichkeit des Werks:
Einerseits fühlen wir, daß das Werk, welches auf uns wirkt, uns so genau angepaßt ist, daß wir es uns nicht in anderer Gestalt vorstellen können. In gewissen Fällen höchster Befriedigung spüren wir sogar, daß wir uns in irgendeiner tiefen Art umformen, um der Mensch zu werden, dessen Sensibilität einer solchen Fülle des Entzückens und des unmittelbaren Erfassens fähig ist. Aber nicht weniger stark und wie mit einem ganz anderen Sinnesorgan fühlen wir zugleich: das Phänomen, welches diesen Zustand in uns verursacht und entwickelt und uns seine Gewalt zu spüren gibt, 28hätte auch nicht dasein können, ja beinahe nicht dasein dürfen; es gehört in die Kategorie des Unwahrscheinlichen.[9]
Die Unverhältnismäßigkeit zwischen Machen und Werk bedeutet, daß das Werk uns nicht mehr als möglich, sondern als unwahrscheinlich erscheint; als unwirklich, nicht in der Wirklichkeit erwartbar, der Ordnung der Wirklichkeit – der Wirklichkeit als Verwirklichung einer Möglichkeit – nicht zugehörig.
Die Unvereinbarkeit von Machen und Werk, die Valéry mit diesen Beschreibungen umkreist, findet ihre äußerste Zuspitzung in der Unvereinbarkeit des dichterischen Machens mit sich selbst. Im dichterischen Machen »kämpft [der schöpferische Geist] gegen das, was er gezwungen ist zuzulassen, zu erzeugen oder auszustreuen; kurz und gut gegen seine Natur«.[10] Dichterisches Machen ist Kampf gegen sich selbst, liegt im Widerstreit mit sich. Denn das dichterische Machen muß sich einerseits der Dispersion, der Zerstreuung und Zufallslenkung öffnen. Nur der Laune und Willkür des Augenblicks verdankt es die »Schätze von Möglichkeiten«, ohne die es gar nichts machen könnte, das heißt: nichts Dichterisches. Aber zugleich muß es gegen sie angehen; denn würde es sich ihnen überlassen und sich in ihnen verlieren, würde es ebenfalls nichts machen:
Hier aber zeigt sich ein sehr erstaunlicher Umstand: diese immer drohende Dispersion ist für die Herstellung des Werkes beinahe ebenso wichtig und hilfreich wie die Konzentration selbst. Wenn der Geist am Werke ist und gegen seine eigene Beweglichkeit ankämpft, gegen seine angeborene Unruhe und seine eigentümliche Vielgestaltigkeit, gegen das natürliche Zerfallen und Abgleiten jeder spezialisierten Einstellung, dann findet er andererseits in dieser Bedingung selbst unvergleichliche Hilfsquellen. Die Unbeständigkeit, die Zusammenhanglosigkeit, die Inkonsequenz, von denen ich sprach, sind ihm zwar Hemmungen und Begrenzungen in seinem Unternehmen folgerichtiger Konstruktion oder Komposition, sie bedeuten ihm aber ebensowohl Schätze von Möglichkeiten, deren Reichtum er in der Nähe ahnt, sobald er mit sich zu Rate geht. Sie bedeuten ihm Vorräte, von denen er alles erwarten kann, Gründe, die ihn hoffen lassen, daß die Lösung, das Zeichen, das Bild, das fehlende Wort ihm näher sind, als er sieht. Immer kann er in seinem Halbdunkel die Wahrheit oder die Entscheidung, die er sucht, erahnen, denn er weiß, daß sie von einem Nichts abhängen, 29von jener gleichen belanglosen Störung, die ihn unendlich davon abzulenken und davon zu entfernen schien.[11]