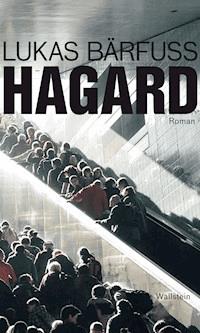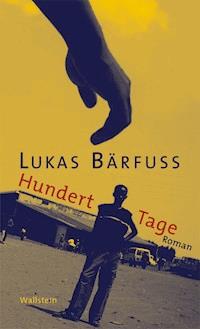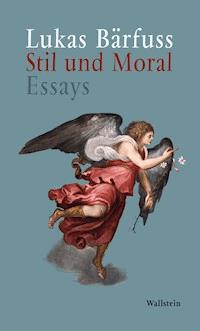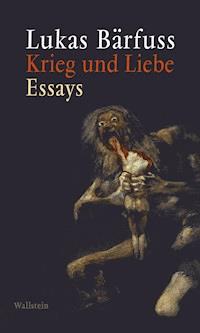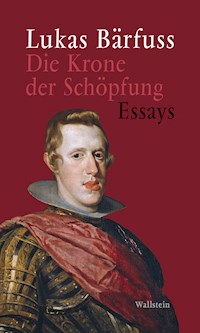9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adelina, Tochter italienischer Einwanderer, arbeitet in einer Zürcher Fabrik, als sie nach kurzem Liebesglück mit einem Kind allein dasteht. Sie verliert die Stelle, die Wohnung, kämpft ums Überleben. In der größten Not lernt sie Emil kennen, einen erfolgreichen Grafiker, der ihre Schulden bezahlt und Adelina mit der kleinen Emma bei sich aufnimmt. Außer an der Liebe fehlt es an nichts. Emil kauft ein Anwesen in den Bergen des Piemont und scheint auf gemeinsames Glück zu hoffen. Aber dann verschwindet das Kind, spurlos. Adelina macht sich auf die Suche, begleitet von einem schweigsamen Unbekannten. Er bringt sie nach Mailand, in eine Kommune, zu Menschen, die an die Revolution glauben und Adelina versprechen, die verlorene Tochter zu finden; sie muss nur bereit sein, sich dem Kampf anzuschließen, und mit ihren Schweizer Papieren über die Grenze gehen, auf eine gefährliche Mission.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Lukas Bärfuss
Die Krume Brot
Roman
Über dieses Buch
Adelina, Tochter italienischer Einwanderer, arbeitet in einer Zürcher Fabrik, als sie nach kurzem Liebesglück mit einem Kind allein dasteht. Sie verliert die Stelle, die Wohnung, kämpft ums Überleben. In der größten Not lernt sie Emil kennen, einen erfolgreichen Grafiker, der ihre Schulden bezahlt und Adelina mit der kleinen Emma bei sich aufnimmt. Außer an der Liebe fehlt es an nichts. Emil kauft ein Anwesen in den Bergen des Piemont und scheint auf gemeinsames Glück zu hoffen. Aber dann verschwindet das Kind, spurlos.
Adelina macht sich auf die Suche, begleitet von einem schweigsamen Unbekannten. Er bringt sie nach Mailand, in eine Kommune, zu Menschen, die an die Revolution glauben und Adelina versprechen, die verlorene Tochter zu finden; sie muss nur bereit sein, sich dem Kampf anzuschließen, und mit ihren Schweizer Papieren über die Grenze gehen, auf eine gefährliche Mission.
Vita
Lukas Bärfuss, geb. 1971 in Thun, ist Dramatiker, Romancier und streitbarer Publizist. Seine Stücke werden weltweit gespielt, die Romane sind in zwanzig Sprachen übersetzt. Lukas Bärfuss ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und lebt in Zürich. Für seine Werke wurde er u. a. mit dem Berliner Literaturpreis, dem Schweizer Buchpreis und dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Zitat S. 92: The Rolling Stones, Angie, Text: Mick Jagger, Keith Richards
Zitat S. 187 f.: Lucio Battisti, Il mio canto libero, Text: Mogol
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Neil Krug
ISBN 978-3-644-01487-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm, aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt, fünfundvierzig Jahre vorher, um genau zu sein, an der Universität in Graz. Dort hatte ihr Großvater, ein Mann namens Angelo Mazzerini, während seines Studiums der Rechtswissenschaften die verbotenen Schriften von Cesare Battisti gelesen, und von da an verehrte er die Karstlandschaft Istriens als heiligen Boden, hasste er das Imperium, den österreichischen Kaiser und seine Henker. Für den Studenten aus Triest fand jede Frage ihre Antwort in der Geschichte, und mit Barzini sah er seine Heimatstadt als Bollwerk der römischen Zivilisation. Ohne den Abwehrkampf an der Adria hätten die Slawen längst das Abendland überrannt. Die Habsburger, deren Untertan er war, stützten diese Horden mit ihrem Geld, ihren Waffen und ihren Gerichten. Italiener wie er, Abkömmlinge eines Weltreichs, hatten im Himmel einen Verbündeten, auf Erden standen sie seit fünfzehnhundert Jahren alleine im Kampf gegen die Vernichtung. Ungeheure Mächte hatten sich verschworen, um die Latinität auszurotten, wie es in Dalmatien geschehen war, und wenn viele in Triest ihn für verrückt hielten, dann nur, weil sie sich von Wien hatten kaufen lassen.
Als Italien im Mai 1915 Österreich den Krieg erklärte, befand sich Angelo auf Urlaub in seiner Heimatstadt, und nach einer schlaflosen Nacht, in der er sich betend an Fortunatus wandte, den Patriarchen von Grado, der sich im achten Jahrhundert ebenfalls gegen ein Imperium, gegen Byzanz, gestellt hatte, zerriss er den Einberufungsbefehl des Kaisers und verließ im Morgengrauen, ohne von seinen Eltern Abschied zu nehmen, die Wohnung an der Via dell’Istria.
Über Udine, Padua, Ferrara und Bologna kam er bis nach Rom. Dort schloss er sich als Freiwilliger den Granatieri di Sardegna an und wurde nach einer dreiwöchigen Ausbildung an die Front bei Monfalcone verlegt. Beim Sturm auf die österreichischen Stellungen erlitt er eine Beinverletzung, und die Monate darauf, bis zu seiner Genesung, saß er als Leutnant der Territorialmiliz in den Bergen bei Garda ab, bevor man Angelo in ein Regiment versetzte, das im Mai 1916 auf der Hochebene bei Asiago fast vollständig aufgerieben wurde. Mit einer Tapferkeitsmedaille in Gold nahm er unter dem Herzog von Aosta an der Schlacht von Caporetto teil und kehrte nach dem Waffenstillstand von Villa Giusti im November 1918 in seine Heimatstadt zurück.
Mutter und Vater waren an der Cholera gestorben. Angelo, alleine in der elterlichen Wohnung, fand sich in der Zeit nach dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie im Leben nur schwer zurecht. In seinen Träumen begegnete er den sterbenden Kameraden, und sonntags, wenn seine Seele an der frischen Seeluft Linderung suchte, sah er ihre Gespenster mit ausgerissenen Augen und zerfetzten Beinstümpfen über die Mole kriechen. Er trank, rauchte und zermarterte sich das Gehirn, etwa, was er über Rossetti denken sollte, ob der geniale Ingenieur eher Bewunderung verdiente, da er mit einem Torpedoboot das Flaggschiff der Österreicher, die Viribus Unitis, im Hafen versenkt hatte, oder ob er ihn als Patriot verachten musste, weil er zu den Republikanern, den Verrätern am Vaterland, übergelaufen war.
Zu seinem Glück hörte Angelo an einem Donnerstag Ende Dezember im Hof der alten Kaserne einen ehemaligen Scharfschützen aus dem Bersaglieri-Regiment über Oberdan und die nationale Frage der Italiener in Venetien dozieren. Ein herrlicher Redner, dessen Worte die Herzen fanden, und als er von der religiösen Erbauung auf dem Schlachtfeld sprach, das neue Geschlecht beschwor, erstanden im heiligen Lärm der Artillerie, eine Elite, bereit, die nationale Wiedergeburt anzuführen, da bebte Angelos verwundete Seele, und wie dieser Mann, Mussolini war sein Name, den Karst erwähnte, den ewigen Hain der italienischen Märtyrer, da wusste der junge Mann, wer für seine und die Sache der Nation einstand.
Er fand eine Stelle als Buchhalter bei der Generali und hatte die Absicht, sich bei der Wahl zur nächsten Bürgerversammlung aufstellen zu lassen, aber auf einer Abendveranstaltung der Società di Minerva, bei der ein Professor aus Bologna über die archäologischen Ausgrabungen in Venetien berichtete, begegnete er Paola Carnieri, einer blonden Dame mit dünnem Haar, die sich den ganzen Abend auf den Arm ihres Vaters stützte und sich immer wieder nach Angelo umwandte. Sie war eigentlich keine Frau nach Angelos Geschmack, ihr Silberblick und ihre Blässe stießen ihn ein wenig ab, aber da sein Begehren bisher nur in den Schützengräben Erfüllung gefunden hatte, folgte er dem erotischen Spiel und wies Paola nicht zurück. An der Brust trug sie eine schwarze Stoffnelke, in Erinnerung an ihren Verlobten, der im letzten Kriegsjahr am Piave gefallen war, und wenn Angelo von seinen Kriegserfahrungen berichtete, von den nächtlichen Angriffen auf die österreichischen Stellungen, dann begann Paola am ganzen Körper zu zittern, ebenso, wenn er zur Politik wechselte, dem anderen Thema, über das er etwas zu sagen hatte.
Paola war kurzatmig, die gemeinsamen Spaziergänge fielen kurz aus, danach saßen die beiden in einem Caffè in der Altstadt, wo Paola anhänglich wurde, sich zu Angelo auf die Bank setzte, seine Nähe suchte, sich an ihn schmiegte, während sie mit leiser Stimme ihre Gedichte vorlas, somnambule Sonette, die sie im Selbstverlag herausgab. Angelo fand sie so peinlich wie Paolas Schwärmerei für D’Annunzio. Das war gewiss ein großer Mann, ein Nationalist und Kriegsheld, aber wenn sie von Fiume und den Arditi sprach und ihre patriotischen Heiligenlegenden mit Zitaten aus Il piacere garnierte, dann war klar, wie wenig Paola von der wahren, der politischen Bedeutung des Dichters begriff. So gingen die Nachmittage dahin. Sie tranken Kaffee mit Orangenlikör, Angelo rauchte eine Zigarre, und Paola hustete in ihr Taschentuch.
Paolas verwitweter Vater, ein hochgewachsener Mann mit Monokel, war ein ehemaliger Prokurist in der literarisch-artistischen Abteilung des Österreichischen Lloyd. Der alte Herr litt an Arthrose, aber er fand Gefallen an der Bekanntschaft seiner einzigen Tochter und förderte sie nach Kräften. Angelo, der die Politik mehr und mehr vernachlässigte, hatte das Gefühl, in einen Zangenangriff geraten zu sein. Die Carnieris ließen ihn keinen Moment in Ruhe, erstickten ihn mit Einladungen zu literarischen Soireen und Bridge-Turnieren, bis er nachzudenken begann, wie er sich ohne Skandal aus dieser Umklammerung befreien konnte. Bei einem gemeinsamen Theaterbesuch, sie spielten Goldoni, eine billige Komödie, wie Angelo fand, typisch venezianisch, ohne Ernst oder Tiefgang, packte der Vater in der Pause Angelo am Ärmel, redete auf ihn ein, beschwor ihn, sich seiner Tochter, die für einen Augenblick den Waschraum aufgesucht hatte, anzunehmen. Der Krieg habe das kranke Kind, wie er wisse, um das Sakrament der Ehe gebracht, Paola blieben ein paar Wochen, vielleicht Monate, mehr nicht, und Angelo müsse, wenn er ein Mann sei und einen Rest Ehre im Leib spüre, seine Tochter vor ihrem Tod an den Altar führen. Eine Heirat werde er nicht bereuen. Das Vermögen der Familie sei intakt, der Name ehrbar. Der Vater wischte sich das Auge trocken, setzte das Monokel wieder ein, dann ging die Glocke und der dritte Akt begann, von dem Angelo nichts mitbekam, zu sehr waren seine Gedanken mit dem Gespräch im Foyer beschäftigt. Nach dem letzten Vorhang verabschiedete er sich mit wenigen Worten, und als er Paolas Hand küsste, warf sie ihm aus ihren blauen Augen einen Blick zu, als hätte er ihr das Herz aus dem Leib gerissen.
Angelo kam nicht zur Ruhe. Der Hinweis auf die todbringende Krankheit, von der er nichts geahnt hatte, die flehentlichen Worte des Vaters, der Appell an das Ehrgefühl, nagten an seinem Gewissen, und vier Wochen später besiegelten Angelo Mazzerini und Paola Carnieri in der Kirche von San Bartolomeo den heiligen Bund der Ehe.
Paola zog in die Wohnung an der Via dell’Istria, und für Angelo begann ein peinvolles Warten. Mit dem Tod war er vertraut, im Krieg war er ihm täglich und tausendfach begegnet, aber es waren Männer und Packpferde gewesen, deren Sterben er beigewohnt hatte, niemals dem einer Frau. Mit ängstlicher Neugier verfolgte er Paolas letzten Kampf, fragte sich, wenn er sie in ihrem Zimmer am Schreibtisch sitzen sah, wann sie aufgeben und wie groß das versprochene Erbe sein würde. Er hatte sich nichts vorzuwerfen, er wünschte ihr den Tod nicht, aber er war nun einmal unumgänglich, das hatte ihr Vater gesagt. Doch das beklommene Warten wich über die Monate einem ungesunden, bitteren Überdruss, einer Langweile, die ihn lähmte und mit dem Gefühl erfüllte, dass die Krankheit seiner Frau auch ihm die Lebenskraft raubte, und er fragte sich, ob die Sterbende ahnte, wie ungeduldig er seiner Befreiung harrte.
Ablenkung fand er nun wieder in der Politik. Im Mai 1919 war er im Haus von Bartolomeo Vigini mit zweihundert Schwarzhemden bei der Gründung der faschistischen Partei in Triest zugegen. Paola erzählte er nichts davon, aber er nahm regelmäßig an den Versammlungen im Haus der Arbeitergesellschaft teil, dabei fühlte er sich dort fremd und ergriff niemals das Wort. Er war und blieb Nationalist, die Faschisten, denen er sich ideologisch und gesellschaftlich überlegen fühlte, waren nur Mittel zum Zweck. Die Führung bestand aus Wichtigtuern, Jacchia war ein Idiot, Comici ein Drückeberger und Suvich mutmaßlich Slowene. Dennoch hielt er ihnen die Stange, und dank seiner neuen Beziehungen ergatterte er eine subalterne Stelle im städtischen Finanzamt, mit einem lächerlich hohen Gehalt.
Paola war stolz auf den Erfolg ihres Gatten und wünschte sich, da sie noch in den Möbeln seiner Eltern lebten, eine neue Ausstattung, was Angelo überflüssig fand und ihr doch als letzten Wunsch nicht verwehren mochte.
Zu seiner Verblüffung kehrte Paola indes nach einem Kuraufenthalt im Veltlin sichtlich genährt und mit roten Wangen nach Triest zurück. Angelo fühlte sich betrogen, eine Tote auf Urlaub, die ihre Abreise verschob und entgegen allen medizinischen Diagnosen nicht sterben wollte. Sogar der Schwiegervater hatte vor ihr das Zeitliche gesegnet, mit dem beschämten Lächeln eines Mannes, der sein Versprechen nicht halten konnte. Mit den Kuren im Sanatorium von Sondalo zehrte die Tochter das väterliche Erbe auf, aber im August 1923, als Banelli Angelo in die Kommission berief, die sich um die Exhumierung des von den Österreichern hingerichteten Patrioten Oberdan kümmerte, eröffnete ihm Paola, dass sie in Erwartung sei.
Angelo hielt dies für einen Scherz, eine Todgeweihte, in der neues Leben entstand, das war absurd, und er vergaß die Nachricht auf der Stelle, überarbeitete weiter den Kommissionsbericht und erörterte die Frage, was die österreichischen Halunken mit dem Kopf des Märtyrers gemacht, ob sie ihn nach Wien geschafft hatten oder das heilige Haupt noch in der Stadt war. Im Frühjahr brachte Paola im Ospedale Maggiore einen gesunden Jungen zur Welt, den sie auf den Namen Mario Giuseppe tauften.
Von da an war alles anders. Angelo liebte dieses Kind, seinen Stammhalter, auf eine Weise, die er nicht gekannt hatte. Die Politik schien ihm nebensächlich, das Intrigantentum in der Partei lächerlich, das Wunder des Lebens überwältigte ihn, und oft stand er mit feuchten Augen an der Wiege des Sohnes, lauschte seinem Brabbeln und versank in seinem engelsgleichen Lächeln, in den blauen Augen seiner Mutter. Diese Rührung weitete sich und schloss bald auch Paola ein. Angelo erkannte in ihr nun die Frau, die das Geschlecht der Mazzerini am Leben erhielt, und er verfluchte sich für die Missachtung, für die verlorenen Jahre, in denen er in Paola nur eine Kranke gesehen hatte. Bekehrt durch die Liebe, fühlte Angelo Reue, er sprach sanft, kümmerte sich zärtlich um Mutter und Kind, und er fand in Paolas Haltung und in ihren Gedichten Grazie, in ihrem Dasein ein Heldentum, eine weibliche Tapferkeit, die jener der Männer in den Schützengräben in nichts nachstand. Er hoffte auf Nachkommen, zahlreicher als die Sterne über dem Adriatischen Meer, auf eine Dynastie, aber im Herbst nach Marios zweitem Geburtstag, als das Kind immer noch ohne Bruder oder Schwester war, verschlechterte sich Paolas Zustand. Sie hustete dickes Blut und war bald so schwach, dass sie sich nicht mehr um den Jungen kümmern konnte. Angelo stellte eine Kinderfrau ein, eine Deutsche aus Württemberg mit einem lahmen Bein. Voller Sorge und Ungewissheit begleitete er seine kranke Frau zur Kur nach Sondalo, und von dort, er war nach Triest zurückgekehrt, um sich der Intrigen und Machtkämpfe in der Partei zu erwehren, erreichte ihn an einem frühen Oktobermorgen das Kondolenz-Telegramm.
Angelo begrub Paola neben ihrem Vater auf dem zentralen Friedhof, verkaufte, weil er nicht wollte, dass sie in der Stadt kursierten, ihre Bücher einem Antiquar in Mailand, aber das Zimmer mit dem Schreibtisch ließ er unberührt. Der Junge schrie nach seiner Mutter und war zwei Monate nicht zu beruhigen, aber die Württembergerin meinte, das werde sich legen, wie jedes Kind in dem Alter werde auch Mario seine tote Mutter bald vergessen haben.
Mit Marios Schuleintritt entließ Angelo die Kinderfrau und kümmerte sich persönlich um seine Erziehung. Er las ihm Gibbons Werk über den Niedergang des Römischen Reiches vor, führte ihn zu Winckelmanns Kenotaph, zeigte ihm das Lapidarium, wo der Junge die Masken und die Amphoren in sein Skizzenheft zeichnen musste, und er verschaffte dem Kind einen Platz im Regio Istituto Tecnico in der Via Veronese. Mario dankte es dem Vater mit blendenden Zeugnissen, er durchlief die unteren Klassen als Jahrgangsbester. Ein kluger, etwas scheuer, aber allseits beliebter Schüler, der die schwarze Uniform der Opera Balilla tadellos in Ordnung hielt, auch wenn sein Vater erkannte, wie wenig geeignet der Junge für alles Militärische war. Aber es störte ihn nicht. Mit jedem Jahr glich Mario mehr seiner Mutter, er war verträumt, ein Einzelgänger, der seine Freizeit hinter den Büchern und mit Schachrätseln verbrachte, intelligent und still, die Sorge und der Stolz seines Vaters, der sommers mit ihm durch den Karst zog und ihn zu den Feldern der Ehre am Isonzo und in den Dolomiten führte. Dem Jungen, so glaubte der Vater, fehlte es an nichts.
In der Stadt kehrte keine Ruhe ein. Die Werftarbeiter streikten, Polizisten wurden erschossen, die Stadt drohte im Chaos zu versinken. Die Führung der Partei übernahmen auswärtige Funktionäre, sie begannen, den Saustall aufzuräumen, und Angelo sah mit Wohlgefallen, wie es den Slowenen an den Kragen ging. Der Sturm auf das Narodni Dom war erst der Anfang gewesen, jetzt wurden ihre Zeitungen und Banken verboten, man zwang sie, ihre Namen zu ändern. Im Finanzamt warf man einen Abteilungsleiter, einen gewissen Slataper, auf die Straße, wortwörtlich, und Angelo nahm seinen Posten ein. Zweimal hatte er Gelegenheit, sich neu zu vermählen, zweimal ließ er sie verstreichen. Er kam ohne Frau zurecht, und er wollte die Entwicklung seines Sohnes, der sich prächtig machte und den Angelo Schritt für Schritt auf größere Aufgaben vorbereitete, durch keine Stiefmutter gefährden.
Es war in jener Zeit, im Monat nach Paolas Todestag, als sich im Caffè degli Specchi ein Mann ungefragt an Angelos Tisch setzte. Es war nach Feierabend, Angelo wollte in Ruhe die Zeitung lesen und erkannte den Mann erst auf den zweiten Blick. Ein Vetter Paolas, den er zuletzt am Grab seiner Frau gesehen hatte, ein Trinker mit einem roten, spitzen Bart, gelben Augen und einem Glas Fernet in der Hand. Der Mann tat freundlich, entschuldigte sich für die Störung, erkundigte sich nach der Familie, dem Jungen, der mittlerweile den Lehrgang für künftige Vermessungsingenieure belegte. Der Vetter leckte sich den Fernet von den Lippen, sprach vom Ruf, den Angelo in der Stadt genieße, ein Vertrauter von Giunta, der Stolz der Familie. Dann sprach er unvermittelt von einer mütterlichen Linie der Familie Carnieri, die aus Istrien stamme, aus Capodistria, slawisches Blut ohne Zweifel, das sich bei Paola und auch bei Mario, wenn er sich recht erinnere, in den hellen Augen erhalten habe. Er werde das für sich behalten, niemand wolle, dass Angelo ins Gerede komme, er solle bloß vorsichtig sein.
Angelo wollte den Idioten auf der Stelle mit dem Cocktail-Spieß erstechen, aber er beließ es bei einer Reprise, die so dreckig war, dass der Vetter vom Tisch aufstand und das Weite suchte.
In den Wochen darauf stellte Angelo heimlich Nachforschungen an. Er wagte zwei riskante Anrufe, besuchte unter einem Vorwand das Stadtarchiv, aber seine Recherchen führten zu nichts und beantworteten keine Frage. Nur der Zweifel wurde genährt. Angelo fühlte sich vergiftet von diesem Vetter und seinen Worten. Falls etwas dran war an den Andeutungen, falls in der Geschichte alle Antworten lagen, dann fragte er sich, warum das Schicksal aus ihm einen Nationalisten geformt und ihn im Feuerofen des Krieges gebrannt hatte, warum er, Angelo, nicht mit seinen Kameraden auf dem Schlachtfeld geblieben war, warum er im Gegensatz zu Millionen seiner Generation das Morden überlebt hatte. Damit er sein Leben für die Erziehung eines Slawen verschwendete? Seine Existenz erschien ihm als Scherz eines liederlichen Gottes, ein Beweis für die Verdorbenheit der menschlichen Zivilisation. Nichts war heilig, kein Gefühl, kein Gedanke, kein Ideal und keine Idee, und wenn er jetzt den Jungen ansah, Marios helle Augen, dann überkam ihn namenlose Wut.
Mario verstand nicht, weshalb ihn sein Vater plötzlich mit Missachtung strafte, warum er kein Wort mehr an ihn richtete, aufgehört hatte, aus den Büchern vorzulesen, und den Jungen sonntags vor die Tür schickte. Was hatte er getan, welchen Fehler begangen, worin bestand sein Verbrechen? Er verzweifelte am Liebesentzug seines Vaters und strengte sich noch mehr an, aber keine gute Zensur und keine Auszeichnung brachten ihm dessen Anerkennung zurück.
Im Finanzamt hatte sich derweil der Wind gedreht. Die Nationalisten der ersten Stunde wie Angelo galten nun als verdächtig, als unsichere Elemente, die mit den lokalen Eliten, mit Juden und Freimaurern im Bunde standen. Angelo zog den Kopf ein, hoffte, der Sturm würde an ihm vorbeiziehen, er versah seinen Dienst so penibel und so unauffällig wie möglich, doch es war erst der Krieg, der ihm die Rettung brachte.
Bei einer Versammlung der Avanguardisti auf dem Platz vor der Börse sprach ihn der Präfekt an. Sein Sohn, sagte er zu Angelo, sei doch bald achtzehn und damit wehrfähig, aber da er das einzige Kind der Mazzerini und Angelo ein Kriegsheld sei, werde der Vater Mario mit einer Zahlung an die Partei und einer zusätzlichen Gebühr an den Präfekten von der Armee freikaufen können.
Mit diesem Angebot im Kopf setzte er sich an jenem Abend mit Mario zu Tisch. Er sah in die hellen Augen, in das einfältige Gesicht dieses Jungen, der nach einer zärtlichen Geste gierte und wissen wollte, wie er sich beim Aufmarsch am Nachmittag gehalten hatte, für ein liebes Wort des Vaters sein Leben gegeben hätte. Aber Angelos Herz blieb verschlossen. Wenn die Slawen ihm einen Balg untergeschoben hatten, der zu nichts gut war, außer Unglück zu bringen, dann würde er ihm Gelegenheit verschaffen, sich für die Nation zu bewähren. Er wusste, was dies bedeutete. Angelo hatte im Großen Krieg die vergeistigten Knaben gesehen, ohne Kraft und Härte, die durch keine Uniform, kein Gewehr, keine Gefechtsübung zu Soldaten wurden. Sie gingen schon in der Etappe ein, am Dünnschiss, am Heimweh oder einigermaßen ehrenvoll mit einem selbst gesetzten Pistolenschuss. Und Angelo beschloss, das Urteil über die Familie Mazzerini der Vorsehung zu überlassen.
Am nächsten Tag ging er in den Palast an der Piazza dell’Unita und teilte dem verdutzten Präfekten mit, wie schändlich sein Angebot sei. Niemals werde er seine Position ausnützen, niemals werde der Sohn sich vor dem Dienst am Vaterland drücken, Angelo redete sich in Rage, er fühlte, wie er sich ins Unglück redete, aber er konnte nicht zurück, er fand keinen Ausweg aus der Wirrnis, in die das Leben ihn geführt hatte. Der Präfekt, amüsiert über den Ausbruch, fragte sich, ob dieser seltsame Mazzerini der einzige aufrechte Patriot war oder einfach ein ausgekochter Idiot.
Und so rückte Mario in die Achte Armee ein, ohne zu erfahren, dass der Vater ihn vor dem Schlachten hätte bewahren können. An einem Freitagmorgen im Mai verabschiedeten sie sich, und am Bahnhof wollte er den Papa an sich drücken, aber Angelo ließ ihn nicht, für ihn war der Junge schon tot. Mario spürte, wie kalt die Hand seines Vaters war, wie abweisend der Blick, und nachdem der Mann mit der roten Mütze das Signal gegeben, nachdem der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte und verschwunden war, irrte Angelo durch die Stadt, verlor sich, weil er nicht in den Straßen Triests, sondern bei seinem Sohn im Zug war, der Mario nach Leifers brachte, wo er im 232. Infanterieregiment das Handwerk des Tötens lernte, bevor man ihn an einem späten Maitag an den Bahnhof Branzoll in Bozen brachte. Dreißig Tage sollte die Reise in den Krieg dauern. In Warschau sah das Kind, das er war, zum ersten Mal zerschossene Brücken, Dörfer in Trümmern, Menschen auf der Flucht. In Brest-Litowsk alte Männer, Kinder, Juden waren es, von der SS zusammengetrieben, weiter mit dem Zug nach Minsk, den Dnjepr entlang, fünfhundert Kilometer in den Süden, nach Kiew. In Dnipropetrowsk war schon Herbst, deutsche, ungarische, rumänische Soldaten, der Matsch, der Schneeregen, der Winter, die Fliegerangriffe, das Mörserfeuer, das Morden, die Gedanken ohne Unterlass beim Vater, der zu Hause in Triest mit jedem Tag den Verrat an seinem Sohn schmerzlicher bereute.
Angelo vermisste den Sohn, den er hätte retten können, und er verstand von Tag zu Tag weniger, was ihn zu diesem Verrat getrieben hatte. In Rom hatten sie den Duce abgesetzt, verhaftet und wieder befreit, die Deutschen in der Stadt, die Kärntner übernahmen das Mord-Kommando, Rainer und sein Henker Globocnik, Vorsitzender des Sondergerichtshofes und ein geborener Slawe, ein Nationalsozialist, ein Deutscher, ein Österreicher, was nicht die geringste Rolle spielte, denn die Menschen, so erkannte Angelo, einerlei welcher Sprache oder Herkunft, teilten sich in nur zwei Kategorien auf, in die Gerechten und in die Verbrecher, und Globocnik, aus welchem Loch er auch gekrochen war und welche Uniform er auch tragen mochte, war ein Massenmörder, er ließ die Juden zusammentreiben und sperrte sie in die Risiera di San Sabba, und jeder in der Stadt kannte die Richtung und das Ziel der Waggons der Reichsbahn. Wer sich mit ihnen eingelassen hatte, war ebenfalls ein Verbrecher, und er, Angelo, zählte sich dazu.
Er verfluchte die Bücher, nichts als Lügen, er verfluchte die Geschichte, ein einziges Verbrennen, er verfluchte Gott, der die Menschen zum Narren hielt. Es war eine kurze Erlösung, als Mario eines Tages vor der Tür stand, lebend zwar, aber unheilbar zerrüttet vom Krieg. Die Scham zerstörte den Vater, es war ihm unmöglich, seinem Sohn in die Augen zu sehen, Augen, deren Farbe er einst geliebt, dann gehasst hatte, und die jetzt nicht mehr blau, sondern schwarz waren, von der Kälte, von den Explosionen, vom Anblick der Hölle, durch die er im Donezker Becken gerannt, gegangen, gekrochen war.
Mario ahnte nicht, was der Vater sich vorwarf, er kannte dessen Schande nicht, er wusste nicht, dass er auf Vergebung wartete, und der Vater war zu feige, seinem Sohn die Schuld zu gestehen. Sie verrammelten die Fenster, verkrochen sich in der Wohnung, bis die Alliierten die Stadt einnahmen und der Krieg zu Ende war. Vater und Sohn fanden sich auf eine stumme, wortlose Weise, in den Mahlzeiten, die sie in der Küche zu sich nahmen, in den Laken, die sie gemeinsam wuschen.
Als die Friedensglocken zum Aufbruch mahnten, wollte Angelo nicht, dass sein Sohn in der Stadt blieb, zu viel war geschehen, zu viele Morde, zu viel Verrat, man würde in Mario immer den Sohn eines Verbrechers sehen. Alles war vergiftet, verdorben, am besten wäre es, den Namen zu ändern, den Vater zu verleugnen.
Sein Junge sträubte sich, er verstand nicht, was da gerade geschah, und ahnte nicht, dass der Vater ihn zum zweiten Mal verstieß. Drei vergebliche Versuche unternahm er, ihn umzustimmen, an einem Abend in der Wohnung an der Via dell’Istria, an einem Sonntag bei einem Spaziergang über die Mole, in einer Bar, spätabends, unter betrunkenen Soldaten. Mario bat, er weinte, er drohte, er flehte. Es half nichts. Drei Monate noch, dann setzte ihn sein Vater vor die Tür.
Mit einer Vertreibung begann für Mario der Krieg, mit einer Vertreibung begann für ihn die Zeit des Friedens.
Ausgestattet mit zwei neuen Anzügen bestieg Mario an einem Sonntagmorgen im Juni den Zug nach Bologna. An der Piazza Santo Stefano fand er ein möbliertes Zimmer in der Pension einer frommen Witwe und schrieb sich am Polytechnikum ein, Ingenieurwissenschaften.
In einer Trattoria lernte er Fiorella kennen, eine junge Frau aus dem Cilento, Studentin der Medizin, Fiorella mit dem unbeschwerten Lachen und dem leichten Gang. Sonntags unternahmen sie lange Promenaden, besuchten die Museen, verkrochen sich ins Kino, und wenn die Witwe außer Haus war, liebten sie sich auf Marios schmalem Bett. Die restliche Zeit waren sie fleißig und saßen vor ihren Büchern.
Fiorella fiel das Studium leicht, sie bestand das Propädeutikum beim ersten Versuch, und auch Mario kam ohne Schwierigkeiten voran, absolvierte die Zwischenprüfungen, machte nach sieben Semestern sein Diplom in Erdvermessung, und während Fiorella eine Stelle als Assistenzärztin antrat, kümmerte sich Mario um ein Stipendium und einen Doktorvater. Alles war auf gutem Wege.
Bis er durch die seismischen Daten, die er für seine Dissertation auswertete, mit den Behörden im Friaul, seiner alten Heimat, in Berührung kam. Sein Vater warnte ihn. Mario fand das lächerlich. Es ging um Erdbeben, Erdbeben hatten nichts mit Politik zu tun. Mario widersetzte sich dem väterlichen Rat und setzte seine Forschungen fort, bis ein Mann, den Mario kaum kannte, ein Assistent am Institut für Bergbauwissenschaften, an der Universität Gerüchte über das Jahr 1943 streute, über das Frühjahr, um genau zu sein, über Vorfälle in Triest. Die Affäre schlug Wellen, und noch vor dem Sommer legte die Fakultätsleitung Mario nahe, sich mit dem Diplom zu begnügen und das Doktorat aufzugeben.
Mario war voller Zorn. Er hasste die Universität, den Vater, an den er sich gekettet sah und den er umso heftiger gegen den Rufmord, wie er es nannte, verteidigen wollte. Er würde seine Doktorarbeit fortsetzen. Wenn sie ihn loswerden wollten, würden sie ihn rauswerfen müssen.
Fiorella unterstützte ihn, stand ihm bei, mäßigte seinen Zorn und tröstete Mario in seiner Verzweiflung. Er solle die Sache nicht zu schwernehmen. Warum sich aufreiben in einem sinnlosen Kampf? Und was wisse man schon über seinen Vater und was der in Triest getrieben habe. Wie sie das meine, wollte Mario wissen, aber Fiorella ging nicht darauf ein und ermunterte ihn, eine Stelle zu suchen, in der Industrie zum Beispiel, der chemischen zum Beispiel. Ingenieure seien gesucht, er werde schnell Karriere machen können und ein gutes Gehalt verdienen. Ein Doktortitel, das sei hübsch, aber nicht entscheidend. Und so gab Mario auf, exmatrikulierte sich, verzichtete auf das Stipendium und räumte das Büro. Er war enttäuscht, er war erleichtert, er war Fiorella dankbar, dass sie ihn den Intrigen entrissen hatte, den Kämpfen, für die er, das sah er nun ein, kein Talent hatte.
An einem Nachmittag in der Pinakothek Anfang Oktober, vor Tintorettos Mariä Heimsuchung, teilte ihm Fiorella mit, sie habe jemanden kennengelernt, im Krankenhaus, ein Kollege, angehender Arzt. Mario werde das sicher verstehen, in der letzten Zeit hätten sie sich auseinanderentwickelt, so drückte sie sich aus. Aber Mario verstand gar nichts. Er wollte den Namen des anderen wissen, aber sie schüttelte den Kopf, er wollte wissen, ob sie mit ihm geschlafen habe, und da schüttelte Fiorella den Kopf nicht.
Unter Marios Füßen öffnete sich der Boden, sein Magen, sein Herz, alles fiel auf den Erdmittelpunkt zu, Zacharias und Johannes blickten mitleidig, die Muttergottes sang das Magnificat, aber es gab keine Rettung, nur das Gefühl absoluter Verlorenheit, von dem er einst gehört hatte, es sei gleichbedeutend mit dem Zustand der verdammten Seelen in der Hölle. Fiorella, die er danach für zwei schreckliche Stunden in ein Caffè zwang, hatte ihn verlassen, endgültig, er wusste es und konnte es nicht glauben. Er machte ihr bittere Vorwürfe, schimpfte sie eine Verräterin, aber sie beteuerte, wie wenig sein akademisches Scheitern mit ihrer Entscheidung zu tun habe. Damit verschwand sie.
Der Vater starb ein paar Monate später, ziemlich gesund und tags zuvor am Telefon wortkarg wie immer, am Abend die letzte Möglichkeit verpassend, den Sohn ins Vertrauen zu ziehen, frühmorgens, plötzlich, Herztod.
In den folgenden Monaten arbeitete Mario als Produktionsleiter in einer Lampenfabrik im Veneto, abends verzog er sich in seine Bude mit Kochplatte und Duschkabine außerhalb Vicenzas. In jener Zeit entwickelte er einen ungeheuren Appetit, er ging vier Mal die Woche in der Trattoria durch alle fünf Gänge, tunkte in einen Teller Suppe ein Pfund Weißbrot, es war, als müsste er die Welt fressen, verschlingen, und wog bald mehr als hundertzwanzig Kilo.
Die meiste Zeit kämpfte er alleine mit seinen Geistern. Sonntags sah man ihn auf der Rennbahn oder im Wettbüro. Er verspielte einen guten Teil des Geldes, das er aus dem Verkauf der Wohnung an der Via dell’Istria erhalten hatte, danach fiel er in eine Depression. Kündigung, Klinik Al pozzo eterno, der völligen Verzweiflung nahe, der Selbstauslöschung, dem Tode, als ihn am zweiten Samstag seines Aufenthalts im Sanatorium eine gewisse Margherita Pelli aus Padua ansprach, die Tochter einer Patientin, die im Alter von vierundfünfzig Jahren im Waschbecken das Blut des Heilands vorgefunden hatte, die erste einer Reihe von Visionen, die sie von da an heimsuchten. An Weltlichem hatte diese Frau jedes Interesse verloren, sie hatte den Betrieb und die Wohnung einem befreundeten Handaufleger überschrieben, der ihr die Zeichen deutete und seine Salbe aus Jerusalem zum Preis von reinem Gold verkaufte, bevor Margherita, ihr einziges Kind, sie entmündigen und ins Sanatorium stecken konnte.
Und an einem Tag, wann genau, weiß niemand, bei der Cassata nach dem Mittagessen, im Neonlicht des fensterlosen Speisesaals, an den wackeligen Tischen mit dem Wachstischtuch, verlor sich Margherita Pelli in Mario Mazzerini, in seiner dunklen Stimme, in den schwarzen Augen. Von da an, es war ganz unerklärlich, gehörte sie zu Mario, dem langsamen, zärtlichen und klugen Bären, der für Margheritas Nase so unwiderstehlich roch, und liebte ihn bedingungslos. Von seinen Gespenstern, von dem, was er erlebt hatte, erzählte er nie.