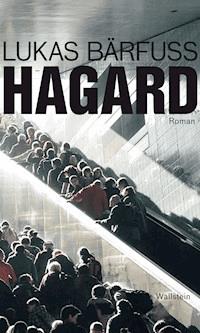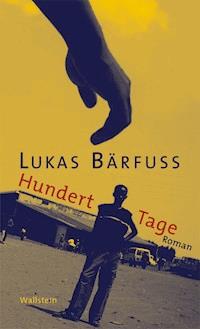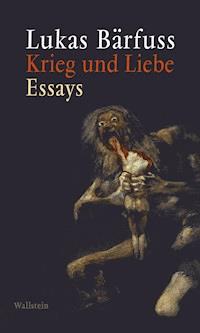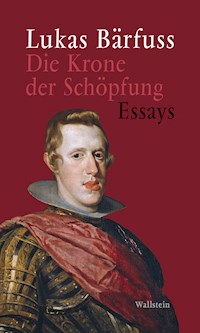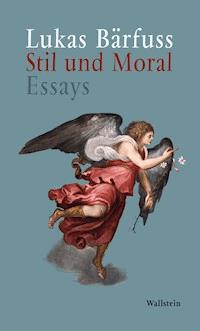
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Frisch und Dürrenmatt hat vielleicht kein Schweizer Schriftsteller mehr solche öffentliche Wirkung gezeitigt wie Lukas Bärfuss. Wenn Lukas Bärfuss über die großen Begriffe nachdenkt: Freiheit, Lüge, Raum, Zeit, »Wo bin ich hier?", dann geschieht das nie im im luftleeren Raum der Abstraktion. Immer erzählt er Geschichten. Er ist neugierig auf die Welt, auf das Kleine und auf das Große. Vor allem wendet er den Blick auf die Menschen, auf die Beziehungen zwischen ihnen: in der Liebe, der Arbeit, der Politik, in der Kunst. »Warum schweigen die Schriftsteller?", fragt Bärfuss fordernd. Er will sich einmischen, und er sieht sich dazu sogar in der Pflicht. Seine biographischen Erfahrungen am unteren Ende der Gesellschaft mögen den Blick geschärft haben für Ungerechtigkeiten und für wohlfeile Ratschläge. Er weiß: Die Antworten sind nicht umsonst zu haben, sie müssen in den Widersprüchen gesucht werden und bleiben zwiespältig. Immer wieder spielt Bärfuss in modellhaft durch, in welches Dilemma einer geraten kann, der im moralischen Sinn richtig handeln will. Was er über Robert Walser schreibt, gilt für ihn selbst: »Seine Literatur fragt mich nicht, wer ich bin, was ich kann, was ich gelesen habe, oder wie groß mein Wissen ist. Sie fragt mich bloß: Bist du bereit? Willst du sehen?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lukas Bärfuss
Stil und Moral
Essays
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2015www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus der Stempel GaramondUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf unter Verwendung eines Gemäldes vonTizian: Verkündigung an Maria (Ausschnitt)Druck und Verarbeitung: Pustet, RegensburgISBN (Print) 978-3-8353-1679-9ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2779-5ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2780-1
I
Kolonien
Neulich erinnerte ich mich an eine Begegnung in Maroua, einer Wüstenstadt im Norden Kameruns, an der Grenze zum Tschad. In der Mittagszeit, im Zedernhain am Rande der Hauptstraße, wohin sich die halbe Stadt vor der Hitze geflüchtet hatte, traf ich einen jungen Mann, einen Grundschullehrer, den ich zuerst für einen fliegenden Händler hielt und abzuwimmeln versuchte. Er aber wollte mir nichts verkaufen, sondern wissen, woher ich komme. Und ich erklärte in wenigen Worten die Schweiz, die Staatsform, das Klima, die Jahreszeiten, die vier Landessprachen, die Geschichte, den Reichtum – obwohl ich meine Ausführungen knapp hielt, schien der Mann ungeduldig zu werden, und als ich mit meinem Abriss schließlich zu Ende war, stellte er mir die Frage, um die sich seiner Ansicht nach alles drehte: Et vous, alors, vous avez été colonisé par qui?
Natürlich lachte ich über seine Einfältigkeit, wandte mich ab und beeilte mich, die knappe Zeit zu nutzen und die Hossère zu besteigen, den Hügel am Rande der Stadt. Und wie ich hinanstieg, beäugt von Kindern, die nicht verstanden, weshalb man freiwillig auf Berge klettert, da ging mir auf, wie berechtigt die Frage des Lehrers gewesen war. Wer hatte mir beigebracht, von Bergen sei mehr zu erfahren als von Menschen? Vielleicht waren mein Misstrauen und die Bevorzugung der Natur die Übernahme eines kolonialen Denkens?
Der Urtourist Johann Wolfgang von Goethe beschreibt in den Briefen seiner Schweizreise aus dem Jahre 1779 akribisch die geologischen und botanischen Gegebenheiten der Alpen. Über viele Seiten hinweg gibt er die Wege wieder, die Felsenschlünde, die Bewaldung, das Wetter, ein höchst detaillierter Bericht jener Gegend – und dann, am 9.11.1779, in Leukerbad, ganz unvermittelt dies: »Ich bemerke, dass ich in meinem Schreiben der Menschen wenig erwähne, sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Vorbeigehen, minder merkwürdig.« Einen Tag später, in Leuk, betritt er dann doch ein Haus. Aber: »Wie man auch nur hereintritt, so ekelts einem, denn es ist überall unsauber; Mangel und ängstlicher Erwerb dieser privilegierten und freien Bewohner kommt überall zum Vorschein.«
Knapp vierzig Jahre später folgt ihm die junge Mary Shelley. Die Idee zu Frankenstein soll ihr bekanntlich in Genf zugefallen sein, und man müsste einmal untersuchen, wie stark die autochthone Bevölkerung als Vorbild für ihr Monster diente. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie Goethe ergeht sich Mary Shelley in den Naturbeschreibungen, und wie bei Goethe fehlen die Menschen. »Die Schweizer erschienen uns damals, und die Erfahrung hat uns in dieser Meinung bestärkt, als ein Volk von langsamer Auffassungsgabe und Schwerfälligkeit.« Mehr erwähnt sie nicht. Wenn einmal Menschen auftauchen, dann nur als Bedrohung. Über die Passagiere einer Diligence, ein Postboot, schreibt sie: »Für Gott wärs einfacher, den Menschen neu zu erschaffen, als diese Monster sauber zu bekommen.«
Es waren nicht nur die Literaten und Touristen, die dieses spezifische Bild der Schweizer zeichneten. Das helvetische Direktorium, von Napoleon (unbestreitbar auch unser Kolonisator) nach der Abschaffung der alten Eidgenossenschaft eingesetzt, schreibt an den französischen Oberkommandierenden, man solle von Vergeltungen an den aufständischen Innerschweizern absehen, denn: »Es sind Wilde, die aufzuklären und der gesellschaftlichen Vervollkommnung näher zu bringen wir uns zur Aufgabe gemacht haben.«
Vielleicht liegt darin ein Grund für die schweizerische Verschwindungssucht, die ihren Niederschlag unter anderem bei Robert Walser findet. Zu Carl Seelig meinte er einmal, vor der Natur seien wir alle Stümper. Das Bankgeheimnis, überhaupt die sprichwörtliche Diskretion der Schweizer, ist vielleicht nichts anderes als die Einsicht, vor dem Hintergrund der Naturschönheiten unweigerlich als Wilde dazustehen. Und vor dieser Tatsache ist es besser, so wenig wie möglich aufzufallen. In der Landschaft zu verschwinden. Vielleicht ist Scham der Grund, der Europäischen Union nicht beizutreten, eine Folge der fortdauernden touristischen Kränkung. Auch nach Goethe und Shelley hat kein Tourist je unser Land besucht, um die Kultur kennenzulernen. Niemand interessiert sich für Schweizer Geschichte (am wenigsten wir selber), Schweizer Küche oder Schweizer Musik. Nein, dieses Land besucht man auch heute ausschließlich der Natur wegen. Sie ist unsere wahre Kultur. Den Menschen aber, dessen Kultur die Natur ist, nennt man einen Wilden. Dessen schämen wir uns, wie sich jeder Knecht für das Bild schämt, das der Herr von ihm zeichnet. Und wie jeder Knecht fürchten wir, das Bild könnte die Wahrheit über uns enthalten.
Der Feuerofen
Die einzige höhere Ausbildung, die ich in meinem Leben genossen habe, waren die Monate am staatlichen Lehrerseminar Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich war als Hospitant aufgenommen worden, und bereits diese Zulassung unter Vorbehalt grenzte an ein Wunder. Seit vielen Jahren war ich der erste Primarschüler, dem dies gelungen war, und wie ich das geschafft habe, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ein wohlwollendes Attest meines alten Lehrers war vermutlich dafür verantwortlich, denn die ordentliche Prüfung werde ich unmöglich bestanden haben. An jenem Tag saß ich in der Aula der Gewerbeschule vor den Prüfungsblättern ohne die leiseste Ahnung, wie ich auch nur eine der Mathematik- oder Französischaufgaben hätte lösen können. Meine Bildung reichte dazu einfach nicht aus.
Ich hatte lediglich neun Jahre Primarschule aufzuweisen, mit Ausnahme eines Abstechers in die Sekundar, aus der ich in der fünften Klasse nach einem Semester relegiert wurde. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das Niveau in der Primar war so tief, dass unsere Klasse nie über die Konjugation von avoir und être hinausgekommen ist. Englisch hatte ich nie gehabt, Physik und Chemie nur in Ansätzen, und auch der höheren Mathematik, der Algebra oder gar Differentialrechnung, war ich nie begegnet.
Natürlich bin ich von der Notwendigkeit der Bildung überzeugt. Es wäre töricht, die Erfolge der allgemeinen Schulpflicht zu bezweifeln. Der Unterricht ist für das gelungene Leben notwendig. Aber als Schriftsteller kann ich mich nicht damit begnügen. Wenn ich aufrichtig sein will, muss ich auch von den Schmerzen berichten.
Ich hatte gute Lehrer. Lehrer, die ihren Beruf ernst nahmen und sich um ihre Schüler kümmerten. Und vielleicht ist gerade ihre persönliche Aufopferung ein Zeichen für das Scheitern. Vielleicht dürfte eine Schule nicht darauf angewiesen sein, dass ein Lehrer sich aufreibt und verbraucht. Weshalb sie gescheitert sind, kann ich nicht sagen, aber alles in allem ist es ihnen nicht gelungen, mich auf die Institutionen vorzubereiten, auf eine Karriere in dieser Gesellschaft, ein Fortkommen in geordneten Bahnen. Vielleicht ist dieser Anspruch vermessen, vielleicht besteht das Erwachsenwerden immer aus einem Pendeln zwischen Widerstand und Anpassung, und vielleicht gibt es keinen pragmatischen Weg, um aus einem Kind ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft zu machen. Aber trotzdem mag ich nicht glauben, dass die Kämpfe, die ich zu führen hatte, notwendig oder gar geplant waren.
Ich hätte mir die Schwierigkeiten gerne erspart, obwohl ich nur von wenigen Momenten meiner Jugend sagen kann, dass es unglückliche waren. Aber dasselbe gilt für die glücklichen. Die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, den Fallen auszuweichen, die überall lauerten. Und es ist wahr, dass ein gefahrvolles Leben in der Rückschau eines ist, das zu erzählen sich lohnt – aber welchen Preis bezahlt man dafür? Niemand kann sich ein Leben nur aus Übungen und Proben wünschen, irgendwann verlangt man nach Ernstfällen, nach Momenten der Bewährung, der Herausforderung, und ich würde gerne glauben, dass die Schule den Raum darstellt, in dem unsere Jugend sich vorbereiten kann auf die Zumutungen des Lebens. Doch ich habe es anders erlebt. Das Leben und die Zumutungen waren von Anfang an da, Verrat war da, Lüge, Eigensucht, Faulheit, auch Freundschaft und Zuversicht, manchmal. Es gab keine Generalintendanz, die das jeweilige Maß bestimmt hätte, die, wenn die Anfeindungen zu groß wurden, eine Deckung baute und alles im Gleichgewicht zu halten versuchte. Es war Ernstfall, die ganze Zeit. Jede Schule will eine Vorbereitung sein, aber was nützt das einem Kind, dem diese Vorbereitung das Leben ist, weil es in der Ewigkeit des Augenblicks lebt?
Ich wollte Erfahrungen sammeln, um beinahe jeden Preis, ich fragte nicht nach dem Ergebnis, Resultate waren mir nicht einfach gleichgültig, sie waren nutzlos, weil sie in einer Zukunft eingelöst werden sollten, von der ich nichts ahnte, kein Bild, kein Nutzen – nichts, auf das zu warten oder hinzuarbeiten sich gelohnt hätte. Diese Gesellschaft hatte mir nichts anzubieten, nichts, wofür ich den Moment geopfert hätte. Ich wollte den Platz nicht, den man mir anbot, und zog es vor, meinen eigenen zu suchen, mit dem ich jedoch, als ich ihn gefunden zu haben glaubte, alles andere als zufrieden war.
Meinen Lehrern bin ich dankbar für die Gedichte, die sie mir zeigten, dankbar, dass sie ihre Niederlagen nicht allzu gut zu verstecken versuchten. Ich denke mit Zärtlichkeit an ihre Kindereien, an ihre Spleens, die sie ins Schulzimmer trugen. Ich danke ihnen für den Spott, den sie auf sich zogen, wenn sie auf ihrer Menschlichkeit bestanden. Der Lehrer in der siebten Klasse las uns Bobik im Feuerofen vor, eine Geschichte aus der russischen Revolution, geschrieben von einem Mann namens Wladimir Lindenberg. Bobiks aristokratische Familie bestimmt abends am Kamin das zu lesende Bibelkapitel, indem jemand eine Nadel an einer beliebigen Stelle zwischen die Seiten der Heiligen Schrift steckt. Und einmal, als die Bolschewisten schon vor der Tür stehen und das alte Leben untergeht, da zeigte die Nadel auf die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen des Nebukadnezar. Ich weiß nicht mehr, wie die Männer hießen, und ich will jetzt auch nicht aufstehen, um es nachzuschlagen. Ich möchte erzählen, wie unser Lehrer eine Bibel nahm und wie in Bobiks Geschichte eine Nadel zwischen ihre Seiten steckte. Sie landete an derselben Stelle, bei den drei Männern im Feuerofen des Nebukadnezar. Dieser Zufall erschütterte unseren Lehrer, und er schickte die ganze Klasse nach Hause. Da habe ich etwas gelernt, das sich schwer in Worte fassen lässt. Die wichtigsten Erkenntnisse liegen außerhalb der Systeme, sie folgen keinen Lehrplänen, und ihr praktischer Nutzen für das Leben ist ungewiss.
Meine Lehrer machten, was sie konnten, versuchten es mit Härte und mit Nachsicht, aber es half nichts. Die Probleme, die wir zu Hause hatten, konnten sie nicht lösen. Alle wussten, dass wir die schlechteste Schule der Stadt besuchten. Wir wussten, dass dort draußen, jenseits der Neunten, niemand auf uns wartete. Die meisten meiner Klasse lebten in Sozialwohnungen, was ihnen eine tägliche Schande war. Viele besaßen die blaue Karte der Stadt, mit der man zum halben Preis auf die Schulreise oder in die Ferienkurse durfte, was ebenfalls eine Schande war. Wir waren halbe Preise, unsere Eltern waren Säufer oder minderbemittelt, manchmal beides zusammen. Wir waren jung, wir hatten Pickel, und wir schämten uns für alles, was wir waren und was aus uns werden sollte. Was wir erreichen konnten, war eine lausige Arbeit zu einem lausigen Lohn, in einer miefigen Kleinstadt. Wozu hätten wir uns anstrengen sollen? Es würde kein Entkommen geben. Wir sahen, wie unsere Eltern lebten. Warum hätten wir nicht jede Minute unserer Kindheit genießen sollen? Noch standen für unseren Unsinn die Erwachsenen gerade, aber es würde nicht mehr lange dauern, und sie würden auch uns kleinkriegen mit ihren Betreibungsämtern, Sektionschefs und Sozialarbeitern.
Ich fand keine Lehrstelle, aber ich hatte auch keine gesucht. Ich schrieb sehr wenige Bewerbungen. Genau genommen gar keine. Ein Handwerk kam nicht in Frage, ich hatte zwei linke Hände. Auf einen kaufmännischen Beruf hatte ich keine Lust – die Vorstellung, nach der Schule weiter an einem Pult zu sitzen und gesagt zu bekommen, was ich zu tun hatte, löste nur mäßige Begeisterung aus. Mein einziger Versuch, an einen Lehrvertrag zu kommen, bestand in einem kurzen Gespräch mit Herrn Mahr, dem besten Buchhändler der Stadt, ein Deutscher. Er hatte schlechte Augen; wenn er das Verzeichnis lieferbarer Bücher konsultierte, berührte seine Nasenspitze beinahe die Seiten. Dazu zitterten seine Hände, es hieß, er habe im Zweiten Weltkrieg als Kind tagelang unter den Trümmern seines zerbombten Wohnhauses gelegen.
Seine Arbeit schien mir nicht übertrieben anstrengend, und zudem wäre ich umgeben von Büchern, eine verheißungsvolle Vorstellung.
Herr Mahr nickte ernst, als ich gestand, in seinem Laden arbeiten zu wollen, und er meinte, gleich nach der Schule mit einer Lehre zu beginnen sei unangebracht. Ein Buchhändler brauche ein gewisses Alter. Ich solle mich um eine Zwischenlösung bemühen. Dann würde sich irgendwo eine Tür öffnen, auch für einen Primarschüler.
So fügte ich mich in mein Schicksal und verschwand für ein Jahr auf einer Tabakplantage im Jorat, einem abgelegenen Gebiet im Waadtland. Der Bauer, der mich für ein paar lumpige Franken von morgens bis abends herumhetzte, war ein Choleriker und Trinker, der seine Kühe mit dem Milchschemel verprügelte, was nicht ungewöhnlich war für eine Gegend, in der man fremde Katzen, die auf dem Hof herumstreunten, kurzerhand mit dem Flobertgewehr erschoss und auf den Miststock warf. Ich erfuhr den Trübsinn der Provinz und den Trost des Weißweins, daneben lernte ich in diesem Jahr nichts. Die Wochenenden verbrachte ich in meiner Heimatstadt, wo ich, da meine Mutter in eine andere Gegend gezogen war und sich niemand um mich kümmerte, den Reiz der Freiheit entdeckte und tat, wonach es mich gelüstete. Irgendwann während dieses Jahres kam ich auf die Idee, mich für die Aufnahmeprüfung im Lehrerseminar anzumelden, warum, bleibt schleierhaft.
Und wundersamerweise wurde ich aufgenommen, aber das Jahr als Knecht und die Momente der uneingeschränkten Freiheit, die ich an den Wochenenden und in der Zeit nach meiner Rückkehr aus dem Welschland gekostet hatte, hatten mich verdorben. Ich bin sicher, dass sich die Lehrer alle Mühe gaben, mich zu einem ordentlichen Mittelschüler zu formen, ein ehrenvolles und gänzlich hoffnungsloses Bemühen. Ich war ein unausstehliches Miststück, ohne elterliche Kontrolle, verwildert, aufsässig und allergisch gegen jede Autorität. Ich trieb mich herum, wechselte meinen Wohnsitz alle paar Wochen, bis ich mich auch bei den neuen Vermietern unmöglich gemacht hatte und schließlich auf der Straße landete. Geld hatte ich keines, ich ernährte mich von dem, was man früher als Mundraub bezeichnete. Ich malte mir spaßige T-Shirts mit den letzten Worten berühmter Amokläufer, in denen ich den Unterricht besuchte. Ich hatte um eine Chance gebeten, und jetzt war ich dabei, sie zu verspielen. Ich wollte nicht dazugehören. Ich redete mir ein, eine Schule, wo ich lernen musste, dass die Altsteinzeit zeitlich vor der Jungsteinzeit kam, könne nichts taugen.
Das Lehrerseminar war keine Eliteschule, aber es herrschte ein liberaler, aufgeklärter Geist, und die Lehrer ertrugen mich länger, als ich erwartet hatte. Sie wollten mich einfach nicht rausschmeißen. Deshalb ging ich eines Tages einfach nicht mehr hin. Niemand vermisste mich, niemand fragte nach mir, sie wussten auch nicht, wo sie mich hätten suchen sollen.
Die Jahre danach, bis ich zwanzig war, lebte ich von Gelegenheitsarbeiten und wohnte bei jedem, der mich ein paar Wochen ertrug. Der Wirtschaft ging es gut, man brauchte Hilfsarbeiter. Ich konnte freitags in einem Temporärbüro meine Dienste anbieten und am Montag auf irgendeiner Baustelle anfangen. Ich hasste das stundenlange Herumstehen in einem feuchten Rohbau, aber es war weniger schlimm, als in einer Gewerbehalle am Stadtrand Fertigchalets für den japanischen Markt bauen zu müssen. In diesen Betrieben gab es Stempeluhren, Betriebsleiter und Zeitglocken – für mich gleichbedeutend mit den vier Reitern der Apokalypse. Da zog ich den Gerüstbau vor, obwohl man dort im Akkord arbeitete, den ganzen Tag Eisenelemente stemmen musste, bis man abends nicht mehr wusste, ob man überhaupt noch Arme hatte. Was aber immer noch besser war, als die Gerüste wieder abzubauen und auf einem wackeligen Brett sechs Meter über dem Boden Elemente auffangen zu müssen, die einem der angetrunkene Vorarbeiter von irgendwo hoch oben zuwarf. Am liebsten arbeitete ich als Magaziner. Ich war alleine, und man ließ mich in Ruhe. Rüstlisten, Beutelsuppen und Heizungsventile waren mir lieber als Menschen.
Wenn ich ein paar hundert Franken verdient hatte, machte ich mich aus dem Staub. Genoss meine Freiheit. Trieb mich mit Freunden in der Gegend herum, aber jene, die wochentags tun und lassen konnten, was sie wollten, wurden immer weniger, und die wenigen wurden von Woche zu Woche blasser und ausgezehrter. Die meisten verschwanden über kurz oder lang in den staatlichen Institutionen, entweder im Jugendknast auf dem Tessenberg oder in der Irrenanstalt Münsingen, je nachdem, ob sie für kriminell oder nur für verrückt gehalten wurden.
Ich weiß nicht, was mich rettete. Vermutlich waren es zwei Dinge. Ich las. Mit siebzehn das Lob der Torheit von Erasmus von Rotterdam. Mit achtzehn machte ich mich an Hegels Phänomenologie des Geistes und Eschenbachs Parzival. Bücher, von denen keiner, den ich kannte, je gehört hatte. Aber ich lernte, dass diese Texte weltberühmt und überall bekannt waren, außer in meiner Heimatstadt. Sie gehörten zu einem Boden, auf den auch meine Gesellschaft gebaut war, ohne dass sie etwas davon zu wissen schien. Meine Lektüre machte mich in meiner Welt zu etwas Besonderem. Sie verlieh mir eine Identität, eine Bildung, die mich von den anderen unterschied und mir einen Wert gab, einerlei, für welchen Taugenichts und Tagedieb man mich halten mochte.
So habe ich Bildung seither verstanden, als eine Möglichkeit, ein Mensch zu werden, der sich unterscheidet, der anders ist und der diese Differenz nicht als Makel, sondern als Auszeichnung versteht. Deshalb missfallen mir die Entwicklungen, die Bildung standardisieren und Leistung vergleichbar machen wollen. Aber viel wichtiger war für mich damals, dass ich durch die Bücher aus meiner Welt hinausfand, einen Zugang zu einem Kosmos entdeckte, in dem die Gegenwart nebensächlich war, eine Maschine, die mich durch die Zeit und über die Grenzen meines Daseins hinweg führte.
Das andere, was mich rettete, waren ein paar Menschen. Die Heimatstadt hatte ich irgendwann endgültig verlassen müssen, es gab da zu viel verbrannte Erde. Nach der Ewigkeit von zwölf Tagen wurde ich aus der Rekrutenschule entlassen, und als müsste er das Versprechen seines Kollegen Mahr einlösen, gab mir ein Buchhändler Arbeit. Eine Stelle in der Comicabteilung seiner Buchhandlung. Das waren nicht die Bücher, die ich las, aber es waren immerhin Bücher, und ich hatte zum ersten Mal eine Arbeit, die ich mochte. Ich war morgens pünktlich, las mich in der Freizeit durch das Sortiment und kannte bald für jede Lebenslage den richtigen Comic. In jener Zeit, ich war gerade zwanzig und also erwachsen geworden, begann ich zu schreiben.
Ich mag den ReformatorHuldrych Zwingli nicht. Warum
Zuallererst mag ich seinen Namen nicht. Zwingli klingt ähnlich wie Zwängli, nach einem, der seinen Kopf gegen alle Vernunft und Widerstände durchsetzen muss, was für diesen Mann ja tatsächlich zutrifft. Er war ein großer Zwängli und erzwang sich seine Auffassung der Welt und des Himmelreichs bis zur eigenen Vierteilung und Verbrennung.
Nun soll man einen Menschen, auch nicht einen Toten, nie wegen seines Namens verurteilen. Daran trägt er so wenig Schuld wie an seinem Äußeren, das ich bei Zwingli, nebenbei, ebenfalls nicht mag. Das bekannte Porträt, im Holzschnitt überliefert und in den Schulbüchern abgedruckt, zeigt ein feistes Gesicht, mit dem Ansatz eines Doppelkinns, als habe er zu viel Milch und Butter genossen, und die schweren Lider kenne ich von den Augen der Choleriker.
Das sind keine besonders stichhaltigen Gründe, weshalb ich Zwingli nicht mag. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht viel über ihn. In Wildhaus geboren, in Einsiedeln Pfarrer, in Zürich Reformator, als Asche mit Unrat vermischt und in alle vier Winde zerstreut auf dem Schlachtfeld in Kappel am Albis, Fockmann hieß sein Mörder, ein Söldnerhauptmann.
Die Abneigung muss an meiner Herkunft liegen, leider, und dafür kann nun ich wieder nichts. Man nennt jene Gegend, aus der ich stamme, auch den schweizerischen Bibelgürtel. Jeder Hof sei eine eigene Kirche, sagen die Leute, so viele verschiedene christliche Bekenntnisse gibt es. Ich wuchs mit allen möglichen Bibeln auf. Am Neuen Testament der Gideons gefiel mir der Eindruck über die Entstehung dieser Gemeinschaft christlicher Kaufleute, dass sich nämlich in einer windigen Nacht in einem Hotel in Amerika drei Reisende getroffen und nach dem gemeinsamen Gebet beschlossen hätten, mit ihren Waren auch das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen.
Ich wäre gerne einer von ihnen gewesen, in Amerika, in einem Hotel, in einer Nacht, im Kerzenschein. Überhaupt die Amerikaner: Joseph Smith, den Begründer der Kirche der Heiligen der Letzten Tage, der Mormonen, bewunderte ich. Sein Buch Mormon, das ihm ein Engel in einer einsamen Nacht offenbart haben soll, war eine frühe Lektüre und erscheint mir noch heute als eine singuläre literarische Leistung.
Am liebsten aber war mir die senfgelbe Kinderbibel der dritten großen amerikanischen Sekte, der Zeugen Jehovas. Ich verliebte mich in die Erzengel, die in weißen Gewändern auf weißen Hengsten über weiße Wolken durch einen glutroten Abendhimmel ritten. Die alttestamentarischen Helden glichen Mannequins, über deren goldenen Haaren Sturmgewitter dräuten, und die Posaunen des Herrn waren aus reinem Gold. Ich verehrte dieses Buch, und selbst die Zentrale dieser Sekte beeindruckte mich, ein weites Gebäude in unserem Viertel, gleich neben der Telefonverteilanlage, hinter Zäunen versteckt, irgendwie unheimlich, weil es sehr modern war und trotzdem nie jemand zu sehen war. Frau Stählin, eine Zeugin Jehovas, mit stahlgrauem Haar, hatte mir diese Bibel geschenkt. Meiner Mutter brachte sie den Wachturm und das Erwachet!, die Sturmschriften dieser Gemeinschaft, und ich weiß nicht, ob meine Mutter sie jemals las, aber ich erinnere mich deutlich, wie sie über den Sämann, das Pfarrblatt der reformierten Gemeinde, schimpfte, er sei langweilig und schlecht geschrieben.
Natürlich hätte sich Mutter nicht im Traum einer Sekte angeschlossen, und auch ich dachte niemals daran, irgendeiner der Kirchen beizutreten, die in meiner Umgebung nach Seelen fischten. Obwohl die Versuchung groß war. Wir waren dabei, als der Nachbarsohn seine wunderschöne Braut im Mormonen-Tempel heiratete, und mussten anerkennen, dass diese Leute eine Menge von Ritualen und sakraler Architektur verstanden. Das kupferne Taufbecken mit den Dimensionen eines Swimmingpools und den vier Wasser speienden Stieren alleine war eindrucksvoller als unsere ganze Stadtkirche.
Die Methodisten beeindruckten mich weniger, es waren brave Menschen, die stille Gottesdienste feierten. Ihr dramatisches Gegenstück waren die Evangelikalen von der Zeltmission, manche von ihnen mit radikalen Ansichten, Extremisten, die nach Jerusalem pilgerten, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass die Heilige Stadt nicht in die Hände der Ungläubigen gefallen war. Selbst diese Fanatiker flößten mir nicht die geringste Angst ein. Manche fand ich albern, die Mädchen vom Brüderverein etwa, doch bloß, weil sie sich mit ihren knöchellangen Röcken und den Haarzöpfen nicht um ihr Aussehen zu scheren schienen, für das ich mich beim weiblichen Geschlecht mehr und mehr zu interessieren begann.
Die religiöse Bedrohung in meiner Kindheit ging nicht von den Sekten, sondern von der bernischen Staatskirche aus, und die war zwinglianisch. Die blaue Zürcher Bibel verabscheute ich von ganzem Herzen. Die protestantischen Kirchen mied ich, wo ich konnte, die moderne Johanneskirche aus Beton nicht weniger als die vielhundertjährige Scherzligkirche, und jenen staatlichen Kirchenunterricht, den man in der siebten Klasse Kinderlehre, später dann Präparandenunterricht und Unterweisung nennt, habe ich statt dreier Jahre bloß einige Wochen besucht. Ich verpasste auch die Konfirmation, aber man sollte sich und seine Absichten nicht zu sehr stilisieren, und ich will nicht behaupten, in mir habe sich die Tradition der Häresie erhalten, für die unsere Gegend bekannt war. Die Oberländer waren die letzten, die das neue Bekenntnis annahmen, nicht freiwillig, mit ein paar hundert Hellebarden mussten sie überzeugt werden, dass der Eintritt ins Himmelreich keiner katholischen Vermittlung bedarf. In den abgelegenen Tälern war die rechte Gesinnung schwer zu kontrollieren. Die Täufer blieben ihrem Glauben durch die Jahrhunderte treu, trotz protestantischer Verfolgung. Als wir in der Schule das Tagebuch der Anne Frank lasen, da hatte ich früher ähnliche Verstecke in den Emmentaler Bauernhäusern gesehen. In Verschlägen unter dem Heustock hatten sich die Täufer vor den Berner Häschern und ihrem zwinglianischen Furor verkrochen.
Ich selbst verweigerte den Unterricht aber weniger aus Überzeugung, sondern vor allem aus Eitelkeit. Ich fand, der Widerstand mache mich verführerisch. Jedenfalls gefiel er meiner Mutter. Der Pfarrer unserer Kirchgemeinde erschien bei uns, um über mein Fernbleiben zu reden. Aber meine Mutter warf den armen Mann kurzerhand aus der Wohnung – allerdings nicht bevor sie die Verhältnisse auf den Kopf gestellt und dem Pfarrer ihrerseits eine Predigt gehalten hatte, deren grundsätzlicher Inhalt die Lästerlichkeit war, als Gottesmann im städtischen Parlament zu sitzen. Auch das große Pfarrhaus schien ihr des Teufels. »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«, lehre das Johannes-Evangelium, und wer in Gottes Namen rede, habe in Armut zu stehen.
Dies war, genau genommen, eine Kritik an den wesentlichen Prinzipien des Zwinglianismus. Sie leuchtet mir noch heute ein. Keiner der Reformatoren verstand die Forderung nach religiöser Umwälzung auch sozial. Die weltlichen Verhältnisse mochten so ungerecht bleiben, wie sie waren. Mit den aufständischen Bauern ging Luther so rücksichtslos um wie mit den Juden, und Zwingli ließ die widerspenstigen Täufer kurzerhand in der Limmat ertränken. Was religiöse Toleranz bedeutet, sollte man nicht unbedingt einen Protestanten fragen.
Trotzdem besteht natürlich kein Zweifel: Die Reformation war geschichtlich unvermeidlich, das sagt uns die Vernunft. Und es wäre blödsinnig, sich die Französische Revolution und den Sieg der bürgerlichen Freiheiten ins Europa des sechzehnten Jahrhunderts zu wünschen, geschweige denn nach Zürich. Es hilft nicht, sich die Dinge zu erträumen, aber deswegen brauche ich Zwingli noch lange nicht zu mögen. Ein Mensch glaubt schließlich zuerst seiner Mutter und dann erst der geschichtlichen Entwicklung. Und ich will nicht daran denken, dass die Erinnerung an eine offene Rechnung oder eine längst erlittene Schmach durch die Zeit an mich weitergegeben wurde, das wäre nur schlecht erfunden. Überhaupt macht einen die fromme Fragerei überempfindlich und man leidet an zwinglianisch eingebildeten Leiden bekanntlich nicht weniger als an wirklichen.
Das Zürich, in dem ich heute lebe, ist nicht mehr Zwinglis Zürich. Das Treiben in meinem Viertel ist bunt und wild, ganz und gar nicht protestantisch. Hier gibt es mehr Bekenntnisse, als ich mir in meiner Kindheit vorstellen konnte, und die wenigsten davon sind christlichen Glaubens. Hier leben Juden, Moslems, Hindus, Christen, Buddhisten, wahrscheinlich sogar Heiden und Tribalisten, und es gibt sie in den Schattierungen von ultraorthodox bis extremliberal. Mein Viertel nähert sich damit einem Idealzustand, in dem jeder seine eigene Religion hätte und sein eigenes Buch besäße, und in jedem Buch stünde mindestens ein Gebet für den armen Huldrych Zwingli und sein übles Geschick auf irgendeinem Acker im Zürcher Umland.
Masken
Neulich im Rietberg, dem ethnologischen Museum der Stadt Zürich, geriet ich bei der Betrachtung der großen Königsmaske der Bamileke aus dem Grasland Kameruns in einen Schwindel, der mich zurückführte an die Ufer des Kivusees, nach Ruanda, in einen Ort namens Kibuye. Dort saß ich einst an einem Freitag im frühen Juli auf der Veranda des Hotels Béthanie und ruhte mich von einer morgendlichen Exkursion aus, die bis zur katholischen Kirche oberhalb der Siedlung geführt hatte. Die Landschaft glich dem Bild eines englischen Genre-Malers, eine Idylle, deren Friede nur gestört wurde von einem Urwibutso, einem Gedenkort, der an den 17. April 1994 erinnerte, an jenen Sonntag, als an derselben Stelle bis zum Einbruch der Nacht 11 400 Menschen mit Macheten und Handgranaten totgemacht, danach zum größten Teil hinunter in den See geworfen wurden wie Tausende vor ihnen, die im Wasser trieben wie Totholz, von der Strömung zu Flößen versammelt und in die Buchten geschwemmt, wo Möwen und Bussarde sich an den Leichen gütlich taten.
In den letzten Wochen hatte ich Gelegenheit gehabt, die Grenzen dieses Landes und jene meiner Vorstellungskraft zu erkunden. Die Schönheit und der Horror hatten sich in jedem Moment umarmt und hatten meinen Geist ermüdet. Deshalb hatte ich einen Ort gesucht, um mich auszuruhen, und war auf dieses Hotel verfallen, eine Anlage aus wenigen Bungalows, auf einer Landzunge einige Kilometer außerhalb der Siedlung gelegen. In der Mitte des Nachmittags kam ich an. Man gab mir ein Zimmer, das sauber, ordentlich und ruhig war und in dem ich es keine zehn Minuten aushielt. Die Stille und die Geckos, die mich von den Wänden schwarz beäugten, ließen mich aus meinem Bett stürzen und zurück in den Ort fliehen, wo ich Menschen erwartete und auf ein Treiben hoffte, das meine Geister ablenken und zerstreuen würde.
In einem Gasthaus fand ich eine Mahlzeit, wie sie überall aufgetischt wurde, gebratenes Huhn, dazu Kartoffeln und Bier. Das Essen und der Alkohol beruhigten mich, und als ich die Rechnung beglichen hatte und mich auf den Weg ins Béthanie machen wollte, war die Nacht hereingebrochen, eine mondlose Finsternis, in die ich mich tastend hineinbewegte. Die Lichter der Siedlung noch im Rücken, fand ich die Straße, die hinaus auf die Halbinsel führte, aber nach der ersten Kurve war der letzte Schein gewichen und ich war von einem Schwarz umgeben, das ohne Frage blieb, eine feuchte Finsternis, die mich anzufassen schien, in der ich mit jedem Schritt tiefer versank. Nur die Füße gaben mir eine Ahnung von der Richtung: Solange ich Kies und Erde spürte, konnte ich davon ausgehen, nicht in den Wald zu irren und mich zwischen den Büschen zu verlieren. Rechts und links herrschte ein unheimliches Getöse, riesenhafte Frösche schrien, und es war kein Quaken, wie ich es von zu Hause kannte. Die Rufe dieser Lurche glichen dem Klingen von Glasglocken, hell und klar wie Cymbale, und ich wäre nicht erstaunt gewesen, mich mit dem nächsten Schritt in einem Sumpf zwischen diesen lärmenden Amphibien und ihren Instrumenten zu finden.