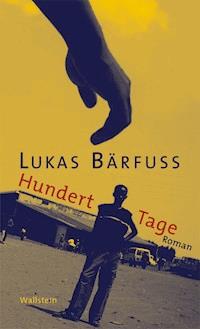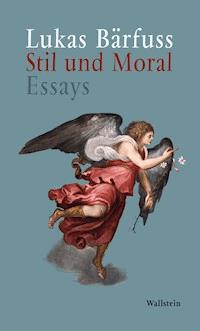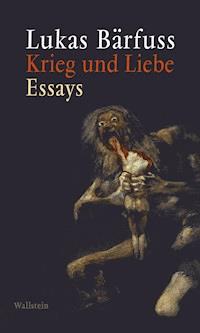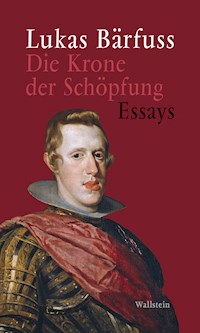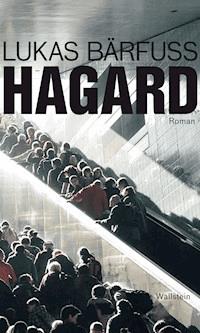
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In jedem seiner Romane wagt Lukas Bärfuss sich auf neues Terrain. In »Hagard« folgt er einem Verfolger, und als Leser fühlt man sich fortwährend ganz nah an dessen Kopf. Ein Mann, eben stand er während des Feierabendgedrängels noch am Eingang eines Warenhauses, folgt aus einer Laune heraus einer Frau. Er kennt sie nicht, sieht sie auch nur von hinten, aber wie in einem Spiel sagt er sich: Geht sie dort entlang, folge ich ihr nicht weiter; geht sie in die andere Richtung, spiele ich das Spiel noch eine kleine Weile weiter. Es bedeutet ja nichts, niemand kommt zu Schaden, und der Abstand in der Menge ist so groß, dass die Frau es gar nicht bemerken wird. Eher ist es eine sportliche Aufgabe, sie in der Menge nicht zu verlieren. In einer knappen Stunde hat Philip ohnehin einen wichtigen Termin. Aber schon fragt er sich, ob der nicht auch zu verschieben wäre, bis zur Abendverabredung bliebe ja noch etwas Zeit. Was ihn bewegt, ist erst einmal unklar. Ist der Verfolger einfach ein gelangweilter Schnösel? Ein Verrückter? Ein Verbrecher? Er scheint selbst vor etwas zu fliehen. Etwas Bedrohliches liegt in der Luft, etwas Getriebenes. Ein atemloser Sog entsteht, in den auch der Leser gerät, je länger die Verfolgung anhält. Allen Sinneswahrnehmungen haftet etwas beunruhigend Surreales an. Die aufgerufenen Fragen über unsere Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert gewinnen eine unabweisbare Schärfe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lukas Bärfuss
Hagard
Roman
Inhalt
Seit viel zu langer
Im selben Augenblick
Und da ist sie
Als sie die Straße
In den ersten
Für Muriel
Es ist für mich das Gleiche, von wo ich anfange;
denn dahin kehre ich wieder.
Parmenides, Fragment V
SEIT VIEL ZU LANGER Zeit versuche ich, Philips Geschichte zu verstehen. Ich will das Geheimnis lüften, das in ihr verborgen ist. Ein ums andere Mal bin ich gescheitert und konnte das Rätsel jener Bilder nicht entschlüsseln, die mich heimsuchen, Bilder der Grausamkeit und der Komik, wie in jeder Erzählung, in der das Begehren auf den Tod trifft.
Ich weiß alles, und ich begreife nichts. Ich kenne die Abfolge der Ereignisse. Ich weiß, wie die Geschichte anfängt, ich kenne den Tag und ich kenne den Ort: Es ist der Brezelstand vor dem Warenhaus beim Bellevue. Ich weiß, wann sie ihr Ende findet, nämlich sechsunddreißig Stunden später, am frühen Donnerstagmorgen des dreizehnten März auf einem Balkon irgendwo in der Vorstadt. Auch die Ereignisse, die dazwischen liegen, sind geklärt: die Sache mit dem Pelz, die erste kalte Nacht im Wagen, die fehlende Börse, die Elster, der verlorene Schuh, der tote japanische Mathematiker – all dies liegt offen zu Tage. Die Umstände aber, die Bedingungen, die jene Ereignisse ermöglicht haben, bleiben verborgen. Und je gründlicher ich die Einzelheiten kläre, umso schemenhafter wird die Welt, in der sich die Geschichte ereignete. Man könnte denken, es gehe mir wie jenem, den die Redensart beschreibt; doch der Wald, darauf bestehe ich, ist eine reine Behauptung, ein abstraktes System, das in der Wirklichkeit nicht zu finden ist. Der Wald zerfällt in lauter Bäume, genau wie der Himmel in Planeten zerfällt, in Sterne und Meteore.
Nach meinen vergeblichen Versuchen, einen Zusammenhang in den Bildern zu finden, bin ich zum Schluss gekommen, dass es weniger diese Geschichte als solche ist, die ich nicht verstehe, und es vielmehr darum geht, meine Verstrickung zu erklären, herauszufinden, was sie mir sagen wollen, diese Erscheinungen, die mich berücken, verzaubern und einige Male an den Rand des Wahnsinns geführt haben. Meine Existenz hängt an dieser Geschichte, so rede ich mir ein, und gleichzeitig weiß ich, wie lächerlich ich bin und dass ich nichts zu fürchten habe, dass ich die Ereignisse jener Märztage ruhen lassen könnte und mir nichts geschehen würde, ich mein Leben weiterführen könnte wie bisher. Tatsächlich wäre ich gerettet, wenn ich eingestehen könnte, an Philips Geschichte gescheitert zu sein. Sie ist zu groß für mich – obwohl sie ganz einfach erscheint. Es ist, als ob ich bei jedem Versuch etwas vergessen würde, eine Einzelheit, die unerlässlich ist, als ob ich ein Zeichen verlöre, das mich auf die richtige Spur führt. Ich weiß, wie oft ich es geschworen und mich damit belogen habe wie ein Trinker, der sich mit dem letzten Glas betrügt. Ich bin ein Spieler knapp vor dem Bankrott, der ein letztes Mal die Karten geben lässt – einen Versuch will ich noch wagen, einmal noch werde ich die Ereignisse auferstehen lassen, einmal noch, und dann soll es damit sein Bewenden haben.
Meine Begierde hat mich umgetrieben, ja. Auch ich habe meine Obsessionen, natürlich, und wie jeder behalte ich sie lieber für mich. Nicht weil ich mich schäme, manche passen bloß nicht in das Bild, das ich von mir selbst habe und das jetzt, in der Hälfte des Lebens, mit jenem meiner Mitmenschen übereinstimmt: ein Mann mit vielen Schwächen und noch mehr Prinzipien. Aber der Eros fragt nicht nach den Bildern, die wir von uns selbst haben, im Gegenteil, oft scheint es, als versuchte er, sie zu widerlegen. Jeder habe seine dunkle Seite, so sagt man, aber mittlerweile habe ich begriffen, wie wenig das bei den meisten Menschen moralisch aufzufassen ist, dass das Dunkel nicht dem Bösen und das Helle nicht dem Guten zugeordnet werden darf. Die finstere Seite ist einfach jene, der das Licht fehlt, und lange hat es gedauert, bis ich verstanden habe, dass in der Nacht die Katzen tatsächlich schwarz sind, also nicht nur schwarz scheinen, nein: Ihnen fehlt jede Farbe. Wie bin ich darauf gekommen? Ach ja: meine Obsessionen. Ich muss hier an die Bekenntnisse von Rousseau denken, die ich vor einigen Jahren gelesen habe und die er doch, wenn ich mich richtig erinnere, damit beginnt, einen ganz und gar ehrlichen Bericht über sich selbst zu verfassen, nichts willentlich auszulassen, und worüber er nichts erzählen könne, das sei einfach dem Vergessen anheimgefallen. Und ich erinnere mich, wie wenig ich ihm diesen Vorsatz glaubte, ich hielt es für eine Stilisierung, ein, wie man sagt, Lippenbekenntnis, und ich misstraute dem Autor, bis er von seinen sexuellen Vorlieben berichtet. Ich kann mich nicht erinnern, in welchen Worten, ich weiß nur noch, wie es mich traf und dass ich von diesem Zeitpunkt an seinen Beteuerungen glaubte. Müsste ich also, um meinen Bericht glaubhaft zu machen, meine Perversionen offenbaren?
Einiges an Philips Geschichte ist mir peinlich, und es sind nicht die abseitigen, schmutzigen und kranken Momente, die man darin auch findet. Es ist die Nichtigkeit einiger Details, mit der ich mich nicht abfinden mag. Vieles erscheint fast unerheblich und ganz und gar alltäglich. So wäre es leichter für mich, wenn nicht diese pflaumenblauen Ballerinas Philips Aufmerksamkeit gefesselt hätten, gewöhnliche Schlupfschuhe, die längst nicht mehr Tänzerinnen vorbehalten sind. Für wenig Geld in jedem Kaufhaus zu finden, genäht oder geleimt, mit oder ohne Schleifen auf dem Rist, in allen möglichen Farben, matt oder gelackt. Und dass sie in diesem Fall aus Kalbsleder waren, fein gearbeitet und ausgesucht, ändert nichts an der Tatsache: Am Anfang dieser Geschichte steht ein Paar Damenschuhe.
Der Anfang? Damit ist es so eine Sache. Niemand kann bestimmen, mit welchem Ereignis eine Geschichte beginnt. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, so heißt es – aber was hat er vorher getrieben? Und was immer es war: Warum gehört es nicht auch zum Anfang? Physiker, die Gott durch den Urknall ersetzen, werden einwerfen, die Frage sei absurd, da sie bereits die Zeit voraussetze, und dergleichen habe vor Gott oder dem Urknall nicht existiert. Bücher und Filme behaupten einen Beginn, doch in der Wirklichkeit gibt es seit dem ersten Anfang keine Anfänge mehr. Und vorläufig auch kein Ende, falls das ein Trost sein soll. Das Eine fließt in das Andere; doch wie das Ende der einen Geschichte mit dem Anfang der anderen zusammenhängt, bleibt dem menschlichen Geist unzugänglich. Wer das Gewebe der Wirklichkeit entwirren will, wird sich selbst verwirren. Das ist es, was ich zurückweise. Ich will das Rätsel lösen, aber ich will nicht verrückt werden.
Ich bin ein Zeuge jener Märztage, und als Zeuge werde ich von ihnen berichten, vollständig und ungeschönt. Manches wird mich in ein schlechtes Licht rücken, aber das ist mir einerlei. Ich könnte, um glaubwürdig zu scheinen, hier etwas weglassen, dort etwas erfinden. Aber das will ich nicht. Meine Obsession, so sei es denn gestanden, meine Obsession ist die Wahrhaftigkeit. Und ob läppisch oder nicht: Es waren nun einmal pflaumenblaue Ballerinas, die Philip in Bewegung setzten. Warum er ihnen folgte? Darauf habe ich keine Antwort. Es wird ein Spiel gewesen sein, wenigstens zu Beginn, harmlos und ohne Gefahr, denn wenn Philip geahnt hätte, was in den folgenden Stunden geschehen würde, er hätte augenblicklich von der Frau abgelassen. Er hat sein Verderben nicht gesucht, nicht einmal die Gefahr, obwohl er dann, als es so weit war und er begriff, an welchem Faden seine Existenz hing, sich dieser Gefahr stellte, ohne zu zögern.
Sicher ist: An jenem Dienstag, es war der elfte März, um Viertel nach vier, wartete Philip, ein Mann Ende vierzig, schwer und in den vergangenen Jahren etwas aus der Form geraten, in einem Café am Rand der Altstadt auf einen gewissen Hahnloser. Philip kannte ihn nicht und hatte bloß gehört, er sei kürzlich mit seinem Malergeschäft pleitegegangen, weshalb er ein Grundstück, das seit Generationen im Besitz der Familie war, veräußern müsse, einen unbebauten Flecken hoch über dem See. Philip war der Ort des Treffens nicht genehm, er hätte das Sitzungszimmer seiner Firma bevorzugt, aber da er ein schnelles Geschäft witterte, das ihm, so schätzte er, dreißigtausend einbringen konnte, und da er gegen sechs Uhr abends ohnehin bei Belinda sein musste, die nicht weit von diesem Café wohnte, hatte er zugestimmt.
Das Lokal befand sich in einem bürgerlichen Palast des neunzehnten Jahrhunderts, einem ehemaligen Grandhotel aus der Zeit der großen Stadterweiterung, als man die Artillerieschanzen geschleift und die Seeufer aufgeschüttet hatte. Gold und roter Plüsch beherrschten die Atmosphäre, eine breite Treppe führte auf die Estrade, an den Tischen saßen Mütter mit ihren Kindern, vor sich die Reste der Süßigkeiten, leere Sirupgläser und Kaffeetassen. Hahnloser ließ auf sich warten, und Philip war versucht, sich aus der Vitrine ein Stück Torte zu bestellen, aber weil bis zum vereinbarten Zeitpunkt bloß fünf Minuten blieben und er unter keinen Umständen mit vollem Mund überrascht werden wollte, begnügte er sich mit einem Kaffee, in den er zwei Tüten Zucker rührte. Doch auch zehn Minuten später, die gereicht hätten, um in Ruhe eine halbe Torte zu verdrücken, war nichts von Hahnloser zu sehen. Er reagierte weder auf den Anruf noch auf die Nachricht, die Philip ihm schrieb. Und nachdem Philip sich von Vera hatte bestätigen lassen, dass er die richtige Nummer hatte, ging er die letzten Meldungen über die Maschine der Malaysia Airlines durch, eine Boeing 777, die am vergangenen Sonntag mit zweihundertneununddreißig Seelen an Bord irgendwo in den Roaring Forties verschwunden war, eine Tragödie, die ihn beschäftigte und beunruhigte. In Kuala Lumpur hatten die Behörden nicht die geringste Vorstellung, was mit dem Flugzeug geschehen war. Die Suche, die von Stunde zu Stunde auf weitere Gebiete ausgedehnt wurde, blieb ohne Ergebnis. Die Passagierliste enthielt neben chinesischen und malaysischen auch die Namen von zwei Österreichern, in Wirklichkeit Iraner, die mit gefälschten Pässen an Bord gelangt waren. Einige Stunden lang hielt man die beiden für Terroristen, bis sie sich als illegale Einwanderer entpuppten und auch diese Spur ins Nichts führte. Trümmer hatte man keine gefunden, und die Ölflecken in der Straße von Malakka stammten vom üblichen Schiffsverkehr.
Irgendwann entschloss sich Philip, eine Runde durch das Lokal zu drehen, doch entdeckte er niemanden, auf den Hahnlosers Beschreibung gepasst hätte. Als er zurück an seinen Tisch kam, war die Tasse abgeräumt und eine dicke Frau mit einer hellblauen Kappe saß auf seinem Platz. Einen Moment stand Philip unentschlossen da und wusste nicht, was er tun sollte, bis er schließlich seinen Aktenkoffer griff, am Tresen bezahlte, das Rückgeld nahm und hinaus auf die Straße trat.
Eine weitere Tatsache, die mir keine Ruhe lässt, ist die Stadt, in der sich dies ereignet hat. Es ist dieselbe, in der ich seit zwanzig Jahren lebe, die mir vertraut und zur Heimat geworden ist. Wenn ich an den Orten vorbeikomme, an denen Philip seine Spur aufnahm, die Plätze sehe, wo sich sein Schicksal entschied, jene ruhigen, friedlichen Orte, dann merke ich, wie unwahrscheinlich es ist, gerade hier eine solche Geschichte zu finden. Die Einwohner sind tüchtig und neigen nicht zu Extremen. Das Leben vollzieht sich in ruhigen Bahnen. Die Kämpfe, die hier ausgefochten werden, sind kaum exemplarisch und selten tödlich. Wenn man die Lebenskurve eines typischen Bewohners aufzeichnen müsste als gezeichnete Linie zwischen Geburt und Tod, dann wäre das Ergebnis ein flacher Strich, ohne Erhebungen oder Täler, ein gemächliches, stetes Streben dem eigenen Ende zu, hier und da unterbrochen von einigen Unregelmäßigkeiten, Erzitterungen durch Krankheit oder Scheidung. Selten wird hier eine Existenz nach dem vierzigsten Lebensjahr anders zu Ende gehen als mit einem allmählichen Verglühen, was vielleicht der falsche Begriff ist, da er ein Brennen voraussetzt. In Flammen stehen Wenige. Es ist eher, als würde einem mäßig gefüllten Ballon langsam die Luft ausgehen. Ja, auch hier gibt es Elend, wie überall, auch hier leben Menschen, die quälen, und Menschen, die leiden. Auch hier hört man gelegentlich von jenen erbarmungswürdigen Greisen, die eines Tages in ihrer Wohnung über ein Möbelstück stolpern, liegen bleiben und, zu schwach, um Hilfe zu rufen, im eigenen Schlafzimmer verdursten, unbemerkt, bis man sie dann findet, nach Monaten, weil sich im Haus ein süßlicher Geruch breitmacht. Doch nur die Toten gehen verloren, solange man lebt, bleibt man nicht unbemerkt. Niemand kann sich verstecken, und wenn man von Menschen hört, die sich über Jahre und sogar Jahrzehnte vor dem Zugriff der Polizei versteckt haben wie jener Verbrecher, der in Süditalien auf einem Bauernhof hauste und von da sein Syndikat leitete, mit Hilfe von handgeschriebenen Notizen, winzigen Papierfetzen, auf die er in mikroskopisch kleiner Schrift seine Anweisungen und Befehle schrieb, welcher Neuling in die Organisation aufgenommen, wann ein Verräter getötet und wie ein Territorialstreit gelöst werden sollte, dann wird das bei uns, in dieser Stadt, immer auf Erstaunen und Unverständnis stoßen. Ein Mensch, der so unauffällig lebt, müsste ins Gerede kommen, das Gerede würde bald die Autoritäten erreichen, der Mensch wäre enttarnt. Man ist wachsam, aber man sollte deswegen nicht glauben, wir besäßen eine besondere Aufmerksamkeit oder sogar ein Interesse für die eigene Stadt oder den Mitbürger, nein, im Allgemeinen ist Gleichgültigkeit die vorherrschende Haltung, eine gepflegte, anständige Ignoranz der fremden wie der eigenen Befindlichkeit gegenüber, und schon vor hundertsechzig Jahren hat man an anderer Stelle über die Menschen hier festgestellt, dass sie allerlei wunderliche Geschichten und Legenden mit der größten Genauigkeit erzählen können, ohne zu wissen, wie es zugegangen sei, dass der Großvater die Großmutter nahm. Seither hat sich viel geändert, die Stadt ist in der Welt beliebt geworden, allerlei internationales Personal verbringt hier ein paar Jahre, in denen man genießt und abschöpft, ohne den Anspruch zu haben, sich zu verwurzeln, heimisch zu werden.
Es war unwahrscheinlich, dass jemand wie dieser Philip sich ein anderes Schicksal wählen und sich innerhalb weniger Tage, um nicht zu sagen, Stunden, von einem soliden, gesicherten Dasein an den Rand der eigenen Vernichtung bringen würde. Man könnte sich diese Vorgänge in einer Umgebung vorstellen, die von inneren Spannungen zerrissen wird, mit Menschen, die Brüche, Leidenschaften gewohnt sind in einer Gesellschaft, in der Konflikte zum Alltag gehören – aber was soll ich machen? Es war nun einmal so, eine weitere Ungereimtheit in Philips Geschichte, und damit habe ich zu leben.
Allerdings begannen sich auch in meiner Stadt die Verhältnisse zu ändern. Es war kein sichtbarer Umbruch, äußerlich blieb alles beim Alten, aber ein Zweifel schlich sich in das Bewusstsein der Menschen. Die Zuversicht war verschwunden, das Vertrauen auf den morgigen Tag mit seinen Möglichkeiten, die Überzeugung, am eigenen Schicksal schmieden zu können, den nächsten Schritt zu machen auf dem Weg der Vervollkommnung, dies alles hatte Risse bekommen. Wenige sprachen es aus, aber viele erwarteten insgeheim einen Zusammenbruch, und an den Werkbänken, in Hörsälen und in Großraumbüros flüsterten Arbeiter, Professoren und Angestellte über die kommende Katastrophe. Es waren nicht zuerst die Bösewichte, die Potentaten, die man fürchtete, auch nicht die Selbstmörder, die sich auf belebten Plätzen in die Luft sprengten. Gewalt hatte man auch vorher gekannt, wir kamen nicht aus friedlichen Zeiten. Doch der Glaube war verloren, dass jemand die Zeitläufte nach seinem Willen bestimmte. Selbst die Mächtigen wirkten hilflos und schwach. Alles schien zufällig und willkürlich, und obwohl das Leben seinen gewohnten Gang nahm, fühlte man sich von einem Feind umgeben, der nur selten ein Gesicht bekam. Für die Einen war es jenes des abgezehrten Menschen, der irgendwo am Stadtrand, nach einer langen Flucht über das Meer, sich in einem Kajütenbett in Albträumen wälzte, in Erinnerungen an Tod und Vertreibung; für Andere waren es unsichtbare Herren, die in Hinterzimmern ihre Intrigen ausbrüteten und die nächste Verschwörung vorbereiteten. Man fürchtete sich vor der Zukunft, der Leichtsinn, der vor gar nicht langer Zeit die karierte Decke auf der blühenden Frühlingswiese ausgebreitet hatte, war verflogen. Man war, so las man in Zeitungskommentaren, in eine Schwellenzeit getreten, deren Ende, wann immer es uns treffen mochte, nur eines bedeuten konnte: den Untergang der Welt, wie wir sie kannten.
Philip stand in der Sonne und zündete sich eine Zigarette an. Der März in jenem Jahr war ungewöhnlich warm, schon der Februar hatte weder Schnee noch Kälte gesehen. Eine Südwestlage trieb das Quecksilber bis auf zwanzig Grad, Südwinde brachten eine dumpfe Wärme. Den ganzen Winter hindurch hatte es keinen Frost gegeben, der mit dem Ungeziefer aufgeräumt hätte, ein ungesunder Atem hing in der Luft, als würde sich nicht der Frühling, sondern eine fiebrige Krankheit ankündigen. Über dem Seeufer, das schwarz war von Menschen, kreisten Möwen, auf den verkoteten Planen der vertäuten Segelboote kauerten struppige Enten und erinnerten Philip an die unheilvollen Nachrichten aus dem Fernen Osten. Von einem Tag auf den anderen erkrankten die Menschen, wie jener Mann aus der Provinz Guangdong, der mit hohem Fieber, Husten und Gliederschmerzen in das Kwong-Wah-Krankenhaus in Hongkong eingeliefert wurde. Angesteckt hatte er sich an einem geschlachteten Huhn, das jemand aus seiner Familie auf dem Markt von Kaiping gekauft hatte. Nach einem Zytokinsturm und einem Lungenödem versagten seine Organe. Das war der fünfte Fall in kurzer Zeit, der tödlich endete. Noch übertrug sich das Virus erst vom Tier auf den Menschen, doch die Ärzte warnten vor dem tödlichsten Erreger, seit man Influenza nachweisen konnte, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Erreger so weit mutiert war, dass er von Mensch zu Mensch springen und jene Hälfte der Bevölkerung, die keine Abwehrkräfte besaß, dahinraffen könnte.
Darüber war Philip in allen Einzelheiten unterrichtet, und dies verdankte er einem Freund, den er stets bei sich trug und beinahe minütlich befragte, ob in der Welt etwas geschehen war, das ihn betreffen könnte. Sein Gefährte war ein kluges Telefon, auf dem er schrieb, las und spielte und das erst vor wenigen Jahren seinen Siegeszug um die Welt angetreten hatte. Das Verhältnis zu diesen Maschinen war ungeklärt. Jene, die sie entwickelten, beteuerten ihre Philanthropie, aber wir misstrauten ihnen, hielten sie für Übeltäter, an einem Projekt beteiligt, das die Abschaffung des Menschen bezweckte. Trotzdem verzichteten die Wenigsten auf die Maschinen, im Gegenteil, wir benutzten sie umso ausgiebiger, räumten ihnen einen Platz in immer neuen Lebensbereichen ein. Arbeit war ohne sie kaum mehr vorstellbar, aber auch in der Freizeit, bei der Gesundheit und immer mehr auch in der Liebe, überließ man ihnen die Führung, ging ergeben an ihrer Leine und wusste gleichzeitig, wie wenig wahrscheinlich es war, dass sie einen ins Glück führten. Aber da wir das Vertrauen in die eigene Freiheit verloren hatten, das Wissen, worin unser Glück bestehen könnte, blieb man diesen Maschinen verbunden.
Jede Epoche besitzt ein Werkzeug, auf das sie fundamental angewiesen ist. Die industrielle Revolution ist gleich der Dampfmaschine, die Aufklärung brauchte den Setzkasten, und auch meine Zeit hing an einem Gerät, allerdings war es nicht das kluge Telefon, wie die meisten glaubten, es war das Netzteil mit einem Ladekabel, ein kleiner Transformator, mit dem man die Lithium-Ionen-Batterien auflud, die jene Alleskönner betrieben. Das Netzteil war klein und unscheinbar, kaum jemand sprach darüber, aber kaum fehlte es, verhungerten diese klugen Telefone, die Menschen wurden stumm und taub und getrennt von den anderen und ziemlich hilflos.
Noch aber war Philip verbunden. Er verschattete die Augen, damit er auf dem Bildschirm die Tastatur erkennen konnte. Er werde, so schrieb er Vera, in der Nähe bleiben, und falls Hahnloser auftauche, möge man ihm Bescheid geben. Bei dieser Gelegenheit erinnerte er daran, ihn rechtzeitig für den Flug nach Las Palmas einzuchecken, auf einem der vorderen Plätze, damit er bei der Landung keine Zeit verlieren und pünktlich in Tejeda sein konnte, um eine Gruppe von Pensionären zu treffen, die dort Wanderferien machten und sich für Alterswohnungen interessierten. Bis Freitag wollte Philip auf der Insel bleiben, den Papierkram mit dem Notar erledigen und die letzten Unterschriften unter die Verträge setzen. Vier der zwölf Apartments hatte er schon verkauft, obwohl sie erst auf den Plänen und in einem lächerlichen Trickfilm existierten. Es war das größte Vorhaben, seit er sich selbstständig gemacht hatte. Die Bebauung hatte ihn Zeit, Geld und Nerven gekostet, und jetzt ging es nur noch darum, die Verträge zu unterzeichnen und den Gewinn einzustreichen.
Die Müdigkeit, die ihn befiel, führte Philip auf das verpasste Mittagessen und die Wärme zurück. In der Stunde, die ihm blieb, bis er bei Belinda erscheinen konnte, wollte er sich in seinen Wagen verkriechen und sich ein paar Minuten aufs Ohr legen. So ging er hinauf zum Parkhaus an der Promenade, das ihm jetzt, kurz vor fünf Uhr abends, seltsam verlassen vorkam. Kein Mensch war zu sehen, nicht an der Kasse unten am Eingang, nicht im Treppenhaus und auch nicht im Fahrstuhl. Auf der Etage G standen die meisten Parkfelder leer. Es war unheimlich still, auch die aggressionshemmende Musik, die sonst aus den Lautsprechern plätscherte, fehlte. Philip fragte sich, ob er ein Schild übersehen hatte, das auf eine außerordentliche Schließung hinwies, ob es einen Polizeieinsatz gab oder einen Brandfall, weswegen man das Parkhaus geräumt hatte, doch als er in den unteren Etagen zuerst einen Motor und dann Stimmen hörte, beruhigte er sich und ging zu seinem BMW. Er schloss auf, schob den Sitz nach hinten, legte die Lehne flach, räumte den Dinosaurier weg und machte es sich bequem. Er drehte das Radio an, bloß ein Rauschen war zu hören; auch sein Telefon hatte, wie er feststellte, in diesem Gebäude, hinter diesen Betonmauern, keinen Empfang. Er ärgerte sich, sie hätten eine Antenne aufstellen können, nun war er von der Umwelt abgeschnitten, und falls Hahnloser doch noch auftauchte, würde ihn Veras Nachricht nicht erreichen.