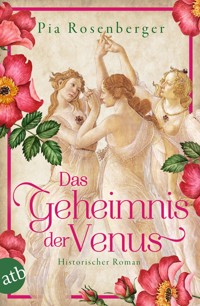Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thalia Bücher GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geheimnisse unter dem sixtinischen Himmel.
Die junge Bildhauerin Delia ist nach dem Tod des Vaters fest entschlossen, seine Werkstatt weiterzuführen. Dazu muss sie allerdings ihren in Rom lebenden Bruder finden und zur Rückkehr nach Esslingen bewegen. Sie reist als Junge verkleidet nach Italien. Die Suche führt sie in die Sixtinische Kapelle, mitten in die Werkstatt Michelangelos, wo sie, getarnt als Dario, Schülerin des berühmten Künstlers wird. Delia kann ihr Glück kaum fassen. Doch dann führt sie die Suche nach ihrem Bruder in eine ungeahnte Gefahr ...
Eine junge Bildhauerin in Rom: ein spannender Einblick in die Entstehung von Michelangelos Meisterwerk.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nach dem Tod ihres Vaters ist es Delias größter Wunsch, sein Erbe zu wahren und seine Bildhauer-Werkstatt fortzuführen. Doch dafür muss die junge Bildhauerin zunächst ihren Bruder wiederfinden, der in Rom lebt. Kurzentschlossen macht sie sich, als Junge verkleidet, selbst auf die Reise nach Italien. Die Suche erweist sich schwerer als gedacht, doch schließlich stößt Delia auf Hinweise, dass ihr Bruder sich im Vatikan aufhält, wo gerade eine Kapelle umgestaltet wird. Als sie sich auf der Baustelle umsieht, lernt sie durch Zufall einen gewissen Michelangelo kennen, der die Decke der Kapelle mit Fresken ausstatten soll …
Über Pia Rosenberger
Pia Rosenberger wurde in Georgsmarienhütte bei Osnabrück geboren und studierte nach einer Ausbildung zur Handweberin Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Sie lebt sie mit ihrer Familie schon lange in Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Die Bildhauerin«, »Die Künstlerin der Frauen«, »Colette«, »Wir Frauen aus der Villa Hermann« und »Das Geheimnis der Venus« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Pia Rosenberger
Die Künstlerin von Rom
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Prolog — 1504
1. — Esslingen, März 1508
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. — Mai 1508
9. — Frühsommer 1508
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. — Ende August 1508
25.
26. — September 1508
27.
28.
29.
30. — November 1508
31.
32.
33.
34.
35. — Capalbio, November 1508
36.
37. — Zwei Stunden zuvor
38.
39. — Fünf Tage später
40.
41.
42.
43. — Esslingen, Anfang Mai 1509
Verzeichnis handelnder Personen:
Impressum
Ich sah den Engel im Stein und meißelte, bis ich ihn freiließ.
Prolog
1504
Es war ein Wagnis, den Pass im Frühling zu überqueren. Doch Rudolf Pirckheimer ging das Risiko ein, weil er die Gipfel der Alpen so schnell wie möglich zwischen sich und seine alte Heimat bringen wollte. Er brach frühmorgens am Nordhang auf, wo sich die Tannen wie schwarze Schriftzeichen in den blassgrauen Himmel zackten. Zunächst kam er gut voran, auch wenn die weiß verschneiten Gipfel in der Ferne im Nebel versanken. Doch auf der Höhe des Passes lag der Schnee klaftertief.
Rudolf kämpfte sich durch die Schneemassen und hatte seinen Wallach Hektor gerade auf sicheren Grund geführt, als er hinter sich einen Hilferuf hörte. Er kam von dem alten Dominikanermönch, dem er auf seiner Reise schon mehrfach begegnet war, einem Mann mit grauem Bart und Tonsur, der sich trotz seiner Jahre aufrecht hielt. Er steckte mit seinem Rappen im Tiefschnee fest und zog und zerrte an den Zügeln, während das Pferd vor Angst schrill wieherte.
»Bleibt ruhig!«
Rudolf arbeitete sich zu ihm vor und nahm ihm die schweren Satteltaschen ab, bevor sie gemeinsam das Pferd aus der Schneewehe befreiten. Danach standen sie durchnässt, aber erleichtert auf der Straße und ließen sich von den anderen Italienreisenden überholen.
Der Alte bedankte sich würdevoll. »Ihr glaubt gar nicht, wie sehr Ihr mir geholfen habt, junger Mann.«
Rudolf zeigte auf die Satteltasche. »Was habt Ihr da drin? Mühlsteine?«
Der Dominikaner lachte nur. Also legten sie dem Rappen die Taschen wieder auf und setzten ihre Reise fort.
Nach einer Weile hörte das Schneetreiben auf, und ein unwirklich blauer Himmel kam zum Vorschein. Rudolf gingen die Augen über. Er hatte nicht gewusst, dass unterhalb des Splügenpasses der Frühling begann. Im Hügelland standen die Mandelbäume in voller Blüte, und im Tal reihten sich die Seen aneinander wie Lapissteine an einer Kette. Allein das Wort: Spluegena. Wenn er es in der Sprache seiner Mutter aussprach, zerplatzte es wie eine reife Traube auf seiner Zunge und schmeckte nach Verheißung. Es gab keinen Zweifel. Er war im Süden angelangt.
»Italia, ich komme!«, rief er ausgelassen und ließ Hektor munter traben. »Ich bin im Land, wo die Zitronen blühen.«
»So wartet doch!« Der Dominikaner schloss zu ihm auf. »Lasst Euch von Eurer Begeisterung nicht hinwegtragen.«
»Permesso!«, sagte Rudolf. »Ich wollte mir nur Luft machen. Die hat mir in Esslingen nämlich gefehlt.«
Der Alte lachte. »Tut Euch keinen Zwang an. Aber gebt auf Euch acht. Ich weiß, was der Süden anrichtet, wenn er einem den Kopf verdreht. Seid vorsichtig, junger Mann! Lasst Euch zu nichts hinreißen, was Ihr hinterher bereut.«
»Danke für Eure Besorgnis. Aber ich glaube, ich kann selbst auf mich aufpassen.« Rudolf hatte zu lange auf diesen Moment gewartet, um sich die Laune verderben zu lassen. »Wir sollten uns eine Herberge suchen, wo wir uns von den Strapazen des Tages erholen können.«
Der Alte ritt an seine Seite. »Ich lade Euch ein. Das habt Ihr Euch redlich verdient, weil Ihr mich nicht im Stich gelassen habt.«
Rudolf begriff, dass er diesen Reisekameraden so schnell nicht wieder loswerden würde. Vielleicht hatte das aber auch sein Gutes, denn nach dem wochenlangen Ritt wusste er ein angenehmes Gespräch zu schätzen.
Unterhalb des Passes duckten sich die Dörfer an die Flanke des Gebirgszuges wie Küken an den Bauch der Glucke. Rudolf und der Mönch kehrten in einem Gasthaus ein, direkt am Ufer eines Sees, der das Tal wie eine Sichel durchzog.
Der Raum war verrußt von der offenen Feuerstelle und vollkommen überfüllt, da auch eine Pilgergruppe auf dem Weg nach Rom hier Rast machte. Die Wirtin mit der grauweißen Haube ließ sich von den Menschenmassen nicht aus der Ruhe bringen. Rudolf bestellte auf Italienisch und erfuhr dabei, dass sie Rosa hieß. Offenbar gefielen ihr seine blauen Augen oder seine Sprachkenntnisse, denn sie bevorzugte sie und brachte rasch einen Krug Wein und eine Vesperplatte mit knusprigem Brot, Räucherwurst und Schinken. Rudolf knurrte der Magen.
Der Dominikaner schenkte ihnen ein. »Ich habe mich noch gar nicht richtig bedankt. Ihr wisst nicht einmal, was Ihr da gerettet habt, junger Mann.« Er neigte den Kopf. »Wie darf ich Euch nennen? Ihr sprecht ja Italienisch wie ein toskanischer Bauer.«
»Eigentlich Rudolf«, antwortete er mit vollem Mund. »Aber wie wäre es mit Rodolfo?« Das klang gut. Wer ein neues Leben begann, brauchte auch einen neuen Namen. »Und wer seid Ihr?«
»Man nennt mich Bruder Octavius von Gent.« Der Dominikaner war mindestens sechzig, seine blauen Augen blutunterlaufen und seine Wangen von roten Äderchen durchzogen. Er nickte nachdenklich und strich sich über den grauen Bart. »Wohin seid Ihr unterwegs, junger Signor Rodolfo?«
Die Satteltasche mit den Mühlsteinen hatte er neben sich auf die Bank gestellt, als wollte er sie nicht aus den Augen lassen.
»Ich reise nach Florenz, zur Familie meiner verstorbenen Mutter.« Rudolf strich sich eine Locke aus der Stirn.
»Ahh, dann seid Ihr wirklich ein halber Italiener. Deshalb fällt Euch diese vertrackte Sprache so leicht. Wie lautet der Name Eurer Mutter?«
Rudolf spürte Trauer, die noch immer in seiner Seele brannte. »Anna della Robbia. Sie stammte aus einem angesehenen Geschlecht von Bildhauern.«
»In der Tat. Der Name ist selbst mir bekannt. Sind das nicht jene, die Madonnen aus glasierter Keramik produzieren? Eine geschäftstüchtige Idee.« Der Dominikaner winkte der Wirtin.
»Ich weiß nicht einmal, ob ihre Familie mich überhaupt empfangen wird.«
Die schöne Anna della Robbia war vor 23 Jahren mit dem vielversprechenden Holzbildhauer Heinrich Pirckheimer durchgebrannt und hatte dadurch alle Ansprüche auf ihr Erbe verwirkt.
Die Wirtin drängte sich durch die Menge und füllte ihre Karaffe neu. Octavius trank in großen Schlucken. »Und was wollt Ihr in Florenz machen?«
»Ich bin Holzbildhauer und komme aus der Reichsstadt Esslingen. Vielleicht kann Annas große Familie so jemanden wie mich ja brauchen. Zur Not bilde ich meine Madonnen auch aus Ton.« Er hatte seinen Meisterbrief und seine Messer dabei. Aber seine Hände, die die Seele in jedem Material erspüren konnten, waren sein wichtigstes Werkzeug.
»Ein wackerer Handwerker also?« Octavius neigte sich vor und flüsterte: »Wärt Ihr so frei, mich zuvor als Leibwächter nach Rom zu begleiten? Es soll Euer Schaden nicht sein.«
Rudolf runzelte die Stirn. »Aber ist Rom nicht ein Dreckloch, in dem das Laster regiert? Ein Sündenpfuhl, sagt man sogar?«
Octavius lachte leise. »Es lässt sich nicht leugnen, dass dem Zentrum der Christenheit dieser Ruf anhaftet. Aber wenn Ihr bereit seid, darüber hinwegzusehen … Rom ist vor allem die Stadt der Päpste und eine große Baustelle. Im Vatikan würden Euch die Aufträge nur so zufliegen.«
Warum brauchte der alte Mönch einen Leibwächter? Rudolf war sich sicher, dass die Antwort auf diese Frage in seiner Satteltasche zu finden war.
Er setzte sich zurück und dachte nach. »Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Kirchen, die Platz für weitere Madonnenstatuen haben, gibt es dort sicher zuhauf.«
»Oh ja, die gibt es. Aber sagt, warum habt Ihr Esslingen verlassen?«
»Ich hatte meine Gründe«, erwiderte Rudolf verdrossen.
Er konnte dem Alten nicht erzählen, dass er die Gegenwart seines Tyrannen von Vater nicht länger ertragen konnte.
»So ist das also. Und was wären das für welche?« Der Dominikaner gab sich nicht so leicht zufrieden. Rudolf schüttelte den Kopf. Mehr würde er ihm nicht verraten. »Ihr habt also Euer altes Leben hinter Euch gelassen«, schloss Bruder Octavius. »Aber sagt: Wird Euch in Esslingen niemand vermissen?«
»Doch«, gestand Rudolf. »Meine kleine Schwester Delia. Sie ist elf Jahre alt. Aber … sicher wird sie beizeiten einen Holzbildhauer heiraten, der die Werkstatt weiterführt.«
Würde sie das? Rudolf drängte die Zweifel beiseite, denn Delia war zwar noch jung, aber von der Kunst ebenso fasziniert wie er. Hatte er sie im Stich gelassen?
»Das Schicksal der Frauen unterscheidet sich von unserem«, sagte Octavius langsam. »Nach Gottes ewigem Ratschluss haben sie sich unterzuordnen. Aber ich würde Euch von der Warte meiner reifen Jahre aus raten, den Kontakt zu der Kleinen nicht vollständig abbrechen zu lassen.«
»Wie soll das gehen?«, fragte Rudolf müde.
»Schreibt ihr einen Brief.«
»Das werde ich beizeiten tun«, erwiderte er traurig. Wenn er ihn an seine Tante Elisabeth adressierte, würde Heinrich nichts davon erfahren. »Und wo werdet Ihr in Rom logieren?«
»Mein Schatz muss in Sicherheit gebracht werden.« Der Dominikaner neigte sich vertraulich über den Tisch und flüsterte Rudolf den Ort ins Ohr.
»Merkt Euch das gut.« Octavius strich selbstvergessen über die Satteltasche aus narbigem Leder, die solide gearbeitet, aber vollkommen unauffällig war.
»Euer Gepäck ist ganz schön schwer.«
»Es ist nicht nur sein reales Gewicht.« Der Alte prostete ihm zu. »Ob Ihr es glaubt oder nicht, junger Herr Rodolfo. Der Inhalt dieser Tasche ist kostbarer als mein und Euer Leben zusammen. Ja, man könnte sogar sagen, das Schicksal der Welt könnte davon abhängen, je nachdem in welche Hände er gerät.«
Rudolfs Neugierde drängte ihn zu fragen: »Was schleppt Ihr denn da mit Euch herum? Edelsteine, Gold, Perlen?«
Octavius lachte. »Außenstehende erkennen seinen Wert nicht auf Anhieb.« Er trank ihm zu. »Auf Euer neues Leben, Rodolfo, und darauf, dass mein Schatz sicher an seinen Bestimmungsort gelangt.«
Die Gaststube war warm und erfüllt von lebhaften Gesprächen. Im Kessel über dem offenen Feuer brodelte eine Minestrone, die verlockend nach Bohnen und Speck duftete. Die Gäste lachten, tranken und unterhielten sich. Eine Gruppe spielte Karten.
Plötzlich kehrte Totenstille ein. Den Moment würde Rudolf für den Rest seines Lebens nicht vergessen. Die Gäste sahen auf, als eine Gruppe schwer bewaffneter Männer in den Raum stürmte, begleitet von einem Schwall tanzender Schneeflocken. Auf ihren Helmen und Brustpanzern spiegelte sich der Schein des Feuers und der Kerzen.
Beim Anblick der Söldner wurden Octavius’ Augen wachsam. Er trank sein Glas leer, stellte es ab und schien sich zu wappnen.
Der Anführer beförderte die Tür mit einem gezielten Fußtritt zurück ins Schloss und sah sich um, bis sein Blick ausgerechnet an ihrem Tisch hängen blieb. Längs über sein Gesicht verlief eine gezackte Narbe, als hätte ein Schwertstreich es zweigeteilt.
Rudolf schluckte trocken. Hatte sein Vater ihm diese Männer hinterhergeschickt, um ihn zurück nach Esslingen zu schleifen? Aber nein. Der Söldner gab dem Dominikaner ein Zeichen, der umständlich aufstand und Rudolf seine Hand auf die Schulter legte.
»Was ist los?«
»Ich muss nur ein kurzes Gespräch führen mit diesem … Abschaum da. Es ist leider unumgänglich.« Kaum hörbar fügte er hinzu: »Kümmere dich um die Tasche und ihren Inhalt, Rodolfo. Ich bitte dich.«
Octavius drängte sich zum Eingang durch und verließ mit den Söldnern den Raum.
Rudolf schob die Satteltasche unter die Bank und vergewisserte sich, dass sie im hintersten Winkel an der Wand lag. Dann aß er in scheinbarer Ruhe weiter. Sie konnten später ein neues Holzbrett mit Wurst und Käse bestellen. Nur, wo blieb der Alte bloß? Er trank die Karaffe leer, aber Octavius kam nicht zurück.
Unruhe erfasste Rudolf, so dass er schließlich aufstand, um den Mönch zu suchen. Er sah vor der Tür nach, wo das Seeufer in dichtem Schneetreiben verschwand, und dann im Pferdestall. Doch er konnte ihn nirgendwo entdecken. Als die Kälte ihm unter die Kleidung kroch, kehrte er zurück in die warme Gaststube.
»Signora Rosa? Die Söldner und der alte Mönch, wo könnten sie stecken?«
Die Wirtin rührte in ihrem Kessel mit Eintopf. »Was geht mich das an? Niente.«
Es half nichts, er musste weitersuchen. Rudolf sah sich verstohlen im Hinterzimmer um und stieg sogar in den Vorratskeller hinab, wo er ein turtelndes Paar zwischen den Weinfässern aufschreckte. Schließlich durchquerte er den Garten und spähte in den Hühnerstall. Aber Bruder Octavius blieb verschwunden. Hatten die Söldner ihn mitgenommen?
Er wollte schon aufgeben, als sein Gefühl seine Schritte zum See lenkte. Die Wasseroberfläche glich in dieser Nacht einem dunklen Spiegel. Es schneite, und die Luft war so kalt, dass sein Atem ihm weiß vor dem Gesicht stand. An der Mole waren ein paar Ruderboote vertäut, doch am Ufer davor lag ein schwarz-weißer Stoffballen, oder war es ein Haufen Lumpen?
Rudolf ging darauf zu, zuerst langsam, dann immer schneller. Bruder Octavius lag auf der nackten Erde. In seiner Kehle klaffte ein tiefer Schnitt, und sein Blut versickerte schwarz im fleckigen Schnee. Rudolf schloss ihm die Augen, murmelte ein paar Worte, die bei Gott als Abschiedsgruß an einen tapferen Mönch durchgehen mochten.
Aber was war das? Als er den Alten umdrehen wollte, ertasteten seine Hände einen eisernen Brustpanzer unter dem weißen Habit. Darunter wand sich ein Schwertgurt um seinen sehnigen Leib; die Waffe fehlte allerdings.
Rudolf richtete sich auf. Anscheinend hatte der Alte ihm ein paar wichtige Informationen über sich vorenthalten.
Wie betäubt ging er zum Gasthaus zurück, aus dem ihm Lärm entgegenklang. Verstohlen schob er sich durch die Tür und beobachtete, wie sich die Pilger einer Herde verängstigter Schafe gleich an der Wand aufreihten, während die Söldner Stühle und Tische umwarfen und Reisegepäck auf dem Boden ausleerten. Waren sie auf der Suche nach der vertrackten Satteltasche? Rudolf brach der Schweiß aus. Wenn er nur wüsste, was der Mönch ihm da anvertraut hatte.
Gerade nahm sich der Anführer in radebrechendem Italienisch die Wirtin vor. »He, du da! Hat der Dominikaner in deinem Rattenloch ein Zimmer gemietet? Una camera?«
Sie schüttelte gleichmütig den Kopf. »Noch nicht.«
Rudolf schaute zu dem Tisch, an dem er mit Bruder Octavius gesessen hatte. Der Inhalt seiner Tasche lag wild durcheinander auf dem Boden verteilt. Er drängte sich an einigen Gästen vorbei und hob seine Messer und seinen Meisterbrief auf, auf dem ein großer Fußabdruck prangte. Egal. Das Schicksal musste ihm wohlwollen, denn die Söldner hatten Octavius’ Tasche nicht gefunden und brachten ihn nicht mit dem Alten in Verbindung.
»Wo hat der verpisste Dominikaner sein Gepäck abgestellt?«, fragte der Anführer die Wirtin auf Deutsch und trat gegen die Feuerstelle, so dass der Kessel gefährlich schwankte.
»Nix Deutsch«, erwiderte sie, so dass er die Frage auf Italienisch wiederholen musste.
»Der hatte nur ein paar Taschen dabei. Ich glaub, die hat er im Stall gelassen«, antwortete sie achselzuckend.
Die Söldner stürmten aus der Tür, während sich die Pilger leise raunend daran machten, ihre spärliche Habe aufzuräumen.
Rudolf trat an die Wirtin heran. »Der Mönch …«
»Verhalt dich ruhig«, zischte sie. »Lenk ihre Aufmerksamkeit nicht auf dich, Junge.« Sie rührte weiter in ihrem Kessel, legte Holz nach und schenkte Wein aus, bis von draußen Hufklänge zu hören waren. »Die reiten zurück in die Hölle«, kommentierte sie. »Wo sie hingehören.«
»Der alte Mann liegt draußen am Ufer«, sagte Rudolf. »Tot.«
Die Wirtin nickte. »Ich weiß. Mein Mann Umberto hat ihn gefunden. Und du? Was machen wir mit dir? Am besten, du verkriechst dich in der Küche am Ofen und gibst dich als mein Neffe aus, falls das Söldnergesocks noch einmal zurückkommt. In der Asche findest du die Tasche.«
Rudolf schluckte erstaunt. »Ich danke dir.«
»Nicht mir. Danke Gott, dass er dein Leben verschont hat. Madre Mia, er muss noch Pläne für dich haben.«
Am nächsten Morgen brach Rudolf mit den beiden Pferden und Octavius’ Satteltasche nach Rom auf. Bevor er sein neues Leben begann, würde er den Schatz des Dominikaners in die Stadt bringen, in der alle Wege endeten.
Die letzten Hügel zogen sich wie eine Welle zurück, und die Ebene der Lombardei glänzte vor ihm in der Sonne. Nach den Ereignissen der letzten Nacht kam Rudolf der Anblick völlig unwirklich vor. Er konnte nicht fassen, dass er den Überfall überlebt hatte. Aber war er nicht schon immer ein Günstling der Fortuna gewesen? Dennoch würde er nicht in die Tasche schauen. Man forderte sein Glück nicht zweimal heraus.
Rudolf hob den Kopf, fasste seine Zügel fester und ritt seinem Schicksal entgegen.
1.
Esslingen, März 1508
Hoch aufgerichtet folgte Delia den Sargträgern. Ihr Vater Heinrich Pirckheimer war in ganz Süddeutschland als Holzbildhauer bekannt gewesen, so dass sich sein Leichenzug am Spital entlang bis zum Friedhof unterhalb der mächtigen Doppeltürme der Stadtkirche St. Dionys erstreckte. Nach dem Regen der letzten Tage lag die Reichsstadt Esslingen unter einer bleichen Sonnenscheibe, die das Kopfsteinpflaster und die kahlen Bäume zum Glänzen brachte. Im Licht wirkten die vielen dunkel gekleideten Menschen wie ein Lindwurm, der sich durch die Straßen wand. Sie alle hatten sich versammelt, um Heinrich die letzte Ehre zu erweisen. Bürgermeister Hans Holdermann führte eine Abordnung des Esslinger Rates an. Dann kamen die Nachbarn, die Zunft sowie seine Kunden und Mäzene. Sogar der junge Herzog Ulrich von Württemberg hatte aus Stuttgart den Marschall Konrad Thumb von Neuburg geschickt.
Delias Augen wanderten zu dem Sarg aus Lindenholz. Ihr Vater hatte ihn vor vielen Jahren zimmern lassen und eigenhändig mit Rosen und zwei Händen verziert, die einander auch im Tod umschlungen hielten. Als Zeichen ihrer Liebe. Ihre Mutter Anna ruhte in dem dazu passenden Gegenstück. Jetzt waren die beiden wieder vereint, und sie selbst war ganz allein.
Wie sollte sie nur die nächsten Stunden überstehen, wie weitermachen, wenn sie Heinrich nicht mehr nach der Richtung fragen konnte? Sie fühlte sich kalt und leer. Daran änderte auch die Gegenwart ihrer Tante Elisabeth Neidhardt nichts, die mit ihrem Mann Andreas an ihrer Seite ging.
Der Friedhof war vom Regen der letzten Tage aufgeweicht. Die Erde roch feucht und modrig. Delia stand am Rande des ausgehobenen Grabes und spürte, wie sich die Kälte von ihren Schuhsohlen aus in ihrem ganzen Körper ausbreitete. Sie bemühte sich, nicht zu zittern, und verpasste so beinahe die Predigt des Pfarrers, der Heinrichs Verdienste würdigte und seine Seele der Gnade Gottes anvertraute. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Ein Menschenleben war schnell vergangen und noch schneller vergessen.
Reglos sah sie zu, wie die Träger den Sarg in die Tiefe senkten und der Pfarrer Weihwasser über ihn sprenkelte. Ihr Vater mit den breiten Schultern und dem dröhnenden Lachen – nun war er fort. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass er auf das Jüngste Gericht warten würde, ohne sich lautstark über diese Zeitverschwendung zu beschweren.
Nachdem die Gäste Delia ihr Beileid ausgesprochen hatten, nahm ihre Tante ihren Arm und führte sie zurück zu ihrem Haus unterhalb der Liebfrauenkirche. Was mochten die Leute sehen? Pirckheimers schlanke Tochter mit den blonden Haaren und den blaugrünen Augen oder die lebendige Erinnerung an ihre Mutter, die Italienerin, der die Esslinger auch nach vielen Jahren noch misstraut hatten?
Dahinter Pankraz, Heinrichs Altgeselle, den man der Farbe seiner Haare wegen nur den »schwarzen Pankraz« nannte.
»Den Ketzer solltest du als Erstes wegschicken«, raunte Elisabeth Delia zu. »Er bringt dich nur in Verruf.«
»Sicher nicht.« Delia schüttelte den Kopf.
Pankraz hatte immer zur Familie gehört. Er war nicht nur der beste Freund ihres Vaters gewesen, sondern ihr Pate, der ihr als Kind das Schnitzen beigebracht hatte.
Delias Elternhaus lag im Schatten der Liebfrauenkirche mit ihrem durchsichtigen Turmhelm aus hellem Maßwerk, gleich neben dem Baumeisterhaus der Familie Beblinger. Der geräumige Fachwerkbau mit den holzvertäfelten Wänden, in dem sie wohnten und arbeiteten, hatte der Familie immer Sicherheit und Behaglichkeit geboten. Nie hätte Delia sich träumen lassen, dass sie darin einmal eine Beerdigungsgesellschaft bewirten musste. Sie schenkte Wein und Schnaps aus und reichte Schmalzbrot herum, während die Magd Marie eine kräftige Rinderbrühe verteilte. Am Fenster stand Konrad Hornberger, der bärtige Obermeister der Zunft, und betrachtete sie nachdenklich, bevor er sich in ein Gespräch mit Niklaus Eisele vertiefte, der die zweite Bildhauerwerkstatt in Esslingen führte.
Delia konnte sich vorstellen, worüber sie redeten. Wie sollte es weitergehen? Niemand hatte ahnen können, dass der kraftstrotzende Heinrich Pirckheimer mit Anfang fünfzig sterben und seine Werkstatt verwaist zurücklassen würde.
Es dämmerte schon, als die Gäste gingen. Delia fühlte sich gleichzeitig erleichtert und unendlich erschöpft.
An der Tür sprach Obermeister Hornberger sie an. »Komm morgen um 9 zu den Eiseles, Delia. Wir haben etwas zu besprechen.«
Niklaus selbst musterte sie, als würde er sie am liebsten mit Haut und Haaren verschlingen. Delia fiel mit Schrecken ein, dass er seit Kurzem verwitwet war.
Sie drückte die Tür hinter den beiden ins Schloss und kehrte in die Stube zurück. Am Tisch saß nur noch Pankraz, der ihr verstohlen zuzwinkerte und einen Schnaps nach dem andern kippte.
Es war das erste Mal, dass sie seit dem Tod ihres Vaters zum Durchatmen kam. Wie sehr vermisste sie seine polternde Stimme und sein ansteckendes Lachen.
Plötzlich lauerten hinter ihren Augenlidern die Tränen. Delia schluckte entschlossen. Auch wenn ihr noch so sehr danach war, durfte sie jetzt nicht die Beherrschung verlieren.
»Willst du dich setzen?« Elisabeth sah genau, was in ihr vorging.
»Nein.« Delia krempelte die Ärmel hoch und half den Frauen beim Aufräumen.
»Wie geht es weiter, Mädle?«, fragte Pankraz leise. Seine dunklen Augen waren blutunterlaufen.
Delia holte tief Luft. »Kannst du mir nicht eine leichtere Frage stellen? Werd’ erst mal wieder nüchtern, Pankraz.«
Als sie das schmutzige Geschirr in den Bottich mit heißem Wasser tauchte, fiel ihr Blick auf die Holzfiguren auf der Fensterbank. Ihr Bruder Rudolf hatte den Esel, den kleinen Fuchs, den Drachen, die Katze mit dem erhobenen Schwanz und den Tanzbären, der auf den Hinterbeinen stand, extra für sie geschnitzt. Sie wunderte sich, dass Heinrich die Figuren behalten hatte, obwohl ihm Rudolfs Verschwinden vor vier Jahren so nahegegangen war.
Ach, Rudolf, dachte sie. Ich brauche dich hier.
Pankraz erhob sich und taumelte in den Garten. Er hinterließ eine Schnapswolke.
»Dieser Nichtsnutz!« Elisabeth hielt sich die Nase zu. »Nicht, dass er dir in die Rosen pinkelt.«
»Lass ihn für dieses Mal. Er ist mein Patenonkel.«
Elisabeth schnaubte. »Ich habe nie verstanden, warum dein Vater ausgerechnet ihn ausgewählt hat.«
Der schwarze Pankraz hatte nie den Ehrgeiz besessen, sich als Meister zu beweisen. Nach seinen Wanderjahren hatte er sich Heinrichs Werkstatt angeschlossen und half ihm bei seinen Aufträgen und der Ausbildung der Lehrlinge. Obwohl man in der Stadt munkelte, dass er von Gauklern abstamme und in der Stadt krumme Geschäfte mache, tolerierte die Zunft ihn dank Heinrichs Fürsprache.
»Endlich hat das ein Ende mit dem Kerl.« Elisabeth drückte Delia die Schulter. »Aber du, mein Schatz, musst dir klarwerden, was aus dir werden soll. Unser Angebot gilt. Zieh zu uns, mein Liebes.« Sie strich Delia übers Haar. »Es soll dir an nichts fehlen. Du wirst für uns wie eine Tochter sein.«
Delia wusste, dass ihre Kinderlosigkeit Elisabeths größter Kummer war.
»Denk darüber nach, Liebes, ich bitte dich«, flehte ihre Tante. »Beizeiten werden wir dich gut verloben, und dann wird sich die Familie endlich wieder vergrößern.«
Delia schüttelte den Kopf. Was sollte aus der Werkstatt werden?
Ihre Tante schien ihre Gedanken zu ahnen. »Die Zunft wird niemals akzeptieren, dass du den Betrieb weiterführst. Du darfst als Frau ja nicht einmal die Gesellenprüfung machen.«
Delia sah auf ihre sonnengebräunten, sehnigen Hände. Die Schnittwunden, die sie sich während ihrer Lehrzeit zugezogen hatte, waren zu einem zarten Muster vernarbt. Sie war Holzbildhauerin, ohne dass die Zunft es ihr je bestätigen würde. Sie hob entschlossen den Kopf. »Mein Handwerk ist alles, was ich habe.«
Elisabeth drückte noch einmal ihre Schulter. »Nein, mein Liebes. Du bist eine Frau. Der Herrgott hat für unser Geschlecht den Weg des Gehorsams vorgesehen.« Sie bedeckte ihr blondes Haar mit einem schwarzen Tuch und schloss sich Andreas an, der an der Tür wartete.
Delia blieb zurück und fühlte sich leer. Wo war ihr Platz, wenn sie nicht bereit war, Elisabeths Sicht der Dinge zu akzeptieren?
2.
Die Mühle grub ihre Schaufelräder tief ins Wasser des Rossneckars und rauschte so laut, dass sie Delias Gedanken übertönte. Sie saß auf der untersten Stufe der Treppe zum Fluss, umklammerte ihre Knie und ignorierte, dass sich der Saum ihres schwarzen Wollkleids langsam aber sicher vollsog. Es tat weh, die Erinnerungen zuzulassen, die sich mit Macht in ihr Herz drängten.
»Papa, Papa, zeigst du mir, wie man ein Pferd schnitzt?« Die kleine Delia saß auf der Kommode und baumelte mit den Beinen.
Heinrich, der gerade an einer lächelnden Madonnenfigur arbeitete, wandte sich ihr zu. Seine Lederschürze war voller Späne. »Du kleiner Fratz willst mir Konkurrenz machen, ernsthaft?«
Er hob sie hoch und warf sie fast bis zur Zimmerdecke. Für einen Moment war sie schwerelos, bis sie fiel und er sie mit seinen starken Armen auffing. Sie liebte dieses Spiel und hatte überhaupt keine Angst.
»Ich will so gut schnitzen können wie Rudolf«, murmelte sie an Heinrichs breiter Brust.
Er lachte dröhnend. »Rudolf ist schon beinahe ein Mann. Er macht demnächst seinen Gesellenbrief und geht dann auf Wanderschaft.«
»Aber ich will es auch versuchen.«
Er strich ihr die weichen blonden Haare aus dem Gesicht. »Du bist ja auch meine Tochter, Delia. Also gut, ich zeige dir, worauf es ankommt.«
Am nächsten Tag erklärte er ihr, wie man einen hockenden Hasen schnitzte, eine einfache, in sich ruhende Form, die sie nicht überforderte. Auch wenn sie ihrem ersten Häschen ein Ohr absägte, stürzte sie sich mit Feuereifer in die Arbeit und schuf alle möglichen Fabelwesen, Einhörner, Drachen und Feen. Dass sie reichlich krumm und schief ausfielen, machte ihr nichts aus. Pankraz unterrichtete sie, wenn ihr Vater keine Zeit hatte. Ihm war es egal, dass sie ein Mädchen war.
»Du musst den Klüpfel aus der Schulter heraus schwingen, Delia. Sonst schmerzt dir irgendwann das Handgelenk.« Pankraz’ raue Finger legten sich um ihre, und er führte ihre Hand. Delia übte und übte, bis Heinrich und Pankraz sie lobten, weil sie ihren ersten Madonnengesichtern so viel Leben eingehaucht hatte. Am meisten aber liebte sie ihre gezeichneten Entwürfe. Pankraz sah ihr über die Schulter und staunte.
»Sie ist begabt«, hörte sie ihn abends zu ihrem Vater sagen. »Ganz besonders als Zeichnerin. Und sie hat die Leidenschaft, die manch anderem fehlt.«
»Meinst du wirklich?« Hoffnung klang in Heinrichs Stimme durch.
»Ja, verdammt! Lass in Zukunft ein paar leere Blätter rumliegen, dann siehst du es auch.«
»Also gut.«
Ihr Vater hörte auf Pankraz, und Delia füllte die Papiere und Pergamente mit Gesichtern, Menschen, Tieren und Szenen voller Figuren, bis Heinrich einsah, dass er sie wie einen seiner Lehrjungen ausbilden musste.
Delia tauchte widerstrebend aus ihren Erinnerungen auf.
Nun war alles anders. Heinrich war tot, sie war allein, und die Werkstatt stand vor dem Aus. Warum hatte der Tod ausgerechnet ihren kraftstrotzenden Vater aus dem Leben gerissen? Delia hatte in der Stube Brotteig geknetet, als sie ihn fallen gehört hatte. Als sie in die Werkstatt geeilt war, hatte er schon am Boden gelegen. Der Schlagfluss hatte ihn wie einen Eichenbaum gefällt, der vom Blitz getroffen wurde.
Ärgerlich wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht.
Und Rudolf? Ihr Bruder, der sein Nachfolger hätte werden sollen, hatte sich vor Jahren aus dem Staub gemacht. Also musste sie allein zurechtkommen. Elisabeths Angebot konnte sie unmöglich annehmen. Das wäre nicht nur der Ruin ihrer Werkstatt, sondern das Ende all ihrer Träume.
Nein, dachte sie. Ich bin Holzbildhauerin, und ich werde alles dafür tun, damit das so bleibt.
Doch wie sollte es weitergehen ohne Meister? Delia raffte ihr Kleid und machte sich auf den Weg nach Hause.
In der Werkstatt war es dunkel und still. Zuletzt hatte ihr Vater an den beiden großen Figuren der Heiligen Petrus und Paulus gearbeitet, die neben der Werkbank standen. Delia strich über die beiden Köpfe aus Lindenholz. Paulus hatte eine Glatze und Petrus dichtes Haupthaar, das Heinrich so sorgfältig wie immer gestaltet hatte. Sie bezweifelte, dass der Benediktinerabt im Oberschwäbischen, der die beiden Skulpturen für seine Kirche bestellt hatte, zulassen würde, dass sie sie vollendete. Dann besser Pankraz.
»Da bist du ja, Delia.« Marie stand am Herd und bereitete den Getreidebrei für das morgige Frühstück zu. Auf der Ofenbank lag der Kater Korbinian und schlief den Schlaf des Gerechten.
Delia wünschte Marie eine gute Nacht und stieg mit schweren Schritten zu ihrer Dachkammer hinauf. Im Mondlicht, das durch das schräge Fenster fiel, schimmerten die Umrisse der Möbel schwarz. Sie besaß ein Bett im Alkoven, eine Truhe mit den Büchern ihrer Mutter und einen Tisch, an dem sie arbeiten konnte. Sorgfältig nach Größe aufgereiht lagen darauf ihre Schnitzeisen und Klüpfel. Daneben stand ihre angefangene Statuette der heiligen Märtyrerin Katharina von Alexandria. Delia hatte ihr einen aufmerksamen Blick gegeben, denn schließlich galt sie als klügste Frau der Christenheit und hatte es in einem Disput mit einer ganzen Horde antiker Philosophen aufgenommen. Katharina hatte sich gegen eine Heirat und für Christus entschieden, was ihr den Märtyrertod und schließlich die ewige Seligkeit eingebracht hatte.
»Was soll ich tun?«, fragte Delia. Ins Kloster einzutreten, kam für sie nicht infrage, auch wenn Onkel und Tante die Mitgift zahlen würden. Selbst wenn sie sich anstrengte, war sie dafür einfach nicht fromm genug.
»Ich will diese Werkstatt weiterführen«, sagte sie so bestimmt wie möglich zu Katharina. Doch deren Antwort war Schweigen.
Am nächsten Morgen stand Delia aufgeregt vor Eiseles Tür. Aus der Werkstatt klang ihr das regelmäßige Klopfen entgegen, das ihr seit Kindertagen vertraut war. Am liebsten hätte sie sich selbst in die Arbeit gestürzt, um alle Probleme zu vergessen. Sie seufzte und wartete, bis ihr eine junge Dienstmagd öffnete und sie in die Küche geleitete, wo Niklaus Eisele und Obermeister Hornberger sie erwarteten.
»Da bist du ja. Willkommen. Setz dich doch.« Eisele goss Delia verdünnten Wein ein. Er war ein magerer Mann von dreißig Jahren mit einem sauber gestutzten Bart und braunen Haaren.
Eingeschüchtert schob sie sich auf die Bank hinter dem Tisch und nippte an ihrem Glas. Die Küche war geräumiger als ihre daheim. Über dem Herd hingen eine Reihe Kupfertöpfe, die so blank poliert waren, dass sich die Morgensonne darin spiegelte. Aus dem Suppenkessel, in dem die Dienstmagd eifrig rührte, roch es vielversprechend nach Eintopf mit Geräuchertem. Vor Delia lag ein großes Stück Rinderbeinscheibe mit Knochen, das demnächst in die Brühe wandern würde. Auf dem Boden standen Körbe mit Zwiebeln, Kohl und Karotten bereit. Delia wusste, dass Eisele wie die meisten Esslinger Handwerker eine Menge Mäuler zu stopfen hatte. Seine jüngst verstorbene Frau hatte ihm eine ansehnliche Kinderschar hinterlassen, die neben den Großeltern und Lehrlingen versorgt werden musste. Aber Geldprobleme schienen ihn nicht zu plagen.
Delias Blick blieb an einer jungen blonden Frau hängen, die auf der Ofenbank saß und einen Säugling stillte. In einem Korb zu ihren Füßen schlief ein weiterer. Delia runzelte die Stirn. War das nicht Margarete Firner, deren Mann, der Metzgermeister Matthäus Firner, vor Kurzem gestorben war? Musste sie sich jetzt als Amme für Eiseles jüngsten Spross verdingen? Als die junge Frau Delias Blick auf sich ruhen fühlte, zog sie sich flink ein Tuch über ihre vollen Brüste. Das Wickelkind schmatzte leise. Sie löste ihre Brustwarze aus seinem Mund, legte es sich über die Schulter und klopfte ihm sachte den Rücken.
»Ach, Margarete«, sagte Eisele freundlich. »Würdest du bitte mit den beiden Würmchen vor die Tür gehen, solange wir Geschäftliches zu besprechen haben?«
Schweigend nahm die Frau die Kinder und ging. Delia grüßte sie mit einem Kopfnicken und wunderte sich über den Hass, der ihr unverhohlen entgegenschlug.
»So«, sagte Eisele. »Das wäre erledigt. Manchmal muss man Nägel mit Köpfen machen.«
Er warf Delia ein verschwörerisches Lächeln zu, bei dem ihr ein kalter Schauer über den Rücken rann. Was ging hier vor? Vater hatte Eisele nie gemocht, ihn sogar als falsche Schlange bezeichnet, weil er sich bei jeder Gelegenheit unberechtigte Vorteile verschaffte.
»Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, Delia«, begann Obermeister Hornberger. »Ich spreche dir im Namen der Zunft mein tiefstes Beileid zu deinem Verlust aus. Aber wir müssen nach vorne schauen. Die Zukunft der Werkstatt Pirckheimer steht auf dem Spiel. Es gibt keinen Meister mehr, der sie weiterführen könnte.«
Delia stand der Sinn nach Rebellion. »Ich bin eine Gesellin. Ihr müsstet mich nur die Prüfung ablegen und dann meinen Meisterbrief machen lassen.« Hastig trank sie einen Schluck Wein, der ihr sofort zu Kopfe stieg, denn normalerweise begnügte sie sich morgens mit einem Kräuteraufguss.
»Das ist unerhört«, rief Eisele. »Frauen haben sich zu bescheiden und dürfen ihren elterlichen Betrieb nicht weiterführen. Das könnten sie auch gar nicht, schwatzhaft und ungebildet, wie sie sind.«
Delia hielt seinem Blick stand. »Und wenn es dieses eine Mal anders wäre? Was, wenn Ihr einmal über Euren Schatten springen würdet?«
»Du weißt ganz genau, dass ein solches Vorgehen gültigem Recht entgegensteht«, erwiderte Hornberger besonnen.
»Aber wenn mein Bruder Rudolf zurückkommt, hätte ich einen Meister in der Werkstatt, Meister Konrad.«
»Von deinem Bruder haben wir seit Jahren nichts gehört«, stellte Eisele klar. »Seit er in den Süden geflohen ist, als wäre der Leibhaftige selbst hinter ihm her. Wir wissen nicht einmal, ob er noch lebt.«
Delia schwieg. Dem konnte sie nicht widersprechen.
Hornbergers große Hand legte sich mitfühlend auf ihre. »Und deshalb haben Meister Eisele und ich über eine schnelle Lösung nachgedacht. Er ist bereit, dich zu heiraten und die Werkstatt deines Vaters zu übernehmen – um der Zunftehre und seiner Christenpflicht willen. Und damit würde auch das Lebenswerk deines Vaters nicht vor die Hunde gehen.«
»Was?« Entsetzen packte Delia. Es fühlte sich falsch an und das nicht nur, weil ihr Vater Eisele verabscheut hatte. »Nein!«
»Ich denke nicht, dass wir dir ein Mitspracherecht einräumen werden«, sagte der Obermeister eindringlich.
Die Küchentür öffnete sich leise. Vier kleine Buben zwischen drei und sechs Jahren stahlen sich in den Raum, zwei Blonde und zwei Braunhaarige. Sie waren barfuß, aber sauber gekleidet. Den beiden Jüngsten lief der Rotz aus der Nase, als plage sie eine Erkältung.
Eisele fuhr herum. »Raus mit euch Lausebengels!«, blaffte er. »Sonst gibt es was hinter die Ohren! Wo steckt eure Großmutter? Ich muss ein ernstes Wörtchen mit ihr reden, dass sie euch nicht beaufsichtigt.«
Die Jungen zuckten zusammen und verschwanden ohne ein weiteres Wort aus der Küche. Eisele hatte seine Familie gut im Griff. Und er war – Delia zählte verstohlen nach – bereits Vater von fünf Kindern. Das Neugeborene im Korb war vermutlich sein Jüngstes, der zweite Säugling gehörte sicher zu Margarete.
»Du siehst, dass meine Buben dringend eine Mutter brauchen«, sagte er. »Und ich …« Er zögerte. »Ich hätte gerne eine Frau, die mir weitere Nachkommen schenkt. Vielleicht zur Abwechslung sogar ein Mädchen.«
Hitze stieg Delia ins Gesicht. »Würdet Ihr mich als Holzbildhauerin arbeiten lassen?«
Eisele sah sie verblüfft an. »Wo denkst du hin? Frauen haben sich mit den Aufgaben zu bescheiden, die Gott ihnen zugewiesen hat. Du stehst vor dem Nichts und kannst dich freuen, wenn ich mich deiner erbarme. Der Obermeister und ich haben diesen Beschluss schon gefasst.«
Er stand unerwartet auf, legte seine Hand an ihr Kinn und bog ihren Kopf zur Seite. Delia blinzelte ins Licht. »Du bist eine hübsche kleine Puppe mit grünblauen Augen und einem edlen Profil. Sicher hast du deinem Vater Modell gestanden. Blond, jung und gerade gewachsen wie eine Tanne. Aber dein Name?« Er schüttelte missbilligend den Kopf. »Wie lautet er vollständig?«
»Delia Maria Francesca«, brachte sie heraus.
Eisele nickte. »Dann werde ich dich Maria nennen. Ich brauche eine gottesfürchtige und gehorsame Hausfrau an meiner Seite und keine, bei der man die fremdländische Herkunft am Namen ablesen kann.«
»Was fällt Euch ein?« Delia befreite sich mit einem Ruck.
Hornberger verfolgte das Geschehen mit gerunzelter Stirn. »Lass ihr Zeit, Niklaus! Das kommt überraschend für sie. Aber du, Delia, musst wissen, dass Niklaus für dich seine Verlobung mit Margarete Firner auflösen wird. Sie ist die Amme seines jüngsten Sohnes. Du hast sie eben gesehen.«
Delias Mund wurde trocken. Kein Wunder, dass Margarete sie so hasserfüllt angestarrt hatte.
Hastig stand sie auf. »Ihr habt was getan?«
Niklaus Eisele lief bis über beide Ohren rot an.
»Ihr brecht wegen mir Euer Eheversprechen Margarete gegenüber? Sie ist verwitwet, hat ein Kind und braucht dringend einen Lebensunterhalt. Ihr solltet Euch schämen!«
Hornberger hob beschwichtigend die Hände. »Aber Delia! Oder sollte ich besser Maria sagen? Er tut das nur für dich.«
Delia schnaubte. »Zu einer Eheabrede gehören zwei, und mein Einverständnis werdet Ihr nicht bekommen.« Ihre Stimme hallte durch den Raum. »Und wagt es ja nicht, mich noch einmal Maria zu nennen. Mein Name ist Delia Pirckheimer-della Robbia.«
Sie drehte sich um und stieß mit der Magd zusammen, die gerade die Suppe auftrug. Etwas heiße Flüssigkeit schwappte auf ihre linke Hand.
»Porca miseria«, fluchte sie in der Sprache ihrer Mutter. Die Magd und die beiden Männer sahen ihr mit offenen Mündern hinterher, als sie aus dem Raum stürmte und die Tür hinter sich zuknallte. Delia verharrte kurz im Gang und hörte, wie in der Küche etwas gegen die Tür schepperte. Ein Zinnteller, vermutete sie.
»Mäßige dich, Niklaus!«, rief Hornberger.
»Ich sag es ja. Schlechtes Blut und der gleiche Feuerkopf wie Heinrich.«
Delia lief bis zum Brunnen gegenüber, tauchte ihre Hände ins Wasser und kämpfte gegen die Tränen an. Nie zuvor hatte sie sich so gedemütigt gefühlt. Christenpflicht, was für ein Hohn! Eisele wollte sich die Werkstatt unter den Nagel reißen, die in ganz Süddeutschland den besten Ruf genoss, und sie gleich mit. Und als ob das nicht genug der Schandtaten wäre, wollte er das Erbe ihrer Mutter auslöschen.
Das Haus ihrer Tante lag in der noblen Webergasse. Die Neidhardts waren wohlhabend. Onkel Andreas entstammte einer Ulmer Patrizierfamilie und arbeitete in Esslingen als Ratsadvokat und Weinhändler. Eine Viertelstunde später saß Delia im Empfangszimmer und ließ sich einen Quarkumschlag auf ihre Hand legen. Durch die Butzenscheiben fiel die milde Mittagssonne herein. Der Raum war vertäfelt, die Decke mit Stuck geschmückt, die Wände mit Seide bespannt, und auf dem Boden lag ein Teppich aus dem Orient.
Delia konnte noch immer nicht fassen, was ihr da gerade passiert war. »Er will mich wirklich heiraten! Einfach so, vom Fleck weg.« Elisabeth nickte nachdenklich. »Er hat schon fünf Kinder«, fuhr Delia fort. »Jungen, die sich in seiner Gegenwart nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und er will alles, was auf die Herkunft meiner Mutter hindeutet, aus mir rausreißen. Sogar meinen Namen will er ändern. Er will mich meiner Wurzeln berauben, ja, das will er.«
Nun brachen sich die Tränen Bahn, die Delia seit dem Tod ihres Vaters zurückgehalten hatte. Sie schluchzte und hätte vor lauter Wut am liebsten auf etwas eingeschlagen. Heinrich war für immer fort und hatte sie mit Problemen zurückgelassen, die sie allein nicht lösen konnte.
»Aber in einem hat er recht.« Elisabeth nahm sie in die Arme. Ihr Hauskleid roch nach Kampfer und Lavendel. »Du hast wirklich Heinrichs aufbrausendes Naturell und nicht das sanfte Wesen deiner Mutter geerbt. Heul nur, mein Schatz. Lass alles raus, was dich traurig macht.«
Sie ließ Delia weinen, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann verband sie ihr die Hand mit sauberen Leinenstreifen und sorgte dafür, dass ihre Haushälterin den Rinderbraten vorzeitig servierte. Bei den Neidhardts kam sogar in der Woche Gesottenes und Gebratenes auf den Tisch. Aber Delia wusste um Elisabeths Kummer. Ihre Tante bedauerte jeden Tag, dass kein Kinderlachen durch die Räume des Patrizierhauses schallte, und den Spruch, ihre Kinderlosigkeit sei der Wille Gottes, hatte sie so oft wiederholt, dass er schal klang.
Nach dem Essen hatte sich Delia ein wenig beruhigt.
Elisabeth neigte sich vor. »Nicht jedem ist ein solches Liebesglück vergönnt wie deinen Eltern. Deine Mutter war wunderschön, klug und sanft. Du weißt, dass ich sie sehr geschätzt habe.«
»Vater hat nie wieder geheiratet.« Die schöne Anna della Robbia war vor neun Jahren bei der Geburt ihres letzten Kindes gestorben, ebenso wie das Neugeborene. Schon wieder stiegen Delia Tränen in die Augen.
Elisabeth legte ihre Hand auf ihre unverletzte Rechte. »Halt … Fang nicht wieder an zu weinen. Es war Gottes Ratschluss, deine Eltern und deinen kleinen Bruder zu sich zu nehmen. Sie sind in Seiner Hand. Aber wir leben noch und müssen überlegen, was für dich das Beste ist.«
»Und für die Werkstatt«, sagte Delia düster. Auch wenn sie mit Hornberger nichts gemein hatte, in diesem Punkt hatte er recht: Heinrichs Lebenswerk stand auf dem Spiel.
»Ja, auch für sie, obwohl ich das als zweitrangig ansehe.« Elisabeth faltete ihre zarten Hände auf dem Tisch. Ein paar blonde Locken hatten sich aus ihrer Haube gelöst und fielen ihr in die Stirn.
»Ich denke, du solltest Eiseles Antrag nicht zu schnell ausschlagen, Deli.«
»Was?«, rief Delia ungläubig. »Du fällst mir in den Rücken? Ich kann ihn unmöglich heiraten!«
Elisabeth holte tief Luft. »Er ist ein ansehnlicher Mann und wird wahrscheinlich dem alten Hornberger als Obermeister der Zunft nachfolgen. Er ist eine gute Partie, und außerdem wäre eine Heirat mit ihm wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Werkstatt zu retten.«
»Meine Mitgift würde ihm auch nicht schlecht gefallen. Nein!« Delia schüttelte heftig den Kopf. »Wenn Rudolf da wäre, könnte er die Werkstatt führen und mich weiter beschäftigen. Und ich könnte heiraten, wen und wann ich will – oder sogar ledig bleiben.«
»Ach, Deli … Wenn du wüsstest.« Elisabeth zögerte, ging dann aber in ihre Kammer und kam mit einem Brief zurück, den sie vor Delia auf den Tisch legte. »Lies!«
»Was ist das?«
»Eine Nachricht von Rudolf. Er ist in Rom und wird niemals zurückkehren.«
»Was sagst du da?« Wie betäubt faltete Delia den Brief auseinander und erkannte Rudolfs gestochen scharfe Handschrift sofort. Als sie zu lesen begann, nahm ihr die Sehnsucht nach ihrem Bruder den Atem. Er erzählte begeistert von seinen Aufträgen und wie zufrieden die Kunstkenner im Vatikan mit seiner Arbeit waren. Außerdem berichtete er von seiner großen Liebe.
»Er ist also in Rom?« Sie ließ den eng beschriebenen Bogen sinken.
»Zumindest hat er dort den Brief verfasst.«
Das Schriftstück war vor zehn Monaten datiert. »Warum hast du ihn mir nicht schon viel früher gezeigt, Tante Elisabeth?«
Elisabeth errötete. »Heinrich hat noch gelebt, und er war immer noch wütend auf Rudolf. Da hielt ich es nicht für klug, dich einzuweihen.«
Heinrich war für sein ausgelassenes Lachen ebenso bekannt gewesen wie für seine Wutanfälle, die die Wände erzittern ließen. Aber dennoch.
»Diese Geheimniskrämerei wäre nicht nötig gewesen«, sagte Delia. Sie war so müde, dass sie es nicht mehr schaffte, ihrem Zorn auf Elisabeth Ausdruck zu verleihen.
»Ich glaube doch.« Elisabeth schüttelte den Kopf. »Ich wollte keinen Keil zwischen euch treiben.«
»Warum ist Rudolf eigentlich fortgegangen?« Diese Frage hatte sich Delia in all den Jahren nicht zu stellen gewagt. Selbst jetzt fühlte es sich an, als kratzte sie den Schorf von einer schlecht verheilten Wunde. Rudolf war nicht nur ihr heiß geliebter und bewunderter großer Bruder, sondern ihr Vorbild gewesen. Wenn ihr Vater finster vor sich hin brütete, hatte er es geschafft, ihr das Gefühl zu vermitteln, dass das Leben lebenswert war. Sein Verschwinden hatte ihr das Herz gebrochen, aber Elisabeths Verhalten machte alles noch schlimmer. All die Lügen und Halbwahrheiten sorgten dafür, dass sie langsam, aber sicher den Boden unter den Füßen verlor.
Elisabeth holte tief Luft. »Ich weiß nichts Genaueres. Es war schwierig zwischen Heinrich und Rudolf. Sie waren wie Feuer und Wasser.« Sie griff nach Delias unverletzter Hand. »Wirst du es dir überlegen? Die Sache mit der Heirat, meine ich.«
Delia kam ein ungeheuerlicher Verdacht. »Eisele und Hornberger, die waren hier und haben dich im Vorfeld gefragt? Ist es nicht so?«
»Gestern Abend.« Elisabeth sah ertappt aus. »Ich wünsche dir das Allerbeste, Delia. Und ich wünsche mir …«
»Eine Schar von kleinen Stiefgroßneffen, die du nach Strich und Faden verwöhnen kannst?«, vollendete Delia. »Und dass ich möglichst noch einmal so viele Kinder dazubekomme? Fang doch schon mal an zu stricken, Tante Elisabeth.«
»Kinder können eine so große Freude sein.« Das Scharlachrot von Elisabeths Wangen vertiefte sich. »Es würde dir gut gehen bei Eisele, da bin ich mir sicher.«
»Aber ich nicht. Vater hat Eisele für seine Falschheit verachtet.«
Delia nahm den Brief und ging.
3.
Pankraz saß am Küchentisch und roch nach Schnaps. »Der Eisele will dich also heiraten? Das könnte dem Kerl so passen. Kriegt die Werkstatt, und die schöne Tochter purzelt ihm als Dreingabe ins Bett.«
Der Raum lag in blauer Dämmerung. Die Fenster hielten die Kälte fern, aber nicht die Finsternis. Delia zündete eine Öllampe an und goss sich Wasser aus einer Karaffe ein. Es war besser als das aus den städtischen Brunnen, weil Pankraz es aus einer geheimen Quelle im Wald holte. Er war immer ein Teil ihres Lebens gewesen, so zuverlässig und gleichzeitig so wechselhaft wie der Lauf der Jahreszeiten. Seine Haare und sein Schnauzbart waren immer lackschwarz gewesen, inzwischen hatten sich einige graue Strähnen hineingeschlichen.
»Sie wollen dich also verschachern?«, fragte er.
Korbinian sprang auf Delias Schoß, begann zu schnurren und schmiegte seinen Kopf an sie, als wollte er sie trösten. Sie vergrub ihre Hände in seinem rot-weißen Fell.
»Vater mochte Eisele nicht, und das sicher nicht nur, weil er unser direkter Konkurrent ist. Seine Kinder haben Angst vor ihm. Ich hab es heute Morgen selbst gesehen. Und er will die Firnerin wegen mir sitzen lassen, obwohl er ihr die Ehe versprochen hat. So jemanden kann ich doch nicht heiraten.«
Delias Finger strichen über Korbinians Kopf und verharrten an seinem ausgefransten Ohr. Er war ein übler Gassenraufer, der keinem Kampf aus dem Wege ging – fast so wie Pankraz.
»Der Eisele ist ein Saukerl. Das hätte ich dir vorher sagen können«, meinte er nachdenklich. »Ihm eilt in der Stadt ein Ruf voraus. Das weiß auch der Obermeister ganz genau.«
»Aber warum bestärkt er ihn dann?«
Pankraz strich sich über seinen Schnauzbart. »Weil er das Problem schnell vom Tisch haben will, genau wie deine Tante.«
Korbinian reckte sich auf Delias Schoß, fuhr seine Krallen aus und gähnte. Dann sprang er auf den Boden und verschwand in der Werkstatt.
»Elisabeth meint es wirklich gut mit mir, Pankraz.«
»Ach, die feine Dame«, höhnte er. »Wenn sie dich dauerhaft im Haus hätte, könnte sie sich ja gar nicht mehr um ihre Schönheit kümmern. Und sag, hat sie dir schon zugeredet, mich endlich rauszuwerfen?«
Delia seufzte. Die Abneigung zwischen den beiden beruhte von jeher auf Gegenseitigkeit. »Du weißt, dass ich das niemals täte.«
»Der Obermeister will dich also so schnell wie möglich an den Eisele verkaufen«, fuhr Pankraz fort. »Und der sackt dich, deine Mitgift und die Werkstatt mit allen ausstehenden Aufträgen ein, ohne auch nur einen Finger krumm zu machen. Das ist ein feines Geschäft, sag ich dir. Dafür kann man die fesche Margarete schon mal sausen lassen.« Er goss sich ein weiteres Glas Schnaps ein und prostete ihr zu. »Willst du auch einen?«
»Auf keinen Fall.« Sie hob abwehrend die Hände. »Ich brauche einen klaren Kopf.«
»Der Klare macht meinen erst richtig klar.« Pankraz grinste. »Aber was willst du denn, Delia?«
Auf diese Frage gab es nur eine Antwort. »Ich will zeichnen und Skulpturen schaffen. Eisele würde nicht zulassen, dass ich je wieder ein Schnitzmesser anfasse. Aber ich brauche Rudolf, um die Werkstatt weiterzuführen.«
Pankraz nickte langsam. »Es ist gefährlich, Frauen Blut lecken zu lassen.«
Sie sah ihn verwundert an. »Wie meinst du das?«
Pankraz’ Brombeeraugen waren vom Schnaps ein wenig glasig. »Du weißt, dass Frauen Gehorsam üben sollen. Da, wo ich herkomme, ist das ähnlich, doch die Frauen wissen sich zu behaupten. Aber wenn ein Mann eine Frau ein Handwerk lernen lässt, merkt sie, was sie verpasst, weil sie kein Teil der Männerwelt ist. Und glaub mir, wer Kunst macht, weiß, wie die Freiheit schmeckt.«
Delia stand auf und schwankte. Der Boden, auf dem sie stand, fühlte sich plötzlich so unsicher an wie ein Brett, das über einem Abgrund lag. Sie konnte abstürzen und in den sicheren Tod fallen. Sie legte den Brief vor Pankraz auf den Tisch. »Der ist von Rudolf.«
»Ach, wirklich?« Seine schwieligen Finger glitten über das eng beschriebene Hadernpapier. »Ich kann doch nicht lesen. Du musst mir schon sagen, was drinsteht.«
»Rudolf hat den Brief vor zehn Monaten in Rom abgeschickt. Er arbeitet für den Vatikan und hat seine große Liebe gefunden.«
»Also ist er dort und nicht in Florenz?« Pankraz runzelte verwundert die Stirn.
»Scheint so.« Die Öllampe flackerte. Delia fröstelte, weil der Herd ausgegangen war. Sie stand auf und feuerte ihn mit Zunder, Zweigen und einem Buchenscheit neu an, bis das Feuer wieder munter prasselte. Pankraz brütete derweil über seiner Schnapsflasche.
»Dann hol ihn doch«, sagte er plötzlich.
Delia fuhr herum. »Aber wie soll das gehen?«
Pankraz lachte leise. »Na, ganz einfach: Du reist nach Rom und bringst ihn mit zurück.«
Delia schnaubte. »Glaubst du wirklich, das ist so einfach? Wie du weißt, liegen die Alpen zwischen uns. Und wenn Rudolf nicht will, seiner Geliebten wegen?«
Pankraz kippte einen weiteren Schnaps. »Darum kümmerst du dich, wenn du dort bist. Am besten, du machst ihm die Hölle heiß und schleifst ihn an den Ohren zurück. Vielleicht kommt sein Mädchen ja mit ihm nach Esslingen, genauso wie die schöne Anna aus Florenz. Die hat auch alles aufgegeben für deinen Nichtsnutz von Vater.«
Delia holte eine Speckseite aus der Vorratskammer, stellte den Brotlaib auf den Tisch und säbelte von beidem zwei dicke Scheiben ab. »Aber ich bin nur eine Frau. Wie soll ich da allein nach Rom reisen?«
»Nur eine Frau? Diesen dummen Spruch schlag dir aus dem Kopf, Mädle. Du bist mindestens so talentiert und fleißig wie alle männlichen Künstler, die ich je kennengelernt habe. Warte mal.«
Pankraz biss vom Brot ab und verschwand im Hinterzimmer. Nach ein paar Minuten kehrte er zurück, in seiner Hand eine Wolltunika, ein Hemd und ein paar Kniehosen, die Rudolf vor Jahren zu klein geworden waren. Delia beäugte die Kleidungsstücke misstrauisch.
»Du kannst überall dein eigenes Geld verdienen, weil du Holzbildhauerin bist, Delia. Aber wenn du dich als Junge verkleidest, blüht dir weniger Ärger. Es gibt Kerle, die betrachten Frauen als Freiwild.«
Nachdenklich ließ Delia ihre Finger über Rudolfs abgelegte Tunika aus grüner Wolle gleiten. Ihr Bruder war mit 16 Jahren gewachsen und so groß wie ihr Vater geworden. Sie hatte nicht gewusst, dass Heinrich die abgelegten Kleider seines Sohnes aufbewahrt hatte.
»Du meinst das ernst? Ich soll mich als Junge verkleiden?«
Pankraz nickte. »Es ist zumindest eine Möglichkeit. Und wenn Rudolf wirklich nicht mit heimkommen will, kannst du ja allein zurückkehren und …«
»Den Eisele heiraten? Nie im Leben!«, rief sie empört.
»Dann verstehen wir uns ja.« Pankraz zwinkerte ihr zu.
Delia lief, so schnell sie konnte, die Treppe hinauf, streifte Mieder, Kleid und Unterkleid ab und schlüpfte in die engen Beinlinge, das vergilbte Leinenhemd und die Tunika von Rudolf. Die Männerkleider fühlten sich ungewohnt, aber nicht schlecht an. Jetzt waren ihre eckigen Schultern und ihre kleinen Brüste von Vorteil. Kirschkerne hatte Elisabeth sie genannt. Auch ihre erste Blutung ließ auf sich warten, aber das machte Delia nichts aus. Sie hatte nie begriffen, was so erstrebenswert an einem Dasein als Frau sein sollte.
Sie ging in Vaters Schlafzimmer und stellte sich vor den fast blinden Spiegel, der ihrer Mutter gehört hatte. Erneut überkam sie eine Welle der Trauer, als sie das leere Doppelbett sah, in dem niemand mehr träumte. Aber es half ja nichts … Sie musste eine Lösung finden, sonst würde Eisele ihre Werkstatt, das Haus und sie selbst übernehmen.
Das Mädchen, das ihr aus dem Spiegel entgegenblickte, hatte ein herzförmiges Gesicht mit karamellfarbener Haut und einem geschwungenen Mund, dazu eine Flut blonder Locken, die ihr ungezähmt über die Schultern fielen. Ihre Beine sahen in den engen Hosen lang und schlank aus. Delia vermied den Blick auf die Stelle, an der sie sich trafen, denn ihre Scham verbargen Frauen bewusst unter mehreren Lagen von Röcken.
Sie hob den Kopf und straffte die Schultern. Als Junge würde sie stolz und aufrecht gehen müssen.
Delia wollte ihre Aufmachung gerade Pankraz zeigen, als sie im Erdgeschoss aufgeregte Stimmen hörte. Sie schlich zum Treppenabsatz und lauschte.
In der Küche stritten zwei Personen aufs Heftigste miteinander. Pankraz und ihre Tante.
»Die Hochzeit mit Eisele ist die beste Lösung für Delia!«, rief Elisabeth aufgebracht. »Rede ihr bloß nicht ein, dass sie eine Wahl hat, Pankraz. Und überhaupt, warum mischst du dich ein?«
»Eisele ist ihrer nicht wert«, gab Pankraz zurück. »Und das weißt du ganz genau. Du musst es dir nur eingestehen.« Er klang überraschend nüchtern für die Menge an Schnaps, die er intus hatte.
»Aber was sollen wir denn bloß tun?«, fragte Elisabeth ratlos.
»Gib ihr etwas Zeit, Elisabeth. Vielleicht finden wir einen besseren Weg.«
»Wir?« Elisabeths Stimme schwankte zwischen Lachen und Weinen, dann wurde es leise.
Ein paar Minuten später stieg Delia ins Erdgeschoss hinab und sah nach, ob die Luft rein war. In der Küche war es so still, dass sie eine Maus über die Bodendielen huschen hörte. Die beiden waren verschwunden, obwohl Elisabeths schwarzer Samtmantel noch immer über der Lehne hing.
Delia schlich sich zurück in ihr Dachzimmer und wechselte ihre Kleider, um an ihrer Katharina weiterzuarbeiten. Aber ihre Hände rührten sich nicht, denn in ihrem Kopf arbeitete es fieberhaft.
Rom? Wäre sie dazu in der Lage, allein über die Alpen zu reisen? Es war ein beschwerlicher Weg, aber wenn sie sich dafür als Junge verkleidete, konnte sie es schaffen. Lieber wollte sie dieses Wagnis eingehen, als in eine Ehe mit Eisele gedrängt zu werden.
Als sie spätabends in die Küche kam, saß Pankraz allein am Tisch und sah aus, als wäre nichts geschehen. Sie belegte sich ein Brot mit Schinken und biss hinein.
»Ich hab die Kleider oben anprobiert«, sagte sie mit vollem Mund. »Sie passen. Wann kann ich abreisen?«
»Hör mir zu, Delia«, erwiderte Pankraz langsam. »Deine Tante Elisabeth mag Eisele auch nicht. Ich habe mit ihr ausgemacht, dass du für zwei Monate zu deiner Tante Cosima ins Kloster nach Augsburg gehst. Um nachzudenken. Es ist ein Aufschub.«
Delia schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall!«
Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie ein Jahr im Dominikanerinnenkloster St. Ursula in Augsburg verbracht, wo ihre Tante als Cellerarin lebte. Dort hatte sie lesen, schreiben und etwas Lateinisch gelernt, aber die strenge Disziplin im Kloster hatte ihr nicht gefallen.
»Du wirst auch nicht wirklich dorthin gehen, glaub mir. Aber wenn Elisabeth das herausgefunden hat, bist du schon längst über alle Berge. Im wahrsten Sinne des Wortes.« Pankraz drehte die leere Schnapsflasche um und ließ die letzten Tropfen auf den Boden fallen, wo Korbinian sie aufleckte. »Ich darf nicht mehr so viel saufen«, sagte er. »Sonst kann ich für das, was wir vorhaben, nicht klar genug denken.«
In dieser Nacht lag Delia lange wach, lauschte ihrem rasenden Herzschlag und dachte über die Gipfel der Alpen nach, die zwischen ihr und dem Heimatland ihrer Mutter lagen. So mancher Reisende kam nie an, und das nicht nur, weil er im Winter in den Schneemassen stecken blieb. Und dennoch. Selbst eine Reise ins Ungewisse war besser, als sich in das Leben zu fügen, das die Zunftmeister und ihre Tante für sie vorgesehen hatten. Eher würde sie sterben, als klein beizugeben, dachte sie, bevor sie einschlief.
Als Delia am nächsten Morgen vor das Haus trat, kämpfte sich die Sonne durch den Nebel. Sie ließ ihren Blick über das Spital und die Doppeltürme der Kirche St. Dionys schweifen und lauschte den Gesängen der Steinmetze auf der Baustelle der Liebfrauenkirche. Doch als sie sich umdrehte, sah sie den toten Hahn, der über dem Fenster zur Werkstatt hing, und erschrak zu Tode. Sein glänzend schwarzes Federkleid fing die Sonnenstrahlen ein, und sein roter Kamm leuchtete mit dem Blut um die Wette, das auf das Pflaster tropfte.
»Schade um das schöne Tier.« Pankraz stand plötzlich neben ihr und nahm den Hahn ab. »Das gilt sicher mir. Aber weil man nichts wegwirft, lassen wir Marie eine Suppe daraus kochen.«
»Warum mögen sie dich eigentlich nicht?«
»Weil ich Manouche bin. Ein Sinto, gebürtig aus Frankreich. Sie denken, ich stehe mit dem Bösen im Bunde. Jetzt, wo Heinrich tot ist, trauen sie sich, es zu zeigen. Es wird Zeit, dass du fortkommst. Sonst färbt das noch auf dich ab.«
4.
Der Karren rumpelte die Straße nach Geislingen entlang. Delia saß neben Pankraz auf dem Kutschbock und betrachtete die Stauferberge, die am Horizont wie Kegel aufragten. Es hatte zwei weitere Wochen gedauert, bis sie endlich aufbrechen konnten. Inzwischen hatte der Frühling Einzug gehalten. In den Büschen jubilierten die Vögel, die Wälder ergrünten, und die Wiesen waren übersäht von goldgelbem Löwenzahn.
»Wo genau bringst du mich hin?« Trotz ihrer häufigen Nachfragen hatte Pankraz sich das vorläufige Ziel ihrer Reise nicht entlocken lassen.
»Frag nicht«, brummte er auch jetzt.
»Ich habe das verdammte Recht, es zu wissen.«
Pankraz strich sich über den schwarzen Schnauzbart und lockerte die Zügel. »Zu Leuten, mit denen du sicher reisen kannst.«
Die letzte Zeit war arbeitsreich gewesen. Elisabeth ließ Delia ungern ziehen, aber sie hatte eingesehen, dass sie Zeit brauchte, um sich in ihr Schicksal zu fügen. Ein Kloster sei der beste Ort, um ihren heftigen Charakter zu mäßigen, hatte sie ihr versichert. Delia hatte sich einverstanden gezeigt und das Haus und den Kater ihrer Magd Marie überlassen, die für die Zeit ihrer Abwesenheit mit ihrer Familie darin wohnen würde. Pankraz hatte Heinrichs Apostelfiguren eingepackt, um sie in dem Kloster in Oberschwaben zu vollenden, für das sie bestimmt waren. Auf diese Weise konnte er wegbleiben, ohne unangenehme Fragen zu provozieren. Delia war froh, dass er dadurch auch den Anfeindungen gegen ihn entging, die sich in Esslingen in letzter Zeit gehäuft hatten.
»Was verbindet dich eigentlich mit meiner Tante?« Delia war der Blick nicht entgangen, den Pankraz zum Abschied mit Elisabeth gewechselt hatte. Sie war die Nachzüglerin in der Familie Pirckheimer gewesen, fast zwanzig Jahre jünger als Heinrich.
»Das geht dich nichts an«, raunzte er. »Hast du deine Ausstattung dabei?«
Sie verdrehte die Augen und nickte. Noch trug sie Frauenkleider, aber sie hatte in Vaters Truhen zwei weitere Leinenhemden, eine Wolltunika sowie ein Paar Stiefel gefunden, die ihr nur wenig zu groß waren.
Nach der Schneeschmelze herrschte auf der Straße Richtung Schwäbische Alb reger Verkehr. Alle Welt schien dieses Frühjahr zu nutzen, um nach Süden aufzubrechen. Fernhändler waren mit Ochsenkarren voller Wein aus dem Rheinland und englischer Wolle unterwegs. Eine Pilgergruppe wanderte Choräle singend Richtung Rom und kam ein paar Bewaffneten in die Quere, die die Standarte der Grafen von Helfenstein aus Geislingen vor sich her trugen und sich lauthals beschwerten.
Falls jemand fragte, wohin Delia und Pankraz unterwegs waren, hatten sie abgesprochen, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben. Delia würde sagen, dass sie sich von ihrem Patenonkel zu ihrer Tante ins Kloster bringen ließ, um sich vor ihrer Hochzeit der Kontemplation zu widmen. Sie setzte sich zurück und faltete die Hände. Niemand konnte ahnen, dass ihr nichts ferner lag.
Eine Gruppe Augustinermönche in schwarzem Habit überholte sie auf ihren Maultieren. »Gott zum Gruße. Wohin des Weges?«
»Nach Augsburg«, rief Pankraz.
»Gottes Segen sei mit euch.«